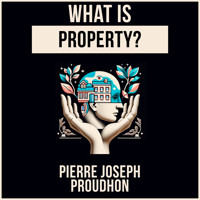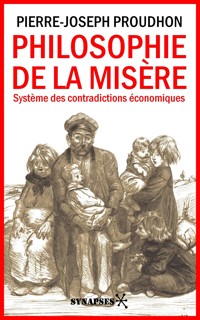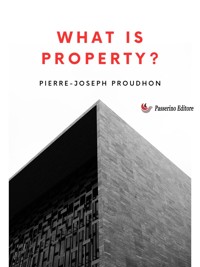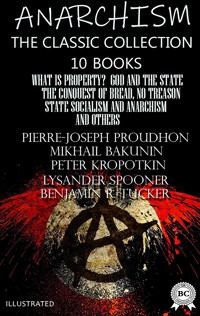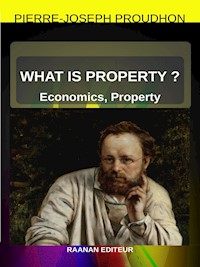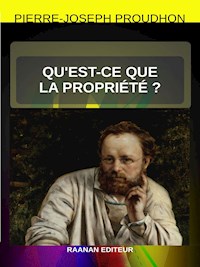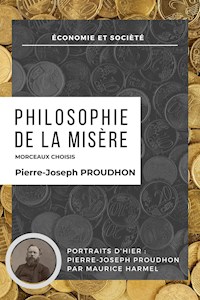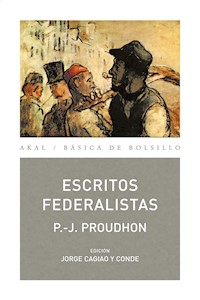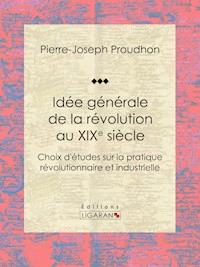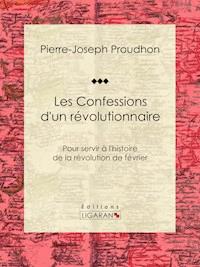Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
1848, ganz Europa im demokratischen Revolutionsfieber. Geht es nicht allen darum, die Fürsten- durch die Mehrheitsherrschaft zu ersetzen, die Staatsgewalt zu zentralisieren und ihre Eingriffe in Gesellschaft und Wirtschaft drastisch auszuweiten? Nein, nicht allen. Ein führender republikanischer und sozialistischer Theoretiker der Revolution in Frankreich, wo die Revolution im Februar 1848 triumphierte, warnt vor dem Missverständnis, die Republik auf rigoros durchgesetzten Mehrheitswillen, Zentralisation und Parteiengezänk aufzubauen: Pierre-Joseph Proudhon (1809-1864). Schon bald bewahrheiteten sich die düstersten Prognosen Proudhons: Das Volk wählte den Neffen von Kaiser Napoleon I. zum Präsidenten einer autoritär-zentralistischen Republik, Louis-Napoleon Bonaparte. Weil der sich von Proudhons Schriften beleidigt sah, wurde Proudhon zu Gefängnis verurteilt und musste sein Experiment mit einer Genossenschaftsbank, das erfolgreich gestartet war, abbrechen. Als Neuwahlen drohten, putschte Louis-Napoleon Bonaparte sich zum Diktator auf zehn Jahre. Das Volk sanktionierte den Schritt per Plebiszit. Ein Jahr drauf erklärte er sich zu Kaiser Napoleon III. Auch diesen Schritt segnete das Volk ab. Proudhon wurde für eine weitere Schrift wiederum verurteilt und ging ins Exil nach Belgien. 1863 schwächelte die Herrschaft des Kaisers; der lockerte die Zensur und rief zu einer neuen Wahl auf. Proudhon kehrte nach Frankreich zurück und verfasste ein Pamphlet, in welchem er auf der Grundlage der hegelschen Dialektik zum Wahlboykott aufrief, und erreichte ein Millionenpublikum. Proudhons republikanisches Ideal richtete sich an Dezentralisation, Selbstverwaltung vor Ort und Föderation statt Zentralismus aus. Die in diesem Band sorgfältig und das erste Mal deutsch edierten Proudhon-Texte aus den Jahren 1848 und 1863 sind nicht nur historisch interessant, sondern auch aktuell, denn sie helfen, die allgegenwärtige Krise der zentralistischen, mehrheitswütigen und illiberalen Demokratie zu verstehen und eine bessere, freiheitlichere Alternative anzustreben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Proudhon, 1864. Eigener Scan vom Original.
INHALT
Einleitung
Zeitleiste zur Revolution von 1848
Für ungeduldige Leser
Zur Dialektik der Demokratie 1848
Demokratie und die Februarrevolution
Zur Dialektik der Demokratie 1863
Monogramm der Demokratie: Einheit
Demokratie und Krieg
Für unerschrockene Leser
Personenregister
Sachregister
«Wer Sozialismus im wahren Sinne des Wortes sagt, meint damit Freiheit von Handel und Industrie, Gegenseitigkeit der Versicherung und des Kredits, Gleichgewicht und Sicherheit der Vermögen, Teilhabe des Arbeiters an den Gewinnen der Unternehmen und Unverletzlichkeit der Familie bei der Weitergabe des Erbes. Die Demokratie dagegen neigt zum Kommunismus, nur per Kommunismus kann sie sich Gleichheit vorstellen. Was sie braucht, sind Obergrenzen, Zwangsanleihen, progressive und verschwenderische Steuern, begleitet von sozialstaatlichen Einrichtungen, Hospizen, Asylen, Kinderkrippen, von Staatsunternehmen, Rentenkassen, Spar- und Hilfsfonds, der ganzen Ausrüstung der Armutsverwaltung und der Uniformierung des Elends. Vor einem Volk von gelehrten Arbeitern, die gleichermaßen denken, schreiben und mit Hacke und Hobel umgehen können und deren Frauen in ihren Haushalten ohne Dienstboten auskommen würden, würde sie zittern. Sie freut sich über die Erbschaftssteuer, die die Familie zerschlägt und das Eigentum in die Hände des Staats legt.» — Proudhon, 1863 1
1 Aus: Du Principe fédératif et de la Nécessité de reconstituer le Parti de la Révolution, Paris 1863, S. → f. Aus Gründen der Verständlich- und Lesbarkeit ist das Zitat hier etwas gekürzt; vollständig auf S. → f.
EINLEITUNG
Der größte aller Sozialisten sei Proudhon gewesen, sagte der deutsche Anarchist Gustav Landauer 1911.2 — Welche Art Sozialist? Und was zeichnete ihn vor den anderen aus?
1848. Ganz Europa im Revolutionsfieber. Im Februar begann es in Frankreich, die Revolution fegte die harmlose, aber konservativ-verstaubte Monarchie des Bürgerkönigs hinweg, die nach der Julirevolution 1830 inthronisiert wurde, um sie durch eine liberale und soziale Demokratie zu ersetzen. Im Monatstakt folgten Italien und Deutschland, mit weniger Erfolg. Die deutschen und italienischen Revolutionäre mischten als Zutat in ihre Forderungen die nach nationaler Einheit.
Weil die Revolution von 1848 zu der unmittelbaren Vor - geschichte der heute herrschenden bürgerlichen Demokratie zählt, wird in der offiziellen Geschichtsschreibung der Eindruck erweckt, beim Programm der Revolutionäre habe es sich mehr oder weniger um ein stimmiges, also harmonisches Ganzes gehandelt. Sie wollten alle ungefähr das Gleiche und das, was sie wollten, hätte auch ohne innere Widersprüchlichkeit umgesetzt werden können, wenn die monarchistische Reaktion es nicht verhindert hätte. In ihrem berühmt-berüchtigten Kommunistischen Manifest setzten Karl Marx und Friedrich Engels sich zwar bereits theoretisch von der Ideologie der bürgerlichen Demokratie ab, schlossen das Manifest jedoch mit zehn Forderungen, die in keiner Weise über sie hinaus gingen. Marx brauchte mehr als 25 Jahre, um sich am Paradigma der 1848er abzuarbeiten: 1875 kritisierte er das Gothaer Programm der Vorläuferorganisation der SPD, in dem die Forderungen von 1848 einfach fortgeschrieben wurden. Das Kind war allerdings bereits in den Brunnen gefallen. Der realpolitische Einfluss des Marxismus, sei es in der reformistischen Variante der Sozialdemokraten, sei es in der späteren revolutionären Variante der Bolschewisten, nachher: Kommunisten, zielte darauf ab, die Staatsgewalt auszubauen. Alle kritischen Ansätze, die Marx vorsichtig von Proudhon gelernt hatte (ohne es je einzugestehen), blieben graue Utopie.
… Proudhon, wer? Pierre-Joseph Proudhon, 1809 bis 1865, französischer Demokrat und Sozialist und allem voran Hegelianer, hatte 1840 den Anarchismus als politische Idee und revolutionäre Bewegung aus der Taufe gehoben. Anarchismus, Anarchie: Es geht auch ohne Herrschaft, es geht besser ohne Herrschaft. Unter Demokratie verstand Proudhon nicht stupides Abstimmen beliebiger Massen über Dinge, die sie weder verstehen noch etwas angehen, sondern die Entscheidungsfindung in überschaubaren und freiwilligen Gruppen. Unter Sozialismus verstand Proudhon nicht die bürokratischen und diktatorischen Prozeduren in zentralstaatlichen Verwaltungseinheiten, sondern den lebendigen Austausch und die mitmenschliche Solidarität ohne äußeren Zwang.
Mit beiden Kennzeichnungen setzte Proudhon sich in Gegensatz zu den herrschenden Interpretationen der Revolution, und zwar ganz besonders in Gegensatz zu deren nationalistischen Aspekten.3 Nicht aber in Gegensatz zu den wirklichen Bestrebungen des Volks. Sicher kann man ein kritisches Fragezeichen machen hinter Proudhons manchmal mystifizierende (und sehr hegelianische) Bezugnahme auf einen Gesamtwillen des Volks, der sich nicht unmittelbar ausdrückt. Diese Bezugnahme ist nicht nur theoretisch wenig überzeugend, sondern sie lässt sich auch politisch übel missbrauchen als Legitimierung einer revolutionären Avantgarde, die weiß, was das Volk ‹eigentlich› wolle. Diese Gefahr ist bei Proudhon allein dadurch gebannt, dass er für Demokratie und Sozialismus als einzige Voraussetzung die Freiheit proklamierte. Er sah die Gefahr des Missbrauchs auch selber: In einer meisterhaft ironisch komponierten Passage des folgenden Textes 4 fragt er, wie das Volk sich denn äußere und auf welch eine Weise festgestellt werden könne, dass diese Äußerung authentisch sei, ganz abgesehen von dem Problem, ob das Volk sich wohl irren könne. Hervorzuheben ist wiederum das Datum, zu welchem Proudhon dies schrieb: 1848. Wie Bakunins Prophetie zum Charakter der marxistischen Diktatur, formuliert im Anfang der 1870 er Jahre, lässt diese Passage sich lesen als hellsichtige Kritik der quasi-religiösen Anbetung der Massen, derer sich die Kommunisten nach 1917 befleißigten.5
Und bei all dem war Proudhon kein verschrobener Einzelgänger oder Außenseiter. Obgleich weder ein begnadeter
Organisator noch ein charismatischer Redner, wurde die von ihm entworfene anarchistische Philosophie zu dem bedeutendsten Motor der revolutionären Bewegung in Frankreich und, nachdem der Russe Michael Bakunin (sowohl ein Charismatiker als auch ein Organisator) Mitte der 1860 er Jahre seine Nachfolge als der Fürsprecher der Anarchisten angetreten hatte, in Europa, in den USA und in Lateinamerika. Dies änderte sich erst mit dem erfolgreichen Staatsstreich der bolschewistischen Marxisten in Russland 1917.6
Wenn es um die revolutionäre (‹linke›) Heranziehung von Hegels Philosophie geht, wird meist auf Marx und das Umfeld der deutschen Junghegelianer verwiesen. Die Junghegelianer waren aber hauptsächlich mit Atheismus beschäftigt. Es war Proudhon, der Hegel verwandelte in einen revolutionären Soziologen.7 Nun ist bekannt, dass Hegels Eigenverständnis dahin ging, die konservativpreußische aufgeklärte Monarchie zum höchsten Gipfel des Geistes zu erklären, und dass er mit Lobliedern auf den Staat nicht hinterm Berg hielt. Wie konnte Proudhon ihn zum Schutzheiligen des Anarchismus machen?
Allen Lobliedern auf den Staat zum Trotz hatte Hegel dem Staat weder Zweck noch Funktion zugeschrieben. Der Gang der Geschichte — der gern bespöttelte Weltgeist — führt laut Hegel über das zunehmende Selbstbewusstsein der Menschen zur Verwirklichung von Freiheit. Der Staat bzw. die Verfassung des Staats ist nicht der Motor dieser Entwicklung, sondern deren bloßer Ausdruck. In diesem Sinne führt der Staat gar keine sozialen Aufgaben aus. Sie werden durch die Gesellschaft übernommen. Man kann da tatsächlich auf die Idee kommen, dass die Entwicklung zur Freiheit den Punkt erreicht, an dem der Ausdruck über eine zentrale Staatsgewalt überflüssig ist. Friedrich Engels’ Formel vom «Absterben des Staats» geht direkt auf Proudhon zurück, außer dass für Proudhon dieses Absterben weder in ferner Zukunft stattfindet noch eine dazwischengeschaltete Diktatur braucht, sondern so rasch als möglich beginnt.
Für Proudhon hat die Freiheit eine politische, soziale und wirtschaftliche Form. Durch diese Einbeziehung der wirtschaftlichen Freiheit unterscheidet Proudhons Ansatz sich von dem aller anderen Sozialisten, wie er selber bemerkte 8 und wie Bakunin später hervorhob: Als einziger unter den Sozialisten hatte Proudhon keine Tendenz zur Bevormundung.9 Die politische Freiheit sah Proudhon in Dezentralisation und (freiwilliger) Föderation, die soziale Freiheit in Selbstorganisation und die wirtschaftliche Freiheit in einer auf Gegenseitigkeit gegründeten Eigentumsordnung (Mutualismus). Dies scheint derzeit sehr weit weg von einem politischen, sozialen und wirtschaft - lichen Alltag, der seit 200 Jahren auf eine Festigung der Gewalt des Staats hinausläuft. — Insofern ist Proudhons hegel’scher Optimismus, die Menschheit sehe in naher Zukunft einer glänzenden Freiheit entgegen, widerlegt. Der beklagenswerte Zustand der Erde mit fortgesetzter Unterdrückung und andauernden Kriegen lässt freilich Proudhons Heilmittel aktuell werden.
Proudhons Argument 1848 gegen Gewaltenteilung und allgemeine Wahl (mit dem er an Rousseau anschließt),10 dass in ihnen die Volkssouveränität sich nicht würde abbilden lassen, kann man lesen als Bolschewismus: Eine Elite von Avantgarde-Revolutionären weiß, was das Volk will. Sein Bedauern über den Krieg gegen die Reichen und sein Insistieren auf Klassenfrieden11 kann man wahlweise lesen als faschistischen Korporatismus oder als Vorwegnahme der Sozialen Marktwirtschaft. Und in der Tat fallen aufgrund seines an Hegel motivierten dialektischen Stils Sätze, die ihm mal das Aussehen eines Bolschewisten, mal eines Faschisten, mal eines Ludwig Erhard verleihen,12 wenn man sie aus ihrem Zusammenhang der Dialektik reißt. Dass er alles dies nicht ist, wird erst dann klar, wenn man hinzunimmt, dass Freiwilligkeit oberstes Prinzip für ihn darstellt. Avantgarde ohne Befehlsgewalt, Faschismus ohne Führer, Soziale Marktwirtschaft ohne regulierenden Staat gibt es nicht. Positiv ausgedrückt: Sofern sie alle auf den Einsatz eines regulierenden Staats verzichten, seien sie herzlich willkommen in Proudhons Welt.
Klassenkampf folgt bei Proudhon nicht wie bei Marx und Engels aus Produktionsverhältnissen, sondern aus der Relation soziologischer Gruppen zum Staat: Wenn sie ihn zum Instrument der Umsetzung ihrer Interessen machen, geraten sie in einen unauflöslichen Verteilungskampf untereinander. Innerer und äußerer Frieden ist nur jenseits des Staats zu erzielen.13
In den Revolutionstagen Anfang des Jahres 1848 schrieb Proudhon einen Text mit dem unspektakulären Titel Die Lösung der sozialen Frage. Meines Wissens wurde dieser Text noch nie vollständig ins Deutsche übertragen. Er besteht in seinem ersten Teil aus dem Nachdenken über die Rechtmäßigkeit der Revolution und im zweiten Teil aus dem über die negative Dialektik der Demokratie: Einerseits steht die Demokratie für die Freiheit des Volks, anderseits entwickelt sie sich zum Instrument von dessen Unterdrückung. Jenen zweiten Teil habe ich in meiner Edition an die erste Stelle gesetzt, weil der erste Teil mehr zeitbezogene Anspielungen enthält, die von heute aus gesehen erst interessant werden, wenn man Proudhons Dialektik der Demokratie verstanden hat.
1863, kurz vor seinem frühen Tod im Januar 1865 aufgrund der Spätfolgen einer Cholera-Infektion von 1850, schrieb Proudhon das Pamphlet Vereidigte Demokraten und ihre Widersacher, in welchem er noch einmal auf die grundsätzlichen Bedingungen für eine wahre Demokratie im Gegensatz zu einer Rechtfertigung der seelenlosen Staatsmaschinerie einging. Auch er ist meines Wissens noch niemals zuvor auf Deutsch erschienen.
Was war 1863 anders als 1848? Zunächst einmal: Es gab keine revolutionäre Situation. Zwar herrschte in Frankreichs Bevölkerung ein gewisser Unmut und ein gewisser Überdruss über die autoritär-demokratische Führung unter Kaiser Napoléon III — einen Kaiser, den das Volk mit großer Mehrheit vor 15 Jahren zum Präsidenten gewählt hatte, dessen Putsch zum Diktator auf zehn Jahre es per Plebiszit ebenso sanktionierte wie seine Ernennung zum Kaiser. Zur Aufbesserung seines Images bot der sieges - gewisse Kaiser seiner republikanischen Opposition eine einigermaßen faire Wahl an. Alles, was er verlangte, war, dass jeder Kandidat einen Treueeid auf den Kaiser leisten muss, um zur Wahl zugelassen zu werden. Liberale (soweit sie sich nicht sowieso schon in den Dienst der Regierung gestellt hatten), Demokraten und Staatssozialisten, die gemeinsam die republikanische Opposition ausmachten, witterten ihre Chance: Sie erstellten en bloc Kandidatenlisten, leisteten den Eid und riefen die Bevölkerung dazu auf, sich als Wähler registrieren zu lassen. Proudhon, gerade hatte der schwer Kranke das Tauwetter in der Herrschaft des Kaisers genutzt, um aus seinem belgischen Exil in die geliebte Heimat zurückzukehren, sagte ‹Nein!› und riet dem Volk in einem Pamphlet von 100 Seiten, das ich hier zum ersten Mal in deutscher Sprache präsentiere, sich der Stimme zu enthalten. Der Regierungspartei erklärte Proudhon, dass sie sich durch die weiterhin in Kraft bleibenden Beschränkungen der freien Wahlen in einem Selbstwiderspruch befinde: Sie berufe sich auf die Zustimmung des Volks (nicht auf göttliche Einsetzung des Kaisers),14 behindere jedoch die Artikulation dieser Zustimmung, die natürlich und logisch die Möglichkeit einschließen müsse, dass das Volk der Regierung des Kaisers seine Zustimmung verweigere. Der (republikanischen) 15 Opposition hielt Proudhon entgegen, dass sie, indem sie den Eid auf den Kaiser leiste und die Beschränkungen der freien Wahlen — wie Pressezensur und ein eingegrenztes Versammlungsrecht — akzeptiere, das System des Kaiserreichs legitimiere und dergestalt ihre Opposition absurd mache. Dabei argumentierte Proudhon streng innerhalb der Idee der Demokratie, da sein Punkt der Selbstwiderspruch war. Seine Kritik an der Demokratie, die er 1848 formuliert hatte, scheint nur an manchen Stellen durch. Dass er diese Kritik nicht zurücknahm, machen die beiden Ausschnitte klar, die ich aus seiner Monographie zum föderativen Prinzip entnehme, ebenfalls 1863 erschienen, und die ich anschließend wiedergebe.
Wie ist diese Wahl ausgegangen? Frankreichs Population betrug 1863 rund 37 Millionen Menschen, darunter etwa 30 % Minderjährige. Bloß Männer waren wahlberechtigt, daraus ergibt sich ein Potenzial von rund 12,5 Millionen Wählern. Von diesen haben sich ungefähr 10 Millionen, also 80 %, zur Wahl registrieren lassen, eine recht hohe Rate. Freilich gaben nur kaum mehr als sieben Millionen eine Stimme ab, egal ob gültig oder nicht. Das ist eine erstaunliche Differenz. Drei Millionen schrieben sich in die Liste ein, nahmen das Wahlrecht aber nicht in Anspruch. Die Gründe hierfür kennen wir nicht; ich will keineswegs ab leiten, dass es in Frankreich damals drei Millionen Anhänger Proudhons gab. Die republikanische Opposition erhielt knapp über eine Million Stimmen, wenig mehr als die Monarchisten. Wenn Proudhon zur Wahl aufgerufen hätte, wäre die republikanische Opposition im Parlament eventuell doppelt so stark vertreten gewesen,16 und dort hätte sie, was Proudhon in seinem Pamphlet präzise darlegte, kein Bisschen zusätzlich gegen die überwältigende Mehrheit der Bonapartisten ausrichten können.
Und wie Proudhon ihnen verhieß, kam die Botschaft der Nichtwähler beim Kaiser an, wie indirekt auch immer. Im Parlament ergab sich eine Zusammenarbeit der liberalen Kräfte innerhalb der Bonapartisten mit Republikanern; die Liberalisierung wurde fortgesetzt. Aber wie Proudhon treffsicher prophezeite, reichte es keineswegs, um Frankreich zu stabilisieren. Militärische Abenteuer, Kolonialismus 17 und politische Begünstigung von wirtschaftlicher Monopolisierung führten zu einer Erosion, bis sich 1870 beim Krieg gegen Preußen zeigte, dass die einst so stolze Nation völlig marode geworden war. In der Niederlage Frankreichs triumphierte der Proudhonismus: Die Pariser Kommune entstand, die, obwohl sie von der Staatsgewalt bloß kurze Zeit drauf brutal niedergeschlagen wurde, die revolutionäre Bewegung in ganz Europa für hundert Jahre beflügelte. Ihre Grundsätze waren der Föderalismus und Mutualismus Proudhons, der Aufbau der Gesellschaft aus autonomen Gruppen, die sich föderieren, und der Wirtschaft nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Der Ruhm der Pariser Kommune war so groß, dass selbst Marx nicht umhin kam, sie zu hofieren und fälschlich als eine Verwirklichung seiner Ideen auszugeben.
Zurück zu Proudhons Wahlpamphlet von 1863. Regierung und Opposition einen Selbstwiderspruch nachzuweisen und damit zu hoffen, sie umstimmen zu können, ist das nicht reichlich naiv? Lassen sich Menschen und vor allem politische Parteien von ihrem Kurs abbringen, wenn man zeigen kann, dass sie einem Selbstwiderspruch erlegen sind? Beruhen Leitlinien der Politik nicht vielmehr auf ökonomischen oder sonstigen Interessen statt logischer Widerspruchslosigkeit und Reinheit der Ideen? Genau das ist es, was Proudhon entlarven wollte. Sein Pamphlet gegen die Wahlbeteiligung ist ein gutes Stück Ideologiekritik. Mit ihm zeigt er auf, dass es gerade nicht die Idee der Demokratie (des allgemeinen Wahlrechts) ist, die die Politik von Regierung und Opposition leitet. Wenn es jedoch eure Interessen sind, die ihr mit der Macht durchsetzen wollt, sagte Proudhon, dann bitte seid so ehrlich, diese vor dem Volk zu nennen. Aber wird es euch dann noch zustimmen? Proudhon hegte die vielleicht wirklich naive Hoffnung, dass dem nicht so wäre.
Im Wikipedia-Eintrag wird nahegelegt, Proudhon habe sich an Napoléon III gewandt, um seine Ideen mit dessen Hilfe durchzusetzen, weil das Volk ihm nicht folgte.18 Der, der ihn einsperren ließ und damit sein Volksbank-Projekt zerstörte! Die Texte, auf die sich derlei Unsinn stützt, habe ich ediert.19 Die möglichen Passagen sind bitterböse Satiren. So fasste die Zensur des Kaisers sie auch auf und kürzte die Veröffentlichung — in Frankreich durften sie überhaupt bloß deswegen erscheinen, weil die Regierung von Napoléon III schwächelte und ihre Zensur lockerte, um die Unterstützung von den Liberalen zu gewinnen. Im Wahlpamphlet von 1863 gibt es Passagen, die ebenfalls als Zustimmung zum Regime verstanden werden können, so man den ironischen Ton überhört.20
Als Bakunin nach Proudhons Tod dessen Erbe antrat und Integrationsfigur des Anarchismus wurde, traf er zwei begriffliche Entscheidungen, die sich mittelfristig als verhängnisvoll erwiesen — das Festhalten am positiven Gebrauch der Worte Sozialismus und Demokratie. Die herrschenden Verhältnisse undemokratisch zu nennen und wahre Demokratie zu fordern, wirft Proudhons eine Frage auf: Sollen fünfzig plus ein Prozent über fünfzig minus ein Prozent ungebremst herrschen? 21 Wie drückt sich der wahre Wille des ganzen Volks aus? 22 — Und Sozialismus zu fordern, wirft Proudhons andere Frage auf: Soll die Gewalt des Staats eingesetzt werden, um gegen die Minderheit oder sogar gegen die Mehrheit eigene Überzeugungen durchzusetzen? Was werden die Folgen sein? Sicherlich nicht Wohlstand, sondern Elend für alle! 23 Proudhon 1848. Man hätte es wissen können. Man hat es gewusst. Und ist dennoch in die falsche Richtung marschiert.
Für eine Dialektik der Demokratie. — «Die Auflösung der natürlichen Gruppen bei den Wahlen wäre die moralische Auflösung der Nation selber, der Ruin des allgemeinen Wahlrechts und die Verneinung des Gedankens der Revolution.» — Proudhon, 1863.24
1. Aus dem demokratischen Prinzip, aus dem allgemeinen Wahlrecht, folgen nach Proudhon drei Grundsätze. Der erste Grundsatz ist Versammlungs- und Pressefreiheit. Dies würde heute keiner mehr bestreiten; damals musste er dies umständlich herleiten und begründen. Und obwohl kontextlos gesehen kein heutiger Demokrat die Notwendigkeit der Versammlungs- und Pressefreiheit als Voraussetzung der Demokratie bestreiten würde, sieht das im Kontext des politischen Tageskampfes ganz anders aus. Selbst in den alten Demokratien Westeuropas und Nordamerikas kehren Zensur und Verbot missliebiger politischer Organisationen wieder.25 Und dies hängt mit dem zweiten Grundsatz zusammen.
2. Der zweite aus dem demokratischen Prinzip folgende Grundsatz lautet, dass die Demokratie (die Mehrheit der Wähler) ihr Votum ändern kann. Auch dies scheint zunächst völlig unstrittig zu sein. Die Mehrheit kann heute die eine und morgen die andere Partei wählen, heute den einen, morgen den anderen Kandidaten ins Amt heben. Dabei kann sie mal für Auf-, mal für Abrüstung stimmen, mal für sozialistische, mal für liberale Reformen. Alles das wird einer Mehrheit zugestanden. Aber sie kann, und hier sieht man die ganze Genialität von Proudhon, auch sich selber negieren. Die Mehrheit kann dafür stimmen, die Versammlungs- und Pressefreiheit einzuschränken oder abzuschaffen. Das ist faktisch so, und Proudhon erkannte es bereits zu seiner Zeit, was uns dann erst schmerzlich durch die Wahlen von faschistischen, kommunistischen oder theokratischen Diktatoren deutlich wurde. Mit einer Mehrheit, die die demokratischen Grundrechte (Pressefreiheit, Versammlungsrecht) negiert, begibt die Demo - kratie sich in einen Selbstwiderspruch: Sie ist nicht mehr «mit sich selbst identisch», wie Proudhon es formulierte. Die Antwort der heutigen Demokratie lautet, dass dem Volk eben nicht erlaubt werden dürfe, per Mehrheits - beschluss die Freiheit einzuschränken. Aber wir sehen hier die Wunde des Selbstwiderspruchs, auf die Proudhon den Finger legte: Dem Volk nicht zu erlauben, per Mehrheitsbeschluss die Freiheit einzuschränken, ist eine Einschränkung der Freiheit. Eine solche Einschränkung lässt sich praktisch bloß in der Weise umsetzen, dass man die Presse (heute: Medien) einer Zensur unterwirft sowie das Versammlungsrecht einschränkt.
3. Aber Proudhon war Dialektiker. Auf These und Antithese folgt die Synthese, und das ist der dritte Grundsatz, den Proudhon aus dem Prinzip des allgemeinen Wahlrechts meint, unmittelbar logisch ableiten zu können. Und dieser Grundsatz lautet, dass die im allgemeinen Wahlrecht auszudrückende Souveränität des Volks eben gar nicht darin besteht, die nummerische Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen möge sich knallhart durchsetzen. Vielmehr bestimmt er die Allgemeinheit des Wahlvotums, mit welchem das Volk seine Souveränität artikuliert, als einen größten gemeinsamen Nenner all der widersprüchlichen Meinungen und Auffassungen im Volk. Das ist genau das, was Rousseau schon gesagt hatte.26
Wenn dieser Grundsatz eingehalten wird, kann die Mehrheit niemals die Freiheit aufheben, es sei denn, es würde Einstimmigkeit herrschen (und selbst dann wäre die Freiheit nicht eingeschränkt, weil es niemanden gäbe, dem man sie nehmen könnte). So bleibt das allgemeine Wahlrecht «identisch mit sich selbst». Nun erhoben damals Politiker ein Geschrei, wie sie es auch heute tun: Unter dieser Voraussetzung sei aber keine Politik zu machen, die Gegner könnten jede politische Aktion per Veto verhindern. Proudhon, der erste Anarchist, lacht sich hier ins Fäustchen und schmunzelt: Um so besser. Wenn ihr es nicht schafft, die verschiedenen Meinungen und Inter - essen unter einen Hut zu bringen, dann tut ihr besser dar an, von einer Umsetzung Abstand zu nehmen.
Aus dem dritten Grundsatz leitete Proudhon ein weiteres Prinzip ab: Föderalismus. In einer Wahl, in der Millionen Menschen zur Abstimmung aufgerufen sind, drücke die Volkssouveränität sich sowieso niemals aus. Hier wiegt die Stimme jedes Einzelnen fast nichts. Sie wird auch zu einem nahezu beliebigen und willkürlichen Akt. Es sind zu viele Dinge, über die zugleich abgestimmt wird: über Pakete von politischen Maßnahmen, deren Konsistenz alles andere als sicher ist, und über Kandidaten, die dem Wähler nahezu unbekannt sind, ausgenommen in den Selbstdarstellungen des Wahlkampfs. Örtliche Gegebenheiten und Belange gehen unter. Wir sehen auch heute in den extrem zentralisierten Staaten, dass bei regionalen Körperschaften der kleinsten Einheiten Parteienpolitik kaum noch eine Rolle spielt und die gemeinsamen Inter - essen im Vordergrund stehen, dass Einstimmigkeit viel leichter zu erzielen ist. Neben diesen regionalen Körperschaften bezog Proudhon aber auch die nicht-regionalen Körperschaften in sein föderalistisches Prinzip ein, freie Vereinigungen, in denen sich gemeinsame Aufgaben und Interessen bündeln.
Von Proudhons beiden Schattenseiten — Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit — ist in den vorliegenden Texten wenig zu spüren. Zwei antisemitische Ausfälle leistete er sich. 1848 aber nicht dort, wo von Spekulanten die Rede ist,27 sondern in einer allgemein gehaltenen Bemerkung.28 1863 in einer schlichten Aufzählung von Personen, denen er nicht wohlgesonnen war.29 Beide Ausfälle zeigen, dass Antisemitismus beim Wort genommen die Enthaltung von jeder Ratio oder Logik ist, denn an beiden Stellen macht es gar keinen Sinn, einer durch Abstammung oder Religion definierten Gruppe eine soziologische Rolle zuzuschreiben. Insofern stellen sie im Text Proudhons unerklärliche Fremdkörper dar: sie ließen sich streichen, ohne die Aussage zu verändern. Antisemitismus ist Teil seines ganz persönlichen Wahns, nicht aber Teil seiner Argumentation oder Philosophie.
Anders liegt die Sache bei einer Fußnote, mit der er im letzten hier aufgenommenen Text, einem kurzen Kapitel aus der ebenfalls 1863 erschienenen Abhandlung über das föderalistische Prinzip, zum in jener Zeit gerade stattfindenden amerikanischen Bürgerkrieg Stellung nimmt. Eine Bemerkung könnte ihm als rassistisch angekreidet werden, wenn man sie aus dem Zusammenhang reißt, nämlich dass es den Schwarzen (was für eine hirnrissige Verallgemeinerung) an philosophischem Verständnis und körperlicher Schönheit gebreche. Freilich ist diese Bemerkung die Wiedergabe eines Vorurteils der weißen Amerikaner. Es bleibt, wie ich zugestehen muss, etwas in der Schwebe, ob Proudhon es teilt (was beschämend und eines Soziologen unwürdig wäre), zumindest nennt er es ein Vorurteil, das er unter anderem auf die Bibel zurückführt — bei seiner Feindschaft gegen das Christentum im Allgemeinen und den Protestantismus im Besonderen kein Hinweis darauf, dass er dieses Vorurteil gutheißt. Nachdrücklich protestiert Proudhon gegen den Plan der Lincoln-Administration,30 die befreiten Sklaven zwangsweise zu deportieren, entweder nach Afrika oder in eine wenig besiedelte Region der USA (im Gespräch war wohl Texas). Proudhon sagte richtigerweise vorher, dass, wenn die Deportation ausbleibe, die Schwarzen nicht etwa zu den Weißen ebenbürtigen Bürgern würden, sondern auf einen niedrigen Sozialstatus verwiesen blieben. Damit zeigte er sich nicht einverstanden. Ebenso hellsichtig ist Proudhons Bemerkung in diesem Zusammenhang, dass es die Brüderlichkeit unter den Völkern nicht fördere, wenn man Vorurteile verbiete oder so tue, als würden sie nicht existieren.
Ein Exkurs zum (niemals in Angriff genommenen) Plan Thomas Jeffersons zur Befreiung der Sklaven, die er zwar theoretisch forderte, für die er aber praktisch kaum etwas unternahm. Jefferson war wie Lincoln (aber eben offensichtlich anders als Proudhon) der Auffassung, dass nach einer Abschaffung der Sklaverei Weiße und Schwarze nicht ohne weiteres zusammenleben könnten. Er nannte als Gründe die Vorurteile der Weißen auf der einen, aber eben auch die Erinnerungen von Schwarzen an das ihren durch Weiße zugefügte Leid auf der anderen Seite. Sein Plan bestand jedoch nicht in Deportation. Die befreiten Sklaven sollten vielmehr mit Land, Vieh, Gerätschaft und vor allem auch mit Waffen ausgestattet werden. Sie sollten ihre eigene Nation bilden oder sich gegebenenfalls aus freien Stücken den USA anschließen. Diesen Plan hätte man zu dem Zeitpunkt, an dem er formuliert worden war, nämlich Ende des 18. Jahrhunderts, durchaus umsetzen können. Mitte des 19. Jahrhunderts möglicherweise nicht mehr. Wie dem auch sei, die Lincoln-Administration dachte in eine andere Richtung. Denn ihr Monogramm entsprach exakt dem, was Proudhon bekämpfte — demo - kratische Einheit.
Zurück zu Proudhons Schattenseiten. Frauenfeindlichkeit? In der Passage, wo es um die Bevölkerungsteile geht, die trotz des allgemeinen Wahlrechts nicht repräsentiert sind, zählt Proudhon ausdrücklich die Frauen auf.31 Für 1848 stimmt es zwar nicht, wie er schreibt, dass noch nie jemand das Frauenwahlrecht vorgeschlagen hätte, denn in der Französischen Revolution forderte es Olympe de Gouges (1748-1793), die unter der Terrorherrschaft von Robespierre dann als Föderalistin hingerichtet wurde. Aber es scheint tatsächlich erst einige Jahrzehnte später ein brennendes Thema der Arbeiterbewegung geworden zu sein.
Einen Originalabzug des Portraits von Proudhon, das Titel und Frontispizseite ziert, habe ich erworben. Bin immer noch aufgeregt wie ein kleines Kind zu Weihnachten, die Reliquie in Händen zu halten. Das Portrait ist vermutlich kurz vor seinem Tod entstanden. Proudhon starb an den Spätfolgen der Cholera-Infektion aus den 1850 er Jahren; im Gefängnis zugezogen? Er saß wegen Beleidigung des Präsidenten Louis Bonaparte, der sich kurz drauf zum Kaiser Napoléon III krönen ließ. Eine erneute Drohung mit Gefängnis für eine Veröffentlichung trieb Proudhon 1858 ins Exil nach Belgien. 1862 durfte er anlässlich einer Liberalisierung des Kaisers nach Paris zurückkehren. In dem Jahr vor seinem Tod Januar 1865 war Proudhon fast erblindet und schrieb seine letzten wunderbaren Essays mit Hilfe seiner Tochter Catherine (1850-1947).
Der Photograph ist Charles bzw. Carl Reutlinger (18161888), ein deutscher Pionier der Fotografie mit Studio in PariS. 54 Portrait-Photos sind von ihm überliefert. Der Abzug muss von Mitte der 1870 er Jahre stammen, denn auf der Rückseite präsentiert er stolz seine Medaillen, dar - unter eine aus dem Jahr 1873 (Weltausstellung in Wien, «Medaille für Fortschritt»).
Auf die Existenz des Photos und die Tatsache, dass es ein Antiquar feilbietet, stieß ich im Rahmen der vorliegenden Proudhon-Edition. Die Texte entdeckte ich, als ich letztes Jahr für meinen Vortrag am In Kontakt Gestaltinstitut zum 100. Jahrestags des Erscheinens von Martin Bubers Ich und Du einige Proudhon-Zitate aus Pfade in Utopia recherchierte (Buber zitiert stets ohne Quellennachweise). Proudhon legte den Grundstein für Bubers politische Theorie. Bubers Pfade in Utopia war das erste Buch eines Anarchisten, das ich je las (Ende 1970); bisher hatte ich mich jedoch noch niemals daran begeben, seinen Zitaten nachzuspüren. — Buber besaß eine intime Kenntnis von Proudhons Werken und Proudhons Denken prägte Buber weit mehr, als sich in der Sekundärliteratur aufgearbeitet findet. Die vorliegende Edition trägt insofern auch zum besseren Buber-Verständnis bei.
«Im Parlament wird das Proletariat agieren wie Beamte: Richter in eigener Sache sein, immer bereit, das Budget anzuzapfen, aber nichts zu ihm beitragen, die Diktatur hofieren, bis das Kapital durch die Steuer erschöpft ist, das Eigentum keine Frucht mehr bringt und der allgemeine Bankrott die parlamentarische Bettelei ins Leere laufen lässt.» — Proudhon, 1848 32
2 Gustav Landauer, Aufruf zum Sozialismus (1911), Köln 1923, S. →. In meiner Lieblingsausgabe, herausgegeben v. Heinz-Joachim Heydorn, Frankfurt/M. 1967, S. →.
3 Vgl. Proudhon, Für dezentrale Nationen, Berlin 2022. Drei von mir erstmals deutsch edierte Texte aus den Jahren 1862 und 1864 gegen die zwangsstaatliche Vereinigung Italiens. Vgl. auch Michael Bakunin, Unterschied ist Leben, Harmonie der Tod: Brief 1872, ebenfalls erstmals von mir in Deutsch ediert (Berlin 2020).
4 Siehe S. →-→ sowie →-→.
5 Ein verspäteter — und insofern auch grotesker — Widerhall quasireligiöser Anbetung der Massen fand sich in den Männerphantasien Klaus Theweleits (1977): Der faschistischen Männerphantasie einer straff geführten Masse stellte er die führerlose, unendlich kreative und befreite kommunistische Masse entgegen, die es, wie er sehr wohl wusste, nie gegeben hat (und nie geben wird).
6 Vgl. Stefan Blankertz, Nur ein altmodisches Liebeslied? Glanz und Elend des klassischen Anarchismus, Berlin 2023.
7 Und das noch vor Max Stirner, dessen Einziger und sein Eigentum 1845 erschien.
8 Vgl. Pierre-Joseph Proudhon, Les Confessions d’un Révolutionnaire, pour servir à l’Histoire de la Révolution de Février, Paris 1849, S. →.
9Le Socialisme (1867), in: Michel Bakounine, OEuvres, Band 1, hg. von Max Nettlau, Paris 1895, S. →.
10 S. → f. Anders (?) im Text zum föderativen Prinzip 1863, siehe S. →.
11 Siehe S. →, → f, →, →, → f, →, →-→.
12 Als Ludwig Erhard, abwegig? Jedenfalls vertrat dies Thilo Ramm in seiner Edition einer Auswahl von Proudhons Schriften (1963).
13 Vgl. hierzu Stefan Blankertz, Das libertäre Manifest, Berlin 2015.
14 Der Kaiser war nicht nur per Plebiszit legitimiert, sondern ließ seine Regierung vom Volk wählen und war dem Parlament verantwortlich. Sein ‹Prärogativ› — das übergesetzliche Vorrecht des Regenten — blieb auf wenige Sachverhalte beschränkt.
15 Es gab auch eine monarchistische Opposition, die Proudhon kaum ansprach. Sie befand sich ebenfalls in einem Selbstwiderspruch, weil sie für die Legitimität einer Regierung keine Zustimmung des Volkes, vielmehr die göttlich gegebene Erbfolge der Monarchie reklamierte, gleichzeitig die Zustimmung des Volkes zu diesem Prinzip anstrebte; andernfalls hätte sie sich nicht zur Wahl stellen dürfen.
16 Proudhon rechnete mit ca. 500 000 Stimmenthaltungen aufgrund seines Aufrufs (siehe S. →; vgl. auch S. →), sodass man sagen kann, sein Erfolg sei gut und gerne doppelt so groß gewesen wie erhofft.
17 Kolonialismus wird auch heute meist noch als eine Ausbeutung der kolonialisierten Völker betrachtet. Proudhon ist neben den von ihm leider unterschätzten und abgelehnten Manchester-Liberalen einer derjenigen, die früh hinwiesen, dass die wirtschaftliche Nettobilanz des Kolonialismus für die Masse der Bevölkerung der den Kolonialismus betreibenden Staaten negativ ist. Er wurde nicht aus Gründen der Wirtschaftlichkeit betrieben, sondern aus Gründen des Ausbaus der Staatsgewalt. (Siehe S. →-→.)
18 «Nachdem Louis Blanc in der Bevölkerung eine weitaus größere Anhängerschaft gefunden hatte, versuchte Proudhon, Napoléon III zur Unterstützung seiner Pläne zu gewinnen.» Stand 11. 9. 2024. Ob Louis Blanc tatsächlich mehr Anhänger hatte, ist fraglich.
19 Pierre-Joseph Proudhon, Für dezentrale Nationen, Berlin 2022.
20 Siehe S. →-→.
21 Siehe S. →; vgl. auch S. →.
22 Siehe S. →-→.
23 Siehe S. →; vgl. auch S. →.
24 Siehe S. →. — Eine jener Stellen, auf welche Martin Buber in Pfade in Utopia (1945) Bezug nimmt.
25 Die Behauptung, der Nationalsozialismus hätte durch Pressezensur und Partei- oder Vereinsverbot sich verhindern lassen, mein Gott, die ist historisch, ökonomisch, psychologisch und soziologisch abwegig.
26 Weil die Formulierung entscheidend ist (und fast immer übersehen wird), hier zitiert nach dem Original des Contrat Social, 1762, S. →: «& s’il n’y avoit pas quelque point dans lequel tous les intérêts s’accordent, nulle société ne sauroit exister. Or c’est uniquement sur cet intérêt commun que la société doit être gouvernée.» (Wenn es nicht einen Punkt gäbe, in dem alle Interessen übereinstimmen, könnte keine Gesellschaft existieren. Und nur nach diesem gemeinsamen Interesse darf die Gesellschaft regiert werden.)
27 Siehe S. →, →.
28 Siehe S. → f.
29 Siehe S. →.
30 Ein Plan, der in heutigen Hymnen auf Präsident Abraham Lincoln als Sklavenbefreier meist keine Erwähnung findet. Geschichte wird nach wie vor von den Siegern diktiert. Auch Chat GPT wiegelt ab.
31 Siehe S. →-→. «Ihr eliminiert die Frauen.» Von Proudhons Liste großer Frauen mag man halten, was man will; deutlich wird, dass er mit dieser Eliminierung nicht einverstanden ist.
32 Siehe S. → f.
ZEITLEISTE ZUR REVOLUTION VON 1848
1775 Revolution in (Nord-) Amerika und Unabhängigkeit vom British Empire. — Schwacher Zentralstaat. — Lose Konföderation (Staatenbund).
1789 Französische Revolution. Erklärung der Menschenrechte. Konstitutionelle Monarchie.
1791 Erste Französische Verfassung.
1792 Erste Französische Republik. — Radikalisierung und Terrorherrschaft unter dem Jakobiner Maximilien de Robespierre. Der Zentralismus setzt sich durch. Man proklamiert die Eine und Unteilbare Nation.
1794 Robespierre wird gestürzt und hingerichtet.
1795 Neue Verfassung in Frankreich. Die Formel von der Einen und Unteilbaren Nation bleibt.
1797 Amerika: Konflikt um die Verfassung. Zentralisten versus Dezentralisten. — Die Zentralisten gewinnen den Machtkampf: Verabschiedung der Verfassung.
1799 In Frankreich putscht Napoléon sich an die Macht.
1804 Napoléon lässt sich zum Kaiser krönen und überzieht Europa mit Krieg. Überall errichtet er einerseits Diktaturen, andererseits führt er das bürger - liche Gesetz ein.
1814 Niederlage Napoléons.
1815 Napoléons kurzzeitige Rückkehr und die endgültige Niederlage. — Restauration der Fürstenherrschaft in ganz Europa unter Dominanz Österreich-Ungarns.
1830 Julirevolution in Frankreich. Der Bürgerkönig Louis-Philippe kommt auf den Thron. — Goldenes Zeitalter der französischen Bourgeoisie.
1847 ‹Sonderbundkrieg› in der Schweiz. Der Staatenbund wird zum Bundesstaat.
1848 Ab Januar: In einigen Regionen des späteren Italien nationalistisch-republikanische Aufstände.33
Februar: Revolution in Frankreich. Zweite Republik. März: In etlichen Ländern des ‹Deutschen Bundes› kommt es zu Umsturzversuchen.
März: Luxemburg.
März: Dänemark.
März: Ungarn.
März: Posen.
April: Moldau.
Mai: Siebenbürgen.
Juni: Walachei.
Juni: Prag.
Juni: Neue Unruhen in Paris. Niederschlagung durch General Louis-Eugène Cavaignac.
September: Slowakei.
Oktober: Wien.
Dezember: Die Franzosen wählen mit großer Mehrheit Louis-Napoléon Bonaparte zum Präsidenten.
1849 Februar: Rom.
Mai: Dresden.
Mai: Iserlohn.
1851 Putsch in Frankreich. Louis-Napoléon Bonaparte ist Diktator. Plebiszit.
1852 Louis-Napoléon Bonaparte erklärt sich zum Kaiser Napoléon III. Plebiszit.
1871 Frankreichs Niederlage gegen Preußen. Abdankung von Napoléon III. — Die Dritte Französische Republik und das Zweite Deutsche Kaiserreich folgen.
33 Zu Proudhons Kritik an nationalistischen Bestrebungen in Italien vgl. Für dezentrale Nationen (Texte 1862-1864), Berlin 2022. Vgl. auch: Michael Bakunin, Unterschied ist Leben, Harmonie der Tod: Ein Brief von 1872, Berlin 2020.
FÜR UNGEDULDIGE LESER
Zu den Forderungen der 1848 er-Revolution
«Das [französische] Volk forderte [während der Februarrevolution 1848] nicht, wie es einige Utopisten wollen, dass die Regierung den Handel, die Industrie und die Landwirtschaft übernimmt, um diese Bereiche zu ihren Aufgaben hinzuzufügen und die französische Nation zu einer Nation von Lohnarbeitern zu machen.» 34
«Denkt das Volk an die Abschaffung der kommunalen Selbstverwaltung, an die Einführung von progressiven Steuern, staatlichen Betrieben, Landwirtschaftsbanken, Papiergeld? Oder denkt es nicht vielmehr daran, dass eine außerordentliche Besteuerung des Reichtums bedeutet, den Reichtum zu töten; dass die Befugnisse des Staats nicht ausgeweitet, sondern eingeengt werden müssen; dass unter Beschaffung von Arbeit nichts anderes verstanden werden sollte als die Förderung des Wettbewerbs; und dass der größte Dienst, den man der Landwirtschaft erweisen kann, statt für sie eine spezielle Staatsbank einzurichten, darin besteht, all ihre Beziehungen zum staatlichen Bankensystem abzubrechen?» 35
Zum Problem zentralstaatlicher Demokratie
«Die Freiheit, das muss man wissen, ist mit Demokratie so unvereinbar wie mit der Monarchie. Früher bildete die Sklaverei einer Kaste die Grundlage für die Existenz der Demokratie, heute wird es die Sklaverei aller sein.» 36
«Die Demokratie ist die ins Unendliche erweiterte Idee des Staats.» 37
«Es gibt keine legitime Vertretung des Volkes, und es kann auch niemals eine solche geben. Alle Wahlsysteme sind Lügenmechanismen: Man muss bloß eines kennen, um alle zu verurteilen.» 38
«[In der Wahl zum Parlament] wird erstens angenommen, dass das Volk befragt werden könne, zweitens, dass es in der Lage sei, auch zu antworten, drittens, dass sein Wille sich authentisch feststellen lasse, und viertens, dass eine Regierung, die auf dem geäußerten Willen des Volkes beruht, legitim wäre.» 39
«Wenn ich beweise, dass die Demokratie weit davon entfernt ist, die vollkommenste aller Regierungen zu sein, sondern die Volkssouveränität verneint und das Prinzip ihres Untergangs darstellt, dann heißt das faktisch und rechtlich, dass die Demokratie nichts weiter ist als eine willkürliche Verfassung, die auf eine andere willkürliche Verfassung folgt, dass sie keinen wissenschaftlichen Wert besitzt und dass man in ihr nur eine Vorbereitung auf die ‹eine und unteilbare [d. h. zentralistische] Republik› [der Jakobiner] sehen muss.» 40
«Als praktischer Mensch frage ich, auf welch eine Weise Seele, Vernunft oder Wille des Volkes gleichsam aus sich selbst heraustritt und sich manifestiert? Wer ist es, der ihm als Organ dienen kann? Wer hat das Recht, anderen zu sagen: ‹Durch mich spricht das Volk›? Wie soll ich es glauben, dass einer das Organ des Volkes sei, der sich von einem Podium aus an zusammengewürfelte Individuen wendet, die ihm applaudieren? Wie kann Kraft der Wahl der Bürger, ja gar ihres einstimmigen Votums, das Privileg verleihen, dem Volk als Sprachrohr zu dienen? Und wenn Sie mir 900 von den Mitbürgern gewählte Personen wie Hostien beim Abendmahl vorführen, weshalb sollte ich dann glauben, dass diese 900 Delegierten, die sich untereinander nicht einigen können, vom Atem des Volkes inspiriert werden? Und wie kann mich das Gesetz, das sie zu machen gedenken, verpflichten?» 41
«Wie sollen die gegensätzlichen Wünsche, die entgegengesetzten Tendenzen in einem gemeinsamen Ergebnis, in dem einen und universellen Gesetz, zusammenfließen?
Die Demokratie ist weit davon entfernt, diese Schwierigkeit zu lösen, ihre ganze Kunst, ihre ganze Wissenschaft besteht ja darin, Entscheidungen herbeizuzwingen. Sie greift auf die Urne zurück; die Urne ist zugleich Mittel der Nivellierung, Waage und Kriterium der Demokratie. Mit der Wahlurne eliminiert sie die Menschen; mit der Abstimmung über Gesetze eliminiert sie die Ideen.
Noch vor kaum einem Monat erregte man sich in allen Tonlagen über den Wahlzensus von 200 Francs. ‹Was!, Geld soll jemanden zum Wähler machen?›
Aber ist es heute nicht das Gleiche in grün? Was wiegt eine Stimme, die jemanden zum Vertreter macht, eine Stimme, die das Gesetz verabschiedet! In irgendeiner gegebenen Frage, von welcher die Ehre und das Heil der Republik abhängt, werden die Bürger in zwei gleich große Fraktionen geteilt. Beide bringen ernsthafte Gründe, schwerwiegende Expertenmeinungen und gesicherte Tatsachen vor. Die Nation ist im Zweifel, das Parlament hängt in der Luft. Ein Abgeordneter geht ohne nennenswerte Gründe von rechts nach links und die Waage neigt sich — er macht das Gesetz.
Und dieses Gesetz, das Ausdruck irgendeines launischen Willens ist, wird als Ausdruck des Willens des Volkes angesehen. Ich muss mich ihm unterwerfen, ich muss es verteidigen, ich muss dafür sterben! Ich verliere durch eine parlamentarische Schrulle das wertvollste meiner Rechte, ich verliere die Freiheit! Die heiligste meiner Pflichten, die Pflicht, mich der Tyrannei mit aller Kraft zu wider - setzen, fällt einem souveränen Dummkopf zum Opfer!
Die Demokratie ist nichts anderes als die Tyrannei der Mehrheiten, die abscheulichste aller Tyranneien, denn sie stützt sich weder auf die Autorität einer Religion noch auf einen Geburtsadel noch auf die Vorrechte des Talents oder des Vermögens, sondern hat die Zahl zur Grundlage und trägt den Namen des Volkes als Maske. Herr de Genoude verweigerte unter der Herrschaft des [Königs] Louis-Philippe die Zahlung von Steuern, weil, wie er sagte, die Steuern nicht von einer echten Nationalvertretung verabschiedet wurden. Herr de Genoude war zu zaghaft, hier auf halbem Weg stehen zu bleiben. Denn wenn eine demokratischere Mehrheit für den Haushalt gestimmt hätte, sollte dann die Minderheit glauben, auch sie habe dem Haushalt zugestimmt und sei folglich zur Zahlung verpflichtet, obwohl sie gegen den Haushalt votierte?
Im ersten Teil dieses Buches bewies ich die Legitimität der Revolution und moralische Notwendigkeit der Republik, indem ich zeigte, dass am 22. Feb. [1848] alle Meinungen, alle unterschiedlichen Parteien zu einem Reformpaket übereinkamen, dessen allgemeine Formel unweigerlich die Republik war. Die Demokratie mit dem allgemeinen Wahlrecht zerstört die Rechtfertigung, die einzige, die es für ihre Entstehung geben kann. Sie versucht, die Massen und die Kommunen zu überreden, sich der Republik anzuschließen; wenn dieser Anschluss nicht erfolgt, wird sie ihn mit Gewalt herbeiführen! Einschüchterung, das ist das Argument der Demokraten für die Re publik! So wird klar, dass das allgemeine Wahlrecht, dass die Demokratie nicht die Souveränität des Volkes ausdrückt.» 42
«Wenn die Monarchie der Hammer ist, der das Volk zerschmettert, so ist die Demokratie die Axt, die es teilt, und beide führen gleichermaßen zum Tod der Freiheit. Das allgemeine Wahlrecht ist eine Art Atomismus, durch den der Gesetzgeber, da er das Volk nicht in der Einheit seines Wesens sprechen lassen kann, die Bürger auffordert, ihre Meinung pro Kopf, viritim [d. h. Mann für Mann], auszudrücken, absolut so, wie der Philosoph Epikur das Denken, den Willen sowie die Intelligenz durch Kombinationen von Atomen erklärt. Das ist politischer Atheismus in der schlechtesten Bedeutung des Wortes. Als könnte aus der Addition einer beliebigen Anzahl von Stimmen jemals ein allgemeiner Gedanke hervorgehen!
Aus dem Zusammenprall von Ideen gehe das Licht hervor, sagte man in früheren Zeiten. Das ist wahr und falsch wie all diese Sprichworte. Zwischen dem Zusammenprall und dem Licht können tausend Jahre liegen. Die Geschichte begann vor kaum einem halben Jahrhundert, sich vor uns zu enthüllen; die Ideen, die in Rom, Athen, Jerusalem und Memphis einst umherschwirrten, erleuchten erst die Menschen unserer Zeit. Ohne Zweifel hat das Volk gesprochen; sein Wort, das sich in den Stimmen Einzelner verliert, versteht aber kein Mensch. Das Licht der antiken Ideen entzieht sich den Zeitgenossen. Zunächst tauchte es vor den Augen von Vico, Montesquieu, Lessing, Guizot, Thierry und ihren Konkurrenten auf. Dient es der Nachwelt, wenn auch wir uns an die Gurgel gehen?
Das sicherste Mittel, um das Volk zum Lügen zu bringen, ist die Einführung des allgemeinen Wahlrechts. Die Abstimmung pro Kopf ist in Bezug auf die Regierung und als Mittel zur Feststellung des nationalen Willens genau das gleiche, was in der politischen Ökonomie Umverteilung des Bodens wäre. Ein solches Gesetz würde die Bodenrechte auf die Behörde übertragen.
Da die ersten Autoren, die den Ursprung der Regierungen untersuchten, lehrten, alle Macht wurzele in nationaler Souveränität, hat man tapfer geschlussfolgert, dass es am besten sei, alle Bürger per Stimme, Füßen oder Zettel abstimmen zu lassen, und dass in der Mehrheit der Wähler sich der Wille des Volkes angemessen ausdrücke. Man führte bei uns die Gebräuche der Barbaren wieder ein, in Ermangelung von Argumenten durch Akklamation und Wahl vorzugehen. Ein materielles Symbol hält man für die wahre Formel der Souveränität. Den Proletariern sagt man: ‹Wenn ihr wählt, macht euch das so frei wie reich; ihr gebietet über Kapital, Produkt und Lohn; ihr könnt, wie ein zweiter Moses, gebratene Wachteln und Manna vom Himmel regnen lassen; ihr seid wie die Götter, denn ihr werdet nicht mehr arbeiten müssen, oder, falls ihr doch arbeiten müsst, wird das so wenig sein, dass es sich anfühlt wie nichts.›
Was man auch tut und was man auch sagt, das allgemeine Wahlrecht, das Zeugnis der Uneinigkeit, kann nur Un - einigkeit hervorbringen. Und mit dieser elenden Idee — ich schäme mich für mein Vaterland — wühlt man seit gut 17 Jahren das arme Volk auf!» 43
Zur Tendenz der Demokratie, Staatsausgaben zu erhöhen
«Die Demokratie ist teurer als die Monarchie.» 44 — «Weit davon entfernt, dass die Demokratie den gegenwärtigen Haushalt kürzen könnte, stehen die Wetten zehn zu eins, dass sie ihn erhöhen wird.» 45
«[Die Demokratie] wird die Staatsausgaben um etliche Millionen erhöhen; sie wird sich der großen Firmen und dann der kleineren Betriebe bemächtigen; sie wird den Wert von Industrie und Handel zerstören; sie wird die Quelle des Kapitals versiegen lassen; sie wird die freie Arbeit belasten, den freien Handel gefährden, den freien Unterricht abwürgen, den freien Konsum einschränken und die freie Wahl verbieten.
Deshalb stoppt die Demokratie jetzt den Verkehr, deshalb schließt sie Betriebe, deshalb erklärt sie Verträge für null und nichtig, deshalb belastet sie Märkte, deshalb treibt sie Handel, Industrie, Landwirtschaft und den Staat in den Bankrott. Bezogen auf die Regierung ist alles, was logisch aus dem Prinzip folgt, der Absicht zuzuschreiben.» 46
«Es ist bewiesen, empirisch, dass jede durch den Staat ausgeführte Dienstleistung im Allgemeinen 50 % mehr kostet, als sie wert ist, z. B. Straßenbau, Steuererhebung, Schutzzoll usw.» 47
Zur Bedingung wahrer (dezentraler) Demokratie
«Wenn das Vorrecht der Bürger nur darin bestünde, alle 3 bis 6 Jahre zwischen Eigennamen zu wählen, Namen, Vornamen und die Parteizugehörigkeit eines Kandidaten mehr oder weniger korrekt auf ein Fetzen von Papier zu schreiben und diesen Wahlzettel dann schweigend in eine Urne zu werfen, die von einigen Beisitzern bewacht wird, dann wäre das allgemeine Wahlrecht nur eine leere Zeremonie und käme dem regelmäßig erneuerten Rücktritt des souveränen Volks gleich, so müsste man zugeben. Zu Recht würde das Volk sich von derartigen Wahlen fernhalten; man sollte demnach nicht seine Gleichgültigkeit anklagen, sondern seinen gesunden Menschenverstand loben.» 48
«Das allgemeine Wahlrecht, sage ich, setzt für seine freie und vollständige Ausübung ein Land voraus, das durch seine natürlichen Gruppen strukturiert ist: Provinzen oder Regionen, Kommunen, Kantone, Gemeinden und Körperschaften usw. Das Ergebnis der Abstimmung ist der vielfältige und zusammengefasste Gedanke, der von diesen Kollektiven zum Ausdruck gebracht wird; sie sind dazu aufgerufen, sich ihren jeweiligen Interessen entsprechend zu äußern. Dies ist von äußerster Wichtigkeit. Hieraus ergibt sich, dass auch in dieser Hinsicht die Organisation der Gesellschaft, sowohl von ihrer politischen als auch von ihrer wirtschaftlichen Ordnung her gesehen, vollständig im allgemeinen Wahlrecht gegeben ist, eine Organisation, die nichts Utopisches oder Willkürliches an sich hat, da sie sich aus der Natur der Dinge ableitet, nicht aus eitlen akademischen Spekulationen, aus dem Belieben der Massen oder aus der Entscheidung eines zentralstaatlichen Parlaments. Das allgemeine Wahlrecht mit den vernünftigen Wahlkreisen ist — warum sollten wir das nicht zugeben? — nicht nur eine politische, sondern überdies eine wirtschaftliche Revolution, wie sie Freiheit,