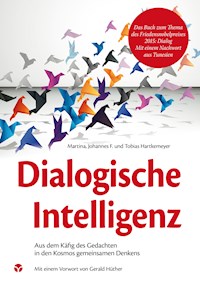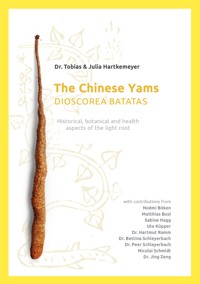Martina, Johannes F. und Tobias Hartkemeyer
Dialogische Intelligenz
Aus dem Käfig des Gedachten in den Kosmos gemeinsamen Denkens
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet überhttp://dnb.ddb.deabrufbar.
ISBN (E-Book) 978-3-924391-91-1
ISBN (Print) 978-3-95779-033-0
Epub der dritten Auflage 2018
© 2015 Info3-Verlagsgesellschaft Brüll & Heisterkamp KG, Frankfurt am Main
E-Book-Konvertierung: de·te·pe, Aalen
Inhalt
Vorwort
Einleitung
1. Von der Fragmentierung des Denkens zum Potential des Dialogs
Der Feind ein Mensch? – 24. Dezember 1914
Bubers Ahnung
Bohms Defragmentierung
Den Blick weiten – das Potential des Dialogs
Wie bestimmt unsere Wahrnehmung unsere Welt?
Paradoxien und Fragmentierung des Denkens erkennen
Weltbild-Gymnastik
2. Der Dialog – Grundlage demokratischen Denkens
Der mühsame Weg aus der Höhle der Unmündigkeit
„Umständliche“ Palaver
Agora und Ubuntu
Die Dialogkultur des Irokesenbundes
Dialog und Diskurs in philosophischen Theorien
Der Diskurs nach Habermas
Der Diskurs nach Foucault
„Philosoph ist jeder, der eine wirkliche Frage stellen kann“
Ein Gespräch mit Hans-Georg Gadamer
„Ich glaube an die Kraft des Dialogs“ – Ein Gespräch mit Edgar Morin
Verstehen ist nicht Verständnis
4. Dem Geist eine Form geben – form follows function
Entwicklung von Form und Vereinbarung
Kreative Hirnfrequenz durch Verlangsamung
Formen des Dialogs
Wirkungen
Dialogprozess-Begleitung
Sich selbst vergessen
5. Ein Kompass im Reich des Nicht-Wissens
Licht und Last der Aufklärung
Die Welt als Objekt unserer Methoden?
Zwischen Lernen und Wissen – die Landkarte des Nicht-Wissens
Forschungsfragen für die Landkarte im Reich des Nichtwissens
Dialogische Prozesse in komplexen Systemen
„Am Rande des Chaos sind wir am kreativsten“ – Ein Gespräch mit Brian Goodwin
6. Pädagogische Haltegriffe in der Landschaft des Lernens
Dialog als ein Weg zur Freiheit des Denkens
Lernende Haltung
Radikaler Respekt
Von Herzen sprechen
Generatives Zuhören
Momos Zuhören
Annahmen und Bewertungen suspendieren
Erkunden
Produktiv plädieren
Eine unschuldige Frage: Parzivals Dilemma
Offenheit
Verlangsamung
Die Beobachterin beobachten
Beziehung der dialogischen Kernfähigkeiten
Die „Leiter der Schlussfolgerungen“
Die zehn Kernfähigkeiten auf einen Blick
Der sichere Weg aus der Dialogfalle – Versuch einer paradoxen Intervention
7. Was macht der Geist im Körper?
Über das Potenzial des Herzens – Ein Gespräch mit Jorge Reynolds
Wie unser Denken Körper und Gene verändert
„Wir brauchen bewussten Dialog zwischen Körper, Geist und Seele“ – Ein Gespräch mit Ernest L. Rossi
8. Mit Parzival und Artus auf dem Weg
Dialog und Organisationsentwicklung
Eine persönliche Suche nach ganzheitlichem Denken
Kindliche Verbundenheit und die Erfahrung der Fragmentierung
Die Subjekt-Objekt-Spaltung und die Fragmentierung der Welt
Die gemeinsame Grundstruktur von Geist und Materie
Sich selbst zum Ausgangspunkt machen
Innere Klarheit Schaffen – Personal Mastery und die Nebenübungen Rudolf Steiners
Dialogische Intelligenz – ein Ausblick
Danke!
Nachwort von Mohamed Adel Mtimet: Ein Tag der Freude und der Hoffnung für den Dialog
Zur Verleihung des Friedensnobelpreises 2015 an das Dialog-Quartett in Tunesien
Literatur
Abbildungsverzeichnis
Seminare und Ausbildungen für Dialogprozess-Begleitung
Über die Autoren
Vorwort
Mit Hilfe unseres hochentwickelten Gehirns sind wir Menschen so gut wie keine andere Spezies in der Lage, vorausschauend zu denken, Wissen und Erfahrungen zu sammeln und Zusammenhänge aus unseren Beobachtungen abzuleiten. Wir können die hinter der Oberfläche wahrgenommenen Phänomene, verborgenen Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten erkennen und eigene Vorstellungen darüber entwickeln, worauf es im Leben ankommt, wie wir uns mit dem, was uns umgibt, in Beziehung setzen, wer wir sind und wie wir leben wollen. Diese außergewöhnlichen Fähigkeiten, also diese typisch menschliche Form von Intelligenz, so denken die meisten Menschen bis heute, verdanken wir der enormen Komplexität unseres Gehirns. Deshalb halten wir manche Menschen für intelligenter als andere, wir glauben, diese Fähigkeit sei in deren Genen verankert und haben im letzten Jahrhundert Verfahren entwickelt, um den Intelligenzquotienten eines einzelnen Menschen zu messen und ihn danach als mehr oder weniger intelligent zu bewerten.
Aber wir Menschen hören ja nicht auf, neues Wissen zu erwerben, neue Zusammenhänge zu erkennen. Deshalb ist es bisweilen ebenso schmerzhaft wie unvermeidlich, dass sich unsere einmal anhand des damaligen Erkenntnisstandes gewonnene Vorstellungen über kurz oder lang als unvollständig, unzutreffend oder gar irreführend erweisen.
Ausgelöst werden solche Infragestellungen des bisher für richtig Gehaltenen durch neue Erkenntnisse, zu denen einzelne Wissenschaftsdisziplinen, meist durch die Einführung neuer Messverfahren beitragen. In der Hirnforschung ist das in den letzten Jahrzehnten geschehen. Aus ihren neuen Erkenntnissen haben die Hirnforscher Vorstellungen abgeleitet, die sich inzwischen immer weiter ausbreiten und vieles in Frage stellen, was wir bisher geglaubt und zur Grundlage unseres Handelns, auch der Art unseres Zusammenlebens gemacht hatten: Genetisch verfügt jeder Mensch nur über das Potential, hochkomplexe Vernetzungen der Nervenzellen in seinem Gehirn herauszubilden und zu stabilisieren. Ob und in welchem Umfang es dem Einzelnen gelingt, dieses Potential auch zu entfalten, hängt von den Erfahrungen ab, die sie oder er zum Teil schon vorgeburtlich im Mutterleib, als Kleinkind in seiner Herkunftsfamilie, als Heranwachsender, in der Schule und sonstigen Bildungseinrichtungen und später, als Erwachsener zu manchen Gelegenheiten macht oder leider allzu oft auch machen muss. Und all diese Erfahrungen machen Menschen primär in ihrer Beziehung zu anderen Menschen. Ihr Gehirn wird also in viel stärkerem Maß als bisher angenommen durch Beziehungserfahrungen mit anderen strukturiert, es ist also ein soziales Konstrukt. Und weil jeder dabei andere Erfahrungen macht, bekommt er auch ein einzigartiges Gehirn, und das hat sich dann auch zwangsläufig so strukturiert, dass er sich damit so gut es nur immer möglich war in seiner jeweiligen Lebenswelt zurechtgefunden hat und meist auch weiterhin einigermaßen zurechtfindet.
Ohne den Austausch mit anderen Menschen wäre kein Kind überlebensfähig und hätte nichts von all dem gelernt, was er oder sie heute kann und weiß.
Aus dieser Erkenntnis lässt sich nur eines ableiten: Intelligenz erweist sich bei genauerer Betrachtung gar nicht als eine individuelle Fähigkeit, sondern ist immer das Ergebnis des Austausches von Wissen und Erfahrungen mit anderen Menschen. Wir sind also auf diesen Austausch angewiesen. Wenn er nicht funktioniert, verblöden wir kollektiv. Und er funktioniert eben nicht, er kann nicht funktionieren, solang sich einer für klüger und intelligenter hält als alle anderen und den anderen vorzuschreiben versucht, wie sie was zu denken, was sie, auch in Gedanken zu tun und zu lassen haben. Oder, mit anderen Worten, solange Menschen einander zu Objekten ihrer Belehrungen, ihrer Vorstellungen, ihrer Bewertungen oder gar ihrer Maßnahmen machen. Wir leben aber gegenwärtig noch in einer Welt, in der das Denken, Fühlen und Handeln der meisten Menschen durch die überholten Vorstellungen aus dem vorigen Jahrhundert geprägt sind. Wie kann es gelingen, dass sich künftig immer mehr Menschen auf einen solchen Austausch, auf eine Begegnung von Subjekt zu Subjekt einlassen? Ja mehr noch, nicht nur einlassen, sondern es als Bereicherung erleben und es mit Freude versuchen? In diesem Zusammenhang freut es mich besonders, dass der Dialogprozess in Tunesien mit dem Friedensnobelpreis 2015 ausgezeichnet wurde. Es zeigt sich, dass Dialogische Intelligenz die Kraft besitzt, die besten Potentiale des Menschen zu wecken.
Damit bin ich nun auch endlich bei diesem Buch von Johannes, Martina und Tobias Hartkemeyer angekommen. Denn was sie hier in leicht verständlicher und ebenso überzeugender wie praktisch umsetzbarer Weise zusammengetragen haben, ist nichts anderes als eine liebevolle Einladung und eine sehr gut begründete Ermutigung, es zunächst einmal einfach nur zu versuchen. Nur dort, wo Menschen miteinander in einen bewussten Dialog eintreten und ihre unterschiedlichen Erfahrungen, ihr jeweiliges Wissen und Können und auch ihre voneinander abweichenden Erkenntnisse, Vorstellungen und Überzeugungen austauschen, können auch für alle Beteiligten neue Sichtweisen entstehen und Perspektiven erweitert werden. In Konfliktsituationen bestehen bessere Chancen, auf diese Weise annehmbare und zwangsläufig auch nachhaltige Lösungen zu finden. Und je verschiedener der Schatz an individuell gemachten Erfahrungen ist, der auf diese Weise von Menschen geteilt wird, desto allgemeingültiger werden auch die aus einem solchen Dialog gewonnenen Erkenntnisse. Aber lesen Sie selbst, ich bin sicher, Sie bekommen dann Lust, es einfach auszuprobieren.
Gerald Hüther
Einleitung
Fragen Sie sich manchmal auch, wie man sich angesichts der flirrenden Meinungen, gegensätzlichen Kommentare, unterschiedlichen Stellungnahmen, unbefriedigenden Gespräche ein tragfähiges Bild von unserer Welt machen kann? Denken Sie manchmal darüber nach, welche Zukunft unseren Kindern angesichts der Zunahme der weltweiten Konflikte und Katastrophenszenarios bevor steht? Sehnen Sie sich manchmal auch nach wirklich ernsthaften Gesprächen, wo wir uns gegenseitig mit neuen Ideen befruchten?
Immer mehr Menschen setzen sich mit diesen Fragen auseinander. Es scheint so, dass wir eine neuedialogische Intelligenzbrauchen. Eine Intelligenz, die unsere menschlichen Möglichkeiten besser entfalten kann. Denn fast alle Probleme, mit denen wir heute umgehen müssen, sind Folgen der Problemlösungen von gestern. Wir können aber, wie Einstein sagte, unsere heutigen Probleme nicht mit dem gleichen Denken zu lösen versuchen, das sie geschaffen hat.
Der Dialog, hier verstanden als eine freie Form systemischer Entfaltung von Intelligenz in Gruppen, Familien oder Organisationen, also in und zwischen Menschen, ist das Thema dieses Buches. Unsere bisherigen VeröffentlichungenDas Geheimnis des DialogsundDie Kunst des Dialogs, die eng mit unserer praktischen Dialogarbeit zu tun haben, sind nach teilweise mehreren Auflagen sowie Übersetzungen vergriffen.
Mittlerweile hat sich aber ein vielfältiges Netz von Dialoginitiativen entwickelt, die in verschiedenen Organisationen, Projekten, Unternehmen oder Verwaltungen aktiv geworden sind und eine Idee und auch eine Erfahrung davon vermitteln, wie wir anders miteinander umgehen können. Etliche Ausbildungen zur Dialogprozess-Begleitung haben Menschen aus den verschiedensten Berufsgruppen motiviert, eigenverantwortlich tätig zu werden, um neue Denk- und Beziehungsqualitäten zu vermitteln.
Der Dialog ist eine, wie wir zeigen werden, ursprüngliche Form der Entwicklung von Gruppenintelligenz und Entscheidungsfindung in der Geschichte der Menschheit. Aufgegriffen und weiterentwickelt wurde diese Form nicht nur von Dialogikern wie Martin Buber, sondern auch von Quantenphysikern wie David Bohm. Unter anderem haben die Forschungen am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston einen weiteren Impuls gegeben, den Dialog in der Organisationsentwicklung zu verankern und ihn von der Diskussion zu unterscheiden. Die Großgruppenforschung, aber auch die moderne Hirnforschung zeigen, dass der Dialog ein ideales natürliches Verfahren ist, sowohl der Arbeitsweise unseres Gehirns besser zu entsprechen, als auch den ganzen Körper zu umfassen. Dieses zeigen in überzeugender Weise mehrere Beiträge in diesem Buch auf. Im Dialog liegt die Chance nicht nur Denkprozesse zu erweitern und Gruppenprozesse zu qualifizieren, sondern auch einen Beitrag zur psycho-physiologischen Gesundheit zu liefern. Angesichts der zunehmenden Fragen von Menschen nach dem Sinn ihres Daseins und dem massenhaften Burn-Out-Phänomen ist das keine zu unterschätzende Wirkung.
Die feminin-maskulin Formulierungen sind in diesem Buch nicht einheitlich gehandhabt. Um unsere Leserinnen und Leser in einer kreativen Spannung zu halten, wechseln wir die männliche und weibliche Schreibweise.
Dieses Buch will einen Beitrag bieten, geschöpft aus den Erfahrungen mit dem Dialog in zahlreichen Projekten in Form einer Weiterentwicklung unserer bisherigen Grundlagenbücher.
Dieses Buch erscheint in der neuen Reihe als Gemeinschaftsprojekt von:
• Deutsches Institut für Dialogprozess-Begleitung, Bramsche (D) (www.dialogprojekt.de)
• Institut Dialog Transnational, Berlin (D) (www.dialog-transnational.eu)
• Im Dialog e.V. – Verein für dialogische Lern-, Lebens- und Beziehungskultur, Dortmund (D) (www.im-dialog-ev.de)
• Gedankenwerk e.V., Partizipation fördern, Potenziale stärken, Perspektiven entdecken, Essen (D) (www.gedankenwerk.ruhr)
• Dialogprojekt Arbogast, Götzis (A) (www.arbogast.at)
• European Network for Dialogue Facilitation (www.dialogue-facilitators.eu)
• Dialogschmiede e.V., Stuttgart
• Dialogzentrum Hamburg (www.dialogzentrumhamburg.de)
„Mit der zwischenmenschlichen Kommunikation steht es schon seit langem nicht zum Besten und Dialog bezieht sich auf diese Tatsache. Hauptbedeutung und Zielsetzung des Dialogisierens liegt aber nicht vorrangig in einer Verbesserung der zwischenmenschlichen Kommunikation. Dialog zielt viel tiefer: Er lenkt unsere Aufmerksamkeit direkt auf vorhandene Kommunikationsblockaden; er bemüht sich weniger um deren begriffliches Verständnis, sondern er geht vielmehr direkt auf diese los. Er zielt auf eine unmittelbare Wahrnehmung gegebener Kommunikationswiderstände. Im Dialog zeigen wir die Bereitschaft, ernsthaft all jene Lebensthemen zu erörtern, die uns große Schwierigkeiten machen.“ (David Bohm)
Es hat kein Licht geregnet
Es hat seit Tagen kein Licht geregnet
Die Brunnen in vielen Augen
Sind von der Dürre gequält.
Deshalb sind Freunde
Nicht leicht zu finden
In dieser Öde.
Wo fast jeder krank geworden ist
Vom eifersüchtigen Betrachten
Des Nichts.
Auf dieser Karawane
Durch glühende Wüstenhitze
Können Karrieren und Städte real erscheinen.
Aber ich sage denen, die mir nahe stehen:
„Geht nicht in ihnen verloren,
Es hat dort seit Tagen kein Licht geregnet.
Schaut, fast jeder ist erkrankt
Vom Lieben
Des Nichts.“
1. Von der Fragmentierung des Denkens zum Potential des Dialogs
Der Feind ein Mensch? – 24. Dezember 1914
Ypern, 24. Dezember 1914. Morgengrauen. Endlich hatte der eiskalte Dauerregen aufgehört. Stille. Von fern einige Schüsse. MG Schütze Franz Meyer vom Sächsischen Jägerbataillon Nummer sechs nahm sein Scherenfernrohr und suchte die britischen Linien ab. Die Royal Welsh Fusiliers lagen nur etwa 80 Meter weiter im Westen in den Gräben. Ihre Scharfschützen waren so aufmerksam, dass er seine Pickelhaube gegen ein Käppi ausgetauscht hatte.
Der Scheißbrite! Nur etwa zehn Meter vor ihm hing er schon seit Wochen im Stacheldrahtverhau. Seine Hand wie zum Gruß erhoben. Der Gestank bestialisch. Wann waren die Ratten endlich fertig? Aber die hatten zu viel zum Fressen. Was stand noch in weißen Lettern an den Zügen, die sie zur Front brachten?
„Jeder Tritt ein Britt!“ „Jeder Stoß ein Franzos!“ „Jeder Schuss einRuss!“ „Serbien muss sterbien!“
Meyer nahm fröstelnd seine Schnupftabakdose aus der Manteltasche. Wie viele hundert Male hatte er schon das abgegriffene Bild in den Fingern gehabt. Seine Frau Anna, seine Kinder Theo und Sophie, drei und fünf Jahre alt. Weihnachten! Mit einem weihnachtlichen Gruß hatte die Oberste Heeresleitung ausklappbare Weihnachtsbäume und Kerzen an die Front geschickt. „Die stellen wir heute Nacht auf, wenn die Briten still sind“, hieß es unter den Kameraden. Bedenken wurden weggewischt. Die wissen doch sowieso, wo unsere Linien sind.
Eiskalte Nacht. Klarer Sternenhimmel. Vollmond. Die Kerzen leuchten wie eine Perlenkette über den deutschen Linien. Irgendwer stimmt an: „Stille Nacht, heilige Nacht.“ Nach und nach folgen tausend raue Männerstimmen. „Es ist ein Ros entsprungen.“
In den britischen Stellungen bleibt es verdächtig ruhig. Eine Minute nach dem letzten Ton ertönt erst zaghaftes, dann ein massenhaftes Klatschen: „Good, old Fritz!“ Und: „More, more.“
Die „Fritzen“, sonst auch gern „Hunnen“ genannt, versuchen so gut es ging ein „Merry Christmas Englishmen“, ergänzt durch „we not shoot, you not shoot!“ von MG Schütze Meyer.
Die Hunnen scheinen es ernst zu meinen. Franz verlässt seine Sandsackstellung und schwingt sich auf die Brustwehr. Kein Schuss. Das Niemandsland in vollem Licht der Gestirne. Überall Bewegung. Briten und Deutsche, zunächst verunsichert ob der völlig wundersamen Situation, kommen aus ihren Gräben und Löchern. Franz voran.
Ein britischer Soldat läuft ihm entgegen. Glitzert eine Träne in seinem Auge? „I am John“. „My Brother“ er weist auf den Toten im Stacheldraht. Gemeinsam versuchen sie vorsichtig seine Überreste aus dem Stacheldrahtverhau zu bergen. John fingert ein vergilbtes Foto mit seinem Bruder Frank und seinen Eltern aus der Brusttasche. Auch Franz öffnet seine Tabaksdose. Sie nehmen sich in den Arm…
Im Wahnsinn des Stellungskrieges gab es im ersten Weltkrieg diese besondere Situation, in der Menschen sich verweigerten und ausstiegen aus der verordneten Hysterie. Weihnachten 1914 geschah dieser Augenblick des Innehaltens, der uns zeigt: Es ist auch unter extremsten Bedingungen möglich, anzuhalten und zurückzutreten von dem verordneten Bild und sich grundsätzliche Fragen, wie wir in der Welt sein wollen, neu zu stellen.
Ein hunderttausendfaches Wunder an Weihnachten 1914 in verschiedenen Frontabschnitten. Keine deutsche Zeitung berichtete. Eine extrem gefährliche Fraternisation, urteilte die deutsche Heeresleitung. Die Truppen müssten sofort ausgetauscht und an fremde Frontabschnitte verlegt werden! Stoßtruppeinsätze müssten die permanente Kampf bereitschaft aufrechterhalten!
Szenenwechsel:
Der Gefreite Adolf Hitler lag bei Wijschote in Stellung und war entsetzt über den seltsamen Weihnachtsfrieden. Seinen Kameraden Heinrich Luganer vom 16. bayerischen Reserve Infanterieregiment fuhr er an: „Es ist aufs Schärfste zu missbilligen, dass deutsche und britische Soldaten im Niemandsland sich die Hände reichen und miteinander Weihnachtslieder singen, anstatt auf einander zu schießen. So was darf in Kriegszeiten nicht passieren!“1
Die bewegenden Weihnachtsgeschichten an West- und Ostfront 1914 zeigen, dass auch in Zeiten aussichtslos erscheinender Unmenschlichkeit andere Optionen bestehen können. Sie umzusetzen braucht Mut, Vertrauen und das Verlassen von Denkschablonen, Hierarchien und Feindbildern, eine Begegnung von Mensch zu Mensch ist Voraussetzung.
Ein überlebender Zeitzeuge, Murdoch M. Wood sagte 1930 in einer Anhörung vor dem britischen Parlament: „Wenn es nach uns gegangen wäre, hätten die Soldaten niemals wieder zu den Waffen gegriffen.“
„Ich habe Angst, dass ich zu einer Figur werde!“
Fion, sechs Jahre, im ersten Schuljahr nach einigen Wochen Schulerfahrung
Zersplittert und fragmentiert in Nationen, Truppeneinheiten, Hierarchieebenen, Funktionsträger werden Menschen zu Figuren und Funktionen in einer von Macht und Ohnmacht getragenen Selbstzerstörungsmaschinerie degradiert. Und diese Zersplitterung kultiviert den „Blutrausch“, der immer wieder auch literarisch überhöht zu „Heldenmut“ ästhetisiert wird. Der bis in die bundesrepublikanische Zeit vergötterte Ernst Jünger schrieb in seinem BuchIn Stahlgewittern:„Ran! Kein Pardon. Wut. Aus Stollen Schüsse. Handgranaten rein. Geheul. Über den Damm. Einen am Hals. Hände hoch! Sprungweise hinter Feuerwalze vor. Melder. Kopfschuss. Sturm auf MG Nest. Mann hinter mir fällt. Schieße Richtschützen ins Auge. Handgranaten. Drin! Allein, Streifschuss, Wasser, Schokolade. Weiter. Einige fallen. Zwei Mann laufen zurück. Kopfschuss, Bauchschuss. Bin grimmig. Engländer fliehen aus Baracken, einer fällt. Stockung. Befehle Sturm gegen Dorfrand Brancourt. Volltreffer, Verluste, vor!“2
Was ist verrückt – was ist normal?
93 berühmte Ärzte, Naturwissenschaftler, Historiker, Dichter, Künstler und Geistliche verfassten 1914 einen flammenden Aufruf zum Krieg und begeisterten sich für den deutschen Militarismus. Einzig der pazifistische Außenseiter, der Herzspezialist Georg Friedrich Nicolai widersetzte sich. Mit einem Gegenaufruf an alle Europäer rief er zum Frieden und zu einem vereinten Europa auf. Er musste aus Deutschland flüchten und ihm wurde noch 1920 – angesichts der verheerenden Niederlage – einstimmig vom Senat der Berliner Universität wegen „Defätismus“ jede Lehrtätigkeit untersagt. Vielleicht war Nicolai ein Abweichler von psychopathologischem Ausmaß. „Aber,“ so schreibt Horst Eberhard Richter in seiner Autobiografie, „ich habe ohnehin gelernt, den landläufigen Begriff von Gesundheit in Zweifel zu ziehen.“ War Nicolai nicht „in einem höheren Sinn gesünder als die Masse der konfliktfrei Angepassten?“3
Bubers Ahnung
Martin Buber und einige weitere zunächst wache Zeitgenossen scheinen bereits vor dem Ersten Weltkrieg die Jahrhundertkatastrophe des massenhaften organisierten Abschlachtens auf dem christlich-abendländischen Kontinent geahnt zu haben. Sie trafen sich in einem unvoreingenommenen, neu zusammen gekommenen Kreis, um über mögliche Maßnahmen gegen den für sie bereits spürbaren Wahnsinn zu sprechen. Dieser ersehnte Dialogprozess hatte jedoch keine Chance mehr, sich wirksam zu entfalten.
Buber schreibt:4„Um Ostern 1914 trat, aus geistigen Vertretern einiger europäischer Völker zusammengesetzt, ein Kreis zu einer dreitägigen Beratung zusammen, die als Vorbesprechung gedacht war. Man wollte gemeinsam erwägen, wie etwa der von allen geahnten Katastrophe vorzubeugen wäre. Ohne dass man irgendwelche Modalitäten der Aussprache vorweg vereinbart hätte, waren alle Voraussetzungen des echten Gesprächs erfüllt. Von der ersten Stunde an herrschte Unmittelbarkeit zwischen allen, von denen manche einander eben erst kennen gelernt hatten, jeder sprach mit einer unerhörten Rückhaltlosigkeit, und offenbar war nicht ein einziger unter den Teilnehmern dem Scheine hörig. Ihrer Absicht nach muss man die Zusammenkunft als eine gescheiterte bezeichnen. ... Die Ironie der Situation wollte es, dass man die endgültige Besprechung auf Mitte August ansetzte, und der Weltgeschichte war es naturgemäß bald gelungen, den Kreis zu sprengen. Dennoch hat in aller Folge gewiss keiner der damals Versammelten bezweifelt, dass er an einem Triumph des Zwischenmenschlichen teilgenommen hatte.“
Doch die Wucht der Kriegspropaganda ergriff damals auch die „Elite“ der deutschen Feingeister. Selbst Rilke fiel herein auf den kaiserlichen Ruf „Ich kenne keine Parteien mehr – ich kenne nur noch Deutsche“. Und Martin Buber war offenbar vom Krieg zunächst ergriffen und schrieb dann doch 1914 vom Krieg als einer
„Reinigung des Geistes“ und von „leuchtenden Wunden“ – was er später gerne unterschlug. Allgemeine Losungen wie die von Kaiser Wilhelm, er kenne keine Parteien mehr, sondern „nur noch Deutsche“ sollten gegen die Nationen gewendet werden, um das sozialistische Motto „Proletarier aller Länder vereinigt euch“ aushebeln.
Können wir heute verstehen, dass sich Menschen wie Rilke und Buber begeistert über die reinigende Kraft des Krieges äußerten? Und erst 1916, als das grauenhafte Abschlachten nicht mehr zu beschönigen war, auf Distanz zu ihrer eigenen Euphorie gingen?
Aber wähnen wir uns heute nicht so sehr aufgeklärt: Die Medien-Kommentare zur Ukrainekrise haben uns erschreckend deutlich gezeigt, wie schnell eine Stimmung unreflektiert umschwenken kann.
Bohms Defragmentierung
Ein anderer Vater des Dialogs, David Bohm, führte eine der Hauptursachen, die den Menschen an einem unvoreingenommenen Dialog hindern, auf die Fragmentierung im Denken zurück: „Es ist das Denken, dass alles zerteilt und aufspaltet. Jede Teilung, die wir vornehmen, ist das Resultat unserer Denkweise. In Wirklichkeit besteht die ganze Welt aus ineinanderfließenden Übergängen. Aber wir wählen bestimmte Dinge aus und trennen sie von anderen, zunächst aus Bequemlichkeit. Später messen wir dann der erfolgten Unterscheidung große Bedeutung bei. Wir bilden separate Nationen, die gänzlich ein Resultat unseres Denkens sind, ebenso wie die Trennung in verschiedene Religionen … Die Fragmentierung ist eine der Schwierigkeiten des Denkens, aber die Wurzeln liegen tiefer. Das Denken ist sehr aktiv. Der Denkprozess denkt, dass er gar nichts tut, sondern nur mitteilt wie die Dinge eben sind … vielleicht wissen wir gar nicht, was es heißt, dem Denken unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Unsere Kultur ist nicht fähig, uns dabei zu unterstützen, wie auch kaum eine andere Kultur, und dennoch ist es von entscheidender Bedeutung. Vom Denken hängt alles ab – wenn das Denken fehlgeht, werden wir alles falsch machen. Aber wir sind so gewöhnt daran, das Denken als selbstverständlich hinzunehmen, dass wir es überhaupt nicht beachten … Nicht Ereignisse wie Krieg, Kriminalität, Drogen, wirtschaftliches Chaos oder Umweltverschmutzung, mit denen wir konfrontiert werden, machen die wahre Krise aus, sondern das Denken, was sie verursacht, und zwar unentwegt …“5
Den Blick weiten – das Potential des Dialogs
Haben Sie sich schon einmal in einer Sackgasse befunden, in einer Situation, in der Sie überrascht feststellten, dass sie mit Ihrer alten, langjährig bewährten Strategie nicht mehr weiter kamen? Wo Sie irritiert waren, die Welt nicht mehr verstanden – oder zumindest Ihrem Gegenüber gedanklich gar nicht mehr folgen konnten? Das Gute an solchen verfahrenen Situationen ist: Wenn die alten Konzepte nicht mehr zu dem gewünschten Erfolg führen, können sie uns für Neues öffnen.
Zielorientiert, schnell, auf Gewinnen orientiert – so argumentieren wir in Diskussionen, wenn es eben darum geht, das Gegenüber zu überzeugen oder durch die besseren Argumente vor einem Publikum zu gewinnen, qualifizierter zu erscheinen und durch Wissen zu überzeugen. In einer Situation, in der es aber gar nicht um Gewinnen oder Verlieren geht, sondern in der ein besseres Verstehen des Konfliktes notwendig ist, sind grundlegend andere, dialogische Qualitäten gefragt: Dem Gegenüber zuhören, um ein wirkliches, tieferes Verständnis zu ermöglichen, und auch in mich selbst hineinhorchen, mir über meine eigenen Gefühle, Bedürfnisse und Denkschablonen klar werden. Also meinen Blick zu weiten, anstatt ihn zielorientiert zu verengen. Solch ein Dialog bedeutet auch den Verzicht auf Machtpositionen und basiert auf gleicher Augenhöhe zwischen den Beteiligten.
Szene aus dem Irakkrieg – GIs mit einem gefangenen Iraker. Verschiedene Wahrnehmungs- und Interpretationswelten entstehen aus einem Bild, je nach Ausschnitt.
Wie bestimmt unsere Wahrnehmung unsere Welt?
Meine Wahrnehmungs- und Interpretationskonzepte der Welt stelle ich gemeinhin nicht in Frage, solange sie sich bewähren oder solange ich mich mit ihnen wohl fühle. Manchmal führen allerdings auch Änderungen äußerer Umstände oder kritische Lebensereignisse zu Veränderungen meiner Wahrnehmung.
Wann sind Sie das letzte Mal im Wald spazieren gegangen? Haben das Rauschen des Windes in den Bäumen gehört, das Leuchten der Blätter im Sonnenlicht genossen, die Strahlen der Sonne, die zwischen dicken Baumstämmen hervor schien, kurz: den Wald als Wanderer erlebt? Waren Sie auch schon einmal im Wald, um dort Holz für Ihre Heizung zu hacken? Um tote Bäume zu fällen, vom Sturm abgebrochene Stämme zu zersägen, zerborstene Kronen zu zerteilen, sich mit Brennholz zu versorgen?
Wir Autoren leben auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, zu dem schon immer einige Hektar Wald gehörten. Durch Änderungen der Besitzverhältnisse in der Nachbarschaft bekamen wir die Gelegenheit, einige an unseren Hof angrenzende Hektar Wald zu erwerben. Zu dieser Zeit waren wir auch auf der Suche nach regenerativen Heizmöglichkeiten. Zu Zeiten des Golfkrieges wollten wir uns weiter vom Öl unabhängig machen – 1980 hatte Johannes das erste Windrad im Landkreis konstruiert, mit dem wir das Wasser für unsere Fußbodenheizung erwärmten – jetzt war eine Holzhackschnitzel-Heizung installiert und alle Wohnungen auf dem Hof wurden mit Holz beheizt.
Schon seit vielen Jahren kannten wir das Waldstück, das wir gekauft hatten, waren dort schon oft spazieren gegangen und hatten dieses Fleckchen Natur genossen. Nun aber gingen wir dort anders vorbei, nicht als Erholung suchende Spaziergänger, sondern wir schauten uns die Bäume daraufhin an, wie sie gewachsen waren, wie und wo sie standen. Würde diese Kiefer die Eiche daneben langfristig zu stark beschatten? Müssten wir nicht die Birke dort fällen, damit die Buche gerade wachsen könnte? Welche würde sich besser entwickeln? Der alten Kiefer war beim letzten Sturm die Krone abgebrochen, sie würde bald absterben, und die tote Eiche trug schon länger kein einziges grünes Blatt mehr – optimal für den Holz-Schnitzler.
Nicht der Wald hatte sich also geändert, sondern unser Blick auf ihn, unser „mentales Modell“ vom Wald war ein anderes geworden. Normalerweise bemerken wir solche inneren Brillen nicht, mit denen wir die Welt betrachten. Wie wir selbst die Welt ansehen, scheint uns der einzig mögliche Blickwinkel. Andere Perspektiven können aber eine ebensolche Berechtigung haben wie die unsere.
Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, wir sehen sie, wie wir sind.
Die größte Herausforderung für uns ist die Identifikation mit unserer inneren – unsichtbaren, un-spürbaren – Brille, mit unseren eigenen mentalen Modellen, Urteilen und Bewertungen, die unseren Blick bestimmt, einschränkt und dem Dialog nicht förderlich ist. Je mehr wir erkennen, dass dieser Blick in die Welt uns begrenzt, umso wacher können wir für unser Gegenüber, für andere Bilder der Welt werden.