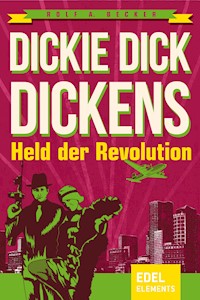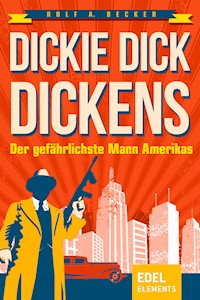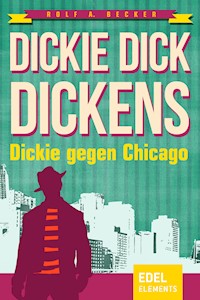WILLKOMMEN, SEÑOR DICKENS!
Dies ist die Geschichte von Dickie Dick Dickens, dem seinerzeit gefährlichsten Manne der Vereinigten Staaten von Amerika, Dickie Dick Dickens, dem sagenumwobenen Übergauner, dem Sturmdränger der internationalen Verbrecherelite.
Eine Geschichte, ebenso erstaunlich wie unglaublich, verwirrend und überraschend. Dies vor allem deswegen, weil es zu der Zeit, da die Geschichte spielt - die Mitte der berauschenden zwanziger Jahre - durchaus ungewiß war, ob Dickie Dick Dickens überhaupt noch lebte.
Mit einer glanzvollen Aktion war es ihm gelungen, sich und die Seinen dem Zugriff der gesamten in Alarmbereitschaft versetzten amerikanischen Polizeikräfte zu entziehen. Es hieß, er und seine Getreuen hätten an Bord eines irischen Walfangschiffes das Weite der Ozeane gesucht.
War es Gerücht? War es Wahrheit? Keiner vermochte es zu sagen.
Doch eines offenbarte sich in betrüblicher Klarheit: Chicago, die schimmernde Millionenstadt, Juwel am Michigansee, Heimstatt kunstvollsten Verbrechertums, entbehrte des Glanzes seiner berühmtesten Persönlichkeit.
Chicago ohne Dickie Dick Dickens? Ein Paradoxon, ein Vogel ohne Flügel, ein Klavier ohne Saiten. Chicago ohne Dickie Dick Dickens? Ein ungewöhnlich traurig stimmendes Bild.
Doch, ach, wie vergesslich ist die Welt!
Nach seinem Verschwinden in Richtung der sieben Meere lebte er noch eine geraume Weile in den Herzen der Chicagoer Bürger sowie in den Schlagzeilen der Zeitungen.
»Dickie Dick Dickens auf den Ozean entführt« hieß es einmal, »Dickie Dick Dickens kreuzt vor Madagaskar« ein
anderes Mal, und schließlich: »Dickie Dick Dickens fängt Riesenwal!«
Doch dann wurden die Nachrichten spärlicher. Die Zeitungsleute bekamen gerührte Stimmen, wenn sie von ihm sprachen. »Wer«, so sagten sie, »hat uns so unermüdlich, tagein, tagaus, nachtein, nachtaus Schreibstoff geliefert?« Und sie beschlossen, ihm die Treue zu halten.
»Dickie Dick Dickens in Seenot« schrieben die einen, »Die Oak-Hoak-Moah1 im Orkan gekentert« die anderen.
Die Leser indessen waren damit nicht recht in Bann zu schlagen. Doch die Zeitungsleute gaben noch nicht auf. Man schrecke, scheuche, hetze den Leser, war ihre Devise, man randaliere mit fetten Buchstaben vor seinen Augen herum und gebe ihm sein täglich Quentlein Panik! So vermeldeten die Zeitungen, die Oak-Hoak-Moah sei von einer Feuersbrunst verzehrt, mit einem Eisberg kollidiert und vor den Hebriden auf Grund gelaufen. Doch die Nachrichten verrauschten im Blätterwald.
Bis eines Morgens in roten Buchstaben in allen Gazetten zu lesen stand:
»DICKIE DICK DICKENS TOT«
Die Bürger lasen es, fanden, dass dies eine Gelegenheit zum Aufatmen sei, falteten die Zeitung zusammen und seufzten. Und dann wurde es still um Dickie Dick Dickens. Er, der einst ganz Chicago in Atem gehalten hatte, war kein Schrecken mehr. Das machte ihn druckunreif.
Indessen stampfte die Oak-Hoak-Moah durch die aufgewühlte See. Weder war sie gekentert, noch auf Grund gelaufen, noch mit einem Eisberg kollidiert. Das einzige, was an Bord hin und wieder Panik verursachte, waren die Launen von Margaret Poltingbrook, dem einzigen weiblichen Walfangkapitän der Welt, die Dickie Dick Dickens und seine Getreuen zu langer Kreuzfahrt eingeladen hatte.
Seine Getreuen - das waren Effi Marconi, die liebsteste Liebste, Opa Crackle, väterlicher Altgangster mit antikem Kuchenzahn, und Bonco, der rosige Schloh, Zartgauner nach Vielermanns Herzen.
Sie also waren in See gestochen. Und ihre Gründe waren diese: So wie sie ihre eigenen ihnen so kostbaren Personen vor dem Zugriff der Polizei bewahren wollten, so beabsichtigten sie, dies auch mit ihrem gesamten, in mühevoller Unterweltsarbeit ergaunertem Hab und Gut zu tun, Goldbarren im Werte von 300000 Dollar. Doch nutzten ihnen diese Goldbarren auf hoher See recht wenig, und Melancholie machte sich breit unter der kleinen, wackeren Schar. Wo man hinsah: glitschige Schiffsplanken, Matrosenbeine im Drillichzeug, Reling, Wasser. Alles war nass, kalt und stank, stank nach Tran, Öl, Teer, Männerschweiß und Alkohol.
»Was nützt uns unser ganzes Geld«, klagte Effi, »wenn wir es nirgends ausgeben können?«
»Und was nützt uns unsere ganze Freiheit«, jammerte Bonco, »wenn wir hier auf diesem lausigen Transtinker gefangen sind!«
Dickie, den Kopf in den Nacken gelegt, hörte die Beschwerden seiner Gefährten nur mit halber Aufmerksamkeit. Sein Geist war mit Größerem, Wichtigerem beschäftigt. Die Weite des Meeres beflügelte sein Denken.2
»Du hörst ja gar nicht zu!« protestierte Effi und tippte ihm mit ihrem wohlmanikürten Zeigefinger auf die Schulter.
»Was ist los?« fragte Dick.
»Zu Hause feiern sie bald Pfingsten. Narzissen und Tulpen blühen. In Long Beach beginnt die Badesaison. Wir sollten wirklich so bald wie möglich an Land gehen!«
»Aber wo, bitte? Hier im Polarmeer? Es ist nicht meine Schuld, dass ein Walfangschiff nicht in Long Beach anlegt.«
»Wir sollten«, sagte Effi mit Nachdruck, »die Oak-Hoak-Moah kaufen und selbst den Kurs bestimmen.«
»Oder«, mischte sich nun Opa Crackle ein, »wir überfallen die Mannschaft, jeder ein Gewehr und dann nichts wie drauf!«
»Oh nein«, widersprach Bonco und strich sich mit einer fahrigen Bewegung durchs rosa-blonde Haar, »Schießereien sind immer so laut. Wir nehmen uns lieber die Kapitänin vor. Wir beeinflussen sie mit magischen Kräften und zwingen sie, den Kurs zu fahren, den wir bestimmen.«
»Wie, zum Teufel, willst du das denn anstellen?« fragte Opa Crackle.
»Mit einem Zauberspruch«, lächelte Bonco versonnen. Er blickte aufs Meer hinaus und sagte in säuselndem Tonfall seinen Spruch auf:
»Ein Kilo Zimt, drei Körnchen Salz.
Bind ‘ einen Wollstrumpf um den Hals
und Koch den Zimt in Tinte gar!
Nun warte bis zum nächsten Jahr!
Wirfst du dann einen Frosch hinein,
wird jeder dir zu Willen sein.«
»Potzblitzdonnerkiel!« ertönte da eine röhrende Stimme mitten in Boncos Rezitat hinein. »Verdammte Lausegesellschaft! «
Es war Maggi Poltingbrook, die in ihrer ganzen majestätischen Fülle, breitbeinig, die Hände in die Hüften gestemmt, die Kapitänsmütze verwegen über das borstige Haar gestülpt, hinter Dickie und seinen Freunden stand.
»Die Oak-Hoak-Moah kaufen!« polterte sie weiter. »Die Mannschaft überfallen! Die Kapitänin verhexen! Man sollte euch tranchieren und eure Eingeweide den Kakerlaken zum Fraß vorwerfen!«
»Wir würden deinen Kakerlaken nur schwer im Magen liegen, Maggi«, gab Dick zu bedenken.
Diese wischte sich die Nase mit dem Handrücken. »Na, zum Glück werde ich euch sowieso bald los. Habe eben einen Funkspruch von meiner Reederei bekommen. Wir ändern unseren Kurs.«
Die vier Getreuen sahen sich aus erwartungsbangen Augen an.
»Und wo geht es nun hin?« lispelte Effi und bekam vor Aufregung eine Fistelstimme.
»Nach Irland«, rülpste Maggi ihr zu und sah sie aus schwimmenden Schweinsaugen an. »Aber dort kann ich nicht mit einer Ladung Leute ankommen, die von der amerikanischen Polizei gesucht werden!«
»Das heißt also?« fragte Dick.
»Aussteigen!« knallte ihm Maggi entgegen und spuckte hart an seinem Ohr vorbei über die Reling.
»Bitte, wo?« lächelte Dick höflich und sah beziehungsvoll auf die Wasserwüste.
»Südamerika ... Nordamerika ... das wird sich finden.«
»Amerika...«, hauchte Effi und bekam feuchte Augen.
Und Opa Crackle begann sofort, ‚The saints go marching in‘ zu pfeifen.
Auch Bonco freute sich: »Amerika, wo die Narzissen blühen! Schluss mit der Wasserwüste und dem Trangeruch!«
Dickie jedoch blickte sinnend vor sich hin. »Und am Kai«, sagte er düster, »steht ein Empfangskomitee von der Polizei. «
Aber auch diese Bemerkung vermochte nicht, die frohgemute Stimmung seiner Freunde zu dämpfen.
»Ach was!« lachte Effi. »Die haben uns längst vergessen.«
Und Bonco ließ sein blendend reines Gebiss glänzen und rezitierte:
»Wenn dir vor Polizisten bangt,
hast du es nur falsch angefangt.
Sie lassen dich stets ungeschoren,
bleibst pfiffig du und unverfroren.»3
In Chicago, der schimmernden Millionenstadt, riss man das Kalenderblatt des 16. Mai 1926 ab. Es war ein heller, fröhlicher Morgen, an dem alle Vögel zwitscherten, glattwangige, kleine Mädchen sich auf langen, schlanken Beinen einherwiegten wie die Blüten im Botanischen Garten, wenn der Frühlingswind weht, Mädchen, die lockend-kesse Blicke unter die Passanten warfen wie im fernen Deutschland der Karnevalsprinz Bonbons unter die Narren. Die Männer gingen aufrechter, hoben die Nasen und schnupperten den zärtlichen Hauch süßen Parfums, der die Stadt stärker zu durchziehen schien als alle Benzin-, Teer- und Staubgerüche.
Chefkommissar Lionel Mackenzie, 51, im Dienst der Kriminalpolizei zu jener roten Gesichtsfarbe gekommen, die ein guter Whisky und eine gehörige Portion Ärger vermittelt, saß in seinem Büro. Die Fenster waren weit geöffnet, und ein warmer Windhauch spielte mit den weißen Löckchen, die sich in einem anmutigen Rondell um das von Haaren gänzlich unbesiedelte Haupt des Chefkommissars gruppierten. Lionel Mackenzie, der den frohen Morgen auf seine Weise zu genießen gedachte, hatte sich just vorgenommen,
dem aus Brotteig geformten Schwan eine Schwänin beizugesellen, als sich die Tür öffnete und Samuel W. Brewster4 eintrat, seines Zeichens Bezirksstaatsanwalt und direkter Vorgesetzter von Mackenzie. Dieser liebte ihn nicht gerade innig, dafür hasste er ihn um so mehr und nannte ihn insgeheim einen ‚Tüchtebold‘, was zu seinen ärgsten Schimpfwörtern zählte. Auch heute sah er dem Eintretenden mit Unbehagen entgegen, denn er fürchtete, empfindlich in seiner wohlverdienten Ruhe gestört zu werden.
Mackenzie sollte recht haben. Der Bezirksstaatsanwalt zog sich einen Stuhl heran und lächelte ungestüm.
»Was denken Sie«, hob er an, »über Dickie Dick Dickens? «
Lionel Mackenzie rang nach Luft. »Ich denke gar nicht!« raunzte er. »Ich lehne ab! Dickens hat Amerika verlassen, und das war das beste, was er je getan hat! Solche Störenfriede können wir hier nicht gebrauchen.«
Brewster runzelte seine hohe, sommersprossenübersäte Stirn. »Wenn er aber nun zurückkommt?«
»Um Himmels Willen«, wehrte Mackenzie mit Emphase ab, »da gibt‘s nur einen Rat: kümmern wir uns nicht um ihn! Sie ahnen ja nicht, was dieser Mensch uns für Scherereien machen kann.«
»Wenn er zurückkommt«, sagte der Staatsanwalt sanft, »macht er Scherereien, ob wir uns um ihn kümmern oder nicht.«
»Man soll von den Leuten nicht immer gleich das Schlimmste denken«, murrte Mackenzie. Doch dann blickte er verwundert auf. »Wie kommen Sie überhaupt darauf?«
»Ich habe einen Tipp bekommen. Das Schiff, mit dem Dickie Dick Dickens in See gestochen sein soll, wurde von seiner Reederei nach Irland zurückbeordert. Ich denke, dass
es auf seiner Heimfahrt einen amerikanischen Hafen anlaufen wird, um Proviant aufzunehmen.«
Der Bezirksstaatsanwalt hielt die Luft an und beobachtete die Wirkung seiner Worte. Doch die war gleich Null. Mackenzie sog gleichmütig an seiner Zigarre.
»Denken Sie nicht«, fuhr Brewster fort und gab seiner Stimme jenen schneidenden Ton, den seine Frau und seine drei Freundinnen so an ihm liebten, »dass es an der Zeit ist, sofort sämtliche Hafenstädte zu alarmieren sowie prophylaktisch Auslieferungsanträge an alle süd- und mittelamerikanischen Länder zu stellen!?«
»Seien Sie vorsichtig!« ereiferte sich Lionel Mackenzie. »Was wollen Sie tun, wenn er dann wirklich ausgeliefert wird?«
Der Bezirksstaatsanwalt zog die Luft durch die Zähne und gab ein Zischen von sich, das dem einer wütenden Schlange glich. »Ich bestehe darauf!« fauchte er.
Mackenzie nickte ungerührt. »Sie werden erleben, was das für einen Schlamassel gibt. Aber sagen Sie nicht hinterher, ich hätte Sie nicht gewarnt!«
Brewster erhob sich. »Ihre Dienstauffassung«, näselte er, »lässt zu wünschen übrig, mein Lieber! Guten Morgen!«
Lionel Mackenzie antwortete nicht. Er war in zentnerschweres Nachdenken versunken.
Zur gleichen Stunde erhielt der Juwelier, Hehler und Inhaber eines Feudalclubs, Josua Benedikt Streubenguß, ein dringendes Telegramm:
»Bin zur Zeit mit meiner Freundin Maggi zum Angeln eingeladen. Fischfang wenig unterhaltsam. Habe Heimweh. Würde dich gerne besuchen, falls Onkel Lionel nichts dagegen hat. Erwarte dringend deine Antwort. Liebste Grüße, Tante Dixi.«
Josua Benedikt betrachtete das Telegramm und strich sich über den wohlparfümierten Kopf. Soweit ihm bekannt war, mangelte es ihm an Tanten.
Dieses Telegramm stammte ohne Zweifel von Dickie Dick Dickens. Er war also immer noch auf diesem Walfangschiff und wollte nun wissen, ob die Polizei die Fahndung nach ihm aufgehoben hatte. Onkel Lionel, der Chefkommissar würde sich schön bedanken für diese Verwandtschaft!
Josua Benedikt Streubenguß war ein Mann der schnellen, aber leisen Tat. So griff er denn zum Telefonhörer, wählte die Nummer der Polizei und ließ sich mit Chefkommissar Lionel Mackenzie verbinden.
»Guten Tag, mein lieber Chefkommissar«, säuselte er, »hier spricht Christian Nottelboom vom ‚Morning-Star‘. Wir kennen uns ja von neulich ... der alte Christian Nottelboom, ja. «
Lionel Mackenzie brummte etwas zur Antwort, das kein Mensch verstehen konnte und auch nicht sollte.
Schon aber säuselte Josua Benedikt in den zartesten Tönen weiter: »Ich möchte Sie um eine kleine Gefälligkeit bitten, Chefkommissar. Meine Zeitung bereitet einen Tatsachenbericht über die Chicagoer Unterwelt vor, mit dem Titel: ‚Hyänen der Großstadt‘«
»Entzückend!« murmelte Mackenzie am anderen Ende der Leitung. »Der Titel greift ans Herz.«
»Ja, nicht?« kicherte Streubenguß selbstgefällig, »ist auch von mir. Passen Sie auf, mein Guter: Ich sorge dafür, dass Ihr Name ganz groß herauskommt. Dafür geben Sie mir eine kleine Information, ist das nicht süß?«
»Wo fehlt ‘s Ihnen denn?«
»Ach«, schwabberte Josua Benedikt, ganz seine sonst so vornehme, gelangweilte Art verleugnend, »mir fehlen noch ein paar Unterlagen über einen Verbrecher namens Dickie Dick Dickens. Kennen Sie den zufällig?«
»Hm«, machte der Chefkommissar.
»Wunderbar«, jubelte Josua. »Dann können Sie mir sicherlich sagen, was aus dem Mann geworden ist. Läuft noch was gegen ihn?«
Lionel Mackenzie lächelte, hielt den Hörer vor sein Gesicht und lächelte noch breiter. Dann nahm er den Hörer wieder ans Ohr und sprach.
Was er sagte, war nicht viel. Doch es ließ Josua Benedikt Streubenguß das Mark in den Knochen zu Zement werden. Dickie Dick Dickens sei tot, behauptete er, und es gäbe keinen Menschen in Nord-, Mittel- und Südamerika, der sich so darüber freue wie er.
Dann knackte es in der Leitung, und Josua wusste, dass Mackenzie das Gespräch für beendet hielt. Leise legte er den Hörer auf die Gabel, stützte einen Arm mit dem Ellbogen in die Hand des anderen, strich mit solitärglitzernder Rechten seinen schönen, dämmergrauen Spitzbart. Solch edle Geste verführte ihn, in einen der großen Spiegel seines Salons zu blicken.
»Ach ja«, seufzte er, »Nachdenken steht mir hinreißend.«
Chefkommissar Lionel Mackenzie aber notierte sich auf dem Deckel einer alten Zigarettenschachtel ein paar Worte. Dann riss er den Deckel ab und steckte ihn sorgfältig in seine Brieftasche.
Darauf stand: »Dienstag 16. 5., 11 Uhr 31, Anruf: Josua Benedikt Streubenguß versucht herauszufinden, ob Fahndung nach Dickie Dick Dickens eingestellt. «
Des Chefkommissars größte Sorge jedoch war, dass jemand diese Notiz zu Gesicht bekommen könnte.
Etwa so jemand wie Bezirksstaatsanwalt Samuel W. Brewster.
Noch in der gleichen Nacht ging ein Funkspruch über den Äther, eilte Tausende von Kilometern über den Atlantik und erreichte die bereits mit Kurs auf den amerikanischen Doppelkontinent
die Wogen durchfurchende Oak-Hoak-Moah. Kapitän Margaret Poltingbrook stapfte über die Schiffsplanken auf die sanft dahindösende Schar des Dickie Dick Dickens zu.
»Hört mal her, Ihr Landratten«, grollte sie. »Ich habe da einen Funkspruch bekommen, aus Chicago. Irgendein Geisteskranker hat mir telegrafiert. Aber vielleicht werdet ihr aus dem Zinnober schlau?« Sie hielt Dick einen reichlich mit Fettflecken garnierten Zettel hin.
Dick fasste mit spitzen Fingern danach, sah Maggi strafend an und begann, laut zu lesen:
»An Margaret Poltingbrook, Kapitänin der Oak-Hoak-Moah. Onkel Lionel erwartet dringend Besuch von Tante Dixi. Hat bereits Fremdenzimmer vorbereitet sowie Freunde und Verwandte in der Nachbarschaft gebeten, Tante Dixi zu ihm zu führen, da Fremdenzimmer nicht sehr komfortabel. Herzliche Grüße, in Liebe, Dein Neffe Gussi.«
Dick ließ das Blatt sinken und sah seine Lieben mit traurigen Augen an.
»Das bedeutet ... «, begann er.
»... dass Chefkommissar Mackenzie immer noch nach uns sucht«, seufzte Effi.
Und Bonco lamentierte: »Oh jemineh, das Fremdenzimmer, das der liebe Onkel Lionel vorbereitet hat ... «
»... ist das gute, alte Stadtgefängnis von Chicago«, ergänzte Opa Crackle trocken.
»Ja«, brütete Dick, »und die Benachrichtigung der Verwandten und Freunde sind ganz ordinäre Auslieferungsanträge an alle amerikanischen Staaten.«
Maggi Poltingbrook stemmte die Fäuste in die Gegend ihres Äquators, bekam ein rotes Gesicht, spuckte aus und brabbelte: »Das heißt, ihr seid im Eimer! Die Oak-Hoak-Moah braucht nur in den Küstengewässern von Amerika
aufzutauchen - schwuppdiwupp, kommt schon eine Polizeibarkasse längsseits und nimmt euch hopp.«
Alle senkten die Köpfe, seufzten, wussten nichts als dem steten Wellenschlag des weiten, weiten Meeres zu lauschen.
Eine traurige, eine niederschmetternde Nachricht. Doch Josua Benedikt Streubenguß, Dickies treuer Freund und Helfer, bewies wieder einmal, dass er nicht nur sein Herz, sondern auch seinen Verstand am rechten Fleck hatte. Nicht umsonst hatte er sich in der Unterwelt einen Namen gemacht, nicht umsonst galt er als einer der erfahrensten, fähigsten Brillantenhehler seiner Zeit, nicht umsonst unterhielt er in Ausübung dieses Berufes weitreichende internationale Verbindungen. Eine Nacht intensiven Nachdenkens genügte Josua Benedikt Streubenguß, seinen Plan reifen zu lassen. Nachdem er am nächsten Morgen ein Ferngespräch mit Puerto Limonata geführt hatte, sandte er ein zweites Kabel an die Kapitänin der Oak-Hoak-Moah:
»Schönste Grüße an Tante Dixi und Familie. Empfehle vorerst Besuch in Canasterica bei Oberst Barbarus Caradossa, Polizeichef von Puerto Limonata. Alter Freund von mir. Habe ihm heute Besuch von Tante Dixi angekündigt. Vergesst nicht, ein hübsches Geschenk mitzubringen. Mit Verehrung, Gussi.«
Dickies Hände zitterten vor Freude, als er den Funkspruch las. »Ein hübsches Geschenk...« Das hieß zweifellos, dass der Herr Oberst Barbarus Caradossa bestechlich war - was weiter hieß, dass Dickies Weltbild wieder in jenes Ordnungsgefüge zurückversetzt wurde, in das es von Natur her gehörte. Man frage sich: Was wäre ein Gangsterleben ohne bestechliche Beamte?
Dick eilte zu Maggi. Trug ihr die Sache vor. Maggi plusterte ergrimmt die Backen auf.
»Canasterica!« rief sie ergrimmt. »Ein Umweg von 1200 Seemeilen! Das kostet mich mindestens drei Tage!«
»Es ist die einzige Möglichkeit für uns, ungeschoren davonzukommen. «
»Dann kommt ihr eben nicht ungeschoren davon. Was kümmert ‘s mich?!«
Maggi hätte das nicht sagen dürfen. Dickie bekam seinen stahlblauen Blick. Er sah Maggi tief in die Augen. Leise und deutlich sprach er: »Käpt ‘n Maggi, mein Schatz, sollten Sie so unvorsichtig sein, einen anderen Hafen anzusteuern, sollte es unser Unglück wollen, dass uns da ein Polizeichef empfängt, der weniger bestechlich ist als Oberst Barbarus Caradossa, werden meine Freunde und ich übereinstimmend aussagen, dass uns die Mannschaft der Oak-Hoak-Moah mit Gewalt auf den Ozean entführt hat.«
Maggi schnaubte Luft durch die Lippen, als seien es Segel. »Man wird euch kein Wort glauben!«
Dick hob die Schultern. »Kann sein. Kann auch nicht sein. Bestimmt aber wird man den Fall untersuchen und das Schiff solange an die Kette legen. Wie ich den Verlauf solcher Untersuchungen in Südamerika kenne, wird es etwa drei Monate dauern. Günstigstenfalls.« Er ließ die Schultern ruckartig fallen, legte den Kopf schief und sah die Kapitänin mit seinem zauberhaftesten Lächeln an. »Na, Maggi, wohin geht die Reise?«
Maggis Fettmassen wurden von einem heftigen Zittern durchlaufen. Dann ballte sie ihre Wurstfinger zu einer Art Faust, drohte Dick, lächelte und sagte: »Beim siebengeschwänzten Affen - nach Canasterica!«
Es vergingen vierzehn Tage.
Sie verflogen wie Spreu im Winde.
Es war an einem Montag, und die gleißende Sonne stand hoch am azurblauen Himmel, schimmernd weiße Möwen tanzten mit gellendem Geschrei wie in die Luft geschossene
Ballettmädchen über dem Schiff - da plötzlich rief der Mann im Mastkorb: »Kapitän ahoi! Land in Sicht! Land in Sicht!«
Alle liefen zusammen und starrten in die Luft, als müssten sie das Land über sich finden. Das kam aber nur davon, dass der Mann im Mastkorb so hoch saß.
»Es ist Canasterica«, rief er herunter.
»Canasterica ...«, lispelte Effi, bekam Kulleraugen und lieferte die der Stunde gemäßen Tränen.
Das ergriff alle. Sie fassten sich an den Händen, sahen einander markig ins Gesicht, um dann, geblendet von der Gewalt des Erlebnisses, geschlossenen Auges vor sich hinzunicken.
Zur selben Minute - die gleißende Sonne stand vergleichsweise ebenso hoch - rief in Puerto Limonata der Wachtmeister Pedro Toledano seinem Vorgesetzten zu: »Hallo, Señor Colonel! Schiff in Sicht! Es ist die Oak-Hoak-Moah!«
Schon kurze Zeit später tuckerten zwei Polizeiboote dem weitgereisten Walfangschiff entgegen und geleiteten es sicher in den Hafen von Puerto Limonata. Kaum hatte die Oak-Hoak-Moah festgemacht, als ein Aufgebot von 48 strammen canastericanischen Polizeibeamten die Gangway emporstrebte.