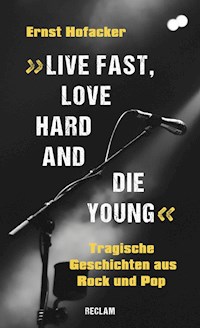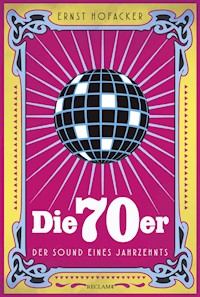
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Die 70er sind das innovationsfreudigste und folgenreichste Jahrzehnt der Popmusik. So unterschiedliche Genres wie Glam, Punk, Reggae und Metal feiern hier ihren Ursprung, nicht zu vergessen Krautrock, Elektropop, Disco, Prog und sogar Hip-Hop. Ernst Hofacker erzählt die Story dieses einzigartigen Jahrzehnts anhand von zehn exemplarischen Daten. Er entfaltet die popkulturelle Vielschichtigkeit, zeigt auf, wie Trends und ihre Gegenbewegungen entstanden, und verfolgt die gesellschaftlichen Hintergründe und ihr Fortwirken bis heute. Das bunte Porträt einer Zeit, in der noch galt: Sag mir, was du hörst, und ich sag dir, wer du bist!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 848
Ähnliche
Ernst Hofacker
Die 70er
Der Sound eines Jahrzehnts
Reclam
Für Emmi – sail on, Silver Girl!
2020 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: zero-media.net
Coverabbildung: FinePic®
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2020
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-961660-5
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011244-1
www.reclam.de
Inhalt
IntroÜber wilde Wasser
Helden und Opfer, Dramen und Triumphe: Warum wir die Musik der 1970er Jahre noch heute cool finden
Sommer in der Merkelrepublik. In einem überfüllten ICE-Abteil sitzt ein etwas zerknitterter Herr, merkwürdigerweise mit unbekleidetem Oberkörper. Freundlich grinsend klärt er einen jüngeren über die mal wieder geänderte Wagenreihung des Zuges auf. Rockfans kennen den Veteranen mit dem blondierten Spaghettihaar als Iggy PopPop, Iggy. Und die Musik im Hintergrund dieses Werbeclips ist »The Passenger«. Auch schon wieder über 40 Jahre her. Mindestens.
Till Diestel, Kreativ-Chef der im schicksten Berlin-Mitte residierenden Werbeagentur BBDO, die das Filmchen 2018 für die Deutsche Bahn drehen ließ, findet all das cool: den Punkveteranen, dessen Musik und dessen Jahrzehnt. Im branchenüblichen Smartsprech erläutert er:
Iggy PopPop, Iggy ist der ›Godfather of Punk‹, auch für die jüngeren Generationen. Oder wie der Rolling Stone schreibt: »Iggy Pop ist das Coolste, was der Rock ’n’ Roll je gebar.« Sehen wir auch so. Und dass diese Coolness ziemlich zeitlos ist. Und Iggys Mega-Song »The Passenger« sowieso. Das alles passt ziemlich gut zur Deutschen Bahn …
Über Letzteres ließe sich womöglich streiten, nicht aber über die zentralen Begriffe dieses Statements: »Rock ’n’ Roll« und »cool«.
Natürlich ist mit Rock ’n’ Roll hier nicht der Musikstil gemeint, sondern der Lifestyle, der seine Wurzeln in den Outlaw-Geschichten der klassischen Pop-Ära findet: Jerry LeeLewis, Jerry Lee, JimiHendrix, Jimi, KeithRichards, Keith, LemmyKilmister, Lemmy und natürlich IggyPop, Iggy. Ein halbes Jahrhundert später wird der Mythos noch immer gerne inszeniert. Weshalb James Osterberg, wie der 72-jährige »Passenger« im wirklichen Leben heißt, auch heute noch mit freiem Oberkörper im ICE reisen muss. Denn die postmoderne Image-Industrie scheint ohne das gute alte Märchen vom Rock ’n’ Roll nicht auszukommen. Um das vermeintlich Coole in den Dienst des Verkäuflichen zu stellen, ist ihr keine gedankliche Pirouette zu absurd. Ohne Cool geht’s nicht, selbstverständlich auch nicht bei einem nüchternen Dienstleistungsunternehmen wie der Bundesbahn.
Doch welche Botschaft sendet der DB-Clip als Subtext? Wohl diese: Die Seventies sind cooler denn je. Auch in der Post-Postmoderne des 21. Jahrhunderts lässt sich mit ihnen, ihrem Personal, ihrer Kunst und ihrem Ideen-Inventar noch jede Menge Staat (und Geld) machen.
Dabei hat das Phänomen nicht nur einen nostalgischen Hintergrund. In einer Zeit, die sich mit den Folgen von vogelwildem Wirtschaftsliberalismus, hemmungslosem Konsumismus und erstarktem Neo-Nationalismus auseinandersetzen muss, haben die lange Zeit nur noch belächelten Ideen der Generation Woodstock wieder Konjunktur. Nicht nur Nörgler und Nachdenkliche fragen sich, ob der an Tugenden wie Toleranz, Brüderlichkeit und Respekt ausgerichtete Wertekanon der damaligen Gegenkultur Antworten auch für die Gegenwart geben kann. Antworten, die uns von der Doktrin des Wirtschaftswachstums um jeden Preis befreien und neue, für den Planeten und seine Bewohner gesündere Perspektiven erschließen können. Womit wir mitten in den 1970er Jahren wären.
Gesellschaft und Politik
Die Dekade nach den 1960ern war ein kaum weniger aufgewühltes Jahrzehnt als das, in dem wir uns gegenwärtig befinden. Sie war schillernd und widersprüchlich, und geprägt war sie von Utopien genauso wie von Pragmatismus. Die Siebziger waren eine Zeit der Umbrüche, der unerbittlichen, mitunter gewaltsamen Auseinandersetzungen und der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Einschnitte. Als das Jahrzehnt begann, waren die hochfliegenden Träume der Sixties geplatzt, an die Stelle ihres bilderstürmenden Optimismus war weitgehende Desillusionierung getreten. Und die hatte ihren Ursprung nicht zuletzt in den Attentaten auf Hoffnungsträger wie Martin Luther King und Bobby Kennedy, in der Tate/LaBianca-Mordserie der Charles-Manson-Bande im August 1969, genau eine Woche vor dem Woodstock-Festival, und in der moralischen Schockwelle, die der Vietnamkrieg bzw. das von der US-Army an vietnamesischen Zivilisten begangene Massaker von My Lai bewirkt hatte. Ein Ende des für die amerikanische Seele so traumatischen Vietnamkriegs war 1970 noch nicht in Sicht.
Auch in anderen Regionen der Welt verschärfte sich die Lage an den Krisenherden: So flammten im Herbst 1969, zwei Jahre nach dem Sechstagekrieg vom Juni 1967, im Nahen Osten erneut heftige Kampfhandlungen zwischen Ägypten und Israel auf, und Yassir Arafats Fatah-Männer gründeten die bald berüchtigte palästinensische Terrorgruppe »Schwarzer September« .
Auch die Lage in Nordirland geriet mehr und mehr außer Kontrolle. Der bittere und von blutigen Anschlägen begleitete Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken stürzte das Land in einen Bürgerkrieg, und London entsandte Truppen – eine politische Lösung und damit ein Ende der Gewalt würde bis weit in die 1980er Jahre auf sich warten lassen.
Andernorts herrschte Aufbruchstimmung. Zum Beispiel in der Bundesrepublik, wo es im Herbst 1969 zum Regierungswechsel gekommen und die große Koalition zwischen CDU/CSU und SPD unter Kanzler Kiesinger (CDU) vom ersten sozialliberalen Regierungsbündnis abgelöst worden war. Die neue Regierung wollte für eine verstärkte Reformierung der Gesellschaft sorgen: Bei seinem Amtsantritt gab Kanzler Willy Brandt die berühmte Losung »Mehr Demokratie wagen!« aus.
Ein Liberalisierungsschub erfasste alle möglichen Bereiche des täglichen Lebens. Die Frauenbewegung formierte sich weltweit und legte die Saat für ein neues weibliches Selbstbewusstsein sowie einen allmählichen Bewusstseinswandel in westlichen Gesellschaften. So wurde die Abtreibung im US-Bundesstaat New York im Juli 1970 erstmals nicht mehr unter Strafe gestellt. In Großbritannien war dies bereits 1968 geschehen, weitere europäische Länder wie Schweden und die Niederlande waren gefolgt. Auch in der Bundesrepublik setzte mit Beginn der 1970er Jahre eine mit harten Bandagen geführte Diskussion um den § 218 ein. 374 Frauen, darunter zahlreiche prominente, bekannten im Juni 1971 öffentlich in der Illustrierten Stern, dass sie abgetrieben hatten – seinerzeit ein unerhörter Vorgang.
In den USA hatte zum Ende der 1960er Jahre die Black-Power-Bewegung und mit ihr die Black Panther Party die spirituelle, ideologische und politische Führung des Civil Rights Movements übernommen. Der Umgang wurde rauer, die Aktionen radikaler, und vor allem wurde der Widerstand des weißen Establishments erbitterter. Das FBI durchsuchte, oft genug ohne jegliche rechtliche Grundlage, die Büros der Organisation, nahm willkürlich Verhaftungen vor und zeigte sich auch im Gebrauch von Waffen nicht zimperlich: Allein zwischen 1967 und 1970 wurden 40 Mitglieder der Black Panther Party getötet und 82 schwer verletzt. Die farbige Aktivistin Angela Davis, die 1972 in einem aufsehenerregenden Prozess von der Anklage der »Unterstützung des Terrorismus« in allen Punkten freigesprochen wurde, galt nicht erst seit diesem Zeitpunkt als internationale Symbolfigur im Kampf um Bürgerrechte und gesellschaftliche Liberalisierung.
Das Klima war ein anderes als noch zu Sgt. Peppers Zeiten. Der Ton wurde aggressiver, die Auseinandersetzungen härter und die Kontrahenten misstrauischer. Zum ersten Mal rückten neben der Frauenbewegung nun auch Themen in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses wie die wachsende Skepsis gegenüber dem technischen Fortschritt, der Klima- und Umweltschutz sowie eine nachhaltige Demokratisierung der Bildungschancen. Und die Wirtschaft, deren stetiges Wachstum bis dahin als Naturgesetz galt, musste sich erstmals mit der Notwendigkeit eines tiefgreifenden Strukturwandels auseinandersetzen. Rezessionen, Währungsprobleme, der Niedergang ganzer Branchen (Stahl-, Textilindustrie) und nicht zuletzt steigende Arbeitslosenzahlen sollten die westlichen Gesellschaften durch die gesamten 1970er Jahre hindurch begleiten und zu deren Ende eine allmählich heraufziehende konservative Wende und eine Renaissance des Neoliberalismus begünstigen.
Mit dieser Entwicklung ging zudem eine Radikalisierung der politischen Protestkultur einher, die sich auch in einer Zunahme des weltweiten Terrorismus äußerte. So starben am 12. Dezember 1969 bei einem rechtsterroristischen Anschlag im italienischen Mailand 17 Menschen, und allein 1969 hatte es weltweit 82 Flugzeugentführungen und Versuche gegeben – mehr als in den vier Jahrzehnten des kommerziellen Flugverkehrs zuvor. Und dann war da noch die Rote Armee Fraktion (RAF), die sich zu Beginn der 70er formierte und Behörden, Bevölkerung und Politiker der Bundesrepublik bis in das folgende Jahrzehnt hinein mit ihren Aktionen in Atem halten sollte.
All dies schlug sich in diesem Jahrzehnt, das der US-Autor Tom Wolfe »The Me Decade« nannte, selbstverständlich auch in der Kultur nieder. An die Stelle der alten Love & Peace-Visionen traten zunehmend Hedonismus und zynische Selbstbezogenheit. Drogen dienten nicht mehr der Bewusstseinserweiterung, sie sollten stattdessen das Ego stärken und für Euphorie, sexuelle Enthemmung und gesteigerte Leistungsfähigkeit sorgen. Folgerichtig löste Kokain LSD als Modedroge Nr. 1 ab. Auch auf der Kinoleinwand war das neue, raue Klima allgegenwärtig: Filme wie Easy Rider, A Clockwork Orange, Taxi Driver und Apocalypse Now zeichneten ein mehr und mehr von Paranoia, Aggression und Neurosen geprägtes Gesellschaftsbild. Gleichzeitig lockte die Freizeit- und Konsumgesellschaft mit immer kühneren Entwürfen in Mode, Design, Kunst und Lifestyle. Sogar in der BRD entwickelte das Fernsehen mutigere Formate wie die Quizshow Wünsch dir was und die ätzend-satirische Familienserie Ein Herz und eine Seele. Die Sexwelle erreichte derweil ihren medialen Höhepunkt – was nicht jeder begrüßte: Der niederländische Jesuitenpater Eduard Krekelberg wurde am 30. Dezember 1970 zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er das Schaufenster eines Pornoladens in Maastricht zertrümmert hatte.
Pop und Gegenkultur
Pop spiegelte all das wider. Nicht immer konkret und in Songtexten, meistens reichte es auch, wenn er die emotionale Textur um sich herum aufnahm und auf die eine oder andere Weise zwischen den Noten wiedergab. Mal war er naiv und idealistisch (»I’d Love to Change the World«, Ten Years AfterTen Years After), mal hoffnungslos sentimental (»Reflections of My Life«, The MarmaladeThe Marmalade), mal war er zornig (»Won’t Get Fooled Again«, The WhoThe Who), mal spirituell (»My Sweet Lord«, George HarrisonHarrison, George). Pop war wie seine Zeit, und ein bisschen funktionierte er wie unsere sozialen Netzwerke heute: Wer Pop hörte, bekam mit, was da draußen los war, stand über die Musik mit seinen Freunden, den Popmusikern, in Kontakt und stellte sich über die Auswahl seiner Favoriten selbst dar. Und, vielleicht das Wichtigste: Pop war Exklusiveigentum der Generation U30, seine Arithmetik verstanden nur Eingeweihte.
Die Sixties hatten Blues, Folk, Country und europäische Einflüsse zu einer neuen Popmusik vereint und dafür gleichsam das kleine Einmaleins geschrieben. Die 70er machten sich nun daran, auf dieser Grundlage ein großes Einmaleins zu entwickeln, die manchmal noch kargen Skizzen der 1960er zu üppigen Gemälden auszumalen, neue Genres zu definieren und dem Pop eine umfassende Grammatik zu schreiben.
So wurde das Jahrzehnt zur vielleicht fruchtbarsten Phase der modernen Popmusik: Da war das kalifornische Singer/Songwriter-Movement, das den Softrock späterer Jahre begründete; der Glamrock, der nicht nur Musiker wie David BowieBowie, David und Marc BolanBolan, Marc groß machte, sondern Impulse setzte für die weitere künstlerische Entwicklung des Pop überhaupt; der Punk, der neben Rotzlöffeln wie Sid ViciousVicious, Sid auch visionäre Künstlerpersönlichkeiten wie Patti SmithSmith, Patti, Elvis CostelloCostello, Elvis und Joe StrummerStrummer, Joe hervorbrachte; Reggae-Prophet Bob MarleyMarley, Bob, die Elektropop-Pioniere KraftwerkKraftwerk, Pink FloydPink Floyd und ihr SciFi-Rock, die Boogie-Minimalisten von AC/DCAC/DC und Rockgiganten wie EaglesEagles, Fleetwood MacFleetwood Mac und Elton JohnJohn, Elton. Nicht zu reden von den vielen weiteren Subtrends und deren Helden: Classic Rock, Jazz Fusion, Blues-, Prog-, Southern- und Pubrock, Outlaw-Country, Funk, Blue-Eyed Soul, Folk und so weiter und so weiter.
Die Summe all dessen ergab ein umfangreiches und komplexes Erbe, ein Fundament, von dem der Planet Pop bis heute zehrt. Die Künstler dieser Dekade begründeten Trends an der Schnittstelle von Avantgarde und Mainstream und stellten Weichen für die Zukunft. Der elektronisch geprägte Pop der Gegenwart etwa wäre undenkbar ohne die Pionierarbeiten einheimischer Krautrocker; ebenfalls in die 70er fallen die Geburt der heute allgegenwärtigen Hip-Hop-Kultur und auch die des Metal-Genres, dessen vielfältige Ausformungen die Rock- und Festivalkultur der Gegenwart prägen – sehr zur Freude einer Freizeitindustrie, die mit entsprechenden Events und Lifestyle-Accessoires Millionensummen scheffelt.
Gleichzeitig aber war Pop auch in den 1970er Jahren bereits eine Kultur, die nur zu gerne die eigene Geschichte feierte. Als John LennonLennon, John1969 mit ein paar Freunden bei einem Rock-’n’-Roll-Festival in Toronto auftrat und statt neuer Songs Chuck-Berry-KlassikerBerry, Chuck zum Besten gab, begann die Popmusik, einen nostalgischen Blick in den Rückspiegel zu werfen. Ab jetzt kam sie ohne Zitate, Bezüge und Verweise auf die Sternstunden von einst nicht mehr aus.
Als Simon & GarfunkelSimon & Garfunkel das neue Jahrzehnt mit ihrer sakralen Ballade »Bridge Over Troubled Water« begrüßten, hätte kein Song besser gepasst als dieser. Mit melancholischer Grandezza trocknete er die Tränen für die Toten der 1960er Jahre, mit spiritueller Kraft spendete er Trost und Zuversicht angesichts der zerbrochenen Illusionen der Generation Hippie. Sechs Wochen lang thronte »Bridge Over Troubled Water« seit dem 28. Februar an der Spitze der Billboard-Charts. Abgelöst wurde der Song am 11. April durch »Let it Be« von den BeatlesBeatles, die passenderweise am Tag zuvor offiziell ihr Ende verkündet hatten.
Trost und Zuversicht: Zum Beginn des Jahrzehnts gelang Simon & GarfunkelSimon & Garfunkel mit der Ballade »Bridge Over Troubled Water« ihr letzter Nr.-1-Hit in den USA.
Die drei großen Symbolfiguren der Hippie-Ära waren zu diesem Zeitpunkt noch lebendig: Jimi HendrixHendrix, Jimi hatte gerade in Woodstock abgeräumt und dort mit seiner Dekonstruktion der amerikanischen Nationalhymne gezeigt, dass Rockmusik mit ihren ureigenen Mitteln große Kunst schaffen konnte; Janis JoplinJoplin, Janis, die schillernde Queen des Bluesrock-Underground, wartete noch auf ihren endgültigen Durchbruch im Popsegment; und Jim MorrisonMorrison, Jim, Leadsänger der DoorsThe Doors und attraktivstes Sex-Symbol der weißen Gegenkultur, schien als Dichter und Hohepriester des Sex für den Aufbruch seiner Generation in das befreite Zeitalter des Wassermanns zu stehen. Niemand konnte damals ahnen, dass diese drei Stars keine 18 Monate nach dem Beatles-SplitBeatles tot sein würden. Und mit ihnen der Nimbus von Love & Peace. Was also würden die 70er aus den rauchenden Trümmern der 60er machen?
Musik und Konsumkultur
Die musikalische Geschichte dieses Jahrzehnts ist die von Helden und Opfern, von Dramen und Triumphen. Genauso aber ist sie auch die Geschichte von Mittelmaß und Langeweile. Nehmen wir das Jahr 1976: Jeder Chronist wird als bedeutendste Entwicklung des Jahres die Konstituierung des internationalen Punk-Movements betrachten, die ersten Konzerte der Sex PistolsSex Pistols, die Gründung wichtiger Bands wie The ClashThe Clash und den Aufbruch junger Künstler in New Yorker Clubs wie dem CBGB. All dies sorgte schließlich dafür, dass in der Popkultur danach nichts mehr war wie zuvor.
Wahrgenommen wurde diese künstlerische Revolution zu diesem Zeitpunkt aber höchstens in Undergroundzirkeln. Der Mainstream, der das Bild von Millionen Fans prägte, blieb davon unberührt. In der Bundesrepublik hießen die Hits des Jahres 1976 »Let Your Love Flow« von den Bellamy BrothersBellamy Brothers, »Ein Bett im Kornfeld« von Jürgen DrewsDrews, Jürgen, »Dancing Queen« von ABBAABBA und »Daddy Cool« von Boney M.Boney M. Vom Mai bis zur Weihnachtswoche, also über den Zeitraum von mehr als einem halben Jahr (!), wechselten sich diese vier Platten an der Spitze der Hitliste ab. Lediglich ein gewisser David DundasDundas, David konnte diese Dominanz mit seinem einzigen Hit »Jeans On« (der quasi aus Versehen zum Hit geworden war, handelte es sich doch um einen Song, der ursprünglich als Werbejingle komponiert worden war) für eine mickrige Woche unterbrechen. Die Sex PistolsSex Pistols und sonstige Helden des aufziehenden Punk-Gewitters hörte 1976 jedenfalls noch kein Mensch, weder in der Bundesrepublik noch in England. Impulse, die an den Rändern der Popkultur und in deren Underground entstehen, brauchen ihre Zeit, bis sie die Oberfläche beziehungsweise den Mainstream erreicht haben. Punk erzeugte beispielsweise in der Bundesrepublik frühestens 1977/78 erste Resonanz in den Medien und fand erst danach nennenswerte Aufmerksamkeit auch bei einem breiteren Publikum: Die erste Band aus dem Punk-Umfeld, die es in die deutsche Singles-Top-Ten schaffte, war im Mai 1978BlondieBlondie mit »Denis«.
Und auch der Blick in die Charts zeigt nur die halbe Wahrheit. Denn abgebildet wird in den Hitlisten nur die aktuell produzierte Musik, die sich auf Tonträgern am besten verkauft, und nicht die Musik, die bereits in den Haushalten und den Senderarchiven vorhanden ist. Unberücksichtigt bleibt in einer Hitstatistik zudem, was bei Tanzveranstaltungen, Schützenfesten, in Bierzelten und bei Geburtstagsfeiern gespielt wird und den Alltag der Menschen vermutlich nachhaltiger prägt als kurzlebige Hits. Als Schlaghosen und Koteletten angesagt waren und der VW-Käfer das Straßenbild beherrschte, drehten sich auf den Plattenspielern eben auch James LastLast, James, die Donkosaken und Willy SchneiderSchneider, Willy. Black SabbathBlack Sabbath, Bob MarleyMarley, Bob und Pink FloydPink Floyd natürlich auch, aber nur in Teenagerzimmern.
Jugendliche und junge Erwachsene entwickelten ihre eigene musikalische Konsumkultur, denn für sie war Pop nicht nur wichtig, sondern, wie es Kurt Kister einmal in der Süddeutschen Zeitung formulierte, »lebenswichtig«1. Ihren Platten und Helden räumten sie im Wortsinne mehr Platz in ihrem Leben ein, als dies im heutigen Zeitalter des Streamings der Fall ist: Langspielplatten erforderten Lagerraum, also mindestens ein Regalbrett, zumindest solange man nur ein Dutzend davon besaß. Sammler dagegen benötigten ganze Regale. Eine Schallplatte konnte dem Besitzer ans Herz wachsen, weil sie nach x-maligem Abspielen verkratzt war und knisterte oder weil das besonders schöne Cover an den Rändern schon ein wenig angefleddert war, da es so oft ins Regal gequetscht und wieder herausgezogen worden war. Zum Abspielen war zudem eine mitunter teure Musikanlage notwendig, entweder als ausladendes Kompaktmodell von Dual, Saba oder Braun oder mit separaten Komponenten wie Verstärker, Plattenspieler, zwei Lautsprecherboxen (je größer, desto besser) und gegebenenfalls einem Tonbandgerät (das seinen Besitzer als engagierten und technisch kompetenten Musikfreak auszeichnete). Überdies erforderte die Auseinandersetzung mit Musik einen hohen Zeitaufwand. Mixtapes entstanden, indem man die Tracks sorgfältig aussuchte, ihre Laufzeit exakt ausmaß, die Songauswahl dann in Echtzeit auf eine Audiokassette aufnahm und zu guter Letzt das Cover mehr oder weniger hübsch beschriftete. Was heute mit wenigen Klicks in Minuten erledigt ist, beanspruchte seinerzeit ganze Nachmittage. Ganz abgesehen davon, dass man Musikstücke aus dem Radio zumeist mit Hilfe vor dem Lautsprecher platzierter Billigst-Mikrophone aufnahm. Dabei musste man ständig damit rechnen, dass irgendjemand ins Zimmer platzte und irgendetwas wollte, womit die schöne Aufnahme dahin war und man also darauf hoffen musste, denselben Song bei nächster Gelegenheit aus dem laufenden Programm zu »fischen«. Die mit alledem einhergehende Affektbindung und Identitätsbildung – wer diesen Aufwand betrieb, war ein echter Musikfan und -kenner – ist im Zeitalter des Streamings und der mobilen Abspielgeräte praktisch weggefallen. Außerdem war Rock die erste Musik in der Geschichte, die per definitionem laut gehört wurde, was zur Abgrenzung von Nichteingeweihten, also den Erwachsenen, beitrug.
Pop und Rock waren in den 70ern längst noch nicht Massen-, sondern Minderheitenprogramm. Folglich fanden sie bis weit in das neue Jahrzehnt hinein auch im öffentlichen Raum kaum statt. Weder wurden sie zur Dauerberieselung im Supermarkt eingesetzt, noch dienten sie als flächendeckende Klangtapete in den Medien. Sie wurden nicht der Werbung unterlegt, und auf Stadtfesten spielten statt Rock-Coverbands in aller Regel Dixieland-Kapellen. Zu hören waren die neuesten Hits höchstens bei Kirmes- und Jahrmarktveranstaltungen, wo sie für Fahrgeschäfte wie Raupe und Autoscooter ein junges Publikum anlocken sollten. In den Pausen zwischen SweetSweet und Gary GlitterGlitter, Gary aber wehten vom Riesenrad oder der nächsten Schießbude verlässlich auch die Schnulzen von Bata IllicIllic, Bata und Peter AlexanderAlexander, Peter herüber. Selbst die klassische Kirmesorgel tönte noch lautstark durchs Getümmel, und das nicht etwa als nostalgische Reminiszenz an die gute alte Zeit, sondern als selbstverständlicher Bestandteil der Kulisse.
Wer Popmusik hören wollte, musste sich Platten kaufen oder jemanden besuchen, der welche besaß. Die aus wenigen, dafür einflussreichen Magazinen bestehende Musikpresse wirkte dabei als Filter und Geschmackskompass. Hefte wie der Rolling Stone, Creem, der englische Melody Maker, ab 1972 auch der NME (New Musical Express) und das deutsche Magazin Sounds versorgten ihre Leser mit den nötigsten Musikinfos und dienten als Forum für Geschmacksentwicklung und die Verbreitung der korrekten Gegenkultur-Ideologie. Das Radio entfernte sich in den USA seit der Einführung des FM-Formats (entspricht dem europäischen UKW) von der reinen Hitformatierung und spielte auch anspruchsvolle Albumtracks. In Europa begriffen die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten um die Jahrzehntwende, dass sie ihre Programme auch auf die spezifischen Bedürfnisse junger Hörer zuschneiden mussten. Ab etwa 1969 begegnete man im Radio vermehrt journalistischen Magazinsendungen, die sich mit den Entwicklungen der Pop- und Rockmusik beschäftigten. Beim bundesdeutschen Fernsehen dagegen blieben Formate wie Beat-Club, Disco, Musikladen und Plattenküche noch bis zum Ende der 1970er Jahre die Ausnahme: Pop war TV-Mangelware.
Und es gab die Plattenläden selbst. Zu Beginn des Jahrzehnts koppelten sich die Plattenabteilungen von ihren Muttergeschäften, in der Regel war das der Elektrofachhandel, ab, zogen in eigene Läden und wurden auf diese Weise zum einflussreichen Teil der jugendlichen Subkultur. Ein Beispiel: Bernd DoppDopp, Bernd, heute Chef von Warner Music und einer der wichtigsten Macher in der internationalen Musikbranche, begann seine Laufbahn in den frühen 1970er Jahren im Plattenhandel. Er erinnert sich:
Anfang der 1970er Jahre war die Preisbindung für Schallplatten aufgehoben worden. Bis dahin musstest du für eine Langspielplatte 22 Mark hinblättern, jetzt konntest du plötzlich ein Album für 13,90 Mark kaufen. Und diese Läden waren sehr einfach gehalten, kaum Ausstattung, nur die Plattenkisten. Aber sie waren cool und Treffpunkte für Gleichgesinnte. Wenn du es geschafft hattest, Plattenverkäufer zum Beispiel bei Govi zu werden, einer der ersten Handelsketten, dann warst du fast schon selbst ein Mini-Rockstar, so ein hohes Prestige war mit diesem Job in der Jugendszene verbunden. Das Beste war, dass man die Platten mit nach Hause nehmen durfte. Und man lernte Mädchen kennen. Obendrein bekam man auch noch Geld dafür. Damals explodierte das Plattengeschäft umsatzmäßig und es ging steil aufwärts.
All dies plus die damals hierzulande noch karge Konzertszene bildete das Spielfeld, auf dem Popmusik stattfand.
Der verkürzte Mythos
Die musikalische Wirklichkeit der 1970er Jahre war im Übrigen eine andere als die, welche uns die Medien heute verkaufen. Denn Letztere wird naturgemäß beschränkt auf die Musik, die über den Tag hinaus blieb. Sei es, weil sie zum Ereignis wurde oder in der Nachbetrachtung als ein solches erscheint, weil sie die Hitparaden anführte, für Skandale sorgte, sie begleitete oder in der Rückschau zur Illustration augenfälliger Phänomene wie der Discomode taugt.
Das unvermeidliche Ergebnis solcher Praxis: Die reiche Blüte der Musikkultur der 1970er Jahre wird heute zumeist verkürzt auf ein paar wenige Namen, Songs und Schlüsselbegriffe – Bee GeesBee Gees, BowieBowie, David, Punk und Ilja RichterRichter, Ilja. In TV-Dokumentationen sehen wir immer wieder dieselben ikonographischen Bilder: Ein bisschen ABBAABBA, ein bisschen SmokieSmokie, vielleicht noch Bob MarleyMarley, Bob und Saturday Night Fever, dazu Willy Brandts Kniefall in Warschau, der autofreie Sonntag, Dutschkes Abschiedsgruß am Grab des RAF-Hungerstreik-Opfers Meins (»Holger, der Kampf geht weiter!«) und die Befreiung der Landshut in Mogadischu. Abgeschmeckt wird das Ganze mit ein paar Schlaghosen, Plateaustiefeln, Bonanzarädern und der unvermeidlichen Alice Emma Schwarzer – fertig ist das Schaufenster auf ein schrilles Jahrzehnt. Bild und Ton werden verknüpft zum plakativen Seventies-Klischee, ein bisschen schrill, ein bisschen verrückt, ein bisschen sonderbar. Dazu hören wir die Playlists vom Streamingdienst unseres Vertrauens mit den immer gleichen Songs. Motto: »Dein Lieblingshit der 70er!«
Ein Beispiel: Am 6./7./8. September 2019 veranstaltete der WDR auf seinem vierten Hörfunkprogramm ein Siebziger-Wochenende für die Zielgruppe der Generation 50plus. Präsentiert wurde ausschließlich die Musik dieses Jahrzehnts. Dazu ein paar Zahlen: 72 Sendestunden standen zur Verfügung, gespielt wurden in diesem Zeitraum 708 Songs, ein paar davon doppelt (die Zahlen basieren auf den online einsehbaren Playlists des Senders; nicht mitgezählt sind hier die ausschließlich den acht bei den Hörern beliebtesten Alben der 1970er Jahre entnommenen Songs, die in der Nacht vom 6. auf den 7. September gespielt wurden). Es ergab sich ein Feuerwerk mit dem seit Jahren bewährten Repertoire, das dem Programm neben den Songs der 1960er und 1980er Jahre ohnehin das Fundament liefert. Von 1970 bis 1979 waren in den Top Ten der bundesdeutschen Singlecharts insgesamt 596 verschiedene Songs vertreten. 106 von ihnen haben es in diesem Jahrzehnt auf Platz eins geschafft. 77 von diesen Nr.-1-Hits, also etwa drei Viertel, hat WDR4 an besagtem Wochenende gespielt, verzichtet wurde lediglich auf allzu Volkstümliches (»Theo, wir fahrn nach Lodz«, Vicky LeandrosLeandros, Vicky), heute kaum noch sendefähige Novelty-Nummern (»Borriquito«, PeretPeret) und das eine oder andere Stück, das offenbar nicht dem Sendeformat entsprach (»Whole Lotta Love« von Led ZeppelinLed Zeppelin und »Paranoid« von Black SabbathBlack Sabbath). An diesem Wochenende waren also fast elf Prozent der gesendeten Songs Nr.-1-Hits. Wenn wir nun annehmen, dass der überwiegende Rest der gesendeten Songs zu jenen verbliebenen 490 Stücken gehört, die in diesen Jahren in den Top Ten oder wenigstens in den Top Twenty vertreten waren (die Playlist bestätigt das), dann darf man davon ausgehen, dass sich die Hörer und Hörerinnen an diesem Wochenende vor Überraschungen sicher fühlen konnten: Sie kannten so gut wie jeden gesendeten Song. Diejenigen, die alt genug waren, bereits seit einem halben Jahrhundert, jüngere Hörer allein schon durch den permanenten Wiederholungseffekt, den das auf größtmögliche Popularität angelegte Sendeformat mit sich bringt.
Ob das so sein muss, soll hier nicht diskutiert werden. Fakt ist: Was da und in anderen Sendern bei der Darstellung vergangener Epochen, egal ob im Radio oder im Fernsehen, stattfindet, könnte man eine mediale ABBAsierungABBA der musikalischen Dekade nennen. Das eigentlich schillernde, vielfältige, vielschichtige und auch widersprüchliche Jahrzehnt wird auf einen launigen Nostalgie-Bilderbogen reduziert und verklärt zur Legende von der guten alten Zeit, als die Welt noch überschaubar, das Leben leicht und der Rock ’n’ Roll sowieso viel besser war. Das Schwierige an der Sache: Man kann nicht ein zweites Mal zum ersten Mal auf dem Mond landen oder »Smoke on the Water« hören. Anders gesagt: Ihre spirituelle Kraft, ihre Faszination, ihren historischen Impuls kann Musik nur in ihrem zeitlichen Kontext entfalten. Ohne ihn wird sie allzu leicht zur Nostalgie und zur Honoratioren-Erzählung. Wobei Agnetha, Anni-Frid, Björn und Benny am wenigsten dafür können – sie haben nur ihre Musik gemacht, die zu gut war, um sie zu vergessen.
Gleiches gilt für den eingangs erwähnten Iggy PopPop, Iggy, der allerdings damals noch ein Undergroundmusiker und weit davon entfernt war, ein echter Star zu sein. Den Status als Punk- und Coolness-Ikone, der ihm den Job als Werbefigur der Deutschen Bahn eingebracht hat, verdankt er also weniger seinem konservierten Seventies-Ruhm als einer nachträglichen Glorifizierung, die vermutlich mehr mit dem Zeitgeist des neuen Millenniums als mit den Heldentaten von einst zu tun hat. Pop ist ein kluger und belesener Mann, und er würde wohl sofort bestätigen, dass Rock ’n’ Roll seinerzeit nicht das war, als das er heute verstanden wird, nämlich ein Synonym für ritualisierte Entgrenzung in einer durchformatierten und normierten Wohlstandsgesellschaft. Vielmehr war er die lautstarke Notwehr, das »Nein!« einer jungen Generation, die sich nicht länger an die durchgefaulten Moralkodizes ihrer Elterngeneration halten wollte. Sie suchte nach überzeugenden Alternativen und einem freien Leben mit selbstbestimmtem Wertesystem. Die Musik jener Epoche reflektiert diesen Prozess – lyrisch, ästhetisch, energetisch, dynamisch.
Zudem war die Musikindustrie damals noch weit entfernt von der unerbittlichen Multimillionen-Vermarktungs-Maschinerie späterer Jahrzehnte. Sie war jung, unfertig, sprunghaft und eine an allen Flanken offene Spielwiese für Verrückte, Hasardeure und Visionäre. Und sie war eine Wachstumsbranche, die nach vorne blickte und zumindest bis zum Ende des Jahrzehnts keine Krise kannte.
Geschichten und Geschichte
Wer Geschichte erzählen will, braucht Daten, Zahlen und Fakten. Und er braucht Geschichten. Auch wenn es kaum je einzelne Ereignisse sind, die als solche und allein den Gang der Dinge verändern, so sind es doch immer wieder Schlüsselmomente, in denen sich komplexe historische Prozesse verdichten. Die Weltgeschichte ist reich an Beispielen. Etwa jener unscheinbare Zettel, der die Welt veränderte: Er lieferte den Haken, an dem sich die Erzählung von Günter Schabowskis berühmter »Sofort, unverzüglich!«-Pressekonferenz vom 9. November 1989 in Ost-Berlin aufhängen ließ. Der Politiker las von seinem Notizzettel ein paar Wörter ab – und hatte in diesem Augenblick, ohne es zu ahnen, den Fall der Mauer eingeleitet.
Nicht anders funktioniert das in der Kultur- und natürlich auch der Musikgeschichte. Auch dort verdichten sich Entwicklungen zu sinnbildlichen Ereignissen, auch dort stehen die Namen einzelner Künstler für Geniestreiche, für Neuerungen und die Erfindung ganzer Genres. Dokumente, Gegenstände und Bilder können Umbrüche, Wendepunkte und Sternstunden symbolisieren. Gerade in den 1970er Jahren, einem Popjahrzehnt, das von einer Vielfalt künstlerischer, technischer und wirtschaftlicher Impulse geprägt wurde, lässt sich vieles auf solche nicht selten zufälligen Momente, auf Figuren und sogar Gegenstände verdichten.
Oft allerdings sind Bedeutung und Folgen dieser Momente auf Anhieb gar nicht erkennbar. Wer etwa hätte geglaubt, dass die Idee des Münchener Musikproduzenten Giorgio MoroderMoroder, Giorgio, sich bei seinem Komponistenfreund Eberhard SchoenerSchoener, Eberhard einen Moog-Synthesizer für eine anstehende Plattenproduktion mit der Sängerin Donna SummerSummer, Donna auszuleihen, dazu führen sollte, dass die Clubmusik auf Jahrzehnte hinaus revolutioniert wurde? Und immer wieder werden epochale Ereignisse auch begleitet vom Unverständnis ihrer Zeitzeugen. So zeigte sich das englische Musikmagazin Melody Maker nach der Uraufführung von Pink FloydsPink Floyd Meisterwerk THE DARK SIDE OF THE MOON im Londoner Rainbow Theatre am 17. Februar 1972, damals noch unter dem Titel DARK SIDE OF THE MOON: A PIECE FOR ASSORTED LUNATICS und ein Jahr vor der Veröffentlichung des Albums, einigermaßen irritiert. Der Kritiker des Blattes schrieb: »Es gab einige großartige musikalische Ideen, aber bei den Soundeffekten habe ich mich gefragt, ob ich versehentlich in den Vogelkäfig des Londoner Zoos geraten bin.«2
Dieses Buch erzählt die musikalische Geschichte der 1970er Jahre nicht zuletzt anhand ihrer Geschichten. Schlaglichtartig erhellen sie ihre Zeit, deren Denken und Geist, lassen uns historische Momente erleben, in denen sich Entwicklungen vollziehen und Ideen Bahn brechen. Gleichzeitig zoomen wir mit der Kamera aus dem jeweiligen Geschehen wieder heraus und betrachten es vor seinen zeitgeschichtlichen Kulissen. Dabei entsteht naturgemäß keine Enzyklopädie, sondern ein buntes Kaleidoskop, das sich erst in der Summe seiner Teile zum Ganzen runden kann. Selbstverständlich beschränkt diese Erzähltechnik das Geschehen auf einzelne Figuren und Geschichten, und selbstverständlich erhebt sie nicht den Anspruch, eine umfassende historische Darstellung zu sein.
»Im Vogelkäfig«: Nicht jeder musikalische Impuls stößt auf Anhieb auf Verständnis – so zeigte sich die Kritik anfänglich irritiert auch von Pink Floyds THE DARK SIDE OF THE MOON.
Natürlich kann hier nicht jede/r verdiente/r Musiker/in in der gebührenden Weise vorgestellt und nicht jeder stilistische Impuls mit der gebotenen Ausführlichkeit gewürdigt werden. Es ging mir darum, die großen, stilbildenden und einflussreichen Entwicklungsstränge zu beleuchten und gleichzeitig einigen bedeutenden Akteuren über die Schulter zu blicken, die untrennbar mit dem musikalischen Lauf der Dinge verbunden sind. Dabei sollten sie soweit möglich selbst zu Wort kommen. Schließlich waren sie dabei.
Ansonsten aber gilt: Nichts kann die emotionale Geschichte dieses Jahrzehnts besser erzählen als die Musik selbst. Und die führte über wilde Wasser.
4. Mai 1970»Verdammt, die haben einen umgebracht!«
Singer-Songwriter und Softrock: Wie Los Angeles zur Welthauptstadt des Pop wurde
Es ist Mittagszeit an diesem Montag, wenige Minuten vor halb eins. Die Sonne steht hoch. Die Schatten sind kurz und die Bäume so früh im Jahr noch fast kahl. Wie stumme Zeugen wachen sie im Hintergrund des Geländes. Weiter vorn ein paar Menschen, auf der löchrigen Rasenfläche wirken sie wie erstarrt, unfähig, sich zu bewegen. In ihren Gesichtern Erstaunen, Verwirrung, Neugier und Entsetzen. Ihre Blicke sind auf einen Mann gerichtet, der reglos vor ihnen auf dem Asphalt liegt. Sein Kopf ist vom Betrachter weggedreht, zu sehen ist nur ein dichter, dunkler Haarschopf. Von dort schlängelt sich ein blutiges Rinnsal zum Bordstein. Er liegt auf dem Bauch, die Hände unter der Brust verschränkt, die Beine lang ausgestreckt. Hinter ihm kniet eine junge Frau, die Augen geschlossen, der Kopf zurückgeworfen, der Mund weit geöffnet. Den einen Arm hat sie vorwurfsvoll erhoben, mit dem anderen scheint sie sich an einem neben ihr stehenden Mann mit Fransenlederjacke und Chelsea-Boots festzuhalten. Das Mädchen – wie sich herausstellen wird, ist es die erst 14-jährige Mary Ann Vecchio aus dem Städtchen Opa-locka in Florida – schreit.
Four dead in Ohio: John Filos berühmtes Foto, entstanden am 4. Mai 1970 nach den tödlichen Schüssen während einer Demonstration an der Kent State University, Ohio.
Das später mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Foto von John Filo wird am 4. Mai 1970 auf dem Campus der Kent State University in Ohio aufgenommen. Filo ist einer von rund 3000 Studenten, die sich an diesem Tag auf dem Gelände versammelt haben, um gegen den wenige Tage zuvor am 30. April von Präsident Nixon verkündeten Einmarsch der US-Truppen in Kambodscha zu demonstrieren.
Es ist ein Montag in Kent. Und schon am vorausgegangenen Wochenende ist in dem kleinen Universitätsstädtchen der Teufel los gewesen. Angefangen hat es bereits am Freitag, dem 1. Mai, als mehr als 500 Studenten demonstrieren und die Polizei vergeblich versucht, die Versammlung mit dem Einsatz von Tränengas aufzulösen. Der Bürgermeister verhängt daraufhin den Ausnahmezustand und fordert beim Gouverneur ein Kontingent der Nationalgarde an. Die Studenten wiederum zünden ein altes Holzhaus auf dem Campus an, das für Offiziersanwärterkurse der Army reserviert ist. Als die Feuerwehr versucht, den Brand zu löschen, kommt es zu weiteren Auseinandersetzungen, in deren Verlauf Steine fliegen und Feuerwehrschläuche durchgeschnitten werden. Kurzum: Seit diesem Samstag eskaliert die Situation.
Chrissie HyndeHynde, Chrissie, damals 18 Jahre alt und noch eine ganze Dekade entfernt von ihrem späteren Rockruhm mit den PretendersPretenders, studiert im ersten Semester an der Kent State University und wird die Stimmung auf dem Campus später in ihrer Autobiographie Reckless beschreiben:
Jeder, der in Kent wohnte, machte sich auf den Weg zum Unigelände. Die Atmosphäre war aufgeladen. Es fühlte sich gut an, unsere Ansichten über den Krieg deutlich zu zeigen. Unsere Stimme zählte, und wir fühlten uns verbunden mit unseren Brüdern und Schwestern im ganzen Land. Klare Sache!3
Am Montagmittag dann findet eine erneute Demonstration statt. Circa 3000 Studenten sind zu diesem Zeitpunkt auf dem Gelände, etwa 500 bilden den harten Kern der Protestierenden. Die mit Bajonett-Schnellfeuergewehren bewaffnete Nationalgarde marschiert auf und bezieht Stellung auf einer Anhöhe. Chrissie HyndeHynde, Chrissie ist vor Ort:
Auf der leicht hügeligen Rasenfläche zwischen den Unigebäuden wimmelte es von Studenten. Noch nie hatte ich dort so viele Menschen gesehen. Zunächst konnte ich nicht erkennen, was noch von dem abgebrannten ROTC-Gebäude übrig war, und daher drängte ich mich durch die Menge. Dann hörte ich dieses Tatatatatatatatatatatatat. Erst dachte ich, es wäre ein Feuerwerk. Eine geisterhafte Stille senkte sich über das Gelände. Bis auf einmal die Stimme eines jungen Typen zu hören war: »Verdammt, die haben einen umgebracht!«4
Nicht nur einen. Die Nationalgardisten haben plötzlich und ohne Vorwarnung mit scharfer Munition gezielt in die Menge der Studenten geschossen. Bei der späteren Untersuchung der Vorfälle wird festgestellt, dass innerhalb von 13 Sekunden 67 Kugeln abgefeuert wurden, vier von ihnen tödlich. Zu den Todesopfern zählen die an der eigentlichen Kundgebung unbeteiligten Studenten Sandra Scheuer und William Knox Schneider, die sich gerade auf dem Weg zu einer Vorlesung befanden. Allison Krause und Jeffrey Miller dagegen gehören zu den Demonstranten. Ermittlungen ergeben, dass die Opfer durchschnittlich mehr als 100 Meter von den Schützen der Nationalgarde entfernt gewesen waren. Weitere neun Studenten werden bei der Schießerei zum Teil schwer verletzt.
Die 23-jährige Patti SmithSmith, Patti, die sich in diesem Frühling ein paar hundert Meilen weiter östlich in der New Yorker Hipsterszene rund um Andy WarholsWarhol, Andy Factory herumtreibt, besucht an diesem Tag das Max’s Kansas City in Manhattans Park Avenue. Lakonisch kommentiert die spätere Rockpoetin die Stimmung an jenem Abend in ihrer Autobiographie: »Es galt als ausgemacht, dass die Regierung korrupt und der Vietnamkrieg falsch war, aber nun lag das Leichentuch der Kent State University über der ganzen Vorstellung, es wurde kein guter Abend.«5
»Eine Nation im Krieg mit sich selbst«
Seit Jahren schon führten die Vereinigten Staaten diesen Krieg auf der anderen Seite des Erdballs, zunächst in Vietnam, nun also auch in Kambodscha, und niemand wusste, wofür das gut sein sollte. Der männliche Teil der Jugend musste mit Erreichen des 18. Lebensjahres jederzeit damit rechnen, von Uncle Sam in die Army gezwungen zu werden. Und das oft genug mit Hilfe fragwürdiger Auswahlkriterien. Prominente Weiße, etwa Senatorensöhne und Film- oder Sportstars, konnten ruhiger schlafen als gewöhnliche junge Männer.
Nicht nur in den USA, spätestens seit 1967 auch im Rest der westlichen Welt, sogar in Japan, war die Generation der Babyboomer aufgestanden, um ihren Protest gegen diesen schmutzigen Krieg lautstark zu artikulieren und dessen rasches Ende zu fordern. Erreicht hatte sie nichts, selbst die massenhaften und gewalttätigen Ausschreitungen des berüchtigten 1968er Jahres hatten nicht viel mehr gebracht als eine Zuspitzung des Konflikts, in dem sich das Establishment als ein zu starker Gegner erwiesen hatte. Ende 1968 war der Republikaner Richard Nixon zum neuen US-Präsidenten gewählt worden, und der sollte sich als letzter Sargnagel auf den Hoffnungen der Hippie-Generation erweisen. Zwar hatte Nixon bei seinem Amtsantritt versprochen, den Krieg keinesfalls auszuweiten und sich stattdessen um einen »anständigen Frieden« zu bemühen. Nun aber marschierten US-Truppen in Kambodscha ein, weil dort angeblich jede Menge Vietcong-Partisanen untergetaucht waren.
Im Frühling dieses Jahres 1970 standen die USA am Rande eines Bürgerkrieges. Der Generationenkonflikt, ein Clash zwischen Alt und Jung, zwischen dem Gestern und dem Heute, zwischen Macht und Moral, war in der Mitte der amerikanischen Gesellschaft angekommen. Hatte man die seit den 1950er Jahren schwelenden und spätestens im Sommer 1967 offen ausgebrochenen Rassenunruhen noch als ein Problem der afroamerikanischen Bevölkerung ausblenden und den rustikalen Polizeieinsatz gegen protestierende Studenten beim Parteikonvent der Demokraten in Chicago als eine bedauerliche, aber einmalige Entgleisung in der Auseinandersetzung mit einer radikalisierten Minderheit abtun können, so war inzwischen einfach zu viel passiert, um sich weiterhin behaglich im Sessel zurückzulehnen. Und vielen dämmerte, dass irgendetwas an diesem Krieg ziemlich faul war. Die Zweifel an seiner moralischen Berechtigung wurden massiv, und sie beschränkten sich nicht mehr nur auf jugendliche Dropouts und weltfremde Hippies.
Als dann vier unschuldige Studenten tot auf dem Campus der Kent State University lagen, schien der Vietnamkrieg im eigenen Land angekommen zu sein. Fernsehen, Zeitungen und sonstige Medien berichteten. Und sie zeigten Fotos, auch das von John Filo. In den nächsten Tagen wurden rund 450 der rund 2100 Colleges und Universitäten des Landes bestreikt. An manchen kam es im Rahmen von Demonstrationen zu weiteren Zusammenstößen mit den Behörden, so etwa in New York, wo es beim sogenannten »Hard Hat Riot« mehr als 70 Verletzte gab. Statt die Wogen zu glätten, goss Präsident Nixon nun auch noch Öl ins Feuer, indem er zu den Vorgängen in Kent wenig einfühlsame Kommentare gab und im Zusammenhang mit den Demonstranten von »Bums« (deutsch etwa »Penner« oder »Gammler«) sprach. Der Vater von Allison Krause, einer der in Kent zu Tode gekommenen Studentinnen, sah sich genötigt, im nationalen Fernsehprogramm klarzustellen: »Meine Tochter war keine Gammlerin.«
Die vietnamkritische Öffentlichkeit schäumte vor Wut. Am 9. Mai dann kam es in Washington D.C. zu einer Massenkundgebung gegen den Vietnamkrieg und die Schüsse von Kent. Rund 100 000 Menschen nahmen teil. Am Rande der Veranstaltung gingen nicht nur ein paar Fensterscheiben zu Bruch, wie sich Nixons damaliger Redenschreiber Ray Kent später erinnerte:
Die Stadt war ein bewaffnetes Lager. Der Mob warf nicht nur Scheiben ein, schlitzte Reifen auf und schob Autos auf Kreuzungen, sie warfen sogar Federbettgestelle von Überführungen hinunter in den fließenden Verkehr. Das war ihr Statement, Studentenprotest. Das ist kein Studentenprotest, sondern Bürgerkrieg.6
Und Nixon-Berater Charles Colson notierte: »Das hier ist eine Nation im Krieg mit sich selbst.«7 Nixon selbst hatte es aus Sicherheitsgründen vorgezogen, sich für zwei Tage an seinen Urlaubssitz Camp David fliegen zu lassen. Der Präsident hatte sich aus der Schusslinie entfernt. Chrissie HyndeHynde, Chrissie erinnert sich an den Freund ihrer Freundin Cindy, den John Filo fotografiert hatte: »Jeff Miller blieb jedoch da. Er konnte nicht mehr aufstehen, sondern lag am Boden, das Gesicht nach unten. Blut strömte aus seinem leblosen Körper und rann in die nächste Gosse.«8
Bis heute wurde niemand für die Morde zur Verantwortung gezogen. Und es bleibt weiterhin ungeklärt, ob die Gardisten aus eigenem Antrieb oder auf Befehl hin geschossen haben.
Stadtschreier der Gegenkultur
Nicht nur in den großen Metropolen des Landes hatte sich in Windeseile herumgesprochen, was in Kent passiert war, die Nachricht drang auch in die abgelegeneren Ecken des Landes. Zum Beispiel nach Pescadero, Kalifornien, eine gute Autostunde südlich von San Francisco gelegen. Im Westen des kleinen Ortes, in dem nur ein paar hundert Seelen leben, rauschen die Wellen des Pazifiks gegen die felsige Küste, östlich erheben sich die sanften Hügel des Butano State Parks mit ihren dichten Wäldern. Steve CohenCohen, Steve besitzt dort eine Jagdhütte, und im Mai des Jahres 1970 bekommt er Besuch von seinen beiden Chefs. Cohen verdient sein Geld als Beleuchter bei Rockkonzerten, und zu dieser Zeit gehört er zur festen Crew der neuen Supergroup Crosby, Stills, Nash & YoungCrosby, Stills, Nash & Young.
Für die Band hätte es in diesem Frühling nicht besser laufen können: Im März ist ihr zweites Studioalbum DÉJÀ VU erschienen, für das bereits zwei Millionen Vorbestellungen eingegangen waren. Prompt rollt das Werk die US-Hitlisten von hinten auf, in der dritten Maiwoche löst es BRIDGE OVER TROUBLED WATER von Simon & GarfunkelSimon & Garfunkel auf Platz eins der Billboard-Charts ab. Für den Frühsommer ist eine umfangreiche US-Tournee angesetzt. Zuvor aber wollen David CrosbyCrosby, David und Neil YoungYoung, Neil noch ein paar Tage lang ausspannen. Sie fahren nach Pescadero, um dort Kraft in der Natur zu tanken. Es ist der 20. Mai 1970. Graham NashNash, Graham berichtet in seiner Autobiographie Wild Tales:
Die beiden hatten einen Ausflug nach Butano Canyon unternommen, um einen fetten Joint zu rauchen und die Riesenmammutbäume zu bewundern. In der Zwischenzeit war Steve CohenCohen, Steve zum Einkaufen auf dem Markt gewesen und kam mit einer Zeitschrift zurück, in der John Filos legendäres Foto von einem Mädchen abgedruckt war, das neben einem erschossenen Kommilitonen kniet. Croz (Crosby) schaute es sich mit wachsendem Schrecken an und reichte die Zeitschrift dann an Neil weiter, der seine Gitarre nahm, hinaus in die Wälder ging und eine halbe Stunde später mit einem fantastischen neuen Song zurückkam: »Ohio«. Er änderte nichts mehr daran, glättete ihn nicht. Der fertige Song entsprach seiner unmittelbaren Reaktion auf den Vorfall. Croz rief mich an und sagte: »Wir müssen alle sofort ins Studio.«9
Schon am nächsten Abend stehen David CrosbyCrosby, David, Stephen StillsStills, Stephen, Graham NashNash, Graham und Neil YoungYoung, Neil zusammen mit ihrer Rhythmusgruppe – Calvin SamuelsSamuels, Calvin (Bass) und Johnny BarbataBarbata, Johnny (Drums) – im Record Plant Studio in Los Angeles und nehmen »Ohio« auf.
Künstler als Chronisten: Neil YoungYoung, Neil (2. v. r.) schrieb »Ohio« über das Kent-State-Massaker und nahm den Song mit Graham NashNash, Graham (l.), David CrosbyCrosby, David (2. v. l.) und Stephen StillsStills, Stephen (r.) auf.
Dabei verzichten sie auf überflüssigen Aufwand, nach wenigen Takes ist der live gespielte Song im Kasten. Als B-Seite für die geplante Single spielen sie noch Stills’Stills, Stephen neue Komposition »Find the Cost of Freedom« aufs Band. Anschließend ziehen sie wieder von dannen.
Tin soldiers and Nixon coming,
We’re finally on our own.
This summer I hear the drumming,
Four dead in Ohio.
Gotta get down to it
Soldiers are gunning us down
Should have been done long ago.
What if you knew her
And found her dead on the ground
How can you run when you know? […]
Am nächsten Abend spielt die Band dem zufällig gerade in L.A. weilenden Ahmet ErtegunErtegun, Ahmet, Boss des CSN&Y-Labels Atlantic Records, die Aufnahmen vor, verbunden mit einer dringenden Bitte. NashNash, Graham:
»Wir wollen die Platte sofort veröffentlichen«, sagten wir. »Der Skandal ist einfach zu groß. Das Land hat angefangen, seine eigenen Kinder zu erschießen. Alles gerät außer Kontrolle.« »Aber ›Teach Your Children‹ ist gerade auf dem Weg auf Platz eins der Charts«, sagte er. »Scheiß drauf!«, sagte ich. Er schaute mich ungläubig an. »Graham, du wirst damit einen Tophit haben!« »Mir egal. Scheiß drauf.«10
ErtegunErtegun, Ahmet lässt sich überzeugen. Persönlich sorgt er nun dafür, dass die neue Single nur zwei Wochen später in den Läden steht. Mit einem Cover im Übrigen, auf dem die amerikanische Bill of Rights (sozusagen das amerikanische Grundgesetz) abgedruckt ist. NashNash, Graham und seine Mitstreiter sind stolz, denn sie empfinden sich als »Stadtschreier, die laut riefen: ›Es ist zwölf Uhr, und nichts ist in Ordnung.‹«11 Und als solche werden sie in ihrer Generation auch wahrgenommen. Noch einmal Patti SmithSmith, Patti, die Crosby, Stills, Nash & YoungCrosby, Stills, Nash & Young am 5. Juni 1970 im New Yorker Fillmore East live erlebt:
Die Band war wirklich nichts für mich, aber von Neil YoungsYoung, Neil Auftritt war ich ergriffen; sein Song »Ohio« hatte bei mir tiefen Eindruck hinterlassen. Für mich manifestierte sich in dem Song die Rolle des Künstlers als Chronist …12
»Trau keinem über dreißig!«
Künstler als Stadtschreier? Popmusiker als Chronisten? Eine Idee, auf die weder Frank SinatraSinatra, Frank noch Elvis PresleyPresley, Elvis gekommen wären. Und selbst die BeatlesBeatles hätten den Gedanken in ihren ersten Jahren weit von sich gewiesen. Dass Pop ein paar Jahre nach Sgt. Pepper sehr wohl – zwar nicht nur, aber oft genug – politisch war, hatte mehrere Gründe. Zunächst einmal: Die Zeiten waren nun mal aufgewühlt und geprägt von scharfen Auseinandersetzungen. Und die hatten ihre gemeinsame Wurzel, egal, worum es dabei konkret gerade ging, in einem grundsätzlichen Konflikt, dem Generationenkonflikt. Oder wie die Jungen das empfanden: dem von Gut gegen Böse.
Die Popmusik spielte dabei längst eine Rolle, die weit über ihre gewöhnliche Unterhaltungsfunktion hinausging. Dort, wo sie begann, hatten die Erwachsenen nichts mehr verloren. Ihre Welt endete da, wo das »Smoke on the Water«-Riff von Ritchie BlackmoreBlackmore, Ritchie und die Synthesizer-Sequenz von The WhosThe Who »Won’t Get Fooled Again« ertönten. Hinter dieser Grenze lag das Reich der Jugendkultur, und die hatte nicht umsonst schon in den 1960ern formuliert: »Trau keinem über dreißig!« Die Musik artikulierte, was in diesem Reich vor sich ging, was dort gedacht und wie gefühlt wurde. Manchmal war sie großkotzig, manchmal albern, manchmal neurotisch und manchmal banal. Aber sie gehörte den Kids. Nicht jede Musik aber, die sich jung gab und in den Charts notiert war, kam an bei den Adressaten, deren Antennen für das, was man heute »Fake News« nennen würde, fein justiert waren. Da aber, wo Sound, Absender und Message ein schlüssiges Paket bildeten, funktionierte die Kommunikation. Nicht nur mit Hilfe der Songtexte, mindestens ebenso wichtig waren der emotionale, sinnliche, abenteuerliche und mitunter rüde Sound der Rockmusik und natürlich ihre schiere Lautstärke: »Play it loud« stand auf vielen Alben geschrieben. Allein das wirkte als Affront gegen die gepflegte Unterhaltungskultur der Generation 30plus.
So hatte der Pop der 1960er Jahre eine identitätsstiftende Kraft entwickelt, die er in dieser Form zuvor nie gehabt hatte, wenn man von dem kurzen Moment einmal absieht, als Elvis PresleyPresley, Elvis in den mittleren 1950er Jahren auf den Plan getreten war. Da allerdings hatte sich die Revolte auf ein Teenagerpublikum beschränkt, das sich um politische Fragen nicht scherte. Nur allzu schnell und bereitwillig war der Mann aus Memphis dann auch in Hollywoods Arme gesunken, hatte alles Rebellische abgelegt und später keinen Hehl mehr daraus gemacht, dass er mit der Gegenkultur der nachgewachsenen Generation und mit deren Musik nichts anfangen konnte. Zwar war ihm 1968 eine erfolgreiche Rückkehr auf die Bühne und in die Charts gelungen, Einfluss auf die Popkultur aber hatte er da schon längst nicht mehr. Groovy war Elvis nicht.
Das waren zu Beginn der 1970er Jahre andere. Zum Beispiel Crosby, Stills, Nash & YoungCrosby, Stills, Nash & Young. Sie sangen von den Dingen, die auch im Leben ihres Publikums eine Rolle spielten. Vom Vietnamkrieg, von den Freuden des Drogenkonsums, von ihren Träumen und von ihren Ängsten – Themen, die im Pop erst in dem Maß relevant geworden waren, als sich ein relativ erwachsenes Undergroundpublikum gebildet hatte, das die Sprache der Rockmusik verstand und sich in den Boy-meets-Girl-Märchen des Charthits nicht länger mehr wiederfinden konnte.
Die kalifornischen BeatlesBeatles
Crosby, Stills, Nash & YoungCrosby, Stills, Nash & Young bedienten diese Klientel, die spätestens seit Woodstock ein mächtiger Marktfaktor geworden war, und sie waren auf diese Weise gleichsam zu den neuen Beatles geworden. Mit seinen Zottelmähnen und erdfarbenen Klamotten wirkte das Quartett allerdings so ganz anders als die Liverpooler. CSN&Y waren sanfter und tiefgründiger, vier grundverschiedene Typen, mit denen sich jeder Hippie identifizieren konnte. Da war der fröhliche Haudrauf David CrosbyCrosby, David mit seinem verwegenen Walross-Schnauzbart, der scheue, geheimnisvolle Neil YoungYoung, Neil, der kühle, ein wenig mürrische Straßenrowdy Stephen StillsStills, Stephen und der unkomplizierte Beau Graham NashNash, Graham. Ein Muster, das erstaunliche Parallelen zu dem der Fab Four aufwies, dies allerdings rein zufällig, denn wenn es etwas gab, dem sich die neue Generation der amerikanischen Songkünstler verweigerte, dann war es das im Showbusiness praktizierte zielgruppengerechte Marketing. Was nicht hieß, dass die Besten dieser neuen Musikergarde nicht mindestens ebenso ehrgeizig gewesen wären wie ihre Vorgänger.
Zusammengekommen war diese unbestrittene First Brotherhood der jungen Musikszene, die sich in den Canyons von Los Angeles gesammelt hatte, im Herbst des Jahres 1968. Und die Umstände stehen beispielhaft für den Paradigmenwechsel, der sich zu dieser Zeit im Pop vollzog. Graham NashNash, Graham, damals 26 Jahre alt, konnte als Gründungsmitglied der englischen HolliesHollies bereits auf eine immens erfolgreiche Popkarriere zurückblicken. Die Band aus Manchester gehörte zu den neben BeatlesBeatles, Rolling StonesRolling Stones und KinksKinks erfolgreichsten Exporten des britischen Beat-Booms. Spätestens 1967 aber hatte Nash von den stromlinienförmigen Hitparadensongs der Hollies (»Bus Stop«, »Jennifer Eccles«) die Nase voll, und der erklärte DylanDylan, Bob-Fan begann komplexeres Material zu schreiben. Dabei entfernte er sich lyrisch von den alten Klischees, verstand sich nicht länger als Dienstleister des Showbiz und betrachtete sich zunehmend als Künstler mit ernster und explizit politischer Message. Der Rest seiner Band aber beharrte auf dem bewährten Popkurs – mit der Folge, dass Nashs Songs, darunter auch einer mit dem Titel »Marrakesh Express«, der später zu den bekanntesten von CSN zählen sollte, von den Hollies abgelehnt wurden. Stattdessen fasste man den Plan, ein Album mit schwülstigen Popinterpretationen von Dylan-Songs einzuspielen. Nash empfand das als Sakrileg und zog im Spätsommer 1968 die Konsequenzen. Während eines Besuchs in Los Angeles im Haus seiner neuen Freundin, der soeben landesweit durchstartenden Sängerin und Songwriterin Joni MitchellMitchell, Joni, traf er auf David CrosbyCrosby, David und Stephen StillsStills, Stephen. Die drei entdeckten, dass ihre Gesangsstimmen aufs vorzüglichste miteinander harmonierten, und beschlossen daraufhin, gemeinsam Musik zu machen. NashNash, Graham verließ die HolliesHollies, und wenig später schon stand er mit Crosby und Stills im Plattenstudio.
Auch seine beiden Mitstreiter hatten 1968 bereits ihre Spuren in der US-Musikszene hinterlassen. David CrosbyCrosby, David, geboren 1941, hatte zu den Gründungsmitgliedern der ByrdsByrds gehört, die mit »Mr. Tambourine Man« und »Turn! Turn! Turn!« die Blaupause für den amerikanischen Folkrock geschaffen hatten. Nach einem Streit im Sommer 1967 beim Monterey Pop Festival, wo er nach seinem Auftritt mit den Byrds auch bei den Kollegen von Buffalo SpringfieldBuffalo Springfield auf die Bühne gestiegen war, hatte Crosby seinen Abschied eingereicht. Buffalo Springfield wiederum waren zu jener Zeit in Los Angeles das Ding der Stunde, hatten mit »For What it’s Worth« einen landesweiten Hit gelandet und gezeigt, was alles ging, wenn man den englischen Beatles-BeatBeatles mit Folk, Country, Acidrock und dem Instrumentarium der modernen Studiotechnik kombinierte. Wie die ByrdsByrds wurde allerdings auch diese Gruppe von einem explosiven Duo geleitet: Stephen Stills und Neil YoungYoung, Neil. Lange konnte das nicht gutgehen, und 1968 brach die Band unter der Last ihrer Monster-Egos auseinander. Buffalo SpringfieldBuffalo Springfield hatten zwar nur kurze Zeit existiert, ihr Einfluss auf die im Wandel begriffene Musikkultur der Westküste jener Jahre lässt sich dennoch kaum überschätzen.
Crosby hatte sich bald zur zentralen Figur der noch kaum flüggen L.A.-Szene gemausert. Umtriebig und notorisch gut gelaunt, kannte er bald jeden Musiker, der in die Stadt kam. Und das waren zu jener Zeit viele. CrosbyCrosby, David hatte seine Fühler in alle Richtungen ausgefahren. Es war also nur eine Frage der Zeit, dass sich in seinem Dunstkreis Entscheidendes tun würde. Jackson BrowneBrowne, Jackson, damals 20 Jahre alter Newcomer und nach einem New-York-Aufenthalt gerade erst an die Westküste zurückgekehrt, beschrieb den Kollegen einmal so: »Er hatte diesen legendären VW-Bus mit Porsche-Motor drin, und das brachte es auf den Punkt – ein Hippie mit Power!«13 Der Texaner Stephen StillsStills, Stephen, damals 23 Jahre alt, zählte zu diesem Zeitpunkt ebenfalls zu den Szenefürsten rund um die Hollywood Hills. Er war kreuz und quer in den Staaten unterwegs gewesen und darüber zu einem der versiertesten Gitarristen, ausdrucksvollen Sänger und potenten Songwriter gereift.
Zum Ende des Jahrzehnts war die Zeit also reif für die erste Hippie-Supergroup. Mit ihrem im Mai 1969 veröffentlichten Debütalbum im Gepäck schafften Crosby, Stills & Nash dann auch bereits bei ihrem zweiten Auftritt überhaupt, dem Gastspiel beim Woodstock Festival im August desselben Jahres, den nationalen Durchbruch. Da allerdings waren sie schon zu viert: Neil YoungYoung, Neil war inzwischen zu dem Trio dazugestoßen.
Barhocker und Hippiegarderobe
CSN&Y führten die Herde an. Die sonnendurchfluteten, idyllisch in den Hügeln westlich von Hollywood gelegenen Canyons brachten eine bald kaum mehr zu überhörende Schwemme von jungen Musikern hervor. Eine der populärsten stilistischen Strömungen repräsentierten dabei zwei Bands, die versuchten, die Rockmusik mit dem bis dahin als reaktionär verachteten Erbe der Country-Music zu versöhnen: PocoPoco und die Flying Burrito BrothersFlying Burrito Brothers.
Letztere wurden angeführt von Gram ParsonsParsons, Gram, dem ebenso labilen wie vermögenden Spross einer Südstaaten-Familiendynastie, die ihr Geld mit dem Anbau von Zitrusfrüchten gemacht hatte. Sein Partner war Chris HillmanHillman, Chris, ein Bassist, Gitarrist und Songwriter, der sich zu den zahlreichen ByrdsByrds-Flüchtlingen gesellt hatte, zu denen nach einem kurzen Gastspiel auch ParsonsParsons, Gram gehörte. Gemeinsam hatten die beiden die »Mr. Tambourine«-Truppe 1968 auf den Country-Geschmack gebracht und mit ihr das epochale Album SWEETHEART OF THE RODEO aufgenommen, das sich jedoch als kommerzieller Totalflop entpuppte.
Die BurritosFlying Burrito Brothers jedenfalls gelten als die Ersten, denen eine schlüssige Formel dessen gelang, was als »Countryrock« in den folgenden Jahren zum Schlagwort wurde. Die andere Band, die dieses Genre prägte, PocoPoco, wurde zwar schnell für ihre großartigen Konzerte berühmt, litt aber von Anfang an unter ständigen Personalwechseln. Sie ging dann auch in erster Linie als unerschöpfliches Talentreservoir für andere Bands in die Geschichte ein. Nicht wenigen erschien Countryrock zu Beginn der 1970er Jahre als das nächste große Ding. Letztlich aber blieb er eine Fußnote, auch wenn er als Idee großen Einfluss auf die damalige Szene ausübte und dazu als Startrampe für den Höhenflug der erfolgreichsten aller amerikanischen Bands, der EaglesEagles, diente.
Als wesentlich langlebiger und kommerziell ergiebiger sollte sich dagegen das Konzept der Singer-Songwriter erweisen. Der sperrige Begriff benannte den entscheidenden Punkt: Es handelte sich um Sänger und Sängerinnen, die ihre Songs selbst schrieben. Natürlich hatte es das auch vorher schon gegeben, allerdings waren singende Songwriter bislang eher im Folk, Country oder Rockabilly beheimatet gewesen und im Pop kaum je aufgetaucht (Ausnahmen wie Buddy HollyHolly, Buddy bestätigen diese Regel). Mit Bob DylanDylan, Bob hatte sich das geändert. Inzwischen hatte der fruchtbare Humus der seit den 1950er Jahren florierenden Folkszene, die sich landauf, landab in den Coffeehouses der Universitäten und in den Clubs der großen und kleinen Metropolen tummelte, eine neue Generation von Musikern hervorgebracht. Sie schrieb ihre eigenen Lieder.
So unterschiedlich die Herkunft der Künstler sein mochte und so divers sie sich stilistisch präsentierten, eins war ihnen fast allen gemein: Ihre Songs schlugen einen neuen Ton an – privat, introvertiert, tendenziell leise und eindringlich. Nichtsdestotrotz gelegentlich auch aufmüpfig. Der Geist von Woodstock war schließlich allgegenwärtig: »Gimme an F! Gimme a U! Gimme a C! Gimme a K! What’s that spell?« Dennoch: Im Mittelpunkt der poetischen Betrachtungen stand klar das Ich. Zwar brachte diese neue Generation ihre Lieder noch immer vornehmlich mit Akustikklampfe oder am Klavier zu Gehör, reicherte sie dazu aber gerne mit Elementen aus Pop und Rock an – neben der elektrischen Gitarre und einer Rhythmusgruppe auch mit Keyboards und weiteren Instrumenten. Dennoch setzte man in der Performance auf Reduktion, verzichtete auf großes Besteck und stellte ganz gegen die alte Devise »It’s the singer, not the song!« bewusst den Song selbst in den Mittelpunkt.
Damit trafen die Singer-Songwriter, wie sie bald genannt wurden, den Nerv eines desillusionierten Publikums. Die Toten des vergangenen Jahrzehnts, auch der in Altamont, wo die als Ordner angeheuerten Hells Angels einen 18-jährigen Konzertbesucher während eines Rolling-Stones-Konzerts erstochen hatten, waren nicht vergessen.
Und nun gab es schon wieder vier Tote, diesmal in Ohio, kaum dass das neue Jahrzehnt angefangen hatte. Die Rolling StonesRolling Stones sangen »Gimme Shelter«, und genau das war es, was die Generation Woodstock suchte: Schutz und Rückzug – »up against the wall, motherfucker!«14 war gestern. Carole KingKing, Carole, die wohl erfolgreichste Singer-Songwriterin jener Jahre, erinnert sich an die damalige Stimmung:
Als wir auftauchten, war das eine kulturell turbulente Zeit mit großen Auseinandersetzungen zwischen den Generationen, und man konnte den Hunger nach diesem ganz persönlichen, vertraulichen Ding spüren, das wir machten.15
Und Jackson BrowneBrowne, Jackson