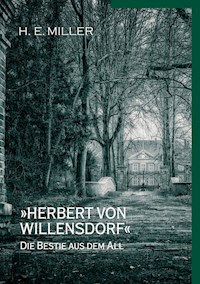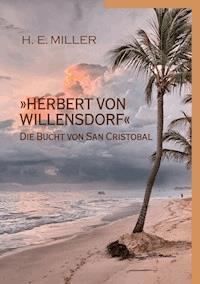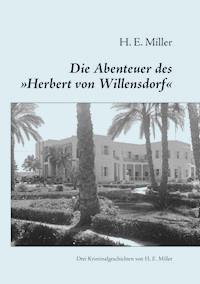
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
„Herbert“, sagte der Kommissar und richtete seine volle Aufmerksamkeit auf mich. „Wer sind Sie in Wirklichkeit?“ „Mein Name ist Herbert von Willensdorf und ich reise in der Welt umher, sozusagen ein ‚Abenteurer', immer auf der Suche nach den ultimativen Ferien. Und wie es der Zufall so will, gerate ich oft an solche ungelösten Kriminalfälle, welche ich dann mit Hilfe eines fähigen Polizisten meistens auch löse.“
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Wadi Halfa Palace Hotel
Kapitel Nächte in Wadi Halfa
Kapitel Die neue Masche
Kapitel Eine Shisha für Rick
Kapitel Das grosse Ding
Kapitel Es kam, wie es kommen musste
Kapitel Die entscheidende Begegnung
Kapitel Die gefährlichste Entscheidung
Kapitel Der Deal ist fast perfekt
Kapitel Der Tag der Entscheidung
Kapitel Auf welcher Seite stehen Sie?
Kapitel Ein Leben für das Abenteuer
Kapitel Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft
Kapitel Ein sauberer unkomplizierter Mord
Kapitel Die Wahrheit über Edi Kellermann
Kapitel Wo ein Willensdorf ist, ist auch ein Weg
Die Auferstehung des Pier Luigi Calzone
Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit
Vorwort
Liebe Literaturfreunde, liebe Leserinnen und Leser, es ist mir eine grosse Freude, Ihnen meinen neuen Kriminalroman vorzustellen. Einmal mehr werden Sie vor eine Herausforderung besonderer Art gestellt, denn nur die erfahrenen Kriminalleserinnen und -leser unter Ihnen werden diese selbstverständlich wahren Geschichten mindestens so routiniert wie unser Hauptakteur, Herbert von Willensdorf, welcher übrigens nicht unter seinem richtigen Namen »Uwe Wackelmeier« auftritt, zu lösen versuchen.
Denn, »Hand aufs Herz«, wer von Ihnen würde einen Kriminalroman zu Ende lesen, bei dem der Hobbykriminalist »Uwe Wackelmeier« heissen würde …
Abermals, in unbestechlicher Manier, lässt sich von Willensdorf weder von unwahrscheinlich attraktiven Frauen noch von unwahrscheinlich männlichen Männern beirren und fokussiert sich in einer nie da gewesenen Lösungsorientiertheit. Der Verfasser verzichtete bewusst auf die Schilderung blutiger Details, um Sie, meine lieben Leserinnen und Leser, nicht in Angst und Schrecken zu versetzen, obwohl es dennoch ratsam wäre, die Wohnungstüre zweimal gut zu verschliessen.«
Mir bleibt nur noch, Ihnen viel Vergnügen zu wünschen, mit der Hoffnung, Sie bei weiteren Abenteuern mit »Herbert von Willensdorf« einbeziehen zu können.
Der Autor: H. E. Miller
Wadi Halfa Palace Hotel
1. Kapitel
Nächte in Wadi Halfa
Langsam, aber bestimmt bewegte ich mich auf meine Hoteltüre zu. Es war nicht schwierig zu erkennen, dass dieses Hotel seine besten Jahre hinter sich gelassen hatte, auch wenn versucht wurde, mit üppigen Dekorationen die ausgelaugten Holzvertäfelungen zu kaschieren. Wie durch einen Filter hindurch waren Geräusche wahrzunehmen und trotzdem kam es mir so vor, als wäre ich der einzige Gast in diesem Hotel. Die Rezeption befand sich in einem kleinen schäbigen Raum, ohne Fenster, in dem ein überdimensionaler Schreibtisch, aus dem vorhergehenden Jahrhundert, mitten im Zimmer, lieblos platziert wurde. Quer durch den Raum hingen zahlreiche Stromkabel, aber nur eines führte zu einer von der Decke herabhängenden Glühbirne, welche wahrscheinlich Monate nicht, wenn nicht Jahre, gewechselt wurde. Bilder aus vergangenen Zeiten säumten die Wände. Ein Schild mit der Aufschrift »Hotelmanager« hing schräg über der verblichenen Türe, aber immer, wenn ich dieses Schild betrachtete, gab es mir das Gefühl, dass dieses Hotel seine Stattlichkeit nie gänzlich verloren hatte. Der Hoteleingang gestaltete sich sehr unscheinbar und unterschied sich nicht gross von den übrigen Hauseingängen dieser Strasse. Nur eine handgemalte Aufschrift liess erkennen, dass es sich um das »Wadi Halfa Palace Hotel« handelte, welches in keinem Reiseführer beschrieben war. Obwohl sich die Mittagshitze fast unerträglich anfühlte, war diese Strasse lebhaft bevölkert und man sehnte sich nach Sekunden, in denen nicht ein Hupen, ein Geschrei oder Sonstiges wahrzunehmen war.
Am Ende dieser staubigen, aber dennoch asphaltierten Strasse bildete ein offenes beschlagenes Holztor den Eingang zu einem Basar, in welchem spärlich Gewürze und Souvenirs angeboten wurden. Trotz der flimmernden Hitze schwitzte man nicht oder nur wenig. Ich erinnerte mich, wie ich in zahlreichen ausgedehnten Spaziergängen durch dieses Tor hindurchgegangen war und rechter Hand über die niedrigen Häuser, die mit Strohballen und irgendwelchem Abfall bedeckt waren, sah.
Die Wüste, welche sich bis zum Horizont erstreckte, all dies gab mir das Gefühl der Weite, welches ich so sehr vermisste, nach Wochen in stinkenden Grossstädten. Nur an drei Orten auf dieser Welt erlebt man diese Weite: auf dem Meer, in der Wüste und in den Bergen, wobei nachts die Milliarden von Sternen so greifbar sind und man sich als dazugehöriges Teilchen des Universums empfindet. Immer zog es mich in diese (scheinbar) trostlose Abgeschiedenheit, um in endlosen Wanderungen die Antworten zu finden, die mir bis jetzt niemand geben konnte.
In meinen philosophischen Studien ging es immer wieder um die Frage unseres Daseins, im Zusammenspiel mit der Gesellschaft, auf der Suche nach dem Ursprung des Göttlichen. Noch immer erschienen mir diese »elementaren Antworten« wie ein Blick durch unzählige Vorhänge hindurch. Die allgemeine Meinung, sich schlicht auf ein höheres Wesen zu beziehen, konnte mich bis anhin nicht befriedigen, auch deshalb nicht, weil wir uns auf Grund unserer »Unwissenheit« immer wieder darauf beziehen. Die Suche nach dem Gottesteilchen sowie auch die Erforschung des unendlichen Weltalls haben uns leider nicht sehr viel weitergebracht. Es ist bereits bewiesen worden, dass sich Darwin in einigen Anschauungen der »Evolutionstheorie« weitgehend irrte. Nicht der Urknall war der Anfang der göttlichen Energie. Vielleicht kommen wir der Antwort näher, wenn wir den Begriff »Unendlichkeit« besser zu verstehen beginnen.
Ich schloss meine Zimmertüre auf. Nichts, ausser dem spärlichen Licht, erhellte den Raum, welches in Streifen durch das geschlossene Lamellenrollo schien. Die schwülwarme Luft roch nach einer Mischung aus alten Mottenkugeln und dem allgegenwärtigen Gestank von Urin, welcher bei diesen Temperaturen so richtig zum Tragen kam, da meist die Hinterhöfe als Toiletten und Abfalldeponien benutzt wurden. Mein Zimmer, in dem ich mich umsah, als hätte ich es nie zuvor gesehen, war weiss getüncht und spärlich eingerichtet und die herabhängenden Spinnweben bewegten sich im schwachen Luftzug. Das große französische Bett war mit einem löchrigen Moskitonetz eingesäumt, welches seiner Bestimmung nicht mehr gerecht wurde. Der herabhängende Ventilator, den man nicht bedienen konnte, drehte sich langsam, wobei er ein Geräusch verursachte, wie von einem entfernten Schlagzeug in monotoner Langweiligkeit. Der schwache Luftzug wirbelte Staub auf, welcher im eintretenden Licht schwach glitzerte. Im kleinen Nebenraum war eine kleine Dusche unsachgemäss installiert und die kleine WC-Schüssel wirkte wie ein Fremdkörper. Wie oft war ich unter der Dusche gestanden (mit eingeseiftem Körper) und wusste nicht mit Bestimmtheit, ob beim Aufdrehen des Wasserhahns auch Wasser kommen würde. Ein an der Wand angebrachtes Lavabo war fleckig, und auch mit Zutun waren mit der Zeit die lebhaftesten Pilzkulturen entstanden, hätte ich es nicht hin und wieder mit einem alten Schwamm gereinigt.
Ich setzte mich auf den Rand des Bettes und schob das Laken zur Seite, um die Milben nicht bei ihrem Dasein zu stören. Warum musste ich mir das antun?, fragte ich mich, obwohl der darin liegende Grund so offensichtlich war. Es lag keineswegs an meinen finanziellen Verhältnissen, die hätten ein besseres Hotel erlaubt.
Langsam stand ich auf und zündete mir eine Zigarette an und zog genüsslich den beissenden Rauch tief in meine Lungen. Als ich gerade dabei war, die Fensterläden zu öffnen, klopfte es zaghaft an meine Türe. Ohne mich umzudrehen, als hätte ich es nicht gehört, schaute ich weiterhin auf die gegenüberliegende Strassenseite. Erneut klopfte es, dieses Mal etwas lauter. Mit farbloser Stimme rief ich »Herein« und begab mich mit langsamen Schritten zur Türe. Niemand ausser Francis wusste von meinem Aufenthaltsort. Nur einen kleinen Spalt öffnete ich die Türe und draussen (ungeduldig wartend) stand Francis in der Flurbeleuchtung.
»Komm schnell herein«, sagte ich zu ihm, und wie ein Besucher, den man nicht erwartete, trottete er ins Zimmer.
Francis war ein vorwitziger junger Mann, den es vor über 14 Jahren in diese Gegend verschlagen hatte, nachdem er mit allen Mitteln verhindern konnte, in den Militärdienst eingezogen zu werden. Seine Schüchternheit, welche sich vor allem beim weiblichen Geschlecht bemerkbar machte, überspielte er mit seiner schnippischen Art. Immer und immer wieder blitzte er bei Frauen ab, ausser bei jener »lesbischen Bordellbesitzerin« aus Toulouse, bei der er sich eingemietet hatte, konnte er seine Persönlichkeit ausleben. Sein Aussehen erinnerte mich an einen Strichjungen, den ich in Hongkong kennengelernt hatte, als ich einen Sushikoch des Mordes überführt hatte. Meine anschliessende Reise zu den Fidschi-Inseln war meine persönliche Belohnung, auf Grund meiner Strapazen in Hongkong.
Mit unbeholfenen Bewegungen kam Francis auf mich zu und klopfte mir auf die Schulter und lächelte in einer Art, die ich etwas überheblich fand, und sprach mit leiser Stimme: »Wenn wir nicht unvorsichtig sind und du die nötigen Verbindungen in die Wege leiten kannst, werden wir es schaffen.«
»Es muss dir aber bewusst sein, dass du einige Zeit auf dein Geld warten musst«, räumte ich ein.
»Einen Vorschuss wirst du mir sicher nicht absprechen können«, fügte Francis in einer fordernden Art dazu.
»50 Pfund ist das Äusserste, was ich dir im Moment geben kann, und rasieren könntest du dich auch mal wieder, obwohl ich es vorziehen würde, mit den beiden selbst zu verhandeln. Sollte etwas schiefgehen, wären wir nicht die Ersten, die wegen einer solchen Geschichte ihr Leben lassen müssen.«
Franics zuckte zusammen und sein Gesicht wurde blass, seine Hände schwitzten.
»Nein«, sagte er, mit einer sich beruhigenden Stimme. »Die werden doch nicht etwa?«
»Nein, nein, das wird in Vergessenheit geraten und zudem können wir nicht mehr als 50.000 Pfund dafür erwarten.«
»Wir werden sehen, wie viel dabei für uns herausspringt«, berichtete ich ihm. »Auf jeden Fall wirst du dich mit deinem Anteil nicht zur Ruhe setzen können, denke ich.«
In mir kamen erstmals Zweifel auf, obwohl, aufgrund meiner minutiösen Planung nichts schiefgehen konnte. Plötzlich hörten wir vom Flur herkommend laute Geräusche. Langsam öffnete ich die Türe einen kleinen Spalt und sah, wie sich Ahmet und Hassan in die Haare kriegten, wild gestikulierend, in einer Art, die ich (obwohl ich oft in arabischen Ländern war) absolut nicht mochte. Ein emotional geladenes Geplänkel, ohne wirklichen Grund, mit rüpelhafter Kommunikation. Oft genug war ich Zeuge solcher Auseinandersetzungen.
Anschließend begab ich mich in meinen Duschraum und wusch mir intensiv die Hände, obwohl es fraglich ist, ob solche Aufregungen mit sauberen Händen besser zu ertragen sind.
Francis hatte sich unterdessen auf einen Stuhl gesetzt und schaute meinem Treiben zu.
»Ist das deine Art, dich reinzuwaschen?«, rief er mir zu, und ich wurde wütend, weil ich nur zu gut wusste, dass er recht hatte.
2. Kapitel
Die neue Masche
Warst du einmal in Kabul?«, fragte ich Francis, um von dem leidigen Thema abzulenken.
»Nein«, antwortete Francis, nichtsahnend, was ich damit bezwecken wollte.
»Als ich im tiefverschneiten Kabul im Abdullah-Guest-House logierte, habe ich erstmals von einem Österreicher namens ›Alois Bösendorfer‹ von dieser Masche gehört. Wir waren bei minus 16 Grad eingeschneit und hatten genug Zeit, diese Masche auszuarbeiten, obwohl es sich in jener Version nur um Silber handelte und dies auch nur in kleinen Mengen. Trotz seiner Morphiumsucht war er klar bei Sinnen, nur sein Blick hatte einen Ausdruck, als schaue man durch ihn hindurch ins Leere, was mich hin und wieder erschaudern ließ. Wir teilten das Zimmer mit zwei Schweizern. Der Raum war mit Teppichen ausgelegt (wie es in solchen Gefilden üblich war), mit eingewobenen Mustern in uralter Tradition. Wenn man nach draussen in den wunderschönen Innenhof blickte, wurde man in eine Märchenwelt entführt, die mit ihren bizarren Skulpturen einen wunderschönen Kontrast zu der ebenen Schneedecke bildete. Immer wieder liess ich meinen Blick zu dem mit Mosaiksteinen gefliessten Brunnen gleiten. Er erweckte den Eindruck, als sei er aus dem Boden gewachsen. Das Tanzen der Schneeflocken unterstrich das Gefühl der Märchenwelt wie aus einer anderen Welt.
Mischka, der Koch des Guest-Houses, stammte aus Minsk und auch später blieb mir dieser schlaksige Russe in bester Erinnerung, weil er über seinen weiten Afghanhosen immer eine Frauenschürze trug. Er sprach nur holländisch und russisch, wobei ich das Holländische besser verstand. Meine vielzähligen Reisen in alle Herrenländer waren jeweils zu kurz, um die jeweilige Sprache zu erlernen.
Wir sassen in diesem Raum, abgeschottet von der Aussenwelt, und rauchten die traditionelle Wasserpfeife im tiefen Bewusstsein »Ruhe und Entspannung«, Zeit und Raum hatten aufgehört zu existieren, nur als Mischka die auf einem Holzherd zubereiteten Pancakes servierte, wurden wir von der Realität wieder eingeholt.
Jeden Morgen spielte ich mit Alois eine Schachpartie im Garten und kann mich nicht daran erinnern, einmal gewonnen zu haben. Auf Grund des teuren Anfeuerungsholzes hatte ich, mit all meinen Kleidern tragend, die Nächte in meinem Schlafsack verbracht. Die Ruhe der Nacht wurde durch das Abfeuern der zahlreichen Flakgeschütze unterbrochen, welche von russischen Belagerern gegen Kabul gerichtet wurden. Die Mudschaheddin und weitere Splittergruppen haben sich rings um Kabul in die Berge zurückgezogen und so waren es die in Kabul lebenden Zivilisten, welche darunter gelitten hatten.
Niemals war ich einer wirklichen Gefahr ausgesetzt und nie ängstlich, denn die Angst ist eher ein Privileg des Alters, wenn man dies so sagen kann. Der Grund dafür liegt in der Erfahrung, viel zu wissen und das zu wissen, was alles passieren könnte, falls man sich in Situationen begibt, welche schon tausend Male erlebt worden waren.
Keines dieser »negativen Erlebnisse« kann man mit positiven Gedanken verhindern, nur mit positivem Handeln.
Wir kennen zum Beispiel keine Statistik, welche belegt, wie viele Frauen nachts um 2 Uhr, im Anschluss an einen Partybesuch, alleine zu Fuss nach Hause gehen und »nicht« überfallen werden. Angst entwickelt sich nach und nach, von unseren ängstlichen Eltern vorgelebt. Es gibt nur zwei wirkliche Grundängste: Die eine ist die Angst vor dem Tod und die andere, weil wir nicht wissen, wann es passiert. Immer wieder stehen wir im Vergleich zu Statistiken, ohne zu merken, dass wir mit einer grossen Lüge konfrontiert werden, welche nur noch durch ein riesengrosses Lügenkonstrukt, welches uns die Medien vorgaukeln, übertroffen wird. Rechtspolitische Gruppierungen versuchen uns im Glauben zu lassen, dass unser ganzes »Unheil« durch Ausländer verursacht würde, und haben die Frechheit, uns dies mit Statistiken beweisen zu wollen. Gerade der Vielgereiste weiß, dass wir grenzenlos sind und unsere Psyche nur durch unsere eigenen Barrikaden begrenzt werden, indem wir nur einen Bruchteil unseres Potenzials nutzen. Es verdichtet sich die Ansicht, dass wir in unzähligen »Zwischenwelten« leben, auch als Parallelwelten definiert, wobei sich der Übergang vom Leben zum Tode innerhalb dieser Parallelwelten abspielt. Die unauslöschbare Energie jedes Menschen befindet sich in dieser Zwischenwelt. Die uns nahestehenden Verstorbenen, in Form ihrer Energie, entfernen sich gleichwohl wie wir uns dieser Wesen entbinden …
Francis schaute mich etwas entgeistert an und der Strassenlärm war wahrzunehmen, während der Deckenventilator unaufhörlich weitertrommelte.
3. Kapitel
Eine Shisha für Rick
Gemütlich schlenderten wir die Taalat Street hinunter, das eine oder andere Mal uns umschauend, obwohl es im Gewühl der Menschen wirklich einfach war, in eine Anonymität einzutauchen. Wir Europäer bewegen uns grundsätzlich schneller als Einheimische, so wie auch die Art des Gehens sich merklich unterscheidet. Nie sei ihm das aufgefallen, meinte Francis zu mir.
»Auf meinen Reisen durch Asien und Südafrika ist mir dieses Phänomen immer wieder aufgefallen«, sagte ich zu Francis in einem schon fast plaudernden Ton.
»Wie erklärst du dir dieses Phänomen?«, fragte Franics.
»Die Intensität der Betrachtung ist nur mit einer ruhigen und unaufgeregten Lebenshaltung möglich! Mit der Eile, welche uns Europäer scheinbar auszeichnet, sind wir unseren Glücksmomenten immer einen Schritt voraus.«
Ich dachte so für mich selber, dass Francis von all dem »nichts« begriffen hatte …
Ich bitte Sie, meine lieben Leserinnen und Leser, meine kleinen Ausflüge in die Welt der Psychologie zu entschuldigen. Ich werde mich in Zurückhaltung üben, um Sie, meine lieben Leserinnen und Leser, nicht von der eigentlichen Geschichte abzulenken …
Francis entdeckte am Ende der Seitenstrasse ein kleines Teehaus namens »Mohammed Inn«. Das Teehaus war etwas zur Strasse hinausgebaut. Die Korbstühle mit ihren abgewetzten Bezügen erinnerten mich an ein Pariser Café, in dem ich mich fast täglich mit Künstlern aus aller Welt über Kunst austauschte. Ich war fest entschlossen, meine damalige Freundin »Claudine« zu heiraten. Leider kam ich nie dahinter, ob sie sich mehr zu Männern oder Frauen hingezogen fühlte, denn die leidige Affäre dauerte nur sechs Wochen. Wir lebten in einer kleinen Pension an der Rue Sagosche. Wir liebten uns Tag und Nacht, bis sie mich wegen eines Golflehrers aus San Francisco verließ. Aus lauter Verzweiflung habe ich sechs Kilo an Körpergewicht zugelegt, was ich immer tue, wenn meine Probleme mich zum Essen animieren. Was aus dieser Frau geworden ist, die ich einst so liebte, weiss ich nicht.
Das Teehaus »Mohammed Inn« war wie eine kleine Oase inmitten der Stadt. Während ich den illustren Gästen zuschaute, meist Ägypter und Sudanesen, welche Backgammon spielten und zwischendurch an ihren Teegläsern nippten, bestellte Francis zwei Chais. Ich ging hinüber, um ein mir bekanntes Gesicht zu begrüssen.
Das Gesicht hatte tiefe Furchen und sein Besitzer war mittlerweile etwa um die 90 Jahre alt. Sein Name war »Rick« und alle nannten ihn so, weil er behauptete, er habe beim Set zum Film »Casablanca« für die ganze Belegschaft »Leberwurstschnittchen« zubereitet. Obwohl er Humphrey Bogart nur von weitem sah, behauptete er, ein guter Freund von ihm gewesen zu sein, was seine Freunde immer zu einem Schmunzeln und Augenzwinkern veranlasste. Rick gesellte sich zu uns und griff sich eine Shisha, welche auf einem kleinen Tischchen stand. Rick hinkte immer noch stark. Seine Behinderung hatte er sich zugezogen, als er sich aus Liebeskummer vor den Balkanexpress werfen wollte, was zum Glück nur teilweise gelang. Seine damalige Frau hatte sich mit einem 30 Jahre jüngeren Tankwart aus dem Staub gemacht. Er brachte gekonnt die Shisha in Gang, während er sein Gespräch mit den Worten »Heiss heute« zu beginnen versuchte.
»Es war aber schon heisser«, entgegnete ich ihm, und wir zogen den Rauch genüsslich in unsere Lunge, während die Mittagshitze unbarmherzig auf uns niederbrannte.
4. Kapitel
Das grosse Ding
Längere Zeit hörte ich nichts von Francis, auch nicht von Diego, welcher ganz ausgesprochen: Diego Garcia Ramon hiess. Er war ein feuriger Spanier, der ohne weiteres als Stierkämpfer durchgegangen wäre. Allerdings brachte er es nur zum »Icecream-Verkäufer« auf der Tribüne. Sein schmuckes Hütchen passte nicht zu seinen weiten Rapper-Jeans, welche er in einem Flohmarkt in New York erstanden hatte. Seine »Icecreams« waren nicht gekühlt, da er sie in einer alten Sporttasche mit sich herumtrug, welche einmal das Aushängeschild einer bekannten Sportartikelfirma gewesen war. Sein Geschäft lief schlecht, und er erinnerte sich daran, wie er früher »sexhungrigen Touristen« Frauen vermittelte und abends die frisch gelegten Schildkröteneier klaute, um wieder einmal etwas essen zu können. Nein, Diego hatte es wirklich nicht einfach, obwohl er aus einem reichen Elternhaus stammte. Sein Vater war »Kulturattaché« in Barcelona und seine Mutter leitete eine Gemüsebiokette, deren Hauptsitz an der Strada Espagnol zu Hause war. Als Kind lag er oft zwischen Bergen von Gemüsen in seinem Korb. Sein erstes Wort, welches er sprechen konnte, war »Bio« und nicht etwa »Mama«. Sein Vater war ihm gänzlich fremd. Später weigerte er sich vehement Gemüse zu essen. Auf Grund dessen hatte er mit 23 Jahren schon seinen ersten Darmverschluss, auf Grund seines übermässigen Rindfleischverzehrs, welches er sich beim Großmarkt besorgte. Zwei Tage saß Diego auf dem Dach eines Wolkenkratzers in Alicante und konnte sich nicht entschließen, herunterzuspringen. Verheiratet war Diego mit einer Krankenschwester aus Serbien, welche ihren ersten Mann (mittels eines starken Giftes) ins Jenseits befördert hatte. Anschliessend versuchte sie in Spanien Fuss zu fassen.
Nach all den Jahren hatte ich Diego hier in Wadi Halfa wiedergetroffen, als er versuchte (unten am Nil) bei den Landungsbooten irgendwelche Touristen anzupumpen, indem er ihnen vorgaukelte, er sei ein direkter Nachkomme von »Lord Nelson« und brauche etwas Geld, um seine Herkunft beweisen zu können. Aus Mitleid gaben ihm einige Touristen ein paar Piaster. Ich hingegen wusste, dass ich mich auf ihn verlassen konnte, und so hatte ich ihn (teilweise) in meine Pläne eingeweiht. Hellbegeistert und ohne Skrupel stimmte Diego zu und so verabschiedeten wir uns bereits am nächsten Tag zur Besprechung in meinem Hotel. Der Hotelmanager des Wadi-Halfa-Hotels sass, wie meist gelangweilt, dösend hinter seinem Schreibtisch und beachtete kaum, als ich meinen Zimmerschlüssel vom Haken nahm. Ausser den zwei vornehm gekleideten Touristen in Sakkos, einer sogar mit einer Krawatte, war die Eingangshalle menschenleer. Kein Lüftchen war zu spüren und die beiden Männer schwitzten, was mir bestätigte, dass die beiden sich noch nicht lange in Wadi Halfa aufhielten. Einer dieser Männer war äusserst nervös und erinnerte mich an Humphrey Bogart, weil er auch immer an seinem Ohrläppchen herumzupfte. »Zwei Einzelzimmer«, sagte einer der beiden und überflog mit seinen Augen die verbleichte Preisliste, welche an der Wand hing. »Sechs Pfund pro Person«, bestätigte der Manager, obwohl er bei diesen (vermeintlich wohlhabenden Touristen) wesentlich mehr hätte verlangen können. Nur Wortfetzen drangen an mein Ohr, als ich die Rezeption verliess. Doch plötzlich hielt ich inne und die beiden Herren, welche sich als »Harry Jones« und »John Smith« ausgaben, kannte ich, doch es wollte mir nicht einfallen, wo ich sie einordnen musste.
Doch ganz plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich identifizierte sie als die Männer, die letztes Jahr in dubiose Geschäfte verwickelt waren. Übermittelt wurde mir das von einem »Nordafrikaner« namens Jean Babtiste, genannt »Joba«. Ein mieser kleiner Gauner mit billigem Goldschmuck, welchen jeder gut sehen konnte, weil er immer damit herumspielte. Ich wollte eigentlich auf seine Anwesenheit verzichten, jedoch war er der Einzige, welcher mir einen gefälschten Reisepass besorgen konnte. 450 Dollar musste ich dafür bezahlen, was schon grundlegend eine Frechheit war. Die Stimmung in diesem Restaurant hatte ein internationales Flair. »Puddingshop« hiess es und es diente als Zwischenstation für Reisende, Hippis und Rucksackreisende, welche auf dem Weg nach Indien waren. Nachdem sich die Leute mit Pudding aus aller Herrenländer vollgestopft hatten, gab es natürlich die obligaten Besichtigungen: Sultan Ahmet Mosche, Hagia Sophia und natürlich den gedeckten Basar. Istanbul hatte mir nie besonders gefallen und bis auf ein paar wenige Freunde kannte ich niemanden in dieser stinkenden Grossstadt. Joba erzählte mir von einem Juwelendeal, welchen zwei Gentlemangangster durchgezogen hatten, wobei er mich als Zwischenhändler an Bord holen wollte, denn meine guten Beziehungen waren weitherum bekannt. Er nannte beiläufig die Namen John und Harry. Jetzt war mir alles sonnenklar, dass es sich um Harry Jones und John Smith handeln musste.
5. Kapitel
Es kam, wie es kommen musste
I