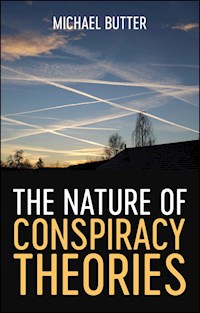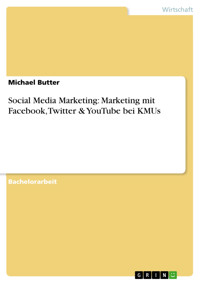21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Spätestens seit der Coronapandemie sind Verschwörungstheorien ein Signum unserer Zeit. Je komplexer unsere Welt wird, desto mehr Menschen scheinen für ihre erklärenden Sinnangebote empfänglich. Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, hat ein ganzes soziales Netzwerk in eine Schleuder für konspirationistische Erzählungen verwandelt. Donald Trump, der mächtigste Mensch der Welt, amtiert als conspiracy theorist in chief im Weißen Haus.
Michael Butter, Bestsellerautor und einer der renommiertesten Experten für das Thema, präsentiert die Ergebnisse seiner jahrelangen Forschung. So groß die Gefahr auch ist: Eine freie und demokratische Gesellschaft darf sich nicht von der Angst vor Verschwörungstheorien beherrschen lassen und in Alarmismus verfallen. Wie Populismus sind auch sie eine Reaktion auf eine empfundene oder befürchtete Exklusion. Wer sie bekämpfen will, sollte andere nicht einfach als Schwurbler oder Leichtgläubige hinstellen. Vielmehr gilt es, die gesellschaftlichen Ursachen zu bekämpfen. Inklusion und Teilhabe, so Butter, stellen den wirksamsten Schutz gegen Hetze und Unwahrheiten dar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
3Michael Butter
Die Alarmierten
Was Verschwörungstheorien anrichten
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2025.
© Suhrkamp Verlag GmbH, Berlin, 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung nach einem Konzept von Willy Fleckhaus:Rolf Staudt. Die Abbildung stammt von Benjamin Pelling für dasProjekt Researching Europe, Digitalisation and Conspiracy Theories.
eISBN 978-3-518-78116-6
www.suhrkamp.de
Widmung
7Für Sebastian und Fabian
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Einleitung
1 Grundlagen
Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen?
Verschwörungstheorien und Verschwörungserzählungen!
Verschwörungstheorien und kritische Theorien
2 Populismus, Extremismus und Antisemitismus
Populismus und Konspirationismus
Demokratiefeindlichkeit und Gewalt
Konspirationismus und Antisemitismus
3 Die Relegitimierung von Verschwörungstheorien und der Angriff auf die amerikanische Demokratie
Von 9/11 bis zur Tea Party
Trumps Transformation: Von Verschwörungsgerüchten zu Verschwörungserzählungen
Die Transformation der Republikanischen Partei
4 Verschwörungstheorien als Sicherheitsproblem in Deutschland
Die »Querdenken«-Bewegung und ihre öffentliche Wahrnehmung
Das »Reichsbürgerkomplott« und der Aufstieg der
AfD
Die
USA
als Zukunft Deutschlands?
5 Die anderen Alarmierten: Der deutsche Diskurs über Verschwörungstheorien
Ungenauigkeiten und Übertreibungen
Desinformation und Ansteckung
Spiegelungen des Konspirationismus
Schluss Was gegen Verschwörungstheorien helfen würde
Dank
Anmerkungen
Einleitung
1 Grundlagen
2 Populismus, Extremismus und Antisemitismus
3 Die Relegitimierung von Verschwörungstheorien und der Angriff auf die amerikanische Demokratie
4 Verschwörungstheorien als Sicherheitsproblem in Deutschland
5 Die anderen Alarmierten: Der deutsche Diskurs über Verschwörungstheorien
Schluss Was gegen Verschwörungstheorien helfen würde
Personenregister
Sachregister
Informationen zum Buch
3
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
239
240
241
243
244
245
246
247
9
Einleitung
An einem Morgen im März 2020 war ich mit meinen Kindern am Neckarufer unterwegs. Wie fast immer während des ersten Lockdowns war das Wetter traumhaft. Der Große fuhr Fahrrad, der Kleine Laufrad, und ich hechelte auf dem asphaltierten Feldweg hinterher. Entsprechend außer Atem war ich, als mein Handy klingelte. Die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) fragte an, ob ich für ihre Sendung »Die Politikstunde«, die sie gerade für Schüler*innen konzipierte, die nun keinen Präsenzunterricht mehr hatten, in den nächsten Tagen eine Folge zu Verschwörungstheorien gestalten könnte. Da ich schon öfters gut mit der BpB zusammengearbeitet hatte, sagte ich sofort zu. Die Sendung wurde wenige Tage später am 31. März gestreamt und ist noch immer auf YouTube verfügbar.
Die Tatsache, dass die BpB so schnell anrief, zeigt, wie sehr Verschwörungstheorien schon vor Beginn der Pandemie ins Licht der Öffentlichkeit gerückt waren. Obwohl die »Hygienedemos« erst langsam anliefen und »Querdenken« noch eine ganz andere Bedeutung hatte, war man bereits für konspirationistische Erklärungen sensibilisiert. Ich habe mich daher in den letzten Jahren ab und an gefragt, was wohl geschehen wäre, wenn die Pandemie uns einige Jahre früher heimgesucht hätte – bevor die russische Annexion der Krim und die Besetzung von Teilen des Donbass im Jahr 2014, die sogenannte »Flüchtlingskrise« von 2015, die Wahl Donald Trumps 2016 und der Aufstieg der AfD das Thema »Verschwörungstheorien« Schritt für Schritt in die Öffentlichkeit trugen. In den ersten Monaten der Pandemie nahm das ohnehin schon große öffentliche Interesse an Verschwörungstheorien dann exponentiell zu.
10Als ich 2008 begann, mich intensiv mit Verschwörungstheorien zu beschäftigen, gab es nur wenige Forschungsarbeiten in diesem Bereich, und außerhalb der Wissenschaft interessierte sich kaum jemand für meine Arbeit. Während meiner Zeit am Freiburg Institute for Advanced Studies, wo ich bis 2012 an einer Habilitation zu Verschwörungstheorien in den USA vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart arbeitete, gab ich vielleicht ein oder zwei Interviews pro Jahr – und das auch nur, weil wir eine umtriebige Pressesprecherin hatten, die sich viel Mühe gab, die Forschung der Fellows in der Öffentlichkeit zu lancieren. Die erste Frage der Journalist*innen war meistens: »Warum glauben so viele Amerikaner an Verschwörungstheorien?« Die mehr oder weniger explizite Annahme war, dass »wir Deutschen« oder »wir Europäer« das nicht tun. Verschwörungstheorien waren skurril und spannend, aber nicht besorgniserregend. Vor allem aber waren sie nicht »unser« Problem.
Dieses Bild wandelte sich in den folgenden Jahren grundlegend, und Verschwörungstheorien erhielten schon vor der Pandemie viel mehr öffentliche Aufmerksamkeit, als ich mir je hätte vorstellen können. Und mit der Aufmerksamkeit nahm auch die Besorgnis zu. Journalist*innen behandelten das Thema nicht mehr als Kuriosum, sondern betonten die Gefahren der konspirationistischen Weltanschauung. Niemand bestritt mehr, dass Verschwörungstheorien auch in Deutschland und Europa weit verbreitet waren. Auf den Internetseiten seriöser Medien konnte man sich nicht länger durch Galerien der abstrusesten Verschwörungstheorien – von den Echsenmenschen bis zu Chemtrails – klicken, sondern fand Artikel darüber, wie Verschwörungstheoretiker*innen in Parallelwelten abdrifteten.
Anfragen für Interviews nahmen zu, auch für Vorträge: in Schulen, Volkshochschulen oder bei kirchlichen Einrichtungen, aber auch auf Tagungen des Verfassungsschutzes 11und für die Fraktionen politischer Parteien auf kommunaler und Landesebene. Bei diesen Veranstaltungen bin ich zwischen 2014 und dem Beginn der Pandemie vielen Menschen begegnet, die nur sehr wenig über Verschwörungstheorien wussten, aber neugierig waren, weil ihnen diese nun immer häufiger in den Medien, in manchen Fällen auch im Bekannten- und Familienkreis begegneten. Mein 2018 erschienenes Buch »Nichts ist, wie es scheint«. Über Verschwörungstheorien vermittelte daher grundlegendes Wissen. Es orientierte sich an den Fragen, die mir immer wieder gestellt wurden und an denen sich auch meine Vorträge orientierten: Was sind Verschwörungstheorien? Wie argumentieren sie? Warum glauben Menschen daran? Welche Rolle spielt das Internet bei ihrer Verbreitung? Sind sie gefährlich? Heute halte ich noch immer regelmäßig Vorträge über Verschwörungstheorien, aber das Publikum hat in der Regel schon viel über das Thema gehört und gelesen, und fast alle sind sehr besorgt über die vermeintlich steigende Popularität von Verschwörungstheorien und deren negative Auswirkungen auf unsere Gesellschaft.
Diese gestiegene Aufmerksamkeit schlug sich unter anderem auch im Interesse an meiner »Politikstunde« auf YouTube nieder. Die meisten Sendungen der Reihe wurden bis heute zwischen 2000 und 5000 Mal aufgerufen, die Folge zu Verschwörungstheorien dagegen mehr als 25000 Mal. Zu den meisten anderen Videos gibt es lediglich eine Handvoll Reaktionen, unter der Episode über Verschwörungstheorien finden sich dagegen fast 300 Kommentare. Einiges Lob ist dabei, aber vor allem Kritik. Man wirft mir vor, entweder keine Ahnung zu haben oder Teil des Komplotts zu sein und die Öffentlichkeit bewusst zu täuschen. Die Zahl der negativen Kommentare ist mindestens zehnmal so groß wie die der positiven. Nähme man die Kommentare naiv als Abbild unserer Gesellschaft, könnte man denken, dass die gro12ße Mehrheit der Bevölkerung mittlerweile an solche Theorien glaubt.
Allerdings bieten die Kommentare nur ein verzerrtes Abbild der Realität. Während der Pandemie mag in Deutschland zwar der Eindruck entstanden sein, dass immer mehr Menschen an Verschwörungstheorien glauben, aber das stimmt nicht. Quantitative Studien attestieren einem Viertel bis zu einem Drittel der Deutschen eine sogenannte Verschwörungsmentalität, also eine allgemeine Neigung zu Verschwörungstheorien. Doch ist das tatsächliche Ausmaß, wie ich im 5. Kapitel ausführen werde, mit großer Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, da die meisten Umfragen konzeptionelle Mängel aufweisen. Realistischer dürfte eine Zahl von um die zehn Prozent der Bevölkerung sein. Das war vor der Pandemie so und hat sich seitdem nicht geändert. Verschwörungstheorien sind in der Pandemie sichtbarer geworden. Und ihre Anhänger*innen dominieren die Kommentarspalten, weil die konspirationistischen Überzeugungen für ihr Selbstbild von größter Bedeutung sind und sie diese daher viel eher nach außen tragen als Menschen, die nicht an Verschwörungstheorien glauben, ihre Ansichten.
Wenn aber nur eine, wenn auch lautstarke Minderheit in Deutschland an Verschwörungstheorien glaubt, kann man nicht davon sprechen, die Gesellschaft sei im Hinblick auf das Thema gespalten. Die Befürchtung, dass es zu solch einer Spaltung kommen könnte, war der Schlusspunkt meines Buchs von 2018. Damals schrieb ich:
Insofern ist die derzeitige Diskussion – Verschwörungspanik in manchen Teilöffentlichkeiten, Verschwörungstheoriepanik in anderen – ein Symptom für eine tiefer liegende Krise demokratischer Gesellschaften. Denn wenn Gesellschaften sich nicht mehr darauf verständigen können, was wahr ist, können sie auch die drängenden Probleme des 21. Jahrhunderts nicht meistern.1
13Diese Sätze erfassen akkurat, was seit einigen Jahren in den USA geschieht. In Bezug auf Deutschland würde ich diese Passage heute aber nicht mehr so schreiben. Anders als in den Vereinigten Staaten gibt es hierzulande keine Spaltung in etwa gleich große Lager oder Öffentlichkeiten; wir haben es vielmehr mit der Abspaltung einer, wenn auch signifikanten, Minderheit zu tun, welche die Welt fundamental anders wahrnimmt als der Rest der Bevölkerung. Das ist alles andere als positiv, von einem »epistemischen Kollaps«, einer Situation, in der sich die Mehrheit der Menschen nicht einigen kann, was gesichertes Wissen ist und was nicht, sind wir jedoch (noch immer) weit entfernt.2
Die öffentliche Wahrnehmung ist insbesondere seit der Pandemie aber eine ganz andere. Viele Menschen denken, Verschwörungstheorien breiten sich immer weiter aus, der epistemische Kollaps habe also zumindest begonnen. In großen Teilen von Politik, Medien und Gesellschaft hat sich die Überzeugung durchgesetzt, Verschwörungstheorien stellten mittlerweile eine der größten Bedrohungen unserer Demokratie dar. Verschwörungstheorien werden häufig als per se antidemokratisch erachtet, als Katalysatoren für Radikalisierungsprozesse gesehen und als untrennbar mit populistischen, rechtsextremen und antisemitischen Überzeugungen verbunden begriffen.
Das ist nicht völlig falsch. Verschwörungstheorien können eine demokratiegefährdende Wirkung entfalten; sie tun dies aber nicht zwangsläufig und derzeit nicht in Deutschland. Verschwörungstheorien können zu Gewaltausübung führen; sie tun dies aber deutlich seltener, als gemeinhin angenommen wird. Verschwörungstheorien sind in den Ländern des Globalen Nordens besonders unter der Anhängerschaft populistischer Bewegungen und an den Rändern des politischen Spektrums verbreitet, aber auch Menschen mit gemäßigten politischen Positionen glauben an sie. Und viele Ver14schwörungstheorien existieren in antisemitischen Versionen, aber beileibe nicht alle sind antisemitisch. Die öffentliche Wahrnehmung von Verschwörungstheorien bietet also ein ähnliches Zerrbild der Realität wie die Kommentare zu meinem Video auf YouTube.
Natürlich handelt es sich bei dieser fehlerhaften Wahrnehmung um kein rein deutsches Problem. Die internationale Forschung zu Verschwörungstheorien ist in den letzten Jahren explodiert. Laut einer kürzlich erschienenen Überblicksstudie sind über siebzig Prozent der wissenschaftlichen Arbeiten zu dem Thema nach 2020 veröffentlicht worden. Die meisten dieser Untersuchungen sind offensichtlich von der Pandemie, dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 oder dem Ukrainekrieg motiviert und zeichnen – aus durchaus nachvollziehbaren Gründen – das verzerrte Bild, das ich gerade kritisiert habe. (Ein Kollege, der sich noch viel länger mit Verschwörungstheorien beschäftigt als ich, schrieb mir zu der erwähnten Überblicksstudie halbironisch: »Eine wichtige Statistik fehlt: 84 Prozent dieser neueren Forschung sind nutzlos.«) Sie beeinflussen so den öffentlichen Diskurs in vielen Ländern.3
In Deutschland ist die Sorge über Verschwörungstheorien indes besonders ausgeprägt. Für ein internationales Forschungsprojekt haben wir in ganz Europa Beratungsstellen, Stiftungen und Thinktanks befragt, die über Verschwörungstheorien aufklären wollen. Mehr als fünfzig Projekte dazu laufen derzeit in der Bundesrepublik – mehr als sonst irgendwo in Europa. Viele sind von der Sorge motiviert, dass Verschwörungstheorien eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart darstellen. Ich teile diese Prämisse nicht, aber es gibt natürlich gute Gründe, sich gegen Verschwörungstheorien zu engagieren. Und viele dieser Projekte leisten sehr gute Arbeit; andere sehe ich dagegen kritisch, weil sie das Thema meines Erachtens falsch an15gehen und vereinfachte, verzerrte oder – man muss es so deutlich sagen – schlichtweg falsche Informationen vermitteln.4
Es gilt also zu differenzieren – sowohl was die Verschwörungstheorien selbst angeht als auch im Hinblick auf den Diskurs über sie. Dies ist das Ziel dieses Buchs. Es will einerseits ein nuanciertes Verständnis davon vermitteln, wie Verschwörungstheorien funktionieren, wann sie wie gefährlich sind und wie man ihnen begegnen sollte. Andererseits analysiert es, wie und warum in Deutschland auf eine bestimmte Art und Weise über Verschwörungstheorien gesprochen wird, warum dies nicht immer hilfreich ist und welche Funktionen dieser Diskurs erfüllt.5
Verschwörungstheorien sind, wie ich im 1. Kapitel ausführe, so gut wie nie im wörtlichen Sinne wahr. Sie verzerren und verkennen die Realität, aber sie können durch reale Probleme, Sorgen und Nöte motiviert sein. In dieser Hinsicht mögen manche zeitgenössische Verschwörungstheorien zu einer Krise der Demokratie beitragen; noch viel häufiger jedoch sind sie durch diese Krise motiviert. Ich stimme der derzeit oft gestellten Diagnose zu, dass wir eine Krise der Demokratie erleben, doch anders als in den USA sind Verschwörungstheorien dafür in Deutschland nicht ursächlich verantwortlich. Sie sind vor allem Symptome der tieferliegenden Ursachen, die man eigentlich angehen sollte.
Der Diskurs über Verschwörungstheorien kann daher als eine Arbeit am Symptom verstanden werden. Er wird aber in Deutschland von einer besonders ausgeprägten Sorge um die Demokratie befeuert. Doch indem er Verschwörungstheorien pauschal als Bedrohung derselben begreift, gerät aus dem Blick, was viel eher geeignet und nötig wäre, um die Demokratie zu stärken. Man adressiert die Folgen, statt die Ursachen zu behandeln. Entsprechend erfüllt der Diskurs über Verschwörungstheorien in seiner derzeitigen Form vor al16lem eine identitätsstiftende und -stabilisierende Funktion, die derjenigen des konspirationistischen Diskurses nicht unähnlich ist. In beiden Fällen grenzt man die eigene Gruppe strikt von »den Anderen«, den Verschwörer*innen bzw. den Verschwörungstheoretiker*innen, ab und versichert sich der eigenen moralischen Überlegenheit.
Es gibt also gewisse Parallelen zwischen Verschwörungstheoretiker*innen und denjenigen, die sich in Stiftungen, NGOs, Thinktanks und Beratungsstellen gegen Verschwörungstheorien engagieren. Der Titel meines Buchs Die Alarmierten bezieht sich daher auf beide Seiten – auf diejenigen, die alarmiert sind, weil Verschwörungen angeblich unsere Demokratie bedrohen, und diejenigen, die alarmiert sind, weil Verschwörungstheorien dies vermeintlich tun. Der Untertitel Was Verschwörungstheorien anrichten bezieht sich einerseits auf die Gefahren, die mitunter von Verschwörungstheorien ausgehen (und die ich überhaupt nicht leugnen will). Andererseits erfasst der Untertitel auch, wie der derzeitige Diskurs mitunter sowohl verhindert, dass Verschwörungstheorien effektiv begegnet wird, als auch von drängenderen Herausforderungen für unsere Demokratie ablenkt.
Diese Parallelen bedeuten natürlich nicht, dass beide Seiten gleichwertig oder gar gleichermaßen gefährlich sind. Unter den Anhänger*innen von Verschwörungstheorien gibt es viele, die menschenfeindliche Positionen vertreten. Man kann erklären, wo diese Überzeugungen herkommen, doch das bedeutet nicht, dass man sie gutheißt oder entschuldigt. Andere wiederum glauben gar nicht an die Verschwörungstheorien, die sie verbreiten, sondern instrumentalisieren diese zynisch. Diejenigen, die gegen Verschwörungstheorien ankämpfen, handeln in der Regel aus idealistischen Motiven für die ich den höchsten Respekt habe. Es geht mir – dies sei ganz klar gesagt – nicht darum, engagierte Menschen an den Pranger zu stellen. Vielmehr erörtere ich die strukturellen 17Gründe, warum Verschwörungstheorien in Deutschland so oft missverstanden und ineffektiv angegangen werden.
Entsprechend ist dieses Buch in drei Teile gegliedert. Die Kapitel 1 und 2 widmen sich Verschwörungstheorien auf einer allgemeinen Ebene. Ihr Ziel ist das bessere Verständnis eines Phänomens, über das, wie bereits angedeutet, viele Fehlannahmen im Umlauf sind. Die Kapitel 3 und 4 sind dem Einfluss von Verschwörungstheorien auf Politik und Gesellschaft in den USA und Deutschland in den letzten zehn Jahren gewidmet. Der Vergleich dieser beiden Länder soll den Blick dafür schärfen, wann Verschwörungstheorien in welcher Form gefährlich werden können. Kapitel 5 und der Schlussteil analysieren den Diskurs über Verschwörungstheorien in Deutschland und machen konkrete Vorschläge, wie man mit dem Phänomen umgehen sollte. Die Kapitel sind so angelegt, dass sie einzeln oder in einer anderen Reihenfolge gelesen werden können. Das Ziel des Buchs ist, dass wir Verschwörungstheorien besser verstehen, unaufgeregter über sie sprechen und ihnen effektiver begegnen.
18
1Grundlagen
Verschwörungstheorien behaupten, dass mächtige Akteure hinter den Kulissen einen perfiden Plan verfolgen und ihn Schritt für Schritt in die Tat umsetzen. Vier Grundannahmen bestimmen die konspirationistische Weltsicht: Erstens geschieht nichts, was für die Durchführung des Plans relevant ist, durch Zufall. Alles wurde geplant. Zweitens ist nichts so, wie es scheint. Erst wenn man den Vorhang beiseiteschiebt, erkennt man, was wirklich vor sich geht, denn die Verschwörer*innen operieren im Verborgenen. Drittens ist alles miteinander verbunden. Es gibt Beziehungen zwischen Ereignissen, Personen und Institutionen, die man nur versteht, wenn man von einem großen Komplott ausgeht. Viertens herrscht in den meisten Verschwörungstheorien eine klare Rollenverteilung. Den »guten« und unschuldigen Opfern der Verschwörung stehen die »bösen« Verschwörer*innen gegenüber.1
Natürlich werten mitunter auch sozialwissenschaftliche Erklärungen gesellschaftlicher Prozesse, mit denen Verschwörungstheorien konkurrieren. Auch sie benennen Verantwortliche und bisweilen sogar Schuldige. Und auch sie suchen nach Faktoren, die unter der Oberfläche wirken, und behaupten, dass verschiedene Phänomene – anders als auf den ersten Blick ersichtlich – miteinander verbunden sind. Doch die Sozial- und Kulturwissenschaften gehen nicht davon aus, dass sich (fast) alles, was geschieht, auf das planvolle Handeln einer meist überschaubaren Gruppe von im Geheimen agierenden Individuen zurückführen lässt. Sie negieren nicht, dass Menschen absichtsvoll handeln, betonen aber, dass sich komplexere Pläne nicht reibungslos umsetzen 19lassen, sondern unbeabsichtigte Folgen haben. Auch richten sie ihr Augenmerk auf die Eigenlogik komplexer sozialer System: Dinge geschehen, obwohl sie niemand geplant oder gar gewollt hat. Was Verschwörungstheorien also von zeitgenössischen sozialwissenschaftlichen Theorien unterscheidet, ist die Überbetonung des heimlichen und erfolgreichen Intentionalismus.
Aus der Konkurrenz von Verschwörungs- und sozialwissenschaftlichen Theorien folgt allerdings nicht, dass erstere notwendigerweise im Widerspruch zu einer wie auch immer gearteten offiziellen Erklärung der Ereignisse stehen. Diese Annahme war früher weit verbreitet, und auch heute noch hält eine Reihe von Forschenden an ihr fest und macht sie mitunter sogar zum Teil der Definition. Das liegt daran, dass sich die Forschung lange Zeit fast ausschließlich mit der westlichen Welt in der Gegenwart beschäftigt hat, wo Verschwörungstheorien tatsächlich meist in Konkurrenz zu von Wissenschaft und Gesellschaft akzeptierten Erklärungen stehen.2
Doch bis in die 1950er Jahre sah es in Europa und Nordamerika ganz anders aus: Über Jahrhunderte hinweg waren Verschwörungstheorien eine akzeptierte Wissensform; Eliten wie gewöhnliche Bürger*innen glaubten an sie und verbreiteten sie. Häufig waren sie die offizielle Erklärung für gesellschaftliche und historische Prozesse. Erst in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg durchliefen Verschwörungstheorien dies- und jenseits des Atlantiks einen Prozess der Stigmatisierung. Sie wanderten aus der Mitte der Gesellschaft an deren Ränder und wurden zu Gegenerzählungen. Außerhalb der westlichen Welt hat dieser Prozess, nach allem, was wir wissen, nicht oder nur in sehr viel geringerem Maße stattgefunden. In arabischen Ländern oder großen Teilen Osteuropas produzieren Verschwörungstheorien bis heute offiziell anerkanntes Wissen. Und im Westen ist ihr ak20tueller Status nicht in Stein gemeißelt, wie wir im 3. Kapitel sehen werden.3
Auch sind Verschwörungstheorien nicht automatisch falsch. Diesen Eindruck habe ich im Vorläufer zu diesem Buch durch eine ungeschickte Formulierung hervorgerufen, wofür ich berechtigterweise kritisiert wurde. Damals schrieb ich, »dass ich es […] für ein weiteres wichtiges Charakteristikum von Verschwörungstheorien halte, dass diese falsch sind«. Das suggerierte, ich hätte Falschheit gleichberechtigt neben den oben beschriebenen Eigenschaften platziert. Das wollte und will ich nicht. Aber aus der konspirationistischen Überbetonung des heimlichen und erfolgreichen Intentionalismus folgt, dass verschwörungstheoretische Erklärungen in der Gegenwart nicht nur im Konflikt mit sozialwissenschaftlichen Erklärungen stehen, sondern in der Regel auch viel weniger schlüssige Beweise anführen können. Man kann daher davon ausgehen, dass Erklärungen, welche die eingangs aufgeführten Eigenschaften aufweisen, nicht stimmen. Dies ist aber die Konsequenz der konspirationistischen Grundannahmen und keine weitere Grundannahme. Es ist daher prinzipiell möglich, dass sich Verschwörungstheorien als wahr herausstellen, nur ist es eben sehr unwahrscheinlich.4
In diesem Zusammenhang auf Verschwörungstheorien zu verweisen, die sich angeblich im Nachhinein als wahr herausgestellt haben, ist allerdings irreführend. Immer wieder wird zum Beispiel der von Edward Snowden aufgedeckte NSA-Überwachungsskandal genannt. Doch mir ist bis heute keine Verschwörungstheorie bekannt, die durch Snowdens Enthüllungen bestätigt worden wäre. Ähnlich verhält es sich mit einem anderen Standardbeispiel, der Watergate-Affäre. Es trifft nicht zu, dass Carl Bernstein und Bob Woodward, die beiden Journalisten, die mit ihren Veröffentlichungen den Skandal lostraten, Verschwörungstheorien formu21liert hatten, die sich dann als wahr herausstellten. Im Gegenteil: Wie die Amerikanistin Katharina Thalmann detailliert gezeigt hat, gaben sich die beiden alle erdenkliche Mühe, um Verschwörungstheorien nicht zu nähren. Oft publizierten sie weniger, als sie in Erfahrung gebracht hatten, um einer entsprechenden Stigmatisierung zu entgehen. Und was sie zum Druck freigaben, konnten sie so gut belegen, dass es von weiten Teilen der Öffentlichkeit sofort akzeptiert wurde.5
Ebenso wenig ist die sogenannte »Lab leak«-Theorie, wonach das Coronavirus in einem Labor in Wuhan erzeugt wurde und bei einem Unfall in Umlauf geriet, ein Beispiel für eine Verschwörungstheorie, die sich später als wahr herausgestellt hat oder unter Umständen noch als wahr herausstellen wird. Es handelt sich dabei schlicht nicht um eine Verschwörungstheorie. Die »Lab leak«-Theorie besagt, dass das Virus unbeabsichtigt freigesetzt wurde, die Covidpandemie wurde demnach eben gerade nicht geplant. Es mag paradox klingen, aber eventuell – ich schreibe diesen Absatz im Juni 2025 – haben wir es mit einer Verschwörung zu tun, um den Unfall zu vertuschen, aber nicht mit einer Verschwörungstheorie, die sich im Nachhinein als wahr herausgestellt hat. Deshalb sollte uns die Art und Weise, wie sich der Status der »Lab leak«-Theorie in den letzten Jahren verändert hat und unter Umständen noch weiter verändern wird, als Warnung dienen, alternative Erklärungen nicht vorschnell als »Verschwörungstheorie« abzutun. Diese Bezeichnung sollte nur für Erklärungen verwendet werden, welche die oben definierten Merkmale aufweisen.6
Der Zufall, bei der »Lab leak«-Theorie in Form von menschlicher Inkompetenz, markiert auch einen wichtigen Unterschied zwischen den imaginierten Komplotten der Verschwörungstheoretiker*innen und realen Verschwörungen. Letztere hat es immer gegeben, und dürfte es wohl auch 22immer geben. Man denke an die Ermordung Julius Cäsars im Jahr 44 vor Christus, ein letztendlich erfolgloses Komplott. Zwar wurde Cäsar getötet, doch das eigentliche Ziel – die Staatsform der Republik zu bewahren – wurde verfehlt. Es kam zum Bürgerkrieg, Octavian schwang sich zum Alleinherrscher auf und läutete die Epoche des Kaisertums ein. »Die Verschwörer«, so schrieb schon Karl Popper, »genießen nur selten die Früchte ihrer Verschwörung.« Zufall und nichtintendierte Konsequenzen lassen sich fast nie völlig und schon gar nicht über einen längeren Zeitraum ausschließen.7
Nachdem ich den Gegenstand dieses Buchs definiert habe, möchte ich in diesem Kapitel die Grundlagen für die Analyse des verschwörungstheoretischen Diskurses und des Diskurses über Verschwörungstheorien legen. Ich zeige zunächst, dass die in Deutschland verbreitete Kritik am Begriff »Verschwörungstheorie« ungerechtfertigt ist und die vorgeschlagenen Alternativen ungeeignet sind. Im zweiten Abschnitt stelle ich ein Modell vor, das zwischen verschiedenen Ebenen des verschwörungstheoretischen Diskurses konzeptionell und begrifflich unterscheidet, um die Diskussion präziser zu machen. Abschließend erörtere ich das Verhältnis von Verschwörungstheorien zu gesellschafts- und kulturwissenschaftlichen Theorien und argumentiere, dass Verschwörungstheorien zwar kaum jemals im wörtlichen Sinne wahr sind, aber ein Symptom für reale Ängste, Nöte und Benachteiligungen sein können, die man ernst nehmen muss, um dem Phänomen effektiv zu begegnen.
23
Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen?
Gemeinsam mit dem Amerikanisten Peter Knight von der Universität Manchester habe ich zwischen 2016 und 2020 das europäische Vernetzungsprojekt Comparative Analysis of Conspiracy Theories geleitet, an dem mehr als 160 Forschende aus 40 Ländern beteiligt waren. In jeder in diesem Projekt vertretenen Sprache existiert eine direkte Entsprechung zum deutschen Ausdruck »Verschwörungstheorie« bzw. zum englischen »conspiracy theory«. Aber nur im deutschsprachigen Raum gibt es eine Debatte über seine Angemessenheit. Bis zum Beginn der Pandemie war sie jedoch sehr überschaubar. Einzelne Wissenschaftler*innen und Organisationen wie die Amadeu Antonio Stiftung lehnten den Terminus ab, aber im wissenschaftlichen und im öffentlichen Diskurs war »Verschwörungstheorie« fest etabliert. Entsprechend handelte ich die Diskussion um die Begrifflichkeit in meinem Buch »Nichts ist, wie es scheint« auf wenigen Seiten ab.8
Seit der Pandemie hat sich die Situation grundlegend verändert. Wo auch immer in Deutschland ich einen Vortrag halte, sei es an einer Volkshochschule, der deutschen Richterakademie oder an einer Universität: Im Anschluss werde ich gefragt, warum ich von »Verschwörungstheorien« spreche und nicht von »Verschwörungserzählungen«, »Verschwörungsmythen« oder »Verschwörungsideologien«. Wie eine von Stephen Albrecht erstellte Grafik zeigt, hat die Verwendung dieser Begriffe in den deutschen Printmedien seit 2020 tatsächlich sprunghaft zugenommen.
24Quelle: Stephen Albrecht, »Von Verschwörungstheorien zu -mythen: Eine kritische Analyse zur Terminologie eines komplexen Phänomens«, Neovex (21. November 2024), online verfügbar unter: {https://neovex-projekt.de/von-verschwoerungstheorien-zu-mythen-eine-kritische-analyse-zur-terminologie-eines-komplexen-phaenomens/}.
Anzahl der Verwendungen der Begriffe »Verschwörungserzählung«, »Verschwörungsglaube«, »Verschwörungsideologie«, »Verschwörungsmythos« und »Verschwörungstheorie« in deutschen Printmedien 2007-2023.
Natürlich wurde zunächst auch »Verschwörungstheorie« deutlich öfter verwendet, weil der Ausdruck zu Beginn der Pandemie noch nicht systematisch hinterfragt und nun mehr über das Thema berichtet wurde als jemals zuvor. Aber wäh25rend »Verschwörungstheorie« in den Printmedien mittlerweile wieder seltener auftaucht, fiel der Rückgang bei den Alternativen deutlich geringer aus. Dieser Umstand erklärt sich nicht aus einem Unbehagen an der Begrifflichkeit, sondern aus einer Abnahme der Aufmerksamkeit für das Thema allgemein.
Wenn nach einem meiner Vorträge Besucher*innen den Ausdruck problematisieren, dann wird neben Handreichungen von NGOs oder der Bundeszentrale für politische Bildung häufig auf das breit rezipierte Buch Fake Facts: Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen von Katharina Nocun und Pia Lamberty verwiesen, das im Mai 2020 erschien. Ich möchte mich daher etwas detaillierter mit der Argumentation der beiden Autorinnen auseinandersetzen, die exemplarisch für die Kritik am Begriff »Verschwörungstheorie« ist und sich in ähnlicher Form auch in vielen anderen Publikationen findet.
Im ersten Kapitel von Fake Facts heißt es:
Der gängige Begriff der Verschwörungstheorie ist in letzter Zeit immer mehr kritisiert worden, da man hierbei nicht von Theorien im wissenschaftlichen Sinn sprechen kann. Eine Theorie ist eine wissenschaftlich nachprüfbare Annahme über die Welt. Wenn sich diese als falsch herausstellt, wird sie auch wieder verworfen. Die Verschwörungserzählung zeichnet sich aber eben genau dadurch aus, dass sie sich der Nachprüfbarkeit entzieht. Egal wie viele Gegenbeweise es gibt, der Verschwörungsideologe beharrt auf seiner Meinung. Kritikwürdig ist außerdem, dass bei der Nutzung des Theoriebegriffs jede noch so verrückte Idee als Theorie aufgewertet werden würde.9
Kurz gesagt argumentieren Nocun und Lamberty, Verschwörungstheorien seien keine Theorien, da sie sich nicht falsifizieren ließen beziehungsweise ihre Anhänger*innen die Falsifizierung nicht akzeptierten. Sie beziehen sich somit, wenn auch nicht explizit, auf den Wissenschaftstheoretiker Karl 26Popper, der Falsifikation bekanntermaßen zum entscheidenden Kriterium für wissenschaftliche Theorien erhoben hat. Das ist durchaus ironisch, da Popper den Begriff »Verschwörungstheorie« in seiner modernen Bedeutung im zweiten Band seines Werkes Die offene Gesellschaft und ihre Feinde geprägt hat.
Um es pointiert auszudrücken: Man kann so argumentieren, aber dann ignoriert man zum einen mehr als siebzig Jahre Wissenschaftstheorie und zum anderen dürfte man dann kaum eine sozial- oder geisteswissenschaftliche Theorie – der Strukturalismus wäre vielleicht eine Ausnahme – als »Theorie« bezeichnen. Das zeigt ein Blick in Poppers kurzen Vortrag mit dem Titel »Wissenschaft: Vermutungen und Widerlegungen«, in dem er Albert Einsteins Relativitätstheorie mit Sigmund Freuds psychoanalytischer Theorie, Alfred Adlers individualpsychologischer Theorie und Karl Marx' Geschichtstheorie vergleicht. Die Relativitätstheorie ist für Popper eine wissenschaftliche Theorie, weil sie den Anspruch erhebt, lediglich eine begrenzte Zahl von Phänomenen zu erklären, und zugleich so konkrete Voraussagen macht, dass eine Falsifikation möglich wird. Die Theorien Freuds und Adlers dagegen sind in Poppers Augen viel zu vage, um falsifiziert zu werden. Gleichzeitig ist ihr Erklärungsanspruch enorm, was für Popper auch ihre Attraktivität erklärt: »Die Welt war übervoll von Verifikationen der Theorie. Was immer sich ereignete, war eine Bestätigung für sie.« Die Marx'sche Geschichtstheorie dagegen trifft konkrete Voraussagen über den Verlauf der Geschichte. Sie ist daher für Popper eine wissenschaftliche Theorie, aber aufgrund des Nichteintretens der Voraussagen – wie der Diktatur des Proletariats – in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schon lange falsifiziert. Marx' Nachfolger jedoch, so Popper, akzeptierten diese Falsifikation nicht, sondern hielten »durch Umdeutung sowohl der Theorie als auch der Tatsachen« an ihr fest, 27wodurch sie ihren Status als wissenschaftliche Theorie verliere.10
Wenn man also auf Poppers Idee der Falsifikation zurückgreift, um zu argumentieren, dass der Begriff »Verschwörungstheorie« unangemessen sei, müsste man konsequenterweise auch den meisten sozial- und kulturwissenschaftlichen Theorien den Status einer wissenschaftlichen Theorie absprechen. Die Disziplinen, in denen diese Theorien verankert sind, wären dann keine Wissenschaft, sondern Pseudowissenschaft. Denn was für Adlers, Freuds und Marx' Theorien gilt, könnte man ebenso für Butler, Bourdieu, Derrida, Foucault, die Frankfurter Schule und alle anderen Theorien zeigen, die Grundlage der Geistes- und Sozialwissenschaften sind. Popper sagt in seinem Vortrag explizit, dass die von ihm kritisierten Theorien, »obwohl sie vorgaben, wissenschaftlich zu sein, in Wirklichkeit mehr mit primitiven Mythen gemeinsam hatten als mit der Naturwissenschaft«. Machte man sich dieses Argument zu eigen, sollte man tatsächlich von »Verschwörungsmythen« und nicht von »Verschwörungstheorien« sprechen.11
Dies ist unsinnig und sicher nicht, was diejenigen, die den Begriff »Verschwörungstheorie« kritisieren, beabsichtigen. Hinzu kommt, dass das »Falsifikationsargument nicht überzeugend [ist], weil es auf einer Ignoranz gegenüber der wissenschaftstheoretischen Debatte« beruht, wie der Philosoph Daniel Minkin betont. Die Wissenschaftstheorie hat sich seit Popper weiterentwickelt und betrachtet Falsifikation nicht mehr als geeignetes Kriterium, um Theorien von Gedankengebäuden zu unterscheiden, die diese Bezeichnung nicht verdienen, und somit Wissenschaft von Pseudowissenschaft abzugrenzen. Seit Längerem hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass manche Theorien bereits kurz nach ihrer Entstehung falsifiziert werden, dies ihren Erkenntniswert aber nicht schmälert, und es sich daher lohnt, an ihnen fest28zuhalten. Außerdem enthalten auch naturwissenschaftliche Theorien nichtfalsifizierbare Elemente und machen metaphysische Annahmen. So geht die Stringtheorie von zehn Dimensionen aus, was weder beweisbar noch falsifizierbar ist. Es handelt sich um eine Setzung derjenigen, die die Theorie entwickelt haben und die dabei vermutlich vom in ihrer Kultur dominanten Dezimalsystem beeinflusst wurden.12
Poppers Ausführungen zu Adler, Freud und Marx lenken den Blick darauf, dass Verschwörungstheorien und geistes- sowie sozialwissenschaftliche Theorien einige Gemeinsamkeiten aufweisen. Zunächst einmal sind nicht Naturphänomene ihr Gegenstand, sondern historische Prozesse und gesellschaftliche Entwicklungen. Zudem ist das Theorieverständnis in den Geistes- und Sozialwissenschaften ein anderes als in den Naturwissenschaften. Theorien werden in der Philosophie und in verwandten Disziplinen, wie die Philosophin Romy Jaster erläutert, »in einem schwachen Sinne interpretiert«, und zwar als spezifische Annahmen oder – und dies ist häufiger der Fall – als eine Reihe miteinander verknüpfter Annahmen, die bestimmte Phänomene erklären sollen: »Sie bestehen aus einem System von Sätzen, die aufeinander verweisen und sich gegenseitig stützen und begründen«, so formuliert es der Philosoph Karl Hepfer.13
Während in den Naturwissenschaften oft gefordert wird, dass eine Theorie empirische Tatsachen korrekt erklären soll, ist dies nicht Teil der schwachen Definition. Ob die Grundannahmen einer Theorie sinnvoll sind und somit zutreffendes Wissen über die Welt generiert wird, ist für die Vergabe des Etiketts »Theorie« irrelevant, denn dieses bezieht sich ausschließlich auf den formalen Prozess der Erklärung. Die zentralen Eigenschaften konspirationistischer Theorien – nichts ist, wie es scheint, nichts geschieht durch Zufall, und alles ist miteinander verbunden – habe ich eingangs vorgestellt. Ihre Annahmen verweisen aufeinander und stützen 29sich gegenseitig. Auf dieser Grundlage erklären Verschwörungstheorien die Welt. Man kann daher dem Philosophen Brian Keeley nur zustimmen, der es zu Beginn der philosophischen Debatte über Verschwörungstheorien auf den Punkt brachte: »Eine Verschwörungstheorie verdient die Bezeichnung ›Theorie‹, weil sie eine Erklärung für etwas liefert.«14
Das bedeutet natürlich nicht, dass es sich bei Verschwörungstheorien um wissenschaftliche Theorien handelt. Es gibt allerdings meines Wissens niemanden, der sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt und dies behauptet. Doch selbst wenn man die Unterschiede zu wissenschaftlichen Theorien jenseits des Erklärungsanspruchs betont, heißt das nicht, dass man Verschwörungstheorien nicht »Theorien« nennen sollte. Schließlich gibt es ja auch Alltagstheorien, wie die Soziologie sie nennt. Menschen denken sich Theorien dazu aus, warum der Kollege heute schlecht gelaunt ist, was in der nächsten Episode der Serie passieren wird, die sie gerade schauen, oder – das ist Jasters Beispiel – »warum es in der Mensa mittwochs immer Eintopf gibt«. Das Argument, die Bezeichnung »Verschwörungstheorie« werte absurde Ideen auf, greift also auch deshalb nicht, weil der Theoriebegriff im Alltag und in den sozialwissenschaftlichen Beschreibungen des alltäglichen Erklärens und Hypothetisierens jenseits von Verschwörungstheorien ohnehin schon lange in ganz unterschiedlichen Kontexten und für ganz unterschiedliche Zwecke genutzt wird.15
Hinzu kommt, dass der Ausdruck »Verschwörungstheorie« hochgradig stigmatisierend ist. Peter Knights fast drei Jahrzehnte alte Beobachtung gilt noch immer: »Der Begriff ›Verschwörungstheorie‹ ist eine Beleidigung. […] Etwas als Verschwörungstheorie zu bezeichnen, reicht nicht selten aus, um die Diskussion zu beenden.« Diejenigen, die an Verschwörungstheorien glauben, lehnen den Ausdruck in aller Regel vehement ab, denn sie fühlen sich durch ihn herabge30würdigt. Es überrascht daher nicht, dass es eine Verschwörungstheorie zur Genese des Begriffs »Verschwörungstheorie« gibt: Er sei eine Schöpfung der CIA, die damit jede Kritik an der offiziellen Version des Attentats auf John F. Kennedy, wonach Lee Harvey Oswald ein Einzeltäter war, zu delegitimieren versuchte. Tatsächlich aber stammt der Terminus aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts; in seiner heutigen Bedeutung hat Karl Popper ihn kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt.16
Doch gerade weil »Verschwörungstheorie« negativ aufgeladen ist und Verschwörungstheoretiker*innen ihn als stigmatisierend empfinden, könnte man ihn aufgeben, wenn eine bessere Option verfügbar wäre. Allerdings sind die vorgeschlagenen Alternativen alle ungeeignet, da sie das Phänomen nur unzureichend erfassen und problematische Assoziationen evozieren, so dass sie eher erkenntnishindernd als erkenntnisfördernd sind.
Das gilt besonders für den Begriff »Verschwörungsmythos«, der die Irrationalität der so bezeichneten Ideen betont. Das ist in manchen Fällen angemessen, verkennt aber den wissenschaftlichen Anstrich, den sich Verschwörungstheorien gerne geben. Besonders deutlich wurde dies während der Pandemie, als Verschwörungstheoretiker*innen beständig auf Studien verwiesen, Statistiken auswerteten oder Expert*innen zitierten. Zudem impliziert »Mythos«, dass die konspirationistischen Vorwürfe bereits länger existieren. Der Ausdruck könnte daher – blendet man die anderen Probleme einmal aus – sinnvoll für Verschwörungstheorien benutzt werden, die seit Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten zirkulieren und die immer wieder aktualisiert werden. Man kann vom Mythos der jüdischen Weltverschwörung sprechen oder vom Mythos des Illuminatenordens. Für Coronaverschwörungstheorien oder solche zur russischen Invasion der Ukraine ist der Begriff dagegen ungeeignet.17
31»Verschwörungserzählung«, inzwischen die populärste Alternative, ignoriert eine mittlerweile jahrzehntealte, als »Narrative Turn« bezeichnete Erkenntnis vieler Disziplinen – von der Anthropologie und Soziologie bis zu den Literatur- und Kulturwissenschaften: Erzählungen sind ein zentrales Instrument der menschlichen Kognition. Die Realität ist keine Erzählung, aber zahlreiche Studien haben gezeigt, dass wir sie uns über Erzählungen erschließen. Der Psychologe Jerome Bruner hat dies in einem berühmten Aufsatz als die »narrative Konstruktion der Wirklichkeit« bezeichnet. Man müsste also zwischen »Nichtverschwörungserzählungen« und »Verschwörungserzählungen« unterscheiden. Dass die Pandemie von einem durch Zoonose entstandenen Virus verursacht wurde, ist ebenso eine Erzählung, wie die konspirationistische Erklärung, Auslöser sei eine im Labor produzierte Biowaffe gewesen. Beides sind »Geschichten mit einem Wahrheitsanspruch«. Doch der Begriff »Verschwörungserzählung« suggeriert, es seien lediglich »die anderen«, die Erzählungen anhingen, man selbst dagegen verstehe die Welt auf Basis von Fakten. Dass Fakten immer nur innerhalb einer Erzählung, welche Form diese auch immer annehmen mag, eine Bedeutung haben, wird dabei ignoriert.18