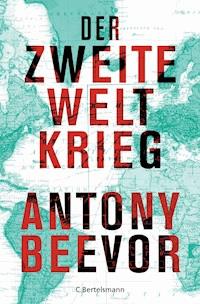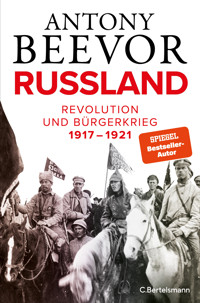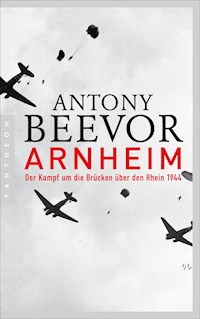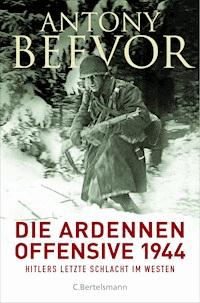
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
80 JAHRE KRIEGSENDE 44/45: Das letzte Aufbäumen Hitlers – die wohl brutalste Schlacht des Zweiten Weltkriegs
Im August 1944 schien das Ende des Zweiten Weltkrieges nah, das Deutsche Reich war in Auflösung begriffen. Doch Hitler beschloss, noch einmal alles auf eine Karte zu setzen. Am 16. Dezember 1944 startete die Ardennen-Offensive – es war der Beginn der wohl brutalsten Schlacht des Zweiten Weltkriegs. Präzise und faktenreich beschreibt Antony Beevor, einer der renommiertesten Historiker zur Militärgeschichte, diese sechs Wochen im Winter 1944/45. Detailliert stellt er die Frontverläufe dar, dem einfachen Soldaten und der auf allen Seiten in die Kämpfe verwickelten Bevölkerung verleiht er eine Stimme. Auf diese Weise gelingt ihm ein eindrucksvoll lebendiges Geschichtspanorama.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 840
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Gegen Ende 1944 schien der Sieg der Alliierten gegen Hitler und seine Wehrmacht zum Greifen nahe: Trotz hoher Verluste war die Landung in der Normandie geglückt, Paris war befreit. Die Ostfront stand kurz vor dem Zusammenbruch, die Rote Armee drängte unaufhaltsam nach Westen. Doch Hitler beschloss gegen den wachsenden Widerstand in der eigenen Heeresführung, noch einmal alles auf eine Karte zu setzen. Am 16. Dezember 1944 startete die Ardennen-Offensive. Vor allem Antwerpen galt es zurückzuerobern, über dessen Hafen der Großteil des alliierten Nachschubs erfolgte. Damit begann die größte Schlacht des Zweiten Weltkriegs in Westeuropa. Insgesamt kämpften über eine Million Soldaten sechs Wochen lang erbittert in Kälte und Schnee um jeden Quadratmeter. Trotz anfänglicher Erfolge der Wehrmacht konnten die Alliierten sie erfolgreich zurückschlagen und damit ihr Schicksal endgültig besiegeln. Mit der Präzision des Historikers und der sprachlichen Kraft des Erzählers schildert Antony Beevor dieses letzte Aufbäumen der deutschen Armee.
Autor
Antony Beevor, Jahrgang 1946, hat sich mit mehrfach ausgezeichneten und in zahlreiche Sprachen übersetzten Büchern zur Geschichte einen Namen gemacht. Auf Deutsch sind von ihm erschienen: »Stalingrad« (1999), »Berlin 1945 – Das Ende« (2002), »Die Akte Olga Tschechowa« (2004), »Der Spanische Bürgerkrieg« (2006), »Ein Schriftsteller im Krieg« (2007), »D-Day« (2010) und »Der Zweite Weltkrieg« (2014).
Antony Beevor
Die Ardennen-Offensive 1944
Hitlers letzte Schlacht im Westen
Aus dem Englischen übertragen
von Helmut Ettinger
C. Bertelsmann
Inhalt
1. Kapitel Im Siegesrausch
2. Kapitel Antwerpen und die deutsche Grenze
3. Kapitel Die Schlacht um Aachen
4. Kapitel In den Winter des Krieges
5. Kapitel Der Hürtgenwald
6. Kapitel Die Deutschen bereiten sich vor
7. Kapitel Das Versagen der Aufklärung
8. Kapitel Samstag, 16. Dezember
9. Kapitel Sonntag, 17. Dezember
10. Kapitel Montag, 18. Dezember
11. Kapitel Skorzeny und Heydte
12. Kapitel Dienstag, 19. Dezember
13. Kapitel Mittwoch, 20. Dezember
14. Kapitel Donnerstag, 21. Dezember
15. Kapitel Freitag, 22. Dezember
16. Kapitel Samstag, 23. Dezember
17. Kapitel Sonntag, 24. Dezember
18. Kapitel Weihnachtstag
19. Kapitel Dienstag, 26. Dezember
20. Kapitel Die Vorbereitung der alliierten Gegenoffensive
21. Kapitel Die doppelte Überraschung
22. Kapitel Der Gegenangriff
23. Kapitel Der Frontbogen wird begradigt
24. Kapitel Schluss
Dank
Militärische Symbole auf den Karten
Schlachtordnung
Abkürzungen
Anmerkungen
Bibliografie
Personenregister
Orts- und Sachregister
Bildteil
Bildnachweis
1. KapitelIm Siegesrausch
Am frühen Morgen des 27. August 1944 verließ General Dwight D. Eisenhower Chartres, um das gerade erst befreite Paris in Augenschein zu nehmen. »›Es ist Sonntag‹, sagte der Oberbefehlshaber der alliierten Truppen zu General Omar Bradley, der ihn begleiten sollte. ›Die Leute werden ausschlafen. Wir werden das ohne Aufsehen tun können.‹«1 Aber die beiden Generale waren kaum zu übersehen, als sie zu diesem »inoffiziellen Besuch« in Richtung der französischen Hauptstadt rollten. Der Cadillac des Oberbefehlshabers in tristem Olivgrün wurde von zwei Panzerwagen eskortiert, und ein Jeep mit einem Brigadegeneral fuhr voraus.2
Als sie die Porte d’Orléans erreichten, war dort eine noch größere Eskorte der 38. Mechanisierten Aufklärungskompanie unter Generalleutnant Gerow wie zur Parade aufgestellt. Leonard Gerow, ein alter Freund Eisenhowers, kochte noch vor Ärger, weil General Philippe Leclerc von der französischen 2. Panzerdivision während des Vormarsches auf Paris alle seine Befehle hartnäckig missachtet hatte. Am Tag zuvor hatte Gerow, der sich als Militärkommandant von Paris sah, Leclerc und dessen Division verboten, an General de Gaulles Siegesparade vom Arc de Triomphe bis nach Notre-Dame teilzunehmen. Stattdessen hatte er ihm befohlen, »Paris und Umgebung weiter vom Feind zu säubern«. Während der Befreiung der Hauptstadt hatte Leclerc Gerow ignoriert, aber an diesem Morgen einen Teil seiner Division aus der Stadt nach Norden gegen Stellungen der Deutschen um Saint-Denis in Marsch gesetzt.3
Die Straßen von Paris waren leer, denn die Deutschen hatten auf ihrem Rückzug fast jedes Fahrzeug requiriert, das sich noch bewegen ließ. Selbst auf die Metro war wegen der schlechten Stromversorgung kein Verlass mehr. Die »Lichterstadt« musste sich mit Kerzen behelfen, die auf dem Schwarzmarkt gehandelt wurden. Ihre schönen Bauten wirkten alt und heruntergekommen, waren aber zum Glück noch intakt. Hitlers Befehl, sie in ein »Trümmerfeld« zu verwandeln4, war nicht befolgt worden. In der noch anhaltenden Freude über den Sieg brachen Gruppen von Franzosen auf den Straßen immer wieder in Jubel aus, wenn sie eines amerikanischen Soldaten oder Fahrzeuges ansichtig wurden. Aber es sollte nicht lange dauern, da hörte man die Pariser murren, die Amerikaner seien »pire que les boches«, »schlimmer als die Deutschen«.5
Zwar hatte Eisenhower erklärt, »ohne Aufsehen« nach Paris fahren zu wollen, aber sein Besuch hatte einen bestimmten Grund. Er wollte General Charles de Gaulle treffen, den Chef der Provisorischen Regierung Frankreichs, die anzuerkennen Präsident Roosevelt sich weigerte. Der Pragmatiker Eisenhower war bereit, die strikte Weisung seines Präsidenten zu ignorieren, die US-Truppen seien nicht in Frankreich, um General de Gaulle an die Macht zu bringen. Der Oberbefehlshaber brauchte Stabilität hinter seinen Fronten, und da de Gaulle offenbar als Einziger in der Lage war, diese herzustellen, war er gewillt, ihn zu unterstützen.
Weder de Gaulle noch Eisenhower mochten riskieren, dass das gefährliche Chaos der Befreiung außer Kontrolle geriet, besonders zu einer Zeit, die von wilden Gerüchten, unerwarteten Panikausbrüchen, Verschwörungstheorien und der hässlichen Denunziation angeblicher Kollaborateure geprägt war. Der Schriftsteller J. D. Salinger, der bei der 4. US-Infanteriedivision als Oberfeldwebel der Spionageabwehr diente, hatte bei einer Aktion in der Nähe des Pariser Rathauses gemeinsam mit einem Kameraden einen Verdächtigen festgenommen. Doch sie konnten nicht verhindern, dass eine erregte Menge ihnen den Mann entriss und vor ihren Augen totschlug.
De Gaulles Siegesparade vom Arc de Triomphe nach Notre-Dame am Tag zuvor hatte mit einer wüsten Schießerei in der Kathedrale geendet. Dieser Zwischenfall überzeugte de Gaulle, dass er die Résistance entwaffnen und ihre Mitglieder in eine reguläre französische Armee eingliedern musste. Noch am selben Nachmittag ging beim Hauptquartier des Oberbefehlshabers der Alliierten Expeditionstruppen (SHAEF) die Forderung nach 15000 Uniformen ein. Leider gab es sie nicht ausreichend in kleinen Größen, denn französische Männer waren im Durchschnitt nicht so groß wie die Amerikaner.
De Gaulles Begegnung mit den beiden US-Generalen fand im Kriegsministerium in der Rue Saint-Dominique statt. Hier hatte im tragischen Sommer 1940 seine kurze Regierungslaufbahn begonnen, und hierher war er nun zurückgekehrt, um den Eindruck von Kontinuität zu erwecken. Die Formel, mit der er die Schande des Vichy-Regimes zu tilgen suchte, war majestätisch einfach: »Die Republik hat nie aufgehört zu existieren.« De Gaulle bat Eisenhower, Leclercs Division in Paris zu belassen, um Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten. Da nun aber einige von Leclercs Einheiten bereits aus der Stadt abzogen, meinte er, die Amerikaner könnten die Bevölkerung vielleicht mit einer Demonstration der Stärke beeindrucken und ihr das Gefühl der Sicherheit geben, dass die Deutschen nicht mehr zurückkämen. Warum sollten nicht eine ganze Division oder gar zwei auf dem Weg an die Front durch Paris marschieren? Eisenhower, der es etwas merkwürdig fand, dass de Gaulle amerikanische Truppen anforderte, um seine Stellung zu festigen, fragte Bradley, was er davon halte. Der meinte, das könne in den nächsten Tagen durchaus organisiert werden. Eisenhower forderte also de Gaulle auf, in Begleitung von General Bradley den Vorbeimarsch der Truppen abzunehmen. Er selbst wollte dabei nicht in Erscheinung treten.6
In Chartres zurück, forderte Eisenhower General Sir Bernard Montgomery auf, sich de Gaulle und Bradley bei der Parade anzuschließen, doch der lehnte ab, nach Paris zu kommen. Dieses unbedeutende, aber bezeichnende Detail wurde von gewissen britischen Zeitungen zum Anlass genommen, den Amerikanern vorzuwerfen, sie beanspruchten den ganzen Ruhm der Befreiung von Paris für sich allein. Die zwanghafte Neigung der Fleet Street, in nahezu jeder Entscheidung des SHAEF eine Herabsetzung Montgomerys und damit der Briten zu sehen, sollte den Beziehungen zwischen den Alliierten noch schweren Schaden zufügen. Sie war jedoch ein Ausdruck des verbreiteten Unmuts darüber, dass Großbritannien zunehmend an den Rand des Geschehens geriet. Jetzt waren die Amerikaner am Zug und würden den Sieg für sich vereinnahmen. Luftmarschall Sir Arthur Tedder, Eisenhowers britischem Stellvertreter, bereitete dieses Vorurteil der britischen Presse Sorge: »Nach dem, was ich im SHAEF zu hören bekam, musste ich befürchten, dass dieses Verhalten geeignet war, einen tiefen Riss zwischen den Alliierten zu erzeugen.«7
Am nächsten Abend begab sich die 28. US-Infanteriedivision unter ihrem Kommandeur Generalleutnant Norman D. Cota bei dichtem Regen von Versailles nach Paris. »Dutch« Cota, der bei Omaha Beach durch außerordentlichen Mut und Führungsqualitäten aufgefallen war, hatte die Division erst zwei Wochen zuvor übernommen, als die Kugel eines deutschen Scharfschützen seinen Vorgänger getötet hatte. Die Kämpfe in der von dichten Hecken durchzogenen Normandie im Juni und Juli waren qualvoll und opferreich gewesen. Aber als unter Führung von General George C. Pattons 3. Armee Anfang August der Durchbruch gelang, war beim Vormarsch zur Seine und nach Paris wieder Optimismus aufgekommen.
Im Bois de Boulogne hatte man Duschen aufgestellt, wo Cotas Männer sich für die Parade säubern konnten. Am nächsten Morgen, dem 29. August, marschierte die Division die Avenue Foch bis zum Arc de Triomphe hinauf und dann den langen Boulevard der Champs-Elysées entlang. Infanterie im Stahlhelm mit umgehängtem Gewehr und aufgestecktem Bajonett paradierte vorbei. Die Männer im olivfarbenen Drillich, 24 in einer Reihe, füllten den breiten Boulevard. Auf der Schulter trugen sie als Divisionsabzeichen das rote »Keystone«-Emblem des Staates Pennsylvania, das die Deutschen wegen seiner Form »Bluteimer« genannt hatten.8
Die Franzosen staunten, wie lässig die Uniformen der Amerikaner wirkten und dass sie offenbar Technik im Überfluss zur Verfügung hatten. »Eine mechanisierte Armee«, notierte der Tagebuchschreiber Jean Galtier-Boissière.9 Die Menschenmenge, die sich an diesem Morgen an den Champs Elysées versammelt hatte, konnte einfach nicht glauben, dass eine einzige Infanteriedivision so viele Fahrzeuge mit sich führte: unzählige Jeeps, manche mit hinten aufmontiertem 12,7-mm-Fla-MG, Panzerspähwagen, die Artillerie mit ihren 155-mm-Feldhaubitzen »Long Tom«, die von Zugmaschinen geschleppt wurden, Pioniere, Serviceeinheiten mit kleinen und großen Lastkraftwagen, M4-Sherman-Panzer und Panzerjäger. Angesichts dieser Vorführung nahm sich die Wehrmacht, die bei der Eroberung Frankreichs im Jahr 1940 geradezu unbesiegbar erschienen war, mit ihren Pferdegespannen seltsam antiquiert aus.
Das Podium für die Generale hatte man auf der Place de la Concorde errichtet. Pioniere hatten zu diesem Zweck umgekippte Sturmboote aneinandergereiht und eine riesige Trikolore darübergebreitet. Zahlreiche Sternenbanner flatterten im Wind. Eine Militärkapelle von 56 Mann, die zunächst an der Spitze des Zuges marschiert war, spielte beim Defilee den Divisionsmarsch »Khaki Bill«. Was den französischen Zuschauern sicher verborgen blieb, was alle Soldaten der 28. Division aber wussten: Sie marschierten geradewegs zum Sturm auf die deutschen Stellungen am nördlichen Stadtrand von Paris. »Das war einer der bemerkenswertesten Angriffsbefehle, der je erlassen wurde«, sagte Bradley später zu seinem Adjutanten. »Ich denke, nicht viele Menschen haben begriffen, dass die Männer von der Parade direkt ins Gefecht zogen.«10
An der Kanalküste hatte die kanadische 1. Armee den Auftrag, die große Hafenstadt Le Havre einzunehmen, während die britische 2. Armee nach Nordosten ins Pas-de-Calais vorstieß, wo mehrere Abschussrampen der deutschen V-Waffen standen. Ungeachtet der Erschöpfung der Panzerfahrer und eines schlimmen Sturms in der Nacht vom 30. auf den 31. August eroberte die Gardepanzerdivision mit Unterstützung der französischen Résistance Amiens und die Brücken über die Somme, was der General der Panzertruppen Heinrich Eberbach, der die deutsche 5. Panzerarmee befehligte, am nächsten Morgen überrascht feststellen musste. Dann gelang es den Briten, mit einem Vorstoß einen Keil zwischen die Reste der 5. Panzerarmee und die 15. Armee zu treiben, die bisher das Pas-de-Calais gehalten hatte. Die Kanadier, an ihrer Spitze das Royal Regiment of Canada, die Royal Hamilton Light Infantry und die Essex Scottish, hielten auf Dieppe zu, wo sie bei dem desaströsen Angriff der Deutschen zwei Jahre zuvor so schwer gelitten hatten.
Die Alliierten sonnten sich in kaum zu überbietender Siegeseuphorie. Der Bombenanschlag auf Hitler vom 20. Juli hatte sie in der Vorstellung bestärkt, wie 1918 beginne Deutschland jetzt zusammenzubrechen. Tatsächlich aber hatte das fehlgeschlagene Attentat eine beträchtliche Stärkung der Nazi-Herrschaft zur Folge. Doch der Chef Aufklärung des SHAEF, G2, behauptete unbeirrt: »Die August-Schlachten haben die Sache erledigt, und im Westen ist der Feind am Ende.«11 Das Kriegskabinett in London kam zu der Auffassung, bis Weihnachten werde alles vorbei sein, und setzte den 31. Dezember 1944 als voraussichtliches Datum des Kriegsendes fest. Lediglich Churchill blieb skeptisch und traute den Deutschen durchaus zu, den Kampf fortzusetzen. In Washington, wo man ähnlich dachte wie beim SHAEF, glaubte man, sich nun stärker den nach wie vor schweren Kämpfen gegen die Japaner im Pazifik widmen zu können. Das U.S. War Production Board, das während des Krieges die amerikanische Rüstungsproduktion koordinierte, begann Bestellungen von Militärgütern, darunter für Artilleriegranaten, zu annullieren.
Auch viele Deutsche glaubten, das Ende sei gekommen. Oberstleutnant Fritz Fullriede in Utrecht schrieb in sein Tagebuch: »Die Westfront ist am Ende, der Feind steht bereits in Belgien und an den Grenzen des Reichs; Rumänien, Bulgarien, die Slowakei und Finnland haben um Frieden nachgesucht. Es ist genau wie 1918.«12 Auf einem Bahnhof in Berlin hatte jemand gewagt, ein Spruchband mit der Aufschrift anzubringen: »Wir wollen Frieden, so oder so!«13 An der Ostfront hatte die Rote Armee mit ihrer »Operation Bagration« die Heeresgruppe Mitte zerschlagen, war 500 Kilometer weit vorgestoßen und stand nun an der Weichsel vor den Toren von Warschau. In drei Monaten hatte die Wehrmacht an der Ostfront 589425 Mann und an der Westfront 156726 Mann verloren.14
Der rasche Vorstoß der Roten Armee bis zur Weichsel hatte die polnische Armija Krajowa bestärkt, den kühnen, aber zum Scheitern verurteilten Warschauer Aufstand auszulösen. Stalin, der kein unabhängiges Polen wollte, ließ kalten Herzens zu, dass die Aufständischen von den Deutschen vernichtet wurden. Inzwischen war auch Hitlers Hauptquartier »Wolfsschanze« bei Rastenburg bedroht, und deutsche Truppen kapitulierten auf dem Balkan. Zwei Tage vor der Befreiung von Paris schied Rumänien aus der Achse aus, als sowjetische Truppen seine Grenzen überschritten. Am 30. August marschierte die Rote Armee in Bukarest ein und besetzte die lebenswichtigen Ölfelder von Ploeşti. Der Weg zur ungarischen Tiefebene, zur Donau und damit nach Österreich und Deutschland stand nun offen.
Mitte August war General George Pattons 3. US-Armee aus der Normandie bis zur Seine vorgerückt. Das fiel mit der erfolgreichen »Operation Dragoon«, der Landung alliierter Truppen an der Mittelmeerküste zwischen Cannes und Toulon, zusammen. Die Furcht, abgeschnitten zu werden, trieb große Teile der deutschen Einheiten zum Rückzug quer durchs Land. Mitglieder der Milice des Vichy-Regimes, die wussten, was sie von der Résistance zu erwarten hatten, begaben sich ebenfalls auf einen Marsch durch feindliches Gebiet, um in Deutschland Zuflucht zu finden. Dieser sollte sich in einigen Fällen über 1000 Kilometer weit erstrecken. Improvisierte »Marschgruppen«, eine Mischung aus Angehörigen des Heeres, der Luftwaffe, der Kriegsmarine und Zivilpersonal, erhielten Befehl, sich aus dem Bereich der Atlantikküste in Richtung Osten in Sicherheit zu bringen und dabei der Résistance möglichst aus dem Weg zu gehen. Die Wehrmacht begann einen Frontbogen bei Dijon zu verstärken, wo sie fast eine Viertelmillion Deutsche in Empfang nahm. Weitere 51000 Soldaten entgingen der Einkesselung an der Atlantik- und der Mittelmeerküste jedoch nicht. Der »Führer« hatte große Häfen zu »Festungen« erklären lassen, obwohl keine Hoffnung bestand, Truppen von dort zu entsetzen.15 Diese Art von Realitätsverweigerung verglich ein deutscher General mit dem Verhalten eines katholischen Priesters am Karfreitag, der den Schweinebraten auf seinem Teller mit Weihwasser besprengt und dabei spricht: »Du bist Fisch.«16
Nach dem Bombenanschlag vom 20. Juli erfuhr Hitlers Paranoia eine weitere Steigerung. In der »Wolfsschanze« in Ostpreußen ging er weit über seine gewohnte Stichelei hinaus, der deutsche Generalstab sei nur ein »Intellektuellenklub«.17 »Jetzt weiß ich, warum in den letzten Jahren alle meine großen Pläne in Russland scheitern mussten«, erklärte er. »Alles war Verrat! Ohne die Verräter wären wir längst Sieger!«18 Hitler hasste die Verschwörer vom 20. Juli nicht nur wegen des Verrats, sondern auch weil sie das Bild von einem monolithischen Deutschland beschädigt hatten, was sich auf verbündete und neutrale Staaten auswirken würde.
Bei seiner Lagebesprechung am 31. August erklärte Hitler: »Es werden Momente kommen, in denen die Spannungen der Verbündeten so groß werden, dass dann trotzdem der Bruch eintritt. Koalitionen sind in der Weltgeschichte noch immer einmal zugrunde gegangen.«19 Propagandaminister Josef Goebbels nahm diesen Gedanken des »Führers« rasch bei einer kurz darauf stattfindenden Ministerkonferenz in Berlin auf: »Es ist sicher, dass sich die politischen Konflikte mit dem scheinbaren Näherkommen eines Sieges der Alliierten steigern und eines Tages Risse im Haus unserer Feinde erzeugen werden, die nicht mehr repariert werden können.«20
Der Stabschef der Luftwaffe, General der Flieger Werner Kreipe, schrieb an diesem letzten Augusttag in sein Tagebuch: »Abends Meldungen über Zusammenbruch im Westen.« Fast die ganze Nacht hindurch ging es hektisch zu – »Befehle, Anordnungen, Telefonate«. Am nächsten Morgen befahl der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW), Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, der Luftwaffe, weitere 50000 Mann für das Heer abzustellen. Am 2. September notierte Kreipe: »Im Westen anscheinend Auflösung, Jodl [der Chef des Planungsstabes der Wehrmacht] merkwürdig ruhig. Die Finnen springen ab.«21 Während der Besprechung an diesem Tag begann Hitler auf den Präsidenten Finnlands, Marschall Mannerheim, zu schimpfen. Er war auch aufgebracht darüber, dass Reichsmarschall Hermann Göring es in einer so kritischen Situation nicht einmal für nötig hielt, bei ihm zu erscheinen. Er deutete sogar an, die Staffeln der Luftwaffe aufzulösen und die Besatzungen in Flakeinheiten einzugliedern.
Da Truppen der Roten Armee nun bereits an der Grenze Ostpreußens standen, fürchtete Hitler eine Aktion sowjetischer Fallschirmjäger, um seiner Person habhaft zu werden. Die »Wolfsschanze« war inzwischen zu einer wahren Festung ausgebaut worden. »Es war mittlerweile ein riesenhafter Apparat entstanden«, schrieb Hitlers Sekretärin Traudl Junge. »Überall waren Sperren und neue Posten, Minen, Stacheldrahtverhaue, Beobachtungstürme.«22
Hitler wollte, dass ein Offizier, dem er vertrauen konnte, die Truppen befehligte, die ihn schützten. Oberst Otto Remer hatte das Wachregiment »Großdeutschland« in Berlin dazu gebracht, die Verschwörer des 20. Juli niederzuringen. Als er von Remers Bitte hörte, zu einer Truppe im Feld abkommandiert zu werden, beauftragte ihn Hitler, eine Brigade zum Schutz der »Wolfsschanze« aufzubauen. Anfangs bestehend aus seiner Einheit aus Berlin, der acht Batterien des Flakregiments »Hermann Göring« angegliedert wurden, wuchs Remers Brigade unaufhörlich weiter. Im September stand die Führer-Begleit-Brigade bereit, die »Wolfsschanze« gegen »einen Angriff von zwei oder drei Luftlandedivisionen« zu verteidigen. Dieses »ungewöhnliche Aufgebot« verschiedener Waffengattungen, wie Remer selbst es nannte, erhielt absolute Priorität bei der Ausstattung mit Waffen, Ausrüstung und »erfahrenen Frontsoldaten«, zumeist aus der Division »Großdeutschland«.23
In der »Wolfsschanze« herrschte eine tief deprimierte Stimmung. Hitler lag tagelang lustlos im Bett, während seine Sekretärinnen damit beschäftigt waren, »ganze Stöße von Schadensmeldungen« von der Ost- und der Westfront abzuschreiben.24 Unterdessen saß Göring schmollend auf dem Jagdschloss der Hohenzollern im ostpreußischen Rominten, das er sich angeeignet hatte. Er wusste, dass ihn seine Rivalen nach dem Versagen der Luftwaffe in der Normandie am Hof des »Führers« ausmanövriert hatten. Das betraf insbesondere den äußerst geschickt agierenden Martin Bormann, dessen Rachsucht sich bald zeigen sollte. Sein anderer Gegenspieler, der Reichsführer SS Heinrich Himmler, hatte den Befehl über das »Ersatzheer« erhalten, in dessen Stab der Bombenanschlag ausgeheckt worden war. Und Goebbels, den der »Führer« inzwischen zum Reichsbevollmächtigten für den totalen Kriegseinsatz ernannt hatte, schien damit die Heimatfront vollständig in der Hand zu haben. Allerdings waren Bormann und die Gauleiter nach wie vor in der Lage, jeden Versuch zu vereiteln, auch ihre Einflussbereiche unter Kontrolle zu nehmen.
War bereits der Anschlag auf Hitler für die meisten Deutschen ein Schock gewesen, so sank die Stimmung beträchtlich weiter, als sowjetische Einheiten an den Grenzen Ostpreußens auftauchten. Vor allem die Frauen wollten, dass der Krieg ein rasches Ende nahm. Wie der Sicherheitsdient der SS meldete, hatten viele den Glauben an den »Führer« verloren. Jene, die tiefer blickten, spürten jedoch, dass es kein Ende des Krieges geben konnte, solange Hitler am Leben war.25
Trotz oder vielleicht gerade wegen der Erfolge dieses Sommers regten sich auf den höchsten Kommandoebenen der Alliierten Rivalitäten. Eisenhower, »eher militärischer Staatsmann als Generalissimus«, wie ein Beobachter es ausdrückte,26 suchte den Konsens, aber er schien geneigt, Montgomery und die Briten beschwichtigen zu wollen, was bei Omar Bradley Ärger und bei General George Patton zornige Verachtung auslöste. Der Streit darüber, der bis ins neue Jahr hinein das Verhältnis zwischen den Beteiligten belasten sollte, hatte am 19. August begonnen.
An diesem Tag hatte Montgomery gefordert, nahezu die gesamte Streitmacht der Alliierten solle unter seinem Befehl durch Belgien und Holland in Richtung Ruhrgebiet marschieren. Als dies abgelehnt wurde, verlangte er, dass seine eigene 21. Armeegruppe mit Unterstützung der 1. US-Armee unter General Courtney Hodges in diese Richtung vorrücken möge. Das hätte es den Alliierten ermöglicht, die Stellungen der V-Waffen zu erobern, die auf London abgeschossen wurden, und den Hochseehafen von Antwerpen zu besetzen, der für den Nachschub beim weiteren Vormarsch von vitaler Bedeutung war. Zwar stimmten Bradley und die Befehlshaber seiner beiden Armeen, Patton und Hodges, zu, dass Antwerpen gesichert werden musste, aber sie wollten in Richtung Saar marschieren und so auf dem kürzesten Wege in Deutschland einrücken. Die amerikanischen Generale waren der Meinung, dass sie aufgrund der unter der Führung von Pattons 3. Armee erreichten Erfolge bei der »Operation Cobra« und beim Durchbruch zur Seine den Vorrang zu beanspruchen hätten. Eisenhower dagegen sah klar, dass ein einzelner Vorstoß, ob der Briten im Norden oder der Amerikaner in der Mitte der Front, hohe Risiken barg – im politischen mehr noch als im militärischen Sinn. Er hatte einen Zornesausbruch der Presse und der Politiker entweder in den USA oder in Großbritannien zu gewärtigen, sollte eine der Armeen wegen Nachschubproblemen gestoppt werden, während die andere vorwärtsstürmte.
Als am 1. September die seit Langem geplante Entscheidung verkündet wurde, dass Bradley, der technisch bisher Montgomery unterstand, nun den Befehl über die 12. US-Armeegruppe übernehmen sollte, reagierte die britische Presse erneut gekränkt. In der Fleet Street sah man diese Umgruppierung als Herabstufung Montgomerys, denn da Eisenhower jetzt sein Hauptquartier in Frankreich hatte, befehligte der Brite die Bodentruppen nicht mehr. In London, wo man dieses Problem vorausgesehen hatte, war man bemüht, die Lage zu beruhigen, indem man Montgomery zum Feldmarschall beförderte (wodurch er theoretisch nun über Eisenhower stand, der nur Vier-Sterne-General war). Patton, der an diesem Morgen Radio hörte, war tief enttäuscht, als »Ike sagte, Monty sei der größte lebende Soldat und nun Feldmarschall«. Von den Erfolgen anderer war keine Rede. Nach einer Besprechung in Bradleys Hauptquartier am nächsten Tag schrieb Patton, der den Vormarsch durch Frankreich angeführt hatte: »Ike hat keinem von uns gedankt oder dazu gratuliert, was wir getan haben.«27 Zwei Tage später stand seine 3. Armee an der Maas.
Wie dem auch sei, der Vorstoß der 1. US-Armee und der britischen 2. Armee nach Belgien gehörte zu den schnellsten Märschen des ganzen Krieges. Das Tempo hätte noch höher sein können, wären sie nicht in jedem Dorf und jeder Stadt Belgiens von der Bevölkerung begeistert begrüßt worden. Der Kommandeur des britischen XXX. Korps, Generalleutnant Brian Horrocks, beschrieb das mit den Worten: »Mit all dem, was sich an Champagner, Blumen, Menschen, vor allem Mädchen, auf den Funkfahrzeugen häufte, war es schwierig, den Krieg noch fortzusetzen.«28 Auch die Amerikaner stellten fest, dass sie in Belgien mit viel größerer Herzlichkeit und Begeisterung willkommen geheißen wurden als in Frankreich. Am 3. September fuhr die US-Gardepanzerdivision in Brüssel unter dem stürmischsten Jubel ein, den sie je erlebt hatte.
Schon am nächsten Tag nahm die britische 11. Panzerdivision unter Generalleutnant »Pip« Roberts in einem bemerkenswerten Handstreich Antwerpen. Mit Unterstützung der belgischen Résistance besetzte sie den Hafen, bevor die Deutschen die Anlagen zerstören konnten. Die 159. Infanteriebrigade griff den deutschen Stab in einem Park an, und um 20 Uhr hatte sich der Kommandant der deutschen Garnison bereits ergeben. Seine 6000 Mann wurden zum Zoo eskortiert, wo man sie in leeren Käfigen unterbrachte, denn die Tiere hatte die hungernde Bevölkerung bereits aufgegessen. »Dort saßen die Gefangenen auf Stroh«, berichtete Martha Gellhorn, »und starrten durch die Gitterstäbe.«29 Der Fall von Antwerpen löste im Führerhauptquartier einen Schock aus. »Sie hatten gerade erst die Somme überquert«, bekannte der General der Artillerie Walter Warlimont im Jahr darauf gegenüber Vernehmungsoffizieren der Alliierten, »und schon standen eine oder zwei Ihrer Panzerdivisionen vor den Toren von Antwerpen. Wir hatten nicht so schnell mit einem Durchbruch gerechnet und waren überhaupt nicht darauf vorbereitet. Als wir die Nachricht erhielten, war das eine böse Überraschung.«30
Auch die 1. US-Armee ging in hohem Tempo vor, um die auf dem Rückzug befindlichen Deutschen einzuholen. Das Aufklärungsbataillon der 2. Panzerdivision eilte den übrigen Truppen weit voraus, stellte fest, auf welcher Route sich der Feind zurückzog, und legte sich dann mit seinen leichten Panzern nach Einbruch der Dunkelheit in einem Dorf oder einer Stadt in den Hinterhalt. »Einen Konvoi ließen wir bis auf die wirksamste Schussweite unserer Waffen herankommen, bevor wir das Feuer eröffneten. Ein leichter Panzer hatte die Aufgabe, ausgeschaltete Fahrzeuge rasch zwischen die Häuser zu schleppen, damit nachfolgende Einheiten nichts bemerkten. So ging das die ganze Nacht.«31 Ein amerikanischer Panzerkommandant rechnete aus, dass sein Fahrzeug vom 18. August bis zum 5. September etwa 900 Kilometer »praktisch ohne jede Instandhaltung« gefahren war.32
An der französisch-belgischen Grenze brachte eine Zangenbewegung in der Nähe von Mons Bradleys Truppen noch größeren Erfolg als den Briten. Motorisierten Einheiten dreier deutscher Panzerdivisionen gelang es noch auszubrechen, bevor die 1. US-Infanteriedivision den Ring schloss. Die Fallschirmjäger der 3. und 6. Division waren verbittert, dass die Waffen-SS wieder einmal nur sich selbst gerettet und alle anderen im Stich gelassen hatte. Die Amerikaner kesselten die Überlebenden von sechs deutschen Divisionen aus der Normandie – insgesamt mehr als 25000 Mann – ein. Bevor diese sich ergaben, boten sie ein leicht zu treffendes Ziel. Im Bericht der Artillerie der 9. US-Infanteriedivision heißt es: »Wir richteten direktes Feuer unserer 155-mm-Kanonen gegen Marschkolonnen der feindlichen Truppen, fügten ihnen schwere Verluste zu und trugen dazu bei, 6100 Mann, darunter drei Generale, gefangen zu nehmen.«33
Angriffe der belgischen Résistance in Mons lösten die ersten Vergeltungsmaßnahmen der Deutschen aus. Dabei wurden 60 Zivilisten getötet und viele Häuser in Brand gesteckt. Bei der Säuberung der Gegend vom Feind arbeiteten Gruppen der Geheimarmee – der belgischen Nationalbewegung, der Unabhängigkeitsfront und der Weißen Armee [1] – eng mit den Amerikanern zusammen. Das deutsche Oberkommando befürchtete, beim Rückzug könnte es in Belgien zu Massenaufständen kommen, bevor die deutschen Truppen sich am Westwall in Sicherheit brachten, den die Alliierten auf Englisch »Siegfried Line« nannten. Junge Belgier beteiligten sich an den Anschlägen, was schon damals schreckliche Folgen hatte, vor allem aber im Dezember, als die deutschen Truppen während der Ardennen-Offensive, nach Rache dürstend, zurückkehrten.
Am 1. September beobachtete Maurice Delvenne in Jemelle bei Rochefort in den nördlichen Ardennen mit großer Freude den Abzug der Deutschen aus Belgien. »Die deutschen Truppen laufen immer schneller, und die Desorganisation scheint zuzunehmen«, schrieb er in sein Tagebuch. »Pioniere, Infanterie, Marine, Luftwaffe und Artillerie – alle durcheinander auf einem Lkw. Die Männer scheinen direkt aus dem Kampfgebiet zu kommen. Sie sind verschmutzt und abgemagert. Sie interessiert vor allem, wie viele Kilometer es noch bis zu ihrer Heimat sind. Und wir machen uns natürlich einen boshaften Spaß daraus, größere Entfernungen anzugeben.«34
Zwei Tage später kamen SS-Truppen, einige Soldaten mit Kopfverbänden, durch Jemelle. »Ihr Blick ist hart, und sie starren die Menschen hasserfüllt an.«35 Sie hinterließen eine Spur der Verwüstung – ausgebrannte Häuser und umgestürzte Telegrafenmasten. Sie trieben gestohlene Schafe und Rinder vor sich her. Die Bauern aus den Deutsch sprechenden Ostkantonen der Ardennen erhielten Befehl, sich samt Familien und Vieh hinter den Westwall auf Reichsgebiet zu begeben. Die Nachrichten von den Bombenangriffen der Alliierten ängstigten sie sehr, aber die meisten wollten ihre Höfe nicht im Stich lassen. Sie versteckten sich mit ihrem Vieh in den Wäldern, bis die Deutschen abgezogen waren.
Am 5. September provozierten die Taten junger Angehöriger der Résistance die Deutschen dazu, an der Fernstraße N4 von Marche-en-Famenne nach Bastogne in der Nähe des Dorfes Bande 35 Häuser niederzubrennen. Noch viel schlimmer wurde es, als die Deutschen während der Ardennen-Offensive am Heiligabend in die Gegend zurückkehrten. Die Vergeltung für Angriffe der Résistance versetzte die Bevölkerung in Angst und Schrecken. In Buissonville rächten sich die Deutschen am 6. September für einen Überfall, der zwei Tage zuvor stattgefunden hatte. Dort und im Nachbardorf setzten sie 22 Häuser in Brand.
Längs der Rückzugslinie der Deutschen strömten Dorf- und Stadtbewohner mit belgischen, britischen und amerikanischen Fahnen auf die Straßen, um ihre Befreier willkommen zu heißen. Zuweilen mussten sie die Fahnen rasch verbergen, wenn eine weitere flüchtende deutsche Einheit in ihrer Hauptstraße auftauchte. Im holländischen Utrecht beschrieb Oberstleutnant Fritz Fullriede »einen traurigen Zug holländischer Nationalsozialisten, die vor dem Zorn der niederländischen Bevölkerung nach Deutschland in Sicherheit gebracht werden. Viele Frauen und Kinder.« Diese niederländische SS-Einheit hatte bei Hechtel jenseits der belgischen Grenze gekämpft. Sie war der Einkesselung entgangen, weil sie einen Kanal durchschwommen hatte. Aber »zur Schande der Briten [die offenbar tatenlos zusahen] wurden die meisten der verwundeten Offiziere und Mannschaften, die sich ergeben wollten, von den Belgiern erschossen«.36 Nach vier Jahren Besatzung hatten Niederländer und Belgier viel zu vergelten.
Die deutsche Front in Belgien und Holland schien komplett zusammengebrochen zu sein. Im Hinterland brach Panik aus, und es kam zu so chaotischen Szenen, dass das LXXXIX. Armeekorps in seinem Kriegstagebuch von »einem Bild« sprach, »das für die deutsche Armee unwürdig und beschämend ist«.37 Streifengruppen der Feldjäger, tatsächlich aber Strafabteilungen, sammelten Versprengte ein und geleiteten sie zu einem Sammellager. Von dort wurden sie dann in der Regel in Gruppen zu 60 Mann unter dem Kommando eines Offiziers an die Front zurückgeschickt. Bei Lüttich marschierten etwa 1000 Mann, geführt von Offizieren mit gezogener Pistole, an die Front. Wer der Fahnenflucht verdächtig war, wurde vor ein Kriegsgericht gestellt. Wenn schuldig gesprochen, lautete das Urteil entweder auf Todesstrafe oder Bewährungsbataillon (in Wirklichkeit ein Strafbataillon). Deserteure, die gestanden oder in Zivilkleidung aufgegriffen wurden, erschoss man an Ort und Stelle.
Jeder Feldjäger trug eine rote Armbinde mit der Aufschrift »OKW Feldjäger« und hatte einen Sonderausweis mit einem grünen diagonalen Streifen bei sich, auf dem stand: »Er ist berechtigt, bei Widerstand von der Schusswaffe Gebrauch zu machen.« Die Feldjäger waren stark indoktriniert. Einmal wöchentlich hielt ein Offizier ihnen eine Lektion »über die Weltlage, die Unmöglichkeit, Deutschland zu zerstören, die Unfehlbarkeit des Führers und über unterirdische Fabriken, mit denen der Gegner überlistet werden würde«.38
Generalfeldmarschall Walter Models Appell an die Soldaten der Westarmee, in dem er sie aufforderte, durchzuhalten und Zeit für den »Führer« zu gewinnen, verhallte ungehört. Nun wurde rücksichtslos vorgegangen. Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel befahl am 2. September, »Drückeberger und feige Simulanten«, einschließlich Offiziere, auf der Stelle hinzurichten.39 Model erklärte warnend, er benötige mindestens zehn Infanteriedivisionen und fünf Panzerdivisionen, wenn er einen Durchbruch des Gegners nach Norddeutschland verhindern sollte. Streitkräfte dieser Stärke waren einfach nicht vorhanden.
Der deutsche Rückzug längs der Küste des Ärmelkanals im Norden verlief wesentlich geordneter, was vor allem daran lag, dass die Kanadier verspätet die Verfolgung aufnahmen. Der General der Infanterie Gustav von Zangen führte den Abzug der 15. Armee vom Pas-de-Calais nach Nordbelgien auf eindrucksvolle Weise. Die Aufklärung der Alliierten irrte sehr, als sie erklärte, dass »die einzige bekannte Verstärkung, die in Holland eintreffen wird, die demoralisierten und desorganisierten Reste der 15. Armee sind, die jetzt über die holländischen Inseln aus Belgien fliehen«.40
Die unerwartete Eroberung Antwerpens mag für das deutsche Oberkommando ein schwerer Schlag gewesen sein, aber da die britische 2. Armee in den Tagen darauf die Nordseite der Scheldemündung nicht besetzte, gelang es General von Zangen, Verteidigungslinien zu errichten. Dazu gehörte eine 20 Kilometer breite Schanzanlage auf der Südseite der Scheldemündung (genannt Breskens-Kessel), auf der Halbinsel Zuid-Beveland am Nordufer des Flusses und auf der Insel Walcheren. Seine Streitmacht bestand bald aus 82000 Mann und hatte 530 Geschütze zur Verfügung, womit er jeden Versuch der Royal Navy verhinderte, sich der stark verminten Scheldemündung zu nähern.
Admiral Sir Bertram Ramsay, der Oberbefehlshaber der Marine der Alliierten, hatte das SHAEF und Montgomery bereits darauf aufmerksam gemacht, dass die Deutschen die Scheldemündung mit Leichtigkeit blockieren konnten. Auch Admiral Sir Andrew Cunningham, der britische Marineminister, hatte gewarnt, dass Antwerpen »uns so viel nutzt wie Timbuktu«, wenn die Zugänge nicht vom Feind gesäubert würden.41 Der Korpskommandeur General Horrocks räumte später seine Verantwortung für diesen Fehler ein. »Napoleon hätte das zweifellos erkannt«, schrieb er, »aber ich fürchte, Horrocks hat es nicht.«42 Aber schuld waren weder Horrocks noch Roberts, der Kommandeur der 11. Panzerdivision. Der Fehler lag bei Montgomery, den die Mündung nicht interessierte und der meinte, die Kanadier könnten sie auch später noch räumen.
Das war ein schwerer Irrtum, der bald zu einer bösen Überraschung führen sollte. Doch in diesen Tagen der Euphorie waren die Generale, die schon im Ersten Weltkrieg gedient hatten, überzeugt, der September 1944 sei mit dem September 1918 zu vergleichen. »Die Zeitungen berichteten über einen Vormarsch von 340 Kilometern in sechs Tagen und wiesen darauf hin, dass Truppen der Alliierten bereits in Holland, Luxemburg, in Saarbrücken, Brüssel und Antwerpen stehen«, schrieb der Militärhistoriker Forrest Pogue. »Die Prognosen der Aufklärung an allen Fronten waren von einem fast hysterischen Optimismus geprägt.«43 Fast alle hohen Offiziere starrten auf den Rhein und glaubten, die Alliierten könnten ihn quasi in einem Sprung überwinden. Eisenhower konnte diese Vision natürlich nicht ernst nehmen, während Montgomery aus ganz eigenen Gründen davon wie berauscht war.
[1] Die Bezeichnung »Weiße Armee« hatte nichts mit den Armeen der Weißgardisten im russischen Bürgerkrieg zu tun. Diese Organisation entstand aus dem belgischen Geheimdienstnetz heraus, das sich unter der deutschen Besatzung im Ersten Weltkrieg gebildet hatte. Es trug den Namen »Weiße Dame«, der auf die Legende zurückgeht, dass die Dynastie der Hohenzollern stürzen werde, wenn der Geist einer in Weiß gekleideten Dame erscheine.
2. KapitelAntwerpen und die deutsche Grenze
Als es Ende August schien, dass die deutsche Front dem Zusammenbruch nahe wäre, drohten Nachschubprobleme Eisenhowers Armeen zum Stillstand zu bringen. Das Schienennetz der französischen Eisenbahn hatten die Bomber der Alliierten weitgehend zerstört. Also mussten Zehntausende Tonnen Treibstoff, Proviant und Munition Tag für Tag den langen Weg von der Normandie in Versorgungs-Lkw des Red Ball Express [2] transportiert werden. Die Entfernung vom Atlantikhafen Cherbourg bis zur Front betrug Anfang September fast 500 Kilometer. Für eine volle Fahrt hin und zurück brauchte ein Lkw drei Tage. Allein das befreite Paris benötigte als absolutes Minimum einen Nachschub von 1500 Tonnen täglich.
Diese Aufgabe konnte nur mit den reichen Ressourcen der Amerikaner bewältigt werden. 7000 Lkw waren Tag und Nacht auf diesen Einbahnstraßen unterwegs, wofür sie täglich knapp 1,2 Millionen Liter Treibstoff verbrauchten. Während der gesamten Aktion mussten etwa 9000 Fahrzeuge abgeschrieben werden. Bei dem verzweifelten Versuch, das Tempo des Vormarsches durch Frankreich zu halten, wurden Kanister mit Treibstoff von Maschinen des IX. Truppentransporterkommandos und sogar von Bombenflugzeugen zu den Fronteinheiten gebracht. Aber ein Flugzeug verbrauchte für die Beförderung von acht Litern Treibstoff selbst zwölf Liter Flugbenzin. Jeder Aspekt dieser Nachschubkrise machte deutlich, wie dringlich es war, den Hafen von Antwerpen zu öffnen. Doch Montgomery blieb auf die Überquerung des Rheins fixiert.1
Am 3. September erfuhr er, dass zwar ein großer Teil der 1. US-Armee ihn im Norden unterstützen, aber nicht seinem Kommando unterstehen sollte. Er hatte geglaubt, Eisenhowers Zustimmung zu einem Vorstoß im Norden unter seiner alleinigen Kontrolle zu haben. Daher geriet er außer sich, als er zur Kenntnis nehmen musste, dass Pattons 3. Armee nicht, wie erwartet, gestoppt worden war. Daraufhin schrieb Montgomery an diesem fünften Jahrestag des britischen Kriegseintritts einen Brief an den Chef des Imperial General Staff, Sir Alan Brooke, in London. Darin legte er seine Absicht dar, die Überquerung des Rheins so bald wie möglich und mit allen Mitteln zu erreichen.2 Offenbar glaubte er, das sei der beste Weg, um Eisenhower zu zwingen, seiner Armeegruppe den größten Teil des Nachschubs und die Befehlsgewalt über Hodges’ 1. US-Armee zu bewilligen.
Statt seine Armee halten zu lassen, bis die Nachschublage sich verbesserte, hatte Patton inzwischen insgeheim den Vormarsch in Richtung Saar fortgesetzt. »Um anzugreifen«, erklärte er in seinem Tagebuch, »müssen wir zunächst so tun, als betrieben wir nur Aufklärung, dann die Aufklärung verstärken und schließlich zur Attacke übergehen. Das ist eine sehr traurige Art der Kriegführung.«3 Wenn es darum ging, seinen Kopf durchzusetzen, konnte Patton skrupellos sein. Bomberpiloten hatten nichts dagegen, Treibstoff zu befördern, denn wenn sie diesen an Divisionen der 3. Armee auslieferten, sprang dabei gelegentlich eine Kiste Champagner »mit Grüßen von General Patton« für sie heraus.4 Patton konnte es sich leisten, großzügig zu sein. Irgendwie war es ihm gelungen, 50000 Kisten zu »befreien«.5
Montgomery war so besessen davon, den Hauptschlag im Norden zu führen, dass er sogar in Kauf nahm, die Anstrengungen zur Öffnung des Hafens von Antwerpen für den Nachschub zu gefährden. Aus der neuen Einsatzplanung des frischgebackenen Feldmarschalls vom 3. September ging hervor, dass er nicht mehr daran dachte, starke Kräfte zur Säuberung der Scheldemündung vom Feind bereitzustellen. Das war der Grund, weshalb Roberts’ 11. Panzerdivision beim Einmarsch in Antwerpen keinen Befehl erhielt, über den Albert-Kanal zu setzen und auf die Halbinsel Zuid-Beveland im Nordwesten vorzurücken, wo die Deutschen bereits begonnen hatten, Verteidigungsstellungen zu bauen.
Es dauerte nur wenige Tage, da waren die Reste der deutschen 15. Armee an beiden Ufern der Schelde erneut zu einer Furcht einflößenden Streitmacht aufgebaut. Hier zeigte sich die außergewöhnliche Fähigkeit des deutschen Militärs, sich nach Niederlagen wieder neu aufzubauen, wie es an der Ost- und der Westfront immer wieder bewiesen hatte. Auch bei schlechter Stimmung verließ es nie ganz die Entschlossenheit, den Kampf fortzusetzen. »Wenn uns auch alle Verbündeten verlassen, wir geben den Mut nicht auf«, schrieb ein Unteroffizier an seine Familie. »Einmal wird der Führer schon seine neuen Waffen sprechen lassen, dann folgt auch der Endsieg.«6
Eisenhower, der durchaus anerkannte, wie wichtig es war, die Zugänge zum Hafen Antwerpen zu sichern, brannte aber auch darauf, jenseits des Rheins einen Brückenkopf zu errichten. Vor allem wollte er die neu geschaffene 1. Luftlandearmee der Alliierten bei einer großen Operation einsetzen. Dieses Interesse teilten sowohl der US-Stabschef in Washington, General George C. Marshall, als auch der Befehlshaber der U.S. Air Force, General »Hap« Arnold. Da sie in den Aufbau dieser Luftlandekräfte so viel Zeit und Mühe investiert hatten, wünschten sie nichts dringlicher, als sie bei der ersten sich bietenden Gelegenheit ins Gefecht zu werfen.
Für einen solchen Einsatz hatten sie seit dem Ausbruch aus der Normandie nicht weniger als neun Pläne erwogen, aber der Vormarsch der Alliierten ging in solchem Tempo vonstatten, dass jedes Projekt schon wieder überholt war, bevor es umgesetzt werden konnte. Auch die Verärgerung der Fallschirmjäger kann man sich vorstellen, die bereits wiederholt in voller Ausrüstung und mit perfekt vorbereiteten Gleitern neben ihren Flugzeugen bereitstanden und dann nicht starten durften.7 Auf einer Pressekonferenz der 3. Armee prahlte General Patton: »Die verdammten Fallschirmjäger sind nicht schnell genug, um mit uns Schritt zu halten.« Dann fügte er hinzu: »Das sage ich außerhalb des Protokolls.«8
In der ersten Septemberwoche begann Feldmarschall Montgomery die Möglichkeit des Einsatzes von Luftlandetruppen bei der Überquerung des Rheins bei Arnheim genauer zu studieren. »Operation Market Garden«, die am 17. September starten sollte, war nicht einfach nur ein höchst ehrgeiziges Unternehmen. Sie war schockierend schlecht geplant, hatte nur eine minimale Chance auf Erfolg und hätte nie versucht werden dürfen. Die Absetzplätze, vor allem was Arnheim betraf, waren vom Ziel der Operation, der Rheinbrücke, zu weit entfernt, als dass man einen Überraschungseffekt erreichen konnte. Die Pläne der 1. Luftlandearmee der Alliierten waren nicht mit denen der Bodentruppen abgestimmt. Das XXX. Korps der Briten sollte auf einer einzigen Straße 104 Kilometer vorrücken, um der britischen Luftlandedivision bei Arnheim zu Hilfe zu eilen, sollte diese die Brücke über den Niederrhein in die Hand bekommen. Das Schlimmste aber war, dass man keinerlei Vorkehrungen für den Fall getroffen hatte, dass etwas schiefgehen sollte. Man hatte auch keinen Wetterumschlag einkalkuliert, der die Verstärkung daran hindern konnte, den Ort des Geschehens rasch zu erreichen.
Die 101. US-Luftlandedivision eroberte Eindhoven und die 82. schließlich auch Nijmegen mit der Brücke über den Waal. Letzteres aus dem einzigen Grund, dass Generalfeldmarschall Model abgelehnt hatte, sie zu sprengen, weil er glaubte, sie noch für eine Gegenoffensive zu brauchen. Aber entschlossener Widerstand der Deutschen und permanente Flankenangriffe auf die ungeschützte Straße, die die britischen Panzerfahrer bald »Weg zur Hölle« tauften, behinderten das Vorankommen der Gardepanzerdivision wesentlich.
Die Aufklärung der Alliierten wusste, dass sich die 9. SS-Panzerdivision »Hohenstaufen« und die 10. SS-Panzerdivision »Frundsberg« in der Gegend um Arnheim aufhielten. Aber die Analytiker begingen den verhängnisvollen Fehler anzunehmen, beide Einheiten seien nach dem Rückzug aus Frankreich so entkräftet, dass sie keine ernste Gefahr mehr darstellten. Auf den Absprung der britischen 1. Luftlandedivision reagierten die Deutschen schnell und brutal. Nur ein einziges Bataillon erreichte die Brücke, und auch das wurde am nördlichen Rheinufer eingeschlossen. Am 25. September gelang es schließlich, die überlebenden Fallschirmjäger über den Fluss zu evakuieren. Insgesamt betrugen die Verluste der Alliierten – Briten, Amerikaner und Polen – über 14000 Mann. Die ganze Operation war kaum geeignet, das Vertrauen der Amerikaner in die Führungsqualitäten der Briten zu stärken.
Die Begeisterung über die Aussicht, den Rhein in nahezu einem Anlauf nehmen zu können, hatte die Aufmerksamkeit der Alliierten von der irdischeren, aber wesentlichen Aufgabe abgelenkt, für einen stabilen Nachschub zu sorgen. Admiral Sir Bertram Ramsay war sehr aufgebracht darüber, dass das SHAEF und besonders Montgomery seine Mahnungen ignoriert hatten, die Scheldemündung und die Zugänge nach Antwerpen zu sichern. Trotz Eisenhowers Drängen, sich auf den einzigen eroberten großen Hafen mit intakten Anlagen zu konzentrieren, hatte Montgomery darauf bestanden, dass die kanadische 1. Armee die deutschen Garnisonen eroberte, die noch in Boulogne, Calais und Dünkirchen ausharrten. Dabei war keiner dieser Häfen wegen der Zerstörungen, die die Verteidiger angerichtet hatten, in nächster Zeit nutzbar.
Eisenhower, der eine Knieverletzung nahezu auskuriert hatte, begann nun endlich Ordnung in die Strategie der Alliierten zu bringen. Er ließ sich bei Reims einen kleinen vorgeschobenen Stab einrichten, und am 20. September übernahm das SHAEF das Hotel Trianon Palace in Versailles, ein prunkvolles Bauwerk im Stil der Belle Epoque. Während des Ersten Weltkriegs hatte sich dort das Hauptquartier des Interalliierten Militärrates befunden. Am 7. Mai 1919 hatte Georges Clemenceau dort im großen Salon die Bedingungen für den Versailler Vertrag diktiert, nur wenige Tage bevor das Dokument im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles unterzeichnet wurde.
In den folgenden zwei Wochen zogen weitere Abteilungen in die zahlreichen umliegenden Gebäude, darunter die riesigen Ställe des Schlosses, ein. Bald waren in 1800 Häusern rund um Versailles 24000 Offiziere und Soldaten einquartiert. In Paris übernahm Generalleutnant John C. Lee, der oberste Chef der US-Kommunikation, genannt Com Z, mehr als 315 Hotels und einige tausend weitere Gebäude und Wohnungen, um seine hohen Offiziere standesgemäß unterzubringen. Dabei beanspruchte er das Hotel George V. fast ganz für sich allein. Der aufgeblasene, ja geradezu megalomanische Lee verlangte sogar von verwundeten Soldaten, in ihren Krankenbetten noch im Liegen Haltung anzunehmen, wenn er gestiefelt, gespornt, die Reitpeitsche in der Hand und mit einem Gefolge von Speichelleckern zu einer Inspektion auftauchte.9
Die Frontdivisionen waren empört, dass die Organisatoren des Nachschubs sich vor allem um ihre eigene Bequemlichkeit kümmerten. Die französischen Behörden klagten, die Amerikaner verlangten weit mehr als die Deutschen. Eine Zeitschrift schrieb, SHAEF bedeute »Société des Hôteliers Américains en France«. Eisenhower war wütend auf Lee, der seiner Anweisung, Paris nicht wie eine Kolonie zu behandeln, frech zuwidergehandelt hatte. Aber er brachte es nicht fertig, ihn abzulösen. Selbst Patton, der Lee hasste und verachtete, wagte es nie, ihm in die Quere zu kommen, weil er befürchtete, das könnte sich auf den Nachschub für seine 3. Armee auswirken.
Der Oberbefehlshaber musste auch feststellen, dass selbst nach dem großen Rückschlag bei Arnheim strategische Fragen nicht geklärt waren. Wenn sich Montgomery etwas in den Kopf gesetzt hatte, ließ er nicht mehr davon ab. Er ignorierte die Tatsache, dass seine eigenen Truppen den Hafen von Antwerpen nicht für die Schifffahrt geöffnet hatten und sein Lieblingsprojekt »Market Garden«gescheitert war. Nach wie vor forderte er, der größte Teil des Nachschubs müsse seiner Armeegruppe für den Vorstoß nach Norddeutschland zur Verfügung gestellt werden. In einem Brief vom 21. September, dem Tag, an dem das britische Fallschirmjägerbataillon bei Arnheim gezwungen war, sich zu ergeben, rüffelte Montgomery seinen Oberbefehlshaber, weil der Patton nicht gänzlich gestoppt hatte.10 Interessanterweise waren selbst die Deutschen der Meinung, dass Montgomery irrte. Der General der Panzertruppen Eberbach, den die Briten in Amiens gefangen genommen hatten, erklärte gegenüber anderen deutschen Generalen in der Gefangenschaft: »Die ganze Richtung ihres Hauptstoßes stimmt nicht. Der traditionelle Zugang führt durch das Saargebiet.«11
Patton argumentierte, Montgomerys Plan, auf einer »schmalen Front« mit »einer Art Dolchstoß bis nach Berlin zu gelangen«, sei total falsch.12 Für eine solche Strategie war Montgomery ein viel zu vorsichtiger Kommandeur, und auf der Nordroute musste er die größten Flüsse Nordeuropas dort überqueren, wo sie am breitesten waren. Bradley spottete, Montgomerys sogenannter »Dolchstoß mit der 21. Armeegruppe bis ins Herz Deutschlands« würde wahrscheinlich zu einem »Stoß mit dem Buttermesser« geraten.13 Patton, der darum kämpfte, die Festung Metz einzunehmen, erhielt den Befehl, zur Verteidigung überzugehen, was seine Stimmung nicht besserte. Aber als Eisenhower am 21. September Montgomery »einen cleveren Hurensohn« nannte, begann Patton zu glauben, der Oberbefehlshaber durchschaue nun endlich, wie sehr der Feldmarschall ihn zu manipulieren trachtete. In seinem Bemühen, zum Befehlshaber der alliierten Landstreitkräfte ernannt zu werden, hatte Montgomery vorausgesagt, die straffe Kontrolle des Feldzuges würde gelockert werden, sollte Eisenhower das Kommando übernehmen. »Das Problem war«, hob der Historiker John Buckley hervor, »dass Monty selbst mehr als jeder andere dafür tat, die Stellung seines Chefs zu untergraben.«14
Eisenhower versuchte, über die Differenzen zwischen Montgomerys Vorschlag und seiner eigenen Strategie eines gleichzeitigen Vorstoßes zu Ruhr und Saar hinwegzugehen. Im Grunde erweckte er damit den Eindruck, dass er Montys alleinigen Vorstoß unterstützte und nur im mittleren Teil der Front etwas mehr Flexibilität zulassen wollte. Das aber war ein schwerer Fehler. Er hätte sich klar ausdrücken müssen. Eisenhower wusste, dass er Bradley und General Jacob L. Devers, den Kommandeuren der beiden US-Armeegruppen, die ihm unterstanden, direkte Befehle erteilen konnte. Aber er ließ Montgomery zu viel Freiraum, weil der ein Verbündeter und kein Teil der Befehlskette der US-Streitkräfte war. Eisenhower hätte inzwischen wissen müssen, dass General Marshall in Washington ihn als Oberbefehlshaber unterstützt hätte und Churchill keinerlei Einfluss auf Präsident Roosevelt mehr hatte, besonders wenn es um militärische Entscheidungen ging. Eisenhowers Zögern, darauf zu bestehen, dass die Zeit der Debatten vorüber war und seine Befehle ausgeführt werden mussten, gab Montgomery die Möglichkeit, eine Strategie, der er nicht zustimmte, immer wieder infrage zu stellen und daran herumzumäkeln, um seinen Kopf durchzusetzen. Dabei kam Montgomery überhaupt nicht in den Sinn, welche Spannungen er damit im angloamerikanischen Verhältnis auslöste. Diese sollten im Dezember ihren Höhepunkt erreichen.
Die Situation wurde auch nicht besser, als Montgomery einer wichtigen Besprechung Eisenhowers am 22. September in dessen Hauptquartier in Versailles fernblieb. An seiner Statt schickte er seinen Stabschef Generalleutnant Francis de Guingand, genannt »Freddie«, der bei allen wohlgelitten war. Amerikanische Generale argwöhnten, Montgomery habe das absichtlich getan, um die dort gefassten Beschlüsse später umgehen zu können. Bei der Zusammenkunft ging es um die Strategie für die Zeit, wenn man den Hafen von Antwerpen gesichert haben würde. Eisenhower stimmte zu, dass Montgomerys 21. Armeegruppe den Hauptstoß führen und das Ruhrgebiet im Norden umgehen sollte. Zugleich sollte Bradleys 12. Armeegruppe den Rhein zwischen Köln und Bonn überschreiten und das Ruhrgebiet von Süden her einkreisen. All das legte Eisenhower zwei Tage später in einem Brief an Montgomery dar, um sicherzustellen, dass der Feldmarschall nichts missverstand.
Nachdem Montgomery die kanadische 1. Armee damit beauftragt hatte, die Zugänge nach Antwerpen freizukämpfen, schien er diesem Thema kaum noch Aufmerksamkeit zu widmen. Vielmehr interessierte ihn, wie er den durch »Operation Market Garden« geschaffenen Frontbogen bei Nijmegen nutzen konnte, um in Richtung Reichswald, ein großes Waldgebiet jenseits der deutschen Grenze, anzugreifen. Als die Kanadier schließlich ihre Aufgaben in Nordfrankreich erfüllt hatten und sich Anfang Oktober der Schelde zuwandten, stießen sie jedoch auf wesentlich stärkeren Widerstand der Deutschen, als sie erwartet hatten. Nun sahen sie sich in heftige Kämpfe verwickelt, da die Reste der deutschen 15. Armee genügend Zeit gehabt hatten zu entkommen und die Insel Walcheren sowie die Halbinsel Zuid-Beveland zu befestigen.
Eisenhower, durch einen Bericht der Royal Navy aufmerksam geworden, zeigte sich nun über das langsame Vorankommen zunehmend besorgt. Montgomery reagierte mit zorniger Rechtfertigung auf jeden Hinweis, er unternehme nicht genug, um Antwerpen zu öffnen. Wieder verlangte er, die 1. US-Armee solle seinem Befehl unterstellt werden, damit der Vorstoß in Richtung Ruhrgebiet beschleunigt werden könne. Am 8. Oktober kritisierte Montgomery Eisenhowers Strategie erneut, diesmal gegenüber General George C. Marshall persönlich, der Eindhoven besuchte. Das war ein schwerer Fehler. Bei dem Exempel dafür, was Marshall Montgomerys »überbordenden Egoismus« nannte, platzte sogar diesem außerordentlich selbstbeherrschten Mann beinahe der Kragen.15 Montgomery, dem jedes emotionale Gespür abging, erneuerte seine Attacken auf Eisenhowers Fähigkeiten als Befehlshaber mit einem Papier unter dem Titel »Bemerkungen über den Oberbefehl in Westeuropa«. Montgomerys Kritik hatte ganz sicher an Schärfe zugenommen, weil man ihm so klar zu verstehen gegeben hatte, dass es sein Versagen bei der Sicherung der Scheldemündung war, das die Armeen der Alliierten am weiteren Vorankommen hinderte. Er deutete sogar an, »Operation Market Garden« sei gescheitert, weil er vom SHAEF nicht genügend Unterstützung erhalten habe.
Eisenhower antwortete wenige Tage später mit einer scharfen Zurückweisung, die er zunächst Marshall gezeigt hatte, um dessen Zustimmung zu erhalten. Weder sein Stabschef, Generalleutnant Walter Bedell Smith, noch General Marshall rieten ihm, den Entwurf abzuschwächen. Das Gewicht eines Absatzes konnte selbst dem dickfelligen Montgomery nicht entgehen: »Wenn Sie als der ranghöchste Befehlshaber eines der großen Verbündeten auf diesem Kriegsschauplatz den Eindruck haben, dass meine Konzepte und Anweisungen den Erfolg der Operationen gefährden, dann ist es unsere Pflicht, die Sache höheren Orts vorzubringen, damit man dort Maßnahmen ergreifen kann, wie drastisch sie auch ausfallen mögen.« Montgomery ruderte sofort zurück. »Von mir werden Sie zum Thema des Oberbefehls nichts mehr hören. Ich habe Ihnen meine Ansicht mitgeteilt, und Sie haben darauf geantwortet. Damit ist die Sache erledigt. … Ihr sehr verbundener und loyaler Untergebener, Monty.«16 Montgomery ließ diese Angelegenheit aber bis ans Ende seiner Tage keine Ruhe.
Die Schlacht um die Scheldemündung, die am 2. Oktober mit einem Vorstoß von Antwerpen nach Norden und Nordwesten schließlich begann, fand bei heftigen Regenfällen statt. Die Kanadier, unterstützt vom britischen I. Korps zu ihrer Rechten, brauchten zwei Wochen, bis sie die Basis der Halbinsel Zuid-Beveland erreicht hatten, und den Rest des Monats, um den Gegner von dort zu vertreiben. Eine weitere Streitmacht des II. kanadischen Korps war fast den ganzen Oktober damit beschäftigt, den großen Kessel im Leopold-Kanal auf der Südseite der Scheldemündung zu säubern. Um die Eroberung der Insel Walcheren zu unterstützen, willigte die Royal Air Force schließlich ein, die Deiche zu bombardieren, um so den größten Teil der Insel unter Wasser zu setzen und die deutsche Besatzung von über 6000 Mann zum Verlassen ihrer Verteidigungsstellungen zu zwingen. Britische Kommandos aus Ostende landeten mit Sturmbooten an der Westspitze der Insel und vereinigten sich trotz schwerer Verluste mit den kanadischen Truppen, die von dem eroberten Kessel im Süden herbeieilten. Am 3. November waren die letzten deutschen Einheiten eingeschlossen. Insgesamt gingen 40000 Deutsche in Gefangenschaft. Doch Kanadier und Briten hatten bei der gesamten Operation an der Scheldemündung 13000 Mann verloren. Da die große Wasserfläche noch von deutschen Minen geräumt werden musste, konnte der erste Konvoi mit Nachschub erst am 28. November in den Hafen von Antwerpen einlaufen. Damit waren seit der Eroberung Antwerpens durch einen Überraschungsangriff der 11. britischen Panzerdivision 85 Tage vergangen.
Die erste amerikanische Patrouille betrat, aus dem nordöstlichen Luxemburg kommend, am Nachmittag des 11. September deutschen Boden. Von einer Anhöhe aus erblickten sie einige Betonbunker des Westwalls. Von nun an erklärten viele Einheiten, sie hätten beim Eintreffen auf Nazi-Gebiet symbolisch auf den Boden uriniert. Am selben Tag traf die französische 2. Panzerdivision als Bestandteil von Pattons XV. Korps nordwestlich von Dijon mit der 1. Division der französischen 7. Armee zusammen, die aus Südfrankreich kam. Nun verfügten die Alliierten über eine geschlossene Frontlinie von der Nordsee bis zur Schweiz.
Patton eroberte Nancy am 14. September. Aber seine 3. Armee wurde durch die mittelalterlichen Befestigungsanlagen von Metz aufgehalten und hatte bei der Überquerung der Mosel schwere Kämpfe zu bestehen. »Wir machten genügend Gefangene«, berichtete ein Offizier, »die wir für Arbeiten am Flussufer einsetzten. Dort beschossen die Deutschen unsere Sanitäter, die versuchten, Verwundete mit Sturmbooten zu bergen. Sie durchsiebten mit ihrem Feuer die Verletzten, die hätten gerettet werden können. Wir setzten die Gefangenen bei den Bergungsarbeiten ein, aber die wurden auch beschossen. Schließlich sagten wir: ›Geht doch zur Hölle!‹, und schossen selber die ganze verdammte Bande zusammen.«17
Die deutschen Divisionen mussten mit anderen Problemen fertigwerden. Ein Regimentskommandeur der 17. SS-Panzergrenadierdivision »Götz von Berlichingen« klagte, seine Fahrzeuge »fielen auch dauernd aus, weil der Sprit ja schlecht war, weil doch Wasser drin war. So sollten wir Krieg führen. Ich hatte überhaupt keine Artillerie. Wissen Sie, wenn unser Landser seine Geschütze dauernd mit dem Mannschaftszug transportieren muss, dann sagt er bald: ›Leckt mich doch am Arsch. Ich gehe lieber in Gefangenschaft.‹«18 Solche Stimmungen wurden sicher nicht dem Führerhauptquartier gemeldet. »Das Verhältnis zwischen Mann und Offizier ist bei der kämpfenden Truppe weiterhin einwandfrei und gibt also zu keinen Befürchtungen Anlass«, berichtete die 1. Armee an das OKW.19 Insgesamt gesehen traf das anscheinend sogar zu, wenn man nach Briefen urteilt, die in der Heimat ankamen.
»Der Krieg hat seinen Höhepunkt erreicht«, schrieb ein Obergefreiter an seine Frau. »Bin in dem Abschnitt gegenüber meinem Geburtsort. Da kann ich doch mit mehr Mut und Tapferkeit meine Heimat und euch verteidigen. … An das Unfassbare einer Niederlage dürfen wir nie denken.«20 Andere äußerten Verachtung für den Feind. »Ohne Flieger und Panzer greift er gar nicht an. Dazu ist er zu feige. Ihm stehen alle denkbaren Waffen zur Verfügung.«21 Ein anderer schrieb: »Der amerikanische Infanterist ist keine 5 Pfennige wert. Die machen alles mit den schweren Waffen, und solange noch ein deutsches MG bellt, kommt der amerikanische Infanterist nicht weiter.«22 Doch Obergefreiter Riegler räumte ein: »Wer die Luftherrschaft hat, gewinnt diesen Krieg, und das stimmt auch vollkommen.«23 Obergefreiter Hoes war verbittert darüber, dass man keine Wirkung der V-Waffen erkennen konnte. »Warum werden immer mehr Menschen geopfert? Immer mehr von unserer Heimat zerstört? Warum erfolgt da keine Vergeltung? Von der man so viel spricht.«24
Am 16. September, dem Tag, bevor »Market Garden« gestartet wurde, überraschte Hitler sein Gefolge in der »Wolfsschanze« damit, dass er nach der morgendlichen Lagebesprechung eine weitere Beratung ansetzte. Generaloberst Alfred Jodl sprach gerade über den Mangel an schweren Waffen, Munition und Panzern an der Westfront. Die folgende Szene beschrieb General der Flieger Kreipe in seinem Tagebuch so: »Führer unterbricht Jodl. Führerentschluss, Gegenangriff aus Ardennen, Ziel Antwerpen. … Eigene Angriffsgruppe, 30 neue Volksgrenadierdivisionen und neue Panzerdivisionen, dazu Panzerdivisionen aus dem Osten. Nahtstelle zwischen Engländern und Amerikanern aufreißen, neues Dünkirchen. Guderian [der für die Russlandfront verantwortliche Stabschef des Heeres] protestiert wegen Lage im Osten. Jodl verweist auf die Luftüberlegenheit der Alliierten und auf den zu erwartenden Einsatz von Luftlandetruppen in Holland, Dänemark und Norddeutschland. Hitler fordert 1500 Jagdflieger bis zum 1. November! Offensive soll während der Schlechtwetterperiode durchgeführt werden, wenn der Feind nicht fliegen kann. Rundstedt wird das Kommando übernehmen. Vorbereitungen bis zum 1. November. In einer langen Rede fasst der Führer seinen Entschluss noch einmal zusammen. Nimmt allen Anwesenden die Verpflichtung auf strikteste Geheimhaltung ab. Nur wenige zuverlässige Männer dürfen eingeweiht werden. … Habe Göring informiert, der noch in der Nacht nach Karinhall zurückfliegt. Bin recht müde, Kopfschmerzen.«25
Guderian war über den Plan bestürzt, denn er wusste, dass Stalin, sobald der Boden hart genug gefroren war, um die T-34-Panzer der Roten Armee zu tragen, eine massive Offensive gegen Ostpreußen und in Richtung Westen von den Brückenköpfen längs der Weichsel aus starten würde. »OKH hat schwerste Bedenken gegen Ardennenplan«, notierte Kreipe.26
Nachdem Hitler Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt während der Schlacht um die Normandie im Juli als Oberbefehlshaber West abgesetzt hatte, berief er ihn jetzt auf denselben Posten zurück. Der »alte Preuße« schien ihm der sicherste Kandidat zu sein. Hitler schlachtete ihn als das Symbol von Rechtschaffenheit aus, dabei hatte er ihn selbst mit Geld und Ehren bestochen. Und obwohl Rundstedt noch über ein nüchternes militärisches Urteilsvermögen verfügte, war er ein Trinker geblieben und hatte mit operativen Entschlüssen nicht mehr viel zu tun. Als Hitler ihn im Dezember 1941 zum ersten Mal aus gesundheitlichen Gründen abgesetzt hatte, wurde das allgemein als ein Vorwand angesehen. In Wirklichkeit aber hatte Rundstedt, der erschöpft war und dem Weinbrand übermäßig zusprach, im Schlaf geschrien und musste von seinen Mitarbeitern zuweilen festgehalten und mit Beruhigungsmitteln behandelt werden.27 Die damalige Absetzung war ihm mit einem »Geburtstagsgeschenk« in Höhe von 400000 Reichsmark versüßt worden. In der letzten Zeit hatte Rundstedt zur Entrüstung vieler traditionell gesinnter Offiziere als Vorsitzender von Hitlers »Ehrengericht« alle Offiziere in Unehren aus dem Militär verstoßen, die man verdächtigte, mit der Verschwörung des 20. Juli in Verbindung zu stehen.
Seit dem gescheiterten Mordanschlag hatte sich das Verhältnis zwischen der Nazi-Partei und der Wehrmacht verschlechtert. Ein Hauptmann gab über seine Frau, die in Reutlingen lebte, folgenden Bericht wieder: »Der Kreisleiter von Reutlingen hat in einer Frauenschaftsversammlung erzählt, dass die deutsche Wm ein ganz großer Sauhaufen ist. Dass wenn die SS und diese Division ›Hitlerjugend‹ nicht gewesen wären, dann wäre der Krieg schon längst vorüber. Die deutschen Offiziere haben mit den Französinnen in den Betten gelegen, nur herumgehurt und wie der Engländer kam, sind sie in Unterhosen aus den Betten geholt worden und er verachtet jeden Offizier. Die Frauen haben natürlich immer ›Pfui‹ gerufen, und meine Frau hat daraufhin das Lokal unter allgemeinem Getöse verlassen und fühlte sich nun, vielleicht ganz richtig, nicht mehr sicher aufgrund dieser Hetzrede.« Als der Hauptmann dies von seiner Frau erfuhr, beschwerte er sich darüber bei seinem General. »Denn das ist ja keine Sache der Heimat, so etwas zu erzählen, wenn es auch teilweise vorgekommen ist, denn die verliert ja restlos das Vertrauen zur Truppe.«28 Mit seinem Protest erreichte der Hauptmann jedoch wenig. Offenbar wurde darüber nach Reutlingen berichtet. Daraufhin rächte sich die lokale Nazi-Führung an seiner Familie, indem sie ihr so viel an Einquartierungen zuwies, dass ihr kein Raum mehr für sich selbst blieb.
Bei Aachen zeigte sich ein Obersturmführer Woelky von der 1. SS-Panzerdivision »Leibstandarte AdolfHitler« schockiert über deutsche Frauen, die sich dagegen wehrten, dass weitergekämpft wurde. Sie hatten gehofft, die Amerikaner würden den Ort einfach übernehmen. »Fünf Jahre hat man uns belogen und betrogen und uns die goldene Zukunft versprochen, und was haben wir?«, schimpfte die freimütigste. »Ich verstehe gar nicht, dass es heute noch einen deutschen Soldaten gibt, der überhaupt noch einen Schuss abgibt.« Sie hatte Glück, ihre Tirade auf Woelky losgelassen zu haben, denn der war offenbar einer der Wenigen in seiner Division, der ihr privat zustimmte, dass Deutschland nicht mehr lange durchhalten könne. Danach, so dachte er zynisch, »werden sie anfangen uns umzuschulen, die SS, auf demokratisch«29.
[2] Der Red Ball Express war ein nach dem Ausbruch der alliierten Truppen aus der Normandie und bei der Verfolgungsjagd in Richtung der deutschen Grenze errichtetes System besonderer, ausschließlich von den Lastkraftwagen der Truppenversorgung befahrener Einbahnstraßen. Lkw und Hinweisschilder waren mit einem großen roten Kreis gekennzeichnet, daher der Name – d. Ü.