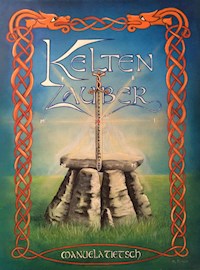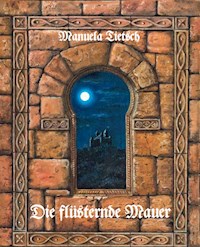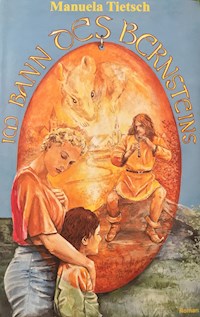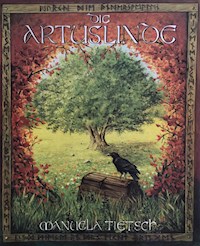
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Rezeptur für die Artuslinde! Zutaten: 1 Comiczeichnerin aus dem 21. Jahrhundert, 1 zauberkräftige Linde*, 1 Artusritter*, 1 Wahre Liebe, je 1 Prise Freude und Leid, 1 Zauberer, Merlin*, (*aus biologischem Anbau). Zubereitung: Den Lieblingsplatz aufsuchen, schöne Musik einschalten. Die angerichteten Zutaten Zeile für Zeile, Seite für Seite lesen und genießen. Warnung: Nicht zu schnell verschlingen, es besteht Suchtgefahr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manuela Tietsch
Die Artuslinde
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1 Die Krönungslinde, Artus Zeit
2 Die wunderbare Lichtung, Sommer 2003
3 Auf Burg Sommerstein, 2003
4 Das Erwachen
5 Auf Burg Sommerstein, 2003
6 Ritter Talivan
7 Das Messer
8 Die Jagd
9 In der Höhle des Löwen
10 Heiß und Kalt
11 Feinde, Fragen und ein Wörterbuch
12 Nähe
13 Auf Burg Sommerstein, 2003
14 Zu Artus Zeiten, auf Talivans Burg
15 Die Reise nach Camelot
16 Camelot
17 Die Entführung
18 Die Befreiung
19 Merlins Garten
20 Auf Burg Sommerstein, 2003
21 Hochzeit
22 Kampf
23 Die Truhe
24 Auf Burg Sommerstein, 2003
25 Rache
26 Das zweite Erwachen
27 Helenes Wohnung, Weihnachten 2004
28 Auf Burg Sommerstein, 2004
29 Helenes Wohnung
30 Das Ende - Der Beginn
Ein paar Worte zum Buch
Über mich:
Bisher sind folgende Romane als E-Bücher und oder als Taschenbücher erschienen:
Impressum neobooks
1 Die Krönungslinde, Artus Zeit
„Die Linde ist tatsächlich gewachsen! Solltest du noch ruhmreicher geworden sein, Artus?“
Artus lächelte über Merlins Worte und schaute seinen Freund und Berater an. Merlin mußte über hundert Jahre sein, Artus wußte es nicht genau; er sah jedoch aus wie ein Mann in den Fünfzigern. Nur sein langer, schlohweißer Bart und der weise Ausdruck in seinen Augen ließ den Betrachter erahnen, wie lange Merlin wirklich auf dieser Erde weilte. Es war viel Wasser den Fluß hinuntergeflossen, seit sie gemeinsam die Linde besucht hatten.
Der Anblick, der inzwischen an die fünfzehn mannslängen hohen Linde, ließ Artus´ Gedanken zurückwandern, bis zu dem Tag, an dem er zum König geweiht wurde. Damals war die Linde kaum größer als er gewesen. Er lächelte, sollte Merlin Recht haben? War sein Ruhm weiter gewachsen? Er trat einen Schritt in den Steinkreis. Seit dem Krönungstag war viel geschehen in seinem Leben. Nun stand er als reifer Mann hier, nicht mehr als sechszehnjähriger Knabe.
Die Krönungsweihe fiel ihm wieder ein. Er sah die zwölf Druiden um die winzige Linde stehen, als wäre die Weihung erst gestern gewesen. Merlin trug damals den Baum und rief Artus zu sich in den Druidenkreis. Unsicher hatte er außerhalb des Kreises auf sein Zeichen gewartet. Seine Hände waren schweißnass gewesen, und die Angst vor dem Königsamt und der Verantwortung hatten ihm die Kehle zugeschnürt. Merlin hatte ihn nur väterlich angesehen und gesagt, daß alles Sträuben das Unausweichliche nur hinausschieben würde; er sei der Auserwählte. Er hatte Merlins Blick standgehalten; sich seinem Schicksal ergeben, um den Kampf gegen das Übel in seinem Reich aufzunehmen.
Er hörte noch immer den kraftvollen, mit Magie behaftetenen Gesang der Druiden, fühlte noch, wie die Erde unter seinen Händen nachgab, als er die Linde zärtlich hineinpflanzte. Kaum hatte er damals die Lindenwurzel mit Erde bedeckt, begann diese zu wachsen. Sie wuchs und wuchs, und alle Pflanzen der Lichtung mit ihr. Und noch immer jagten ihm die Gedanken daran Schauer über den Rücken. Merlin hatte ihm erklärt, daß die Linde mit seinem, dem Ruhm des König Artus, wachsen würde.
Schon am Tag der Krönung erreichte sie eine Höhe, welche dreimal seine eigene Körpergröße überragte. Wörtlich erinnerte er sich an Merlins Weihespruch: „Mit deinen Taten, mit deinem Ruhm und deiner geistigen Größe, wächst auch diese Linde. Sie wird fortbestehen, solange du in den Herzen der Menschen lebst, und weit über deinen Tod hinaus. Allerdings wird sie, in den kommenden Jahrhunderten, für das menschliche Auge nur selten zu sehen sein; Wer nicht von ihr weiß, wird sie nie bemerken; es sei denn die Linde lädt ihn ein, oder du selbst. Diese Lichtung ist dein ureigener Kraftort.“
Danach ließen ihn die Druiden und Merlin allein mit der Linde. Und erst nach diesen drei Tagen und Nächten war er der König. Ein geachteter König, mit großer Macht und einem riesigen, friedliebenden Reich.
Artus fielen seine Ritter ein, die Ritter seiner Tafelrunde, an der nur die Besten saßen. Vor seinem inneren Auge tauchte das Gesicht Talivans auf, der einer seiner treuesten und bescheidensten Ritter war und der ihm auch dieses Mal wieder herzliche Gastfreundschaft entgegenbrachte, da sie bei ihm Zwischenrast hielten. Er wandte sich Merlin zu, dessen Blick wissend auf ihm ruhte.
„Findest du nicht, daß Talivan immer ernster und in sich gekehrter wirkt?“
Merlin wog nachdenklich den Kopf hin und her. „Sein Äußeres macht ihm mehr zu schaffen, als er es sich selber zugesteht, geschweige einem anderen!“
„Ich habe bemerkt, daß die Dame Brighid ihm schöne Augen macht!“
Merlin schüttelte den Kopf, schloß die Augenlider, wie um dahinter verborgene Geheimnisse zu enthüllen. Als sähe er dort Dinge, welche er mit offenen Augen nie wahrnehmen könnte. Als sich seine Lider wieder öffneten, lag ein Leuchten in seinem Blick. „Talivan braucht eine Frau, die seine seelischen Narben zu heilen versteht, und die seine körperlichen annimmt!“ Er nickte, wie um sich selber zu bestätigen. „Es gibt sie, Artus. Sie werden sich in einer anderen Welt begegnen.“
„Er braucht sie jetzt!“ warf Artus ein.
Merlin konnte nicht anders, er schmunzelte. Da stand dieser mächtige König Artus vor ihm, ein Mann, dem Tausende trauten, als ihren Obersten anerkannten, und gebärdete sich wie ein trotziger kleiner Junge. Seine hellbraunen Augen sprühten Funken, und seine blonden Locken flogen wild um seinen Kopf. Wären nicht die beeindruckende Größe und die breiten Schultern, so könnte Merlin leicht den Knaben wiederfinden, den er einst großzog.
„Du bist ein Heißsporn, Artus... doch du magst recht haben, Talivan wünscht sich eine Frau.“ Merlins Lächeln wurde breiter. „Weshalb versuchst du nicht, deine Schwägerin mit ihm zusammen zu bringen?“
Artus Blick schnellte zu Merlin, gerade sah er noch dessen breites Grinsen. „Bronwynn? Das ist nicht dein Ernst!“ Artus erwägte den Gedanken. „Aber..., die Vorstellung gefällt mir sogar. Talivan gehört zu meinen ehrlichsten Rittern; ich könnte einen schlechteren Schwager bekommen.“ Er überlegte. „Bronwynn wünscht sich Kinder; und Talivan wird nie in diesem Leben Vater eigener Kinder sein!“ Artus Blick wanderte nach oben, in die Lindenkrone. „Ich wünschte, die Frau, von der du sprachst wäre hier.“ Er schaute Merlin spitzbübisch an. „Könntest du nicht...?“
„Oh nein, Artus! Du weißt, daß ich niemals in das Weltgeschehen eingreife. Jedenfalls nicht, wie du dir das gerade vorstellst. Es gibt einen Eid, wie du weißt!“ Merlin ärgerte sich, wie konnte der Junge solche Fragen stellen!
Artus, offen für Merlins Empfindungen, spürte dessen Unmut. „Entschuldige. Es wäre jedoch nur gerecht, wenn es eine Möglichkeit gäbe.“ Er berührte zärtlich die Rinde des Baumes.
Merlins Blick entspannte sich. Er konnte Artus nicht ernsthaft böse sein. Wenn er ehrlich mit sich war, dann erfüllte er seinen Wunsch nur zu gerne, denn auch er mochte Talivan, und er wußte um Artus Schuldgefühle.
„Laß uns gehen, Artus. Wenn auch Talivan, als einer der wenigen, um die Zeitlosigkeit dieses Ortes weiß, so könnte er uns doch vermissen.“
Die Lindenblätter rauschten leise, als bewege sie ein Wind. Artus und Merlin schauten in die Krone.
„Seltsam! Wo kommt der Wind her?“ Artus blinzelte.
Zwei rotgoldene Blätter fielen tanzend hinunter, auf seine ausgestreckte Hand. Versonnen betrachtete er sie.
2 Die wunderbare Lichtung, Sommer 2003
Was nun? Unschlüssig stieg ich vom Rad. Der Weg gabelte sich an dieser Stelle. Welchen sollte ich nehmen? Den rechten oder den linken? Ich atmete ein paar mal tief durch und genoß die würzige Waldluft. Mit einem Griff vergewisserte ich mich, ob die Decke, und mein Rucksack auf dem Gepäckträger hielten. Ich blickte erneut die beiden Wege entlang. Der rechte lud ein, denn ein Schild kündigte einen See an. Trotzdem entschied ich mich für den linken. Möglicherweise lag es an den Sonnenstrahlen, die gebündelt durch das dichte Blattwerk der Buchen fielen und am Ende den Weg erleuchteten.
In diesem ungewöhnlich großen, unbesiedelten Waldgebiet fand ich sicherlich was ich suchte, Ruhe und Zufriedenheit, Abstand vom betriebsamen Alltag und dem Lärm der Stadt. Manchmal glaubte ich selbst in der Kleinstadt noch fehl am Platz zu sein, da mir die Natur viel näher war. Ich stieg wieder auf mein Rad und fuhr los. Wie um meine Gedanken zu strafen flog in diesem Augenblick ein Düsenflieger über mich hinweg. Ich zuckte zusammen, doch zum Ohren zuhalten kam ich nicht mehr. Er flog so tief, daß er beinahe die Baumkronen berührte. Ich blickte ihm böse hinterher.
Während der Fahrt, unter den hohen Buchen, genoß ich den kühlen Schatten, den sie spendeten. Buchen schafften Klarheit, wo gedankliches Durcheinander herrschte. Ein bißchen besserte sich meine Laune tatsächlich. Ich dachte nicht mehr ständig an diesen dummen Verleger, der meine Bilder und Geschichten nicht mehr wollte und mir grundlos gekündigt hatte. Eine bodenlose Frechheit. Mir wurde flau im Magen als ich an seine plumpen Versuche dachte, mich in sein Bett zu bekommen, indem er mir eine Vertragsverlängerung anbot. Von wegen. Und dabei waren meine Comics gut. Klar nicht jedem lag das Mittelalter, doch brachten die Bildergeschichten den heutigen Menschen die alte Zeit näher, und waren gleichzeitig unterhaltend. Mir gefielen sie jedenfalls und meinen Lesern auch.
Der Buchentunnel kam mir gerade recht, da selbst der Fahrtwind, der mir lauwarm durch mein rotes Baumwollkleid strich, keine Kühlung brachte. Schon seit Wochen hielt das warme Wetter an. Warm? Ach was, das beschrieb nicht annähernd die Wahrheit, es war brütend heiß. Nach einigen hundert Metern Fahrt endete der Buchentunnel unvermutet. Ich spürte, wie die Sonnenstrahlen an Kraft gewannen; denn als ich den Schattenkreis der Bäume verließ, wärmten sie mich wieder.
Nach etwa einem Kilometer Fahrt sah ich plötzlich linker Hand einen Hohlweg liegen. Beinahe wäre ich daran vorbeigefahren, ohne ihn zu bemerken. Ich stoppte meine Fahrt, stieg ab und schob mein Rad das kleine Stück zurück.
Ohne ersichtlichen Grund atmete ich mit einem Mal flach. Ich meinte, eine Stimme zu hören die meinen Namen rief und fühlte mich unweigerlich von diesem Pfad angezogen.
Er führte bergab, begrenzt von großen Eichen und dichtem Gebüsch. Ein seltsames Licht schimmerte innerhalb des Weges. Die Sonne versuchte ohne Erfolg, ihre Strahlen durch das dichte Geäst der Büsche und Bäume hindurchzuzwängen, trotzdem leuchtete der Pfad in einem weißlichen Licht. Er lockte mich, den ersten Schritt zu wagen. Trotz meiner seltsamen Empfindungen, und obwohl sich etwas in meinem inneren sträubte, stellte ich mein Rad an einer kleinen Birke außerhalb des Hohlweges ab, nahm meinen Rucksack und die Decke und wagte diesen ersten Schritt. Er war leicht, auch der nächste und übernächste. Was erwartete ich auch? Daß mich eine Raubkatze ansprang? Ich folgte, grundlos außer Atem, den Windungen des Pfades, bis mich eine wild gewachsene Buschhecke am Weitergehen hinderte. Sollte dieser wundervolle Weg eine Sackgasse sein? Mit den Augen suchte ich in dem knorpelig gewachsenen Gebüsch eine Öffnung und entdeckte tatsächlich eine Lücke. Gerade so groß, daß ich hineinpassen würde. Ohne weiter über das seltsame Gefühl in meiner Magengegend nachzudenken, zwängte ich mich hindurch und richtete mich schwer atmend auf der anderen Seite wieder auf, um im selben Augenblick die Luft anzuhalten.
Ich glaubte zu träumen, denn ich stand auf einer von Laub- und Nadelbäumen und der dichten Hecke umsäumten Lichtung. Jegliche Sicht nach außen war verwehrt. Ich konnte mich nicht erinnern, schon einmal Wundervolleres als diese Lichtung gesehen zu haben. Auf der Wiese wuchsen wilde Blumen, leuchteten bunt aus den vielfältigen Grüntönen der Gräser. Schmetterlinge, Bienen, Hummeln und vielerlei Kerbtiere und Käfer tummelten sich darauf.
In der Mitte der Lichtung lag ein Steinkreis, wie gewollt niedergelegt, bestehend aus zwölf Steinen ungleicher Gestalt und Farbe. Und in der Mitte des Steinkreises stand eine Linde: riesig, uralt und überirdisch schön.
In den Bäumen rund um die Lichtung zwitscherten die Vögel, und hoch über mir, über der Linde, sang eine Lerche ihr schwermütiges Loblied. Seltsam, in der Linde selber konnte ich keinen einzigen Vogel entdecken. Ich fühlte mich überwältigt. Bezaubert. Alles wirkte vollkommen, und doch unwirklich. Als wäre die Lichtung nicht von dieser Welt. Fehlte nur, daß ich eine Elfe auf einer der Blumen sitzen sah, oder einen Zwerg um einen der Bäume blickend. Verzaubert ging ich weiter und stellte mich unter die Linde. Mir wurde unheimlich zumute. Ich glaubte, diese starke Kraft des Baumes kaum ertragen zu können. Überwältigt von dem Gefühl, schluckte ich schwer. Es gab keinen Zweifel, ich befand mich an einem heiligen Ort, einer Kraftquelle. Einer Verbindung zwischen Himmel und Erde.
Offensichtlich war ich seit langem der einzige Besucher, denn menschliche Spuren sah ich nirgends. Das erschien mir allerdings mehr als seltsam. Wie konnte solch eine Lichtung keine Beachtung finden? An diesem Ort gab es heilige Kraft. Ich legte meine Sachen nachdenklich auf den Boden, trat dicht an die Linde und wagte es, den Baum zu umarmen. Ich spürte die raue Rinde an meiner Wange, während ein leiser Wind durch die Blätter rauschte.
Mir war, als hörte ich ein Lied, und es klang verrückt, als käme in diesem Lied mein Name vor. Gefühle von Freundschaft, Liebe und Verbundenheit mit der Erde, dem All, überwältigten mich so heftig, daß mir die Tränen kamen. Ich glaubte, die Lebensader des Baumes zu fühlen. Eine Kraftwelle erfaßte mich, trug meinen Geist in schwindelnde Höhen, hinauf in die Lindenkrone. Einer Ohnmacht nahe, schloß ich die Augen, drückte mich fester an den Stamm, um nicht zu stürzen. In meinem Kopf wirbelten Lichter und Farben durcheinander. Ich hatte das Gefühl, mein Blut kochte über, derweil das Lied immer mehr drängte. Erschrocken schaffte ich es, einige Schritte vom Baum wegzutreten. Diese ungeheure Kraft war zu stark für mich. Es dauerte eine Weile, bis ich mich wieder gesammelt hatte.
Um mich abzulenken, schaute ich mich erneut auf der Lichtung um. Erst jetzt entdeckte ich, daß diese von weiteren Tieren bevölkert wurde, als wären sie aus dem Nichts aufgetaucht. Kaninchen saßen im Gras, blickten kauend zu mir herüber und in einiger Entfernung lag ein zusammengerolltes Rehkitz, dicht bei ihm döste die Mutter in der Sonne. Eichhörnchen kletterten ohne Scheu in den Ästen der Hecke umher, und Haselmäuse tummelten sich zwischen den Gräsern. Zwei spielende Füchse versetzten mich in maßloses Erstaunen. Sie tollten umher, doch nicht eines der anderen Tiere schien über ihre Anwesenheit im Geringsten beunruhigt. Die Füchse ihrerseits kümmerten sich nicht um sie. Herrschten hier andere Gesetze? Wo waren die Tiere zuvor gewesen? Wie hatte ich sie übersehen können? Zumal keines Angst vor mir zeigte. Ich bückte mich vorsichtig und streichelte zaghaft, mit einem Finger eine Maus, ehe diese geschäftig und ohne Angst, davoneilte. Ich konnte es nicht fassen.
Noch immer stand ich unter der riesigen Linde und schaute verwirrt, als Winzling diesem Riesen in die Krone. Kopfschüttelnd breitete ich meine Decke aus und ließ mich darauf nieder, denn ich fühlte mich seltsam, dabei angenehm müde. Ich holte meine Wegzehrung, den Zeichenblock und die Bleistifte aus dem Rucksack. Die Äpfel lachten mich an, ich entschied mich jedoch, zuerst auf Papier zu bringen, was ich sah. Als ich das Deckblatt meines Blockes öffnete, stieg der Ärger wieder in mir auf. Bloß weil ich nun keine Arbeit mehr hatte, konnte ich die Verwirklichung meines Traumes vergessen. Trotzdem konnte ich den Gedanken, mir die Truhe bauen zu lassen, die ich einem inneren Bild zur Folge aufgezeichnet hatte, nicht ohne weiteres abschieben. Ursprünglich wollte ich ja einen Schauplatz für meine neue Geschichte zeichnen, da sah ich die Truhe vor meinem geistigen Auge stehen. Keltische Laufmuster zierten sie, und selbstredend hatte sie ein Geheimfach. Der Wunsch, sie in meiner kleinen Wohnung stehen zu haben, war übermächtig. Ich sollte schnellstens wieder einen Verlag finden, der sich für mittelalterliche Comics begeisterte und ich mußte gleich morgen bei der Burgschreinerei anrufen, denn meine Rohzeichnungen mit der Bestellung würden sicherlich inzwischen dort angekommen sein. Diese Angelegenheit hatte zu warten, dafür hatte ich im Augenblick wirklich kein Geld übrig.
Entschlossen, meinen Grübeleien ein Ende zu setzen, blätterte ich weiter bis zum nächsten leeren Blatt. Wenn es mir gelang, dieses unglaubliche Bild mit der Linde auf der Lichtung einzufangen, konnte ich die Zeichnungen gegebenenfalls ausstellen und fand sogar einen Käufer. Meine Hand flog nur so über das Papier. Es war unheimlich, als führte sie ein anderer, so schnell ging es.
Nachdem ich die letzte Zeichnung beendet hatte, verstaute ich den Zeichenblock und die Stifte wieder in meinem Rucksack. Nun konnte ich in Ruhe essen. Genüßlich biß ich in eine Scheibe Brot, während ich einen gold schimmernden Käfer beobachtete, der sich auf meine Decke verlaufen hatte. Auf der anderen Seite lief eine Kreuzspinne, die im Eilschritt versuchte, von den fusseligen Fasern der Decke herunterzuflüchten. Der Wind rauschte sacht in den Lindenblättern über mir. Mir wurden die Lider schwer.
Die Naturgeräusche, das Brummen und Surren der Käfer und Bienen, der Vogelgesang, die Lerche hoch oben, das Rauschen des lauwarmen Windes in den Blättern, das Zirpen der Grillen und die heißen Sonnenstrahlen ließen mich zufrieden und schläfrig, die Augenlider schließen. Ich fühlte ein Lächeln auf meinen Lippen, als ich mich auf den Rücken legte. Während ich die Arme unter meinem Nacken kreuzte, spürte ich wie sich mein Haarknoten löste und die Haare sich fließend auf der Decke ausrollten. Ich öffnete die Augenlider wieder und schaute in den Lindenbaum. Es fiel mir jedoch immer schwerer sie geöffnet zu halten, obwohl in meinem Kopf die Gedanken tobten.
Das mittelalterliche Lied Unter den Linden von Walter von der Vogelweide, kam mir in den Sinn. Leise summte ich es vor mich hin und verdrängte dadurch, für einen Augenblick, das seltsam lockende Summen der Lichtung und der Linde. Doch immer mehr driftete mein Geist ins Land der Träume ab, es war so unendlich schwer, sich zu sammeln. Die Geräusche verschwammen immer mehr, wurden leiser. Das Lied, das mich rief, wurde stärker, drängender. Ab und zu blinzelte die Sonne durch eine Lücke der Lindenblätter und der Sommer erfüllte die Luft. Das Sonnenlicht drang durch meine geschlossenen Augenlider. Ich hörte erneut meinen Namen, leise und eindringlich, keinen Widerspruch duldend. Dann ließ ich mich fallen. Ich hörte auf, dagegen anzukämpfen. Ich folgte dem Ruf und schlief ein.
Augenblicklich träumte ich: Mein Geist wanderte zur Linde, durch den Stamm hindurch arbeitete ich mich bis zum Kern des Lindenbaumes vor. Ich sah die Jahre des Baumes an mir vorbeiziehen, als blickte ich entgegen der Fahrtrichtung aus einem Zugabteil. Am Ende befand ich mich mitten in der Linde und verschmolz mit der Seele des Baumes. Ich konnte wie die Linde fühlen. Empfand Liebe zu allen Wesen. Ich wußte, die Linde hatte mich gerufen, wußte für Augenblicke alles, ...ehe die Ewigkeit mich umfing.
3 Auf Burg Sommerstein, 2003
Die Nacht war pechschwarz. Das Herz pochte wild in seiner Brust, er hörte jeden Schlag laut in seinen Ohren dröhnen. Als er die Augen öffnete, brauchte er erst eine Weile um sich zurechtzufinden. Beim zweiten Anlauf fand er den Schalter der Lampe. Der Raum wurde augenblicklich in ein angenehmes mildes Licht getaucht. Liam atmete laut aus. Er war klatschnaß geschwitzt. Diese Träume hatten es in sich. Sein Blick wanderte zu der alten keltischen Truhe, die neben seinem Bett an der Wand stand. Er schnitt ihr eine Grimasse. Hatte sein Bruder Brian recht? War sie am Ende tatsächlich Schuld an seinen eigenartigen Träumen und Erscheinungen? Er erinnerte sich überdeutlich an den Augenblick, als ihm das Fuhrunternehmen die Truhe vor die Tür stellte. Einen Absender gab es nicht, und der Empfänger war eindeutig er. Seine Familie und er standen vor einem Rätsel. Drei Tage nach dem Eintreffen der verschlossenen Truhe, kam dieser Brief aus England. Er enthielt den Schlüssel für die Truhe und lediglich einen schlecht lesbaren Satz auf einem kleinen, sehr alten Pergament:
„Da es nun an der Zeit ist, sende ich Dir Deine Truhe samt Inhalt! Ich wünsche Euch alles Glück, in tiefer Verbundenheit Euer ...“
Wer auch immer, Euer... war, und wen auch immer er mit Euer meinte, niemand konnte die Zeichen lesen, mit denen der Schrieb unterzeichnet war. Eine genauere Erklärung fehlte. Niemand hatte je von ihm gehört. Vermutlich hatte dieser Mensch sich doch getäuscht, und die Truhe war für einen anderen bestimmt? Sie waren alle verwundert, noch dazu, weil er der Empfänger war und nicht sein Vater oder Großvater, was die gerechte Erbfolge gewesen wäre, sofern es sich um einen Verwandten aus Schottland handelte.
Nachdem er mit zittrigen Fingern die Truhe geöffnet hatte, starrten sie alle in die gähnende Leere, die sie enthielt. Von dem angekündigten Inhalt fehlte jede Spur. Hatte er oder sie vergessen ihn hineinzulegen?
Versonnen hatte er auf das innere Holz des Deckels geblickt, plötzlich sah er darin das Gesicht einer Frau. Entsetzt war er einen Schritt zurückgesprungen. Sogar seine Nackenhaare hatten sich gesträubt, trotzdem konnte er die Augen nicht abwenden. Sogar jetzt lief ihm ein Schauer über den Rücken. Ja, er bekam erneut eine Gänsehaut, wenn er an das Gesicht dachte, daß ihn wie aus einem Spiegel entgegenblickte. Er war jedoch der Einzige, der sie gesehen hatte.
Von diesem Tag an häuften sich die Erscheinungen und die Träume. Alles glich sich. Immer schien die Frau verwirrt, auf der Suche. Sie flehte ihn ohne Worte um Hilfe an. Abgesehen davon, daß ihn das Gefühl, ihr nicht helfen zu können, berührte, ging ihm der Zauber auf die Nerven. Er brauchte seinen Schlaf, gerade jetzt.
Manchmal fragte er sich, wie sie hatten so dumm sein können, aus Schottland fortzuziehen und eine Burg in Deutschland zu kaufen? Nur, um darin mittelalterliche Märkte und Turniere zu veranstalten?! Klar, es war die Gelegenheit gewesen, trotz Schuldenberg. Und ein Zurück gab es vorerst nicht. Morgen würden sie mit ihrem ersten Fest und Turnier ins kalte Wasser springen müssen. Es stand in den Sternen, ob es so gut ankäme, wie sie es sich erhofften. Womöglich waren die Menschen schon übersättigt vom Mittelalterkram! Nun, wenn es so war, mußten sie die Schulden eben mit ihrer eigentlichen Arbeit begleichen, auch wenn das bedeutete, daß er sein Leben lang schreinern mußte. Es lag wohl an den Vorfahren, die ihre Bedürfnisse durch sie stillten. Weshalb sein Vater allerdings von Schottland ausgerechnet hierhergezogen war, würde ihm Zeit seines Lebens ein Rätsel bleiben.
Müde stand er auf. Ein Blick auf die Uhr, meinte er, berechtigte ihn zu gähnen, denn es war erst vier. Er warf sich seinen Morgenmantel über, während sein Blick schon wieder zur Truhe wanderte. Er kniete sich neben sie. Als Schreiner sollte es ihm doch möglich sein ihr Geheimnis zu ergründen? Seine Hände strichen sachte über die geschnitzten Muster. Sie fühlten sich seltsam vertraut an. Er schüttelte den Kopf und erhob sich. An Schlaf war nicht mehr zu denken, also zog er sich an. Nach einem letzten Blick auf die keltischen Laufmuster der Truhe verließ er sein Zimmer, um zur burgeigenen Bücherei zu gehen.
Zum Frühstück erschien er mürrisch und unausgeschlafen. Ein weiterer Schock suchte ihn heim, als er seine Post öffnete. Es handelte sich um die Bestellung einer Truhe von einem gewissen H. Linden, mit Rohzeichnung anbei, und es war genau die Truhe, die in seinem Zimmer stand. Unmöglich! Hier wollte ihn doch jemand auf den Arm nehmen?
Brian blickte seinen kreideweißen Bruder an. Er merkte, daß etwas nicht stimmte, ging zu ihm und legte ihm die Hand tröstend auf die Schulter. Liam starrte ihn erschrocken an, als käme er gerade aus anderen Welten zurück. In Brians Brust stritten die Gefühle. Er liebte seinen Bruder, oft hatte er jedoch den vernunftwidrigen Wunsch, ihn bei den Schultern zu packen und kräftig zu schütteln. Er fühlte sich für alle Mißgeschicke seines Bruders verantwortlich, und gab ihm andererseits für alles die Schuld. Dafür plagten ihn dann ständig Schuldgefühle, wofür er wiederum Liam verantwortlich machte. Obwohl er mit ihm fühlte, kamen seine Worte beißend über die Lippen, er konnte nichts dagegen tun.
„Wieder dein Gespenst?“
Liam blickte ihn ernst an. In seinen Augen erkannte Brian die unterdrückte Trauer darüber, daß er sich auf seine Kosten belustigte.
Warum nur mußte er immer sticheln? fragte sich Brian.
Liam zeigte den anderen den Schreinerauftrag, den sie erhalten hatten.
Er glaubte nicht einen Augenblick daran, daß dieser Linden die Truhe einer inneren Eingebung zur Folge entworfen und gezeichnet hatte. Doch woher wußte er von der Truhe?
4 Das Erwachen
Etwas stimmte nicht, dessen war ich mir bewußt noch bevor ich meine Lider öffnete. Ich zitterte am ganzen Körper. Als ich die Augen aufschlug, suchte ich sofort einen Anhaltspunkt in der Lindenkrone, doch mein Blick irrte wild suchend umher. Die Linde war nicht mehr da! Jedenfalls nicht in der gleichen Art wie zuvor. Die Linde, unter der ich jetzt lag, war ein höchstens dreißig, möglicherweise vierzigjähriger Baum. Ein unangenehmer, kalter Wind, der einen eisigen Regen vor sich herpeitschte, riss an seinen Ästen und an mir. Mit einem Ruck sprang ich auf die Beine. Ich fror so erbärmlich, und der Wind drückte mir das nasse Kleid an den Körper. Entsetzt stellte ich fest, daß ich zwar auf einer Lichtung stand, außer den angeordneten Steinen jedoch nichts der anderen Lichtung glich. Oder handelte es sich womöglich doch um dieselbe? Nur viel jünger! Die Hecke und die Steine glichen den anderen. Gleiche Anzahl, gleiche Farben und Gestalt der Steine.
Aber wo waren die Tiere? Ein leises Kribbeln wanderte meine Wirbelsäule hinunter. Ich näherte mich ungewollt einer übermächtigen Angst. Abgesehen von diesen erschreckenden Erkenntnissen, drang allmählich in mein Bewußtsein, daß der Hochsommer von einem kalten, regnerisch ungemütlichen Herbsttag abgelöst worden war. Die Blätter der Bäume leuchteten rot, gelb und braun, während sie von dem eisigen, starken Wind gebeutelt, wild tanzend auf die Erde nieder fielen.
Schlotternd flocht ich meine schweren, nassen Haare zu einem Zopf, zu dumm daß ich kein Gummi zum zusammenbinden mit hatte. Das konnte doch nur ein Alptraum sein, ein äußerst wirklichkeitsnaher allerdings, räumte ich mir ein. Ohne weiter auf meine klappernden Zähne zu achten und auf die Kälte, die mir durch Mark und Bein drang, dachte ich nach. Mit Vernunft mußte ich dem Spuk doch auf den Grund kommen und ihm ein Ende bereiten können. In der Hoffnung, mich damit wärmen zu können, hob ich meine Decke auf, doch meine Erwartung wurde jäh zerstört, denn sie hing bleischwer und naß in meiner Hand. Ich ließ sie fallen. Das war doch lächerlich! Ärgerlich nur, daß mir nicht nach Lachen zumute war. Ich nahm meinen Rucksack und schaute hinein. Er hatte Gott sei Dank dicht gehalten. Zufällig berührten meine Finger den Zeichenblock. Was fand ich wohl, wenn ich hineinsah? Vorsichtig, damit der Regen nicht auf die Papierblätter fiel, öffnete ich den Block und schaute nach. Ich hatte mich nicht getäuscht: Die Zeichnungen der Lichtung, der Tiere, das Selbstbildnis und die Zeichnungen der Truhe waren noch da. Ich lachte wider Willen.
„Ich habe doch nicht ein halbes Jahr verschlafen?“ Ich schnitt mir selber eine Grimasse. Was war denn jetzt Traum, was Wirklichkeit?
„Verdammt, wo ist denn hier die Vernunft?“
Im meinem Hinterkopf sang Herbert Grönemeyer, mich auslachend: „Was soll das?“
Ich mußte unbedingt zu meinem Rad, um ins Dorf zu fahren und andere Menschen zu sehen, sonst drehte ich durch. Gedankenversunken legte ich meine Decke zusammen, befestigte sie an meinem Rucksack und hängte ihn mir um. Ich versuchte mich zu sammeln, doch das Gefühl, neben mir zu stehen, ließ sich nicht vertreiben. Und wenn es doch bloß nicht so kalt wäre. Verzweifelt machte ich mich auf die Suche nach meinem Rad. Ich mußte so schnell wie möglich mit einem vernünftigen Menschen reden. Einem, der mir sagte, daß mein Erlebnis völlig alltäglich sei, und der für die seltsamen Ereignisse eine verständliche Erklärung verfügbar hatte.
Bestimmt war dies nur wieder ein Versuch der Mächtigen und Wissenschaftler, das Wetter der Welt zu beherrschen, welcher dieses Mal geglückt oder auch mißglückt war. Und diese riesige, uralte Linde? Die war ein Trugbild, Kraft meines Wunsches, eine solche einmal zu sehen, tatsächlich jedoch gar nicht vorhanden.
Die Linde! War es ihr betörender Duft, der mir die Trugbilder in den Kopf pflanzte? Am Ende bewahrheiteten sich die Geschichten von den Menschen, die nach einem Schläfchen unter einer Linde Wahnvorstellungen bekamen, oder gar nicht mehr aufwachten! Ich bekam Angst und je mehr Angst sich meiner bemächtigte, umso mehr fror ich. Fest drückte ich meine Arme an mich, als könnten sie mir Halt geben. Die Angst im Nacken, begann ich zu laufen. Ich lief in die Richtung, aus der ich glaubte, gekommen zu sein. Tatsächlich fand ich die Lücke wieder. Sie hatte sich ebenfalls verändert. Nachdem ich hindurchgeschlüpft war, verlor ich gänzlich den Weg. Kein Baum glich in Größe oder Aussehen denen, die ich zuvor gesehen hatte. Ich fand weder den Hohlweg, noch mein Fahrrad. Wurde es gestohlen? Es mußte doch hier sein!
So blieb mir also nur, zu Fuß zum Dorf zu laufen. Es lag nur wenige Kilometer entfernt von hier. Ein Schauer durchlief mich. Die Angst, das Dorf könnte sich nicht mehr an der Stelle befinden, wo ich es vermutete, ließ mich schneller laufen. Dem Himmel sei Dank, hörte der Regen auf.
Ich lief und lief so weiter, dennoch, die Gegend sah so anders aus. Wo waren die Wege? Wo die Kreuzung? Ich erkannte nichts wieder. Mein Magen krampfte sich zusammen. Ich glaubte, eine sich windende Schlange darin zu fühlen. Ein Gutes konnte ich meinem schnellen Lauf abgewinnen: Mein Kleid und meine Haare, die sich wieder gelöst hatten, trockneten, und mein Körper erwärmte sich. Dafür schnürte ein eisiges Band mein Herz ein. Wie eine Klammer, welche mir die Luft zum Atmen nahm. Immer öfter flog mein Blick nun hinter mich, da ich das Gefühl nicht los wurde, daß mir jemand folgte. Das Gegenteil jedoch war der Fall, ich sah keine Menschenseele. Der Wald wollte und wollte kein Ende nehmen. Ich fand weder das Dorf, geschweige einen Menschen. Unbewußt hatte ich schon damit gerechnet, aber ich wollte die Hoffnung nicht aufgeben.
Nach meinem Gefühl mußte ich wohl mindestens eine Stunde gelaufen sein, vermutlich länger, als ich, verzweifelt und erschöpft, am inzwischen erreichten Waldrand eine Pause einlegte. Ich ließ mich schwer auf die Erde fallen und lehnte mich matt an einen Baumstamm. Da entdeckte ich sie. Die fünf Jungen liefen, Fangen spielend, den Hang hinauf. Der heftige Regenguß vor etwa einer Stunde war von einem wärmenden Sonnenschein abgelöst worden. Wild stoben sie durch das Herbstlaub der vereinzelt stehenden Eichen und Buchen.
Überraschend blieb Bennet stehen. Die vier Nachfolgenden liefen auf, da sie ihre Köpfe gesenkt hielten um nach Eicheln auszuschauen. Ärgerlich blickten sie auf, um über Bennet ein Donnerwetter loszulassen, als auch sie den Grund seines unerwarteten Stehenbleibens entdeckten.
Eine Frau kam auf sie zu. Sie war keine gewöhnliche, denn sie trug einen Hauch von Stoff an ihrem Körper, der wie Feuer zu lodern schien. Ihre dunkelroten Haare wehten wild. Mit ihren schwarzen Augen starrte sie jeden einzelnen von ihnen an. Die Sonne schien sie von hinten in Brand zu setzen. Ihr Blick war wild und gehetzt. Sie schien erstaunt und blieb stehen. Bennet trat einen Schritt zurück, mitten auf Dub‘s Füße, da dieser geradewegs hinter ihm stand. Die Frau sprach sie an, oder doch nicht?
„GottseiDank, daßicheuchhiertreffe. Könntihr mirhelfen? Ich habemichirgendwieverlaufen!“
Bennet verstand kein Wort. Womöglich sprach sie gerade eine Beschwörung über sie? Angst griff wie eine Klaue nach seinem Herzen. Weg, sie mußten hier weg, und zwar sofort. Weg von dieser wilden Wicka der schwarzen Seite, die vermutlich nur darauf wartete, unschuldige Knaben zu opfern!
„Bestimmt verflucht sie uns gerade!“ Bennet sprach aus, was auch die anderen dachten. In wilder Aufregung stoben sie den Abhang hinunter.
Ich konnte es nicht fassen. Endlich hatte ich Menschen gefunden. Anstatt mich jedoch mit ihnen unterhalten zu können, flohen die Jungen vor mir. Weshalb hatten sie mich so angestarrt? War denn mein Anblick so schrecklich? Ich sah die Kinder den Hang hinunterhetzen. Es blieb keine Zeit weiter darüber nachzudenken, ich mußte hinterher. Schon zulange irrte ich in diesem Wald umher, ohne die geringste Spur oder einen Anhaltspunkt zu finden, der auf eine Stadt oder ein Dorf hinwies. Nicht nur, daß ich das Gefühl hatte, mich in einem anderen Wald zu befinden, denn dieser war viel wildwüchsiger und ursprünglicher als der andere, sogar die Beschaffenheit der Pflanzen schien mir fremd. Die Luft, die ich atmete, war rein und klar, schmeckte beim Luftholen gut. Die Bäume strahlten Gesundheit und Kraft aus. Dichtes Unterholz hatte mir ständig das Laufen erschwert, und ich hatte solch einen urwüchsigen Wald nie zuvor in meinem Leben gesehen. Ja, selbst die Kinder kamen mir fremdartig vor. Eher kleinwüchsig von Statur, doch gesund, stämmig und stark. Sie strahlten eine Leistungsfähigkeit aus, die nur in einer gesunden Umwelt zu erlangen war. Wüßte ich es nicht besser, ich glaubte, mich im Mittelalter zu befinden. Wußte ich es denn besser? Mein Unterbewußtsein nagte zweifelnd an meinem Schutzschild. Die Kleidung der Jungen ließ darauf schließen... ihr Gehabe... der Wald... Lächerlich, in welche Bahnen sich meine Gedanken verirrten. Wahrscheinlich spielten die Jungen gerade Robin Hood und schreckten vor mir zurück, weil sie niemanden erwartet hatten. Es schien hier auch recht einsam zu sein. Wie um alles in der Welt hatte ich mich derart verlaufen können? Ich erkannte nichts wieder, und das Dorf schien wie vom Erdboden verschluckt. Ich fühlte mich wie in einer meiner eigenen Bildergeschichten. War es möglich, daß sich jemand einen solch grausigen Scherz mit mir erlaubte und mich im Schlaf an einen anderen Ort gebracht hatte? Aber wer? Das war hirnrissig! Mein Schlaf war leicht, und meinen Freunden traute ich solch eine Gemeinheit nicht zu. Und was geschah dann? Da war sie wieder, die Angst, ohne Vorwarnung.
Ich lief hinter den Jungen her immer den gleichen Abstand haltend. Ich sah, daß die Kinder ihren Lauf beschleunigten, als sie merkten, daß ich ihnen folgte. Mein Herz klopfte bis zum Hals hinauf, und das Gefühl, daß hier nichts stimmte, verließ mich nicht mehr.
Schließlich erblickte ich vor mir ein paar kleine Häuser. Selbst diese, so stellte ich mit Unbehagen fest, sahen so gar nicht zeitgemäß aus. Klarer Fall! Endlich begriff ich. Ich befand mich auf dem Gelände eines Museumsdorfes. So mußte es sein! Hier veranstalteten Mittelalterliebhaber ihre Treffen. Aber wieso hatte ich nicht davon in der Zeitung gelesen? Und meines Wissens gab es in der Gegend kein Museumsdorf, das hätte ich mir doch nicht entgehen lassen.
Ich sah die Jungen wild mit den Armen gebärdend im Dorf ankommen. Sie riefen laut. Nach und nach kamen von allen Seiten Leute und hörten ihnen zu. Es dauerte nur wenige Augenblicke, ehe ich sämtliche Augenpaare auf mich gerichtet sah. Bisher war ich weitergelaufen, wenngleich bedeutend langsamer, doch jetzt, da ich die abweisenden Blicke der Menschen erkannte, blieb ich stehen. Es war nicht zu glauben, die Menschen dort vor mir trugen allesamt mittelalterliche Gewänder, und ich konnte an ihnen dieselbe Beobachtung machen wie zuvor bei den Jungen. Diese Leute paßten in jeden mittelalterlichen Film, nicht jedoch ins 21. Jahrhundert. Es war und blieb ein Alptraum. Die Frauen trugen Tücher und lange Kleider. Die Männer gröbere Kittel und Wämse. Ihre Schuhe erinnerten mich an germanische Schnürschuhe und Wikingerhalbschuhe. Zögernd ging ich weiter auf sie zu. So sicher wie eben zuvor, daß ich in einem Museumsdorf gelandet war, blieb ich nicht. Einige Schritte Abstand wahrend, hielt ich an. Ich sah Angst in den Gesichtern der Leute. Wovor hatten sie Angst, doch nicht etwa vor mir? Einer der Männer löste sich aus der Gruppe und kam mir entgegen. Er sprach mich an, doch ich traute meinen Ohren kaum, ich verstand kein Wort. Ich kannte mich doch gut mit Sprachen aus, war wenn ich meinen Sprachlehrern glauben durfte besonders sprachbegabt, aber hier? Ich wußte nicht einmal zu sagen, welche Sprache er dort sprach. Eine keltische, ja, aber...? Ich hatte keine Ahnung. Als der Mann merkte, daß ich ihn nicht verstand, versuchte er es mit Gebärden. Die Holzforke in seiner Hand senkte sich wie eine Waffe und er fuchtelte damit in Richtung Wald. Ich wollte nicht begreifen, was offensichtlich war. Er jagte mich fort. Mit einem Mal schien sämtliche mir noch verbliebene Kraft aus meinem Körper zu weichen. Tränen liefen mir über die Wangen, ohne daß ich etwas dagegen tun konnte. Sahen sie denn nicht, daß ich Hilfe brauchte? Daß ich völlig verloren war?
Eine Frau mittleren Alters kam näher. Sie schien zornig, schrie zuerst den Mann an, dann mich. Unerwartet und heftig kam ihre nächste Handlung. Sie bückte sich, hob einen vor ihr liegenden faustgroßen Stein auf und warf ihn mit aller Wucht gegen meine Schulter. Ich schrie vor Schmerz auf.
Schließlich mußte ich begreifen, trotz meiner Verzweiflung, daß mir nur die Flucht blieb, ehe diese Leute sich weitere Nettigkeiten einfallen ließen. So schnell ich konnte rannte ich in Richtung Wald davon. Ich blickte mich einmal um, doch die Menschen harrten bewegungslos vor ihrem Dorf und schauten mir nach. Ich lief und lief, bis ich glaubte, meine Lungen müßten platzen. Die Tränen der Empörung und Verzweiflung waren längst getrocknet. Völlig erschöpft ließ ich mich zu guter Letzt auf den Boden fallen. Meine Schulter schmerzte, es war jedoch Gott sei Dank nur eine Prellung, keine offene Wunde. Allmählich meinte ich, den Verstand zu verlieren. Eins nahm ich mir jedenfalls nach diesem Erlebnis vor: Dem nächsten Menschen, dem ich begegnete, würde ich mit mehr Vorsicht entgegentreten. So etwas wollte ich nicht noch einmal erleben. Plötzlich wandelte sich mein Schluchzen in überreiztes Lachen. Was für Gedanken spukten mir denn da im Kopf herum? Glaubte ich inzwischen tatsächlich, im Mittelalter gelandet zu sein? Wahrhaftig, es hatte mich erwischt, eine andere Erklärung gab es nicht. Ich fühlte mich so einsam und verlassen wie nie zuvor in meinem Leben. Aus meinem Lachen wurde wieder ein Schluchzen.
Es dämmerte bereits. Erst jetzt bemerkte ich, daß mein Magen knurrte. Sinnierend starrte ich auf den Boden. Seufzend holte ich mein Brot und einen Apfel aus meinem Rucksack. War dies meine Henkersmahlzeit? Ich wog den Apfel, als wäre er bleischwer; wann bekam ich wieder zu Essen? Nach der Mahlzeit trank ich einige Schlucke Wasser aus meiner Flasche, auch hier schrumpfte der Vorrat bedenklich. Schweren Herzens stand ich auf. Weitergehen! Nicht aufgeben! Ich mußte doch über kurz oder lang auf eine Straße oder irgendeine Stadt stoßen! Mir Mut zusprechend, ging ich los.
Ich mußte noch einmal gut eine Stunde unterwegs gewesen sein, die Sonne stand schon als rotglühender Ball recht tief am Horizont, jedoch war ich nicht einmal in die Nähe irgendeiner Stadt gelangt. Keine Wege, keine Straßen. Wohin mein Blick fiel, zeigte sich mir unberührte Natur. Die prächtigsten Wälder, Wiesen und Lichtungen.
Um mich herum raschelte und knackte es. Mein Gefühl sagte mir, daß diese Geräusche von Wildtieren des Waldes stammten, sehen konnte ich indes kein einziges. Trotzdem glaubte ich mich von Tausenden von Augenpaaren beobachtet, und das jagte mir Angst ein. Trotz meines schnellen Schrittes fror ich erbärmlich. Jetzt zur Nacht hin wurde es deutlich kälter. Während des Weitergehens fand ich mich mit dem Gedanken ab, daß ich mir, wohl oder übel, einen Schlafplatz suchen mußte. Mir blieb keine Wahl. Ärgerlich stellte ich fest, daß mein Kampfgeist, zumindest heute, aufgab. Ich fand doch heute sowieso niemanden mehr! Und morgen? Mir blieben drei Äpfel, eine halbe Flasche Wasser, eine feuchte Decke, mein Zeichenzubehör und mein Leben! Das war doch schon was! Was wollte ich mehr? Außerdem, ich würde nicht gleich verhungern, selbst wenn ich ein, möglicherweise zwei Tage weniger Essen bekam. Wasser gab es sicherlich irgendwo, in Gestalt eines Baches, und wenn dieses so rein und klar war wie die Luft, dann brauchte ich mir darüber nicht den Kopf zu zerbrechen.
Zum hundertsten Male kehrten meine Gedanken zu den Menschen zurück, die ich zuletzt gesehen hatte. Um welche Sprache handelte es sich? Irisch, schottisch? Oder walisisch? Vielleicht bretonisch? Die Lage war so unglaublich. Ja, ich glaubte an Wiedergeburt, an Leben nach dem Tod. War ich denn gestorben? Erlebte ich möglicherweise eine Rückführung? Hatte ich mich selber in Entrückung versetzt?
Meine Angst vor dem Ungewissen wuchs. Was ich zu glauben begann, überstieg trotz allem meinen Verstand. Ich hatte wirklich das widersinnige Gefühl, mich im Mittelalter zu befinden. Ich blickte fragend in den wolkenverhangenen Himmel, und erst da wurde mir überdeutlich bewußt, daß schon seit Stunden kein Flugzeug mehr über mich hinweggeflogen war. Ich hatte nicht ein einziges maschinell erzeugtes Geräusch vernommen. Und diese Tatsache allein reichte, um mich vollends zu verängstigen.
Ratlos suchte ich die Umgebung nach einem geeigneten Schlafplatz ab. Ein paar dichte Tannen fielen mir auf, denn sie eigneten sich sicherlich bestens, um darunter die Nacht zu verbringen. Während ich auf die Bäume zuging, faßte ich wieder Mut. Ich freute mich darauf, am nächsten Morgen wieder unter der Linde liegend aufzuwachen, um feststellen zu können, daß mein Erlebnis nur ein Alptraum war, nichts weiter.
Jäh wurde ich aus meinen Gedanken gerissen, als es hinter mir laut knackte. Ängstlich drehte ich mich um... und mir stockte der Atem... In etwa dreißig Schritt Entfernung stand ein riesiger Bär. Das Herz sank mir in die Knie. Fieberhaft überlegte ich, wie ich mich retten konnte, und hielt Ausschau nach einem geeigneten Baum, es mußte schnell gehen! Eine Eiche, deren Krone einladend hin und her schaukelte, schien mir genau die richtige. Trotzdem blieb ich, keiner Bewegung fähig, dem ebenso starren Bären gegenüber stehen. Die Eiche war so nahe, doch meine Beine brachten nicht einen Schritt zuwege. Der Bär schien ebenso erstaunt wie ich. Er beobachtete mich eine Weile, dann brummte er laut. Ich zuckte unwillkürlich zusammen. Ein lautes Rauschen in meinen Ohren, kündigte mir eine nahe Ohnmacht an. Bestimmt kam er gleich wütend auf mich zu, und dann war es aus mit mir. Trotz allem, ich konnte mich nicht rühren. Er drehte ungeduldig den Kopf zur Seite, ehe das Unglaubliche geschah und er sich abwandte. Genauso überraschend wie er aufgetaucht war, verschwand er wieder. Erst nach einer Weile lösten sich meine verkrampften Muskeln. Ich zitterte, butterweich in den Knien, und sackte wie ein Kartoffelsack auf den Boden. Die zweite Lehre an diesem Tag... Unter den Tannen würde ich bestimmt nicht schlafen, das Sicherste war ein Schlafplatz auf dem Baum. Wenn es hier Bären gab, dann gab es womöglich auch Wölfe und Luchse oder andere Tiere, die einem Menschen gefährlich werden konnten, sofern sie sich bedroht fühlten. Ich atmete einige Male tief durch. Die Dunkelheit kroch wie ein böser Schatten über das Land, ich mußte mich beeilen.
Mit bleischweren Gliedern stand ich auf und ging hinüber zu der Eiche. Ängstlich spähte ich umher, um nicht ein weiteres Mal überrascht zu werden. Es könnte anders ausgehen. Wieder beschlich mich dieses unangenehme Gefühl... Wo gab es im 21. Jahrhundert in Deutschland solche Bären? Freilebend?
Inzwischen stand ich vor der nächsten Schwierigkeit. Die Eiche war hoch gewachsen, wie sollte ich dort hinaufgelangen? Ich zog meinen Rocksaum nach oben, befestigte ihn am Bund und prüfte den Sitz meiner Sachen, Ich lief um den Baum herum. Welch ein gewaltiges Werk der Schöpfung! Erst beim zweiten Umrunden entdeckte ich einen tiefhängenden Ast der mir geeignet erschien. Trotzdem reichte ich nicht einmal mit ausgestreckten Armen und auf Zehenspitzen heran. Es fehlte nur ein kurzes Stück, verdammt! Ich sprang und bekam ihn gleich beim ersten Versuch zu fassen. Nun mußte ich mich der nächsten Schwierigkeit stellen. Ich würde ein weitres Mal meine Kraft aufbringen müssen, um an dem Ast und Stamm hinaufzuklettern. Ich stemmte meine Füße dagegen und hangelte mich am Ast hoch. Immer wieder rutschten meine Sandalen an der Rinde ab. Mit einem Arm am Ast hängend, so wie Tarzan, zog ich mir mit der freien Hand meine Sandalen aus und ließ diese über sie auf meinem Arm entlanggleiten, um sie mit nach oben nehmen zu können. Ich versuchte, bald am Ende meiner Kräfte, den Aufstieg erneut, und dieses Mal mit Erfolg. Allerdings nahmen mir besonders meine Füße die Begegnung mit der rauhen Rinde übel. Ich hatte überall Schrammen und Kratzer. Schließlich hatte ich es geschafft, ich saß auf der ersten größeren Astgabel und ruhte mich aus. Nur nicht aufgeben! Bloß nicht wieder heulen, das half ja doch nicht. Stück für Stück arbeitete ich mich hoch, bis ich schätzungsweise fünf Meter über der Erde saß. Ich fand eine breite Gabelung, von der ich hoffte, darauf die Nacht verbringen zu können, ohne herunterzufallen. Ich mußte mich festklemmen. Nur wie? Und wenn ich schlafend den Halt verlor? Der Wind blies eisig hier oben, was mir jetzt, da ich zur Ruhe kam, auffiel. Die Nacht versprach kalt und unangenehm zu werden.
Schicksalsergeben holte ich meine Decke hervor und wickelte mich ein, besser feucht, jedoch nicht gänzlich dem eisigen Wind ausgesetzt. So könnte ich nicht viele Nächte überstehen. In plötzlicher Empörung über meine Gedanken biß ich die Zähne zusammen. Jetzt zweifelte ich schon wieder, dabei fand sich morgen sicher die Lösung meiner Schwierigkeiten!
Wenn ich mein Erlebnis später meinen Freunden erzählte, glaubte mir bestimmt niemand, geschweige denn, daß einer nachvollziehen könnte, was ich in diesem Augenblick empfand und durchlebte. So schrecklich einsam, so ängstlich!
Gedankenverloren aß ich einen Apfel und befestigte meinen Rucksack sorgsam an einem Ast, schräg über mir. Die Erschöpfung übermannte mich schließlich. Ich bat die göttliche Kraft um Hilfe, und tatsächlich, getröstet durch mein Gebet, schlief ich schließlich übermüdet ein. Ich übergab mich vertrauensvoll der Hülle des Schlafes und dem göttlichen Schutz. Ich schlief bis zum Morgengrauen durch, hörte nicht die Tiere der Nacht, die unter der Eiche umherstreiften, hörte nicht die Rufe der nächtlichen Greifvögel. Ich schlief einen heilsamen Schlaf, der meinem überforderten Geist und übermüdeten Körper eine Weile Ruhe schenkte.
5 Auf Burg Sommerstein, 2003
Sie lief und lief. Ab und zu drehte sie ihren Kopf, um zu sehen wie dicht ihr der Verfolger auf den Fersen war. Liam konnte das nackte Entsetzen in ihren Augen erkennen. Er wollte ihr zurufen stehenzubleiben; er wollte ihr doch nichts tun, doch kein Wort drang über seine Lippen.
Dann sah er wieder ihren gehetzten Blick. Sie lief weiter, er hinterher. Er fühlte sich wie ein Auge ohne Körper. Er versuchte, sie erneut zu rufen, doch nur ein gequältes Gurgeln kam heraus. Er stöhnte, dann wachte er auf.
Eine Weile lag er im Bett, seinen erregten Atemzügen lauschend, ehe er das Licht einschaltete. Es spendete ihm Trost und Sicherheit. Er stieg aus dem Bett. Unschlüssig stand er vor der Truhe. Sollte er sie verkaufen? Verschenken? Unter Umständen an den Mann, der ihm die Rohzeichnungen schickte? Oder sollte er sie zu Brennholz verarbeiten?
Das Ding war in diesem gut erhaltenen Zustand ein Vermögen Wert. Schon der Gedanke, sie aus den Händen zu geben, schnitt ihm ins Herz wie ein Messer. Nein, irgendwie mußte er sich mit ihr und ihrem Geheimnis auseinandersetzen, und mit dem, was sie ihm bescherte. Nur dann würde er seine Ruhe finden!
6 Ritter Talivan
Ich wachte durch den frühmorgendlichen Gesang der Vögel auf. Es dämmerte gerade, noch bedeckte dichter Nebel den Boden, bis hinauf in die Baumwipfel. Die Luft war kühl, so kühl, daß ich meinen Atem sehen konnte. Ich zitterte am ganzen Körper. Meine Glieder waren steif und schmerzten. Ich versuchte mich zu strecken, ohne vom Baum zu fallen. Nicht nur die Kälte trug Schuld an meinem Zittern, es lag auch an der Aufregung.
Meine Hoffnung, wieder unter der Linde aufzuwachen, war wie eine zu dünne Eisschicht zerbrochen. Mir wurde überdeutlich bewußt, daß ich in meinem Kleid, nur mit dieser leichten Decke, die zudem feucht war, nicht lange überstehen könnte. Die Decke war ekelhaft klamm, sie hielt lediglich den kühlen Wind davon ab, mir die Haut gänzlich von den Knochen zu reißen. Wärme spendete sie keine. Ich mußte sie unbedingt irgendwo zum Trocknen aufhängen. Wie sollte ich sie jedoch wiederfinden, wenn ich womöglich sonstwohin laufen mußte, um einen Bach zu finden, wo ich meinen Wasservorrat auffüllen konnte. Außerdem mußte ich mir einen besseren Schlafplatz suchen. Dieser war zwar vergleichsweise sicher, doch gemütlich beim besten Willen nicht.
Warum nur glaubte ich, daß ich auch heute nicht den richtigen Weg fand? Oder einen Menschen des 21. Jahrhunderts?
Als ich glaubte, meinem Körper wieder trauen zu können trotz der kalten Starre, die ihn bedrückte, begann ich mit dem Abstieg. Beim letzten Ast hielt ich mich mit den Händen fest und ließ mich nach unten gleiten. Ein paar Leibesübungen dehnten meinen steifgefrorenen Körper. Mein Magen knurrte. Sollte ich ihm meinen vorletzten Apfel anvertrauen? Gegebenenfalls fand ich ja ein paar Beeren oder Früchte? Ich aß ihn! Im besten Falle konnte ich das eine oder andere Wildgemüse sammeln? Vorausgesetzt ich fand mir bekanntes. Ich schickte ein Dankgebet an meine Großmutter, die trotz meines Streubens darauf bestanden hatte mir all ihre Kenntnisse in Kräuter- und naturkunde zu vermitteln. Hatte sie etwa damals schon eine Ahnung gehabt, daß ich sie einmal brauchen würde? Ich trank ein paar Schlucke Wasser. Schließlich fühlte ich mich wohler und für den kommenden Tag gestärkt. Die Sonne gewann zunehmend an Kraft. Der Nebel kroch nur noch in einzelnen Schwaden über den Boden. Tatsächlich versprach es ein angenehmer Tag zu werden, nicht so ein Trauerspiel wie gestern.
Als ich am Morgen aufwachte und feststellte, daß mein Traum nicht zu Ende war, womöglich weil es sich nicht um einen solchen handelte, hatte ich trotzdem mutig beschlossen, den Tag zu überstehen und alles andere, was kommen sollte. Vermutlich wurde ich ja inzwischen schon gesucht! Wie auch immer, der Schlaf hatte mir Kraft geschenkt. Ich sollte mich am besten südlich halten, also blickte ich zur Sonne hinauf. Selbst wenn das bedeutete in die entgegengesetzte Richtung zu gehen, aus der ich vermeintlich gekomme war, würde ich bestimmt auf eine Straße stoßen. Auch auf die Gefahr hin, damit eine mögliche Suchmaßnahme zu erschweren. Würde mich denn schon jemand vermissen? Ich hängte mir meinen Rucksack mit der Decke um und tat einen weiteren Schritt in meine ungewisse Zukunft. Während des Gehens bemerkte ich überall um mich herum erwachendes Leben. Mäuse huschten durch das Unterholz, Eichhörnchen sprangen von Ast zu Ast. In der Ferne hörte ich Hirsche röhren und hoffte, ihnen nicht zu nahe zu kommen, denn mit brünftigen Hirschen war nicht gut Kirschen essen. Kirschen! Wie gerne hätte ich jetzt solche. Unweit hinter mir hörte ich Wildschweine in der Erde wühlen. Sie suchten sicherlich Bucheckern und Eicheln, während sie laut grunzten und quiekten. Bei jedem neuen Geräusch spürte ich meine Beine einen Schritt schneller werden, und mein Herz pochte laut in der Brust. Das mußte doch auch jedes gefährliche Tier hören! Mich wunderte, daß diese Tiere trotz der Helligkeit noch so geschäftig waren? Aber nein, ich hatte doch gelesen, daß all diese Tiere noch im frühen Mittelalter gar keine Dämmerungstiere waren, sondern nur durch den Menschen dazu getrieben wurden. Ein Schauer lief mir über den Rücken.
Ich war inzwischen gut eine halbe Stunde unterwegs, als ich es vor mir plätschern hörte. Ich lief erfreut darauf zu und entdeckte einen mittelgroßen Bach. Das mit Steinen übersäte, flache Bachbett schlängelte sich durch den Wald. Ich kniete am Rand nieder, um daraus zu trinken. Das Wasser sah so rein und klar aus, eine Köstlichkeit, süß und würzig. Solch ein Wasser hatte ich nie zuvor getrunken. Der Jahreszeit entsprechend war es schon recht kalt, genau das Richtige, um wach zu werden. Ich bildete mit den Händen eine Schale und spritzte mir von dem Naß ins Gesicht. Ich mußte scharf die Luft einziehen, so kalt war es. Es mußte sein, nur so konnte ich meinen Körper gegen die Kälte abhärten. Ich blickte mich um, ob mich jemand beobachtete, doch im selben Augenblick kam mir der Wahnwitz dessen in den Sinn: Ich sollte doch froh sein, wenn es so wäre! Ich nahm all meinen Mut zusammen, zog mich aus, hockte mich in den Bach und glaubte, meine Füße würden erfrieren, während ich mich prustend mit dem eisigen Wasser bespritzte. Um Atem ringend sprang ich ans Bachufer. Mit der klammen Decke versuchte ich, mich notdürftig zu trocknen, und zog mich eilig wieder an. Meine Durchblutung dankte mir die Schockbehandlung, mir wurde endlich wieder wärmer. Meine Haut fühlte sich jetzt straff an, und das ewige Zittern hörte auf. Nach meiner Kaltwasserbehandlung goß ich den restlichen Inhalt aus meiner Flasche aus und füllte sie mit dem köstlichen Wasser des Baches.
Schlagartig kam mir in den Sinn, wo Wasser floß, da lebten Menschen. Ich brauchte bloß dem Bachlauf zu folgen, der glücklicherweise in Richtung Süden lief, und er würde mich unweigerlich zum nächsten Dorf bringen. Frohen Mutes schloss ich mich dem Wasserlauf Bachabwärts an.
Ich mußte wiederum mindestens eine Stunde unterwegs gewesen sein, als ich endlich auf einen Weg stieß. Weg? Diese Bezeichnung verdiente er gar nicht. Worauf ich stieß, war eher ein Trampelpfad. Wenigstens ein solcher, schoss es mir gerechterweise durch den Kopf. Er würde mich sicherlich an eine Straße führen. Glücklich trat ich aus dem Wald auf den Pfad und folgte ihm.
Obwohl ich schon eine Weile unterwegs war, begegnete mir keine Menschenseele. Ich hörte eine gemeine Stimme in mir, die mir schadenfroh verkündete, daß ich die Hoffnung endlich aufzugeben hätte. Kindisch schnitt ich ihr eine Grimasse. Verdrossen kramte ich meinen letzten Apfel heraus und biß hinein, als wäre er mein ärgster Feind. Ich hatte die Nase voll von allem, war wütend und verzweifelt zugleich. Irgendwie mußte mein Verstand gelitten haben, anders konnte ich mir mein Erlebnis nicht erklären.
Mich an den Saum des Pfades setzend, vertilgte ich den Apfel. Eine lange Weile starrte ich kauend nur ins Leere, plötzlich vernahm ich ein Geräusch.
Pferde! Ich hörte Hufe auf dem Sandboden. Pferde auf einem Pfad, das bedeutete sicherlich auch Reiter. Mein Körper setzte schon zum Sprung in die Mitte des Pfades an, als mich eine Eingebung zurückhielt. Ich atmete ein paarmal tief durch. Mein Gefühl sagte mir, daß ich mich ins Gebüsch zurückziehen sollte. Ich konnte den Leuten ja hinterherrufen, wenn sich meine Vorsicht als unnötig entpuppte. Ich duckte mich also tiefer ins Gebüsch und presste meinen Rucksack eng an mich, als gäbe er mir Sicherheit. Die Augen richtete ich auf den Pfad, meine aufkommende Angst niederkämpfend.
Dann stockte mir der Atem. Die Reiter ritten in die Wegkrümmung ein. Eine Gänsehaut rieselte meinen Rücken entlang. Diese Reiter dort waren keine Freizeitreiter! ...Die Kappen dieser Reiter bestanden aus Metall, welches, säuberlich geputzt, sogar die spärliche Herbstsonne spiegelte. Und dort, wo ich eine Weste vermutet hätte, trugen sie feste Leinengewänder, über schweren Kettenhemden, die unter den Säumen hervorblitzten. Ihre Hosen waren mit Stoffbändern umwickelt und an ihren Gürteln baumelten schrecklich lange Schwerter und Dolche, deren Hefte und Griffe in der Sonne aufblitzten. Schwere Kampfrosse wirbelten mit mächtigen Schritten den Sand des Weges auf. Das konnte doch unmöglich wahr sein? Das waren keine Ritter! Niemals, auch nicht, wenn alles danach aussah! Diese gehörten zum Museumsdorf, wie die anderen, das stand fest! Und weshalb lief ich ihnen dann nicht hinterher, nagte mein Unterbewußtsein an meinem Selbsttäuschungsversuch? Die Reiter galoppierten den Pfad entlang, gleich würden sie aus meiner Reichweite entschwunden sein. Ich mußte ihnen folgen! Was immer sie wirklich waren, sie sahen verteufelt echt aus und blickten verbissen ihrem Ziel entgegen.
Im Nachhinein war ich mir unsicher, ob sie mich bemerkt hätten, wäre ich auf den Pfad gesprungen? Und wenn? Die Erinnerung an das grimmige Gesicht des ersten Reiters ging mir durch und durch. Diese Männer hatten nicht einen Hauch Ansprechendes an sich. Sie wirkten brutal und unaufhaltsam. Mir sackte das Herz in die Knie, und ich dankte meiner inneren Stimme zutiefst berührt, daß sie mich mit einer Eingebung gewarnt hatte, und dankte mir, daß ich auf sie gehört hatte. Mit einem Mal war ich mir sicher, daß diese Kerle nicht davor halt gemacht hätten, mir das Leben zu nehmen.
Die Hufschläge verklangen, die Ritter entschwanden gänzlich meinem Blickfeld. Das waren nicht die schimmernden Helden, von denen schwärmerische junge Mädchen träumten. Ihre Gesichter versprachen nichts Gutes!
Das war kein Spiel! Die Erkenntnis traf mich wie ein Schlag in die Magengrube. Das waren auch keine Museumsleute! Ein neuer Gedanke versuchte, mich vor der aufsteigenden Angst zu bewahren... Wahrscheinlich wurde hier ein Film gedreht? Mein Bewußtsein bemühte sich, meine letzte Hoffnung zu retten, doch umsonst, es konnte nicht gegen das an, was mich mein Unterbewußtsein schon längst glauben ließ. Es gab nur eine Erklärung, da alle anderen mir auf Grund der Tatsachen unglaubwürdig erschienen: Sie waren echt!
Wieder und wieder liefen mir die Schauer über den Rücken. Ich schloß meine Augen und holte mir das Bild der Ritter ins Gedächtnis zurück, als wollte ich sie zu Papier bringen. Vierzehn Männer hatte ich gesehen. Ritter und Knappen. Die Reitpferde und vier Packpferde. Also waren sie für länger unterwegs! Wo wollten sie hin? Wo kamen sie her? Wohnten sie hier in der Nähe, oder waren sie auf Reisen und hatten einen weiten Weg vor sich? Ich beschloß, dem Pfad und ihnen trotz aller Ungewißheit zu folgen, allerdings soweit ich konnte für andere unsichtbar. Wenn ich eine Burg oder ein weiteres Dorf entdeckte, dann hielt ich erst einmal nach diesen Rittern Ausschau. Mein Gott, ich billigte das erstemal in Gedanken, womöglich tatsächlich im Mittelalter gelandet zu sein. Weiß Gott wie!
Was, wenn ich wirklich und wahrhaftig in eine ungewollte Zeitreise geraten war? Wie würde sie weitergehen? Sollte es bei einer Reise bleiben? Wie würde es enden? Würde ich ebenso unerwartet wieder in meiner Zeit erwachen? Schlagartig schnürte mir die Angst die Kehle zu. Was, wenn ich nie mehr zurückgelangte? Der Gedanke war kaum zu ertragen. Wie lange würde ich wohl hier überleben?
Ich stellte mir vor, wie ich ständig auf der Flucht vor diesen und anderen Rittern im Wald überleben mußte. Wie sollte ich jemals Nähe zu anderen Menschen finden? Oder würde ich von allen so aufgenommen werden wie von den Bauern am Tag zuvor? Inzwischen zweifelte ich nicht mehr daran, daß diese Menschen ihre Echtheitsbescheinigung verdienten. Ich erschrak vor meinen eigenen Gedanken, ich glaubte wirklich, was ich sah. Ich war mir sogar vollkommen sicher. Diese Leute hier wirkten viel robuster, als trügen sie gesündere und mehr Kräfte in sich als die Menschen meines Jahrhunderts. Eigentlich sollte ich mich glücklich schätzen, denn hier erlebte ich eine unversehrte Natur, wie ich sie mir gewünscht hatte.
Keine Maschinen verpesteten die Luft, das Wasser war rein und klar! Im Geheimen hatte ich doch schon immer den Wunsch gehegt, einmal in diese Vergangenheit blicken zu können, selbstverständlich nur als stiller Beobachter, nicht als Beteiligter. Warum sonst zeichnete ich Bildergeschichten die im Mittelalter spielten? Ich fühlte eine große, unerklärliche Angst in mir. Entschlossen stand ich auf, diese Ängste verdrängend, es half ja alles nichts, ich mußte hinterher!
Es mußte gut eine Stunde vergangen sein, ehe ich schließlich ermüdet, an den Rand des Waldes gelangte. Ich blieb im Dickicht stehen, um die Lage auszukundschaften. Da stand sie, die Burg, mit der ich schon gerechnet hatte. Irgendwie erstaunte mich diese Tatsache gar nicht mehr, obwohl ein flaues Gefühl im Magen nicht ausblieb, wahrscheinlich erst recht, weil ich mit meiner Vermutung richtig lag. Sie stand nicht weit entfernt von mir in einer ansprechenden, hügeligen Landschaft, auf höchster Erhebung. Ich konnte meine Augen weit schweifen lassen. Der Pfad, dem ich gefolgt war, lief weiter bis zur Burg und gabelte sich schätzungsweise fünfhundert Meter vor dem Tor. Unterhalb der Burg siedelten die Bürger. Allerdings wirkten ihre Häuser eher dörflich, enger zusammengerückt als das Dorf, daß ich am Vortag sah. Die Burg thronte über allem. Sie war keine Schönheit, eher eine verschönerte Festung, die Tore standen indes weit geöffnet und wirkten einladend.
Wie sollte ich denn nun weiter vorgehen? Angenommen, die Ritter von vorhin waren die Besitzer? Denen wollte ich auf keinen Fall wieder begegnen. Und was würde ich den Menschen erzählen? Ich konnte kaum die Wahrheit sagen, vorausgesetzt sie verstünden mich.
Und wenn ich ins Dorf schlenderte, das Beste hoffte und wartete, was passierte? Was könnte alles geschehen, falls ich mich wirklich im Mittelalter befand. Ich wollte diesen Gedanken lieber nicht weiterspinnen, so wie die Dörfler mich angeschaut hatten, hielten sie mich allesamt für eine Hexe. Ich beschloß, weiterhin im Versteck und vorerst bei der Beobachtung zu bleiben. Kummer bereitete mir nur mein Magen, der so heftig aufbegehrte, daß bald alle Burgbewohner in meine Richtung blicken würden, weil sie glaubten, ein Ungeheuer läge auf der Lauer und brüllte.
Der für mich eher ungewohnte, stramme Fußmarsch, zudem mit meinen zerkratzten Füßen hatte mich ordentlich hungrig gemacht. Ich suchte mit den Augen die Umgebung der Burg ab, gab es denn keinen Burggarten? Wie dumm, daß ich unterwegs nicht auf Brombeeren geachtet hatte, doch die Angst, entdeckt zu werden, hatte mich weitergetrieben. Ich konnte keinen Garten entdecken. Verdammt, ich mußte näher heran. Hier und da wuchsen Büsche am Weg, hinter denen konnte ich mich verstecken. Wenn ich all meinen Mut zusammennahm, gelänge es mir wahrscheinlich, unentdeckt näher heranzuschleichen. Immer vorsichtig, Stück für Stück, schob ich mich weiter. Den Pfad ließ ich links liegen, jedoch nicht unbeobachtet. Jetzt wieder dem kühlen Wind ausgesetzt, da mich das dichte Laubwerk der Bäume und Büsche nicht mehr schützte, begann ich erneut zu frieren. Vielleicht hundert Meter vor dem ersten Haus hielt ich an, ein dicker Busch bot mir die nötige Sicherheit. Jetzt konnte ich sogar einzelne Burgbewohner bei ihrem Tagwerk erkennen.