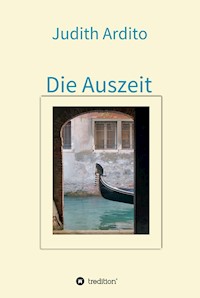
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Venezia
- Sprache: Deutsch
Venedig im Winter: Claudia, Rechtsanwältin aus Berlin, nimmt zehn Wochen Auszeit von Beruf, Ehe und Alltag und reist ganz allein nach Venedig. In der Anfängerklasse einer Sprachschule lernt sie den amerikanischen Kunsthistoriker Christopher kennen, der darauf hofft, in Europa ein neues Leben beginnen zu können. Und dann ist da noch Victoria, eine junge Frau aus Sankt Petersburg, die sich mit Existenzängsten und ungewissen Zukunftsperspektiven plagt. Ihnen allen gemeinsam ist ein Faible für Literatur, und dass sie der Serenissima verfallen sind. Vor dem Hintergrund der winterlichen Lagunenstadt entwickeln sich ihre Freundschaften und Zukunftsträume. Erst langsam, dann immer schneller gerät Claudias Leben in Bewegung und nimmt eine Dynamik an, mit der sie nie gerechnet hatte…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
www.tredition.de
Judith Ardito
Die Auszeit
© 2017 Judith Ardito
Titelfoto: Judith Ardito
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7439-7458-6
Hardcover:
978-3-7439-7459-3
e-Book:
978-3-7439-7460-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Für B.
Prolog
Venedig, 21. Oktober 2012, spätabends
Als ich heute Abend am Piazzale Roma aus dem Bus stieg, begrüßte mich Venedig mit einem dramatischen Auftritt: Blitze, Donner und ein gewaltiger Wolkenbruch. Große Oper. Die dreihundert Meter bis zur Anlegestelle der Linie 1 reichten bereits vollkommen aus, um mich zu durchnässen. Dort stellte ich mich so nah an den offenen Ausgang, wie es der Regen erlaubte und blickte auf den Canal Grande hinaus, ohne den vertrauten Anblick wiederzufinden. Die Wasseroberfläche sah aus wie eine zerknitterte Plastikfolie, eine dieser dünnen Folien, wie man sie zur Abdeckung beim Anstreichen verwendet.
Nach und nach füllte sich der Wartebereich mit vom Festland heimkehrenden Venezianern und mit Touristen, die große Koffer mit sich führten und immer wieder den Fahrplanaushang studierten: Fährt hier die Linie 1 ab? Richtung Rialto und San Marco? Die Andersartigkeit von Venedig hatte sie hergelockt, jetzt waren sie verwirrt angesichts dieser Stadt, in der nichts so ist wie an anderen Orten.
Endlich tauchten die Scheinwerfer eines Vaporetto aus dem Regen auf. Das Boot stupste hörbar an den Steg, der Schaffner öffnete die Absperrung und rief „per San Marco!“ Ich fand einen Platz am Fenster, doch außer dem Licht der Blitze und den regelmäßig auftauchenden Schildern der jeweiligen Anlegestellen war durch die beschlagenen Scheiben kaum etwas zu sehen. An der Haltestelle Ca d’Oro erwartete mich Angelika ganz undramatisch in Gummistiefeln und mit zwei großen Regenschirmen ausgerüstet.
Auf diese Weise bin ich noch nie hier angekommen. Das Unwetter hat alles verfremdet und damit all meine Befürchtungen überflüssig werden lassen. Zudem wohne ich diesmal nicht in „meinem“ Apartment im alten Ghetto, sondern hab ein kleines Studio unten in einem Palazzo, direkt unterhalb von Angelikas Wohnung. Ein guter Anfang.
Immer noch im strömenden Regen gingen wir ein Stück die Strada Nuova entlang und tauchten hinter dem Campo S. Apostoli in das Gassenlabyrinth ein. Bevor wir noch um ein paar Ecken und schließlich in eine weitere winzige Gasse einbogen, erhaschte ich einen kurzen Blick auf die sanft angeleuchtete Miracoli-Kirche in all ihrer Schönheit und Anmut. Am Ende einer engen Sackgasse standen wir schließlich vor einer Mauer mit einem großen hölzernen Tor. Angelika schloss auf und führte mich quer über einen verwitterten Innenhof zu ihrer Einliegerwohnung, direkt neben dem Wassereingang. Sie zeigte mir noch, wo die Lichtschalter sind und wie man die Heizung reguliert, dann wünschten wir uns eine gute Nacht.
Jetzt packe ich meine Sachen aus und richte mich ein. An Schlaf ist sowieso noch nicht zu denken. Die Kleidung hänge ich in den offenen Schrank, ein paar Teebeutel und eine Packung Müsli (ach wie deutsch!) kommen in die Miniatur-Küche, den Laptop, mein Tagebuch und einige Bücher verstaue ich im Regal.
Die alte Ausgabe von „Ufer der Verlorenen“ ist auch mitgekommen; darin liegt als Lesezeichen ein Foto von uns dreien im Caffè Florian. Ich brauche es nicht herausnehmen, ich weiß auch so, was darauf zu sehen ist. Wir sitzen auf einer roten Plüschbank an dem Ecktisch unter dem Bildnis des Chinesen. Der Kellner hat uns fotografiert; wir blicken alle drei strahlend in die Kamera. Es gibt nur dieses eine Foto von uns, und dabei wird es auch bleiben.
Im Bett liegend lausche ich dem Wasser, das direkt hinter mir an die Hausmauer gluckst und höre ab und zu ein Boot vorbeifahren. Der Regen hat aufgehört, und ich habe die Fenster weit geöffnet. Lange Zeit kann ich nicht einschlafen.
Venedig
Kapitel 1
Damals war ich in einer Januarnacht angekommen. Das Flugzeug hatte Verspätung gehabt. Es war sehr kalt, der zweite Tag des Jahres, und abgesehen von den anderen Reisenden, die mit mir im selben Bus gesessen hatten, war keine Menschenseele zu sehen. Ich fühlte gar nichts. Mechanisch griff ich nach meinem großen Koffer und dem Handgepäck und machte mich auf den Weg zur Anlegestelle.
Beim Abschied von Martin vor wenigen Stunden in Berlin hatte ich sehr geweint. Zehn Wochen Auszeit in Venedig und der Plan sah nicht vor, sich in dieser Zeit gegenseitig zu besuchen. Ich wollte wissen, wie es sich anfühlt, allein unterwegs zu sein, das war Teil des Programms. Am Check-in-Schalter fühlte sich das jedoch herzzerreißend falsch an. Es war, als würde ich Martin für immer verlassen und dabei selbst verloren gehen. Und gleich danach, im Wartebereich, kam schon die große Leere über mich. Das Studentenwohnheim, in dem ich ein Zimmer gebucht hatte, lag auf der Giudecca-Insel in einem Seitentrakt des Klosters, gleich hinter der berühmten Redentore-Kirche. Normalerweise war die Rezeption um diese Uhrzeit nicht mehr besetzt, daher hatte ich meine Verspätung vom Flughafen aus telefonisch durchgegeben. Dennoch reagierte niemand auf mein Klingeln, als ich endlich vor dem Eingangstor stand, aber glücklicherweise kam eine japanische Studentin so spät noch heim und ließ mich hinein. Drinnen schlenderte nach einer Weile ein junger Mann ohne Hast den Gang entlang zur Rezeption und begrüßte mich charmant lächelnd. Er nahm sich meines Gepäcks an, zeigte mir mein Zimmer, gab mir die Schlüssel, wünschte mir eine gute Nacht und verschwand. Immer noch wie betäubt packte ich das Nötigste aus, schrieb eine SMS nach Hause und ging zu Bett.
Nach einer kurzen Nacht verließ ich früh am nächsten Morgen das Studentenwohnheim und trat hinaus in die schmale, leere Gasse. Ich bog um ein paar Ecken und gelangte schließlich an das Ufer des breiten Giudecca-Kanals, der noch ganz in Nebel gehüllt war. Wie war ich eigentlich auf die Idee gekommen, mich in Venedig für einen Italienischkurs anzumelden, anstatt einfach mal ein paar Wochen lang in den Tag zu leben? Aber da musste ich nun wohl durch.
An der Vaporetto-Haltestelle betrat ich Fabios Bar, die ich noch von früheren Aufenthalten kannte; einen hell erleuchteten Zufluchtsort inmitten von morgendlicher Kälte und Feuchtigkeit. Ich wünschte einen guten Morgen, bestellte einen Cappuccino und eine Brioche, die mir noch ofenwarm in die Hand gedrückt wurde und nach Trost und Zuversicht schmeckte. Außer mir standen noch vier oder fünf Leute an der Theke, von denen ich annahm, dass sie aus der Nachbarschaft stammten. Nach einigen Tagen kannten wir uns bereits vom Sehen und grüßten einander, wenn wir uns irgendwo in der Stadt über den Weg liefen.
Wie auf ein geheimes Kommando hin legten auf einmal alle Geld auf die Theke, wandten sich zur Tür und gingen die zwei Schritte hinüber zur Anlegestelle, ich tat es ihnen hastig nach. Dort wartete bereits eine kleine Menschentraube auf das Vaporetto Linie 2, das nun fast unmittelbar vor uns völlig geräuschlos aus der Nebelwand auftauchte. Im Boot waren alle Sitzplätze besetzt von verschlafen aussehenden Berufstätigen und schnatternden Schulkindern mit ihren Müttern. Ich suchte mir im Mittelgang einen Stehplatz und hielt mich irgendwo fest, während wir langsam im allmählich heller werdenden Grau dahinschaukelten. An der übernächsten Haltestelle, am Zattere-Ufer, stiegen die meisten aus, ich auch.
Meinen Schulweg hatte ich mir vorab auf dem Stadtplan angesehen. Ich wandte mich also ohne zu zögern nach links, ging über eine Brücke und weiter am Ufer entlang bis zu einer schmalen Gasse auf der rechten Seite, die beinahe unsichtbar zwischen zwei hohen Häusern hindurchführt, eine dieser typisch venezianischen Gassen, durch die man mit einem aufgespannten Regenschirm nur dann hindurch passt, wenn man ihn ganz schräg hält oder halb schließt. Noch eine Brücke, geradeaus an einem kleinen Kanal entlang, über ein weiteres Brückchen, dann nach rechts vorbei an einem Papierwarengeschäft, einer Boutique und einer Osteria bis sich der Blick auf den Campo San Barnaba öffnete. Hier bog ich wieder um eine Ecke und überquerte den nächsten Kanal, um schließlich mein Etappenziel, das Café Majer, zu erreichen, wo sich das Prozedere von vorhin wiederholte: Ich grüßte allgemein in den Raum hinein, in dem sich außer mir noch einige ältere Herren befanden, stellte mich an die Theke und trank einen weiteren Cappuccino. Mein Blick fiel auf die Uhr an der Wand. Jetzt wurde es langsam Zeit für mich, bald würde der Unterricht im Istituto Venezia beginnen, der Sprachschule, bei der ich mich für zweieinhalb Monate angemeldet hatte. Zweieinhalb Monate erschienen mir heute Morgen sehr lang. Warum tat ich mir das an? Warum nicht einfach umkehren und mich wieder ins Bett legen? Ich hatte die Kursgebühr für einen Monat im Voraus bezahlt, aber das Geld könnte ich im Zweifel auch unter „Verluste“ verbuchen und sausen lassen. Ich legte einen Euro fünfzig auf die Theke und begab mich hinüber zur Schule auf die andere Seite der Gasse.
Hinter einem schmiedeeisernen Tor, das von - jetzt im Januar kahlen – Glyzinienzweigen überrankt war, führte eine Außentreppe zur eigentlichen Eingangstür im ersten Stock eines kleinen Palazzo. Ich betrat einen sehr großen fensterlosen Flur mit einem schönen alten Terrazzoboden. Dunkle zweiflügelige Holztüren zu allen weiteren Räumen gingen von hier ab, und ganz hinten mündete der Raum in ein kleines, mit einer Glaswand abgetrenntes Büro, das Schulsekretariat. Dort zeigte ich meine Anmeldebescheinigung vor, trug mich in zwei Listen ein und nahm einen Studentenausweis in Empfang; dann setzte ich mich auf eine alte, mit Schnitzereien verzierte Bank im Flur und musterte die Neuankömmlinge, während ich auf den Unterrichtsbeginn wartete.
Zur Schule gehen mutete wie eine Regression in frühere Jahrzehnte an. Ich war 56 Jahre alt und hatte zusammen mit Kollegen eine Anwaltskanzlei in Berlin. Mein Studium lag lange zurück. Hier sah ich nun fast nur junge Leute hereinkommen, alle mehr oder weniger im Alter meiner Kinder, wenn ich denn welche gehabt hätte … Es war ein bisschen wie auf einem Schulhof. Man stand plaudernd in Grüppchen zusammen, schlängelte sich durch das Gedränge hindurch ins Sekretariat oder zu den Toiletten und verschwand schließlich gemeinsam in den Schulzimmern.
Nach einer Weile wurde dann die Anfängerklasse livello uno aufgerufen. Im Klassenraum ließ ich mich auf einem Platz nah an die Tür nieder und blickte mich um. Rechts neben mir saß ein junger Mann, den ich auf Ende zwanzig schätzte und der so typisch französisch aussah, als wäre er einem Kinofilm entstiegen. Weiter rechts, an der Querseite saß eine gut aussehende blonde Frau ungefähr in meinem Alter, die recht freundlich wirkte und die ich für eine Deutsche hielt. Daneben ein ganz junger Mann aus Asien, der sehr kindlich wirkte, dann ein brünetter Junge, sehr groß gewachsen, auch er fast noch ein Kind und schließlich eine rothaarige junge Frau mit üppigen Rundungen. Die beiden Letzteren unterhielten sich bereits angeregt in unverkennbarem Amerikanisch. An den Tischen mir gegenüber hatten zwei Japaner Platz genommen, ein blasser junger Mann und ein hübsches Mädchen, das trotz der eisigen Januartemperaturen nur mit einem dünnen Jäckchen, Minirock und Pumps bekleidet war. Ein weiterer Stuhl daneben war leer geblieben. Eine zierliche schwarzhaarige Frau trat ein, sagte buon giorno, stellte sich als unsere Lehrerin vor und sprach fortan nur noch Italienisch mit uns.
Carla, so hieß sie, schrieb zunächst einige nützliche Begriffe und Redewendungen an das Whiteboard: „Was bedeutet dieses Wort?“, „Wie schreibt man …?“, und Ähnliches mehr. Es folgten weitere Vokabeln, erste grammatikalische Erklärungen, kurze Sätze und die Zahlen von eins bis hundert. Mein Blick schweifte zum Fenster, vor dem immer noch nur Nebel zu sehen war, und ich spürte, wie der Nebel nun auch von meinem Gehirn Besitz ergriff.
Als ich wieder zuhörte, schien eine erste praktische Übung anzustehen. Carla schrieb Kennenlernfragen und die dazugehörigen Antworten an das Board: „Wie heißt du?“, „Woher kommst du?“, „Wie alt bist du?“ und „Ich heiße …“, „Ich komme aus …“, „Ich bin … Jahre alt“. Dann zeigte sie auf die entsprechenden Sätze an der Wand und sagte dabei ganz langsam und deutlich „Ich heiße Carla. Ich komme aus Bologna. Ich bin 30 Jahre alt.“
Sie nickte mir freundlich auffordernd zu und fragte: „Wie heißt du?“ „Ich heiße Claudia.“ „Woher kommst du?“ „Ich komme aus Berlin.“ „Wie alt bist du?“ Ich blickte suchend auf die Wandtafel, fand endlich die richtige Zahl und antwortete stockend „Ich bin 56 Jahre alt.“ „Danke, Claudia, sehr gut. Und jetzt die anderen“, forderte sie die Klasse auf. Dem Franzosen neben mir, er hieß Nicolas, 30 Jahre alt, natürlich aus Paris, fiel es leicht, Italienisch zu sprechen; nach ihm mühten sich Sabine, 58 Jahre alt, aus Frankfurt, und Jacky, 26 Jahre, aus einem unaussprechlichen Ort in China, mit ihren Redebeiträgen ab. Bei den beiden amerikanischen Schülern, Matt, 17, aus Seattle, und Samantha, 23, aus San Francisco, geriet die Vorstellungsrunde vorübergehend ins Stocken, weil sie zunächst ganz entspannt und selbstverständlich in ihrer Muttersprache antworteten. Die beiden Japaner hingegen, Toshiaki aus Osaka, 24 Jahre alt, und Sumiko, 20, aus Yokohama, schienen bei ihrer Vorstellung echte Höllenqualen zu leiden und waren kaum zu verstehen.
Wir waren alle dankbar für die Unterbrechung, als an dieser Stelle die Tür aufging und ein weiterer Schüler die Klasse betrat. Er setzte sich auf den freien Platz mir gegenüber und musste gleich in der Runde fortfahren. „Ich heiße Christopher, und ich komme aus New York.“ „Wie alt bist du?“, fragte Carla langsam und sorgfältig akzentuierend. „Ich heiße Christopher, und ich komme aus New York.“ „Und wie alt bist du?“, wiederholte Carla geduldig. „Ich heiße Christopher und ich komme aus New York.“ Carla schaute ihn irritiert an, lächelte unverbindlich und wechselte das Thema.
Ich unterzog den neuen Mitschüler einer kritischen Prüfung: Mittelgroß, sehr schlank, um nicht zu sagen mager, graue Haare mit jenem leichten Gelbstich, der ein vormaliges Blond vermuten lässt, sehr gepflegt und meiner Schätzung nach deutlich über sechzig. Zu eitel, um sein Alter zu nennen, dachte ich, du meine Güte, wie unsympathisch!
Der Rest des Vormittags ist in einem Wust von Vokabeln und Grammatik aus meinem Gedächtnis verschwunden. Ich weiß nur noch, dass wir um zwanzig vor eins alle so offensichtlich erschöpft waren, dass unsere zweite Lehrerin, Paola, den Unterricht vorzeitig beenden musste. Müde und hungrig ging ich zusammen mit der deutschen Mitschülerin, Sabine, hinüber zum Campo S. Margherita ins Caffè Rosso, ein beliebter Treffpunkt für die Studenten der nahegelegenen Universität und ein Tipp in dem einen oder anderen Reiseführer. So hatte auch ich es vor Jahren entdeckt und zu einer festen Anlaufstelle erkoren.
An der Theke suchten wir ein paar Tramezzini aus und ließen uns dann an einem der Tische nieder. Sabine hatte eine kleine Immobilienagentur in der Nähe von Frankfurt und nahm sich – genau wie ich – eine mehrmonatige Auszeit. Sie war schon seit Ende November in Venedig und hatte vor Weihnachten bereits zwei Wochen lang Unterricht am Istituto gehabt, allerdings nur mit mäßigem Erfolg, weswegen sie nochmals mit der neuen Anfängerklasse in das Lernprogramm startete. Auf Nachfragen erzählte ich ein wenig lustlos von meinem Beruf, der Kanzlei und den Plänen für meine Auszeit hier. Und dann sprachen wir natürlich noch über bisherige Aufenthalte in Venedig und tauschten Tipps aus, wie sie ein jeder parat hat, der dieser Stadt verfallen ist und immer wiederkehren muss. Viele Gespräche in Venedig drehen sich um Venedig.
Sabine ging anschließend wieder zurück zur Schule, um an dem nachmittäglichen Kulturprogramm teilzunehmen. Ich winkte ab, genug für heute. Auf dem Weg zum Vaporetto kaufte ich etwas ein, ließ mich über den Kanal setzen, ging auf dem kürzesten Weg zum Redentore-Kloster und in mein Zimmer, legte mich aufs Bett und schlief sofort ein.
*
Am nächsten Morgen sprach Carla mich an, als ich den Flur betrat und wies auf die Tür eines anderen, größeren Klassenraums, in dem sich Sabine und die beiden japanischen Schüler bereits eingefunden hatten. „Was ist los?“, fragte ich bei Sabine nach. „Ich glaube, wir bekommen noch einige neue Mitschüler“, erwiderte sie. „Gestern Nachmittag haben sie ein paar Neuzugänge auf ihre Grundkenntnisse getestet, und wer für livello due nicht genug Italienisch kann, muss eben zu uns.“ „Na, da bin ich aber mal gespannt“, sagte ich und packte mein Schreibheft aus.
Ich erinnere mich nicht mehr an alle vier neuen Mitschüler. Wie sich später zeigte, gab es immer wieder Leute, die nur für ein oder zwei Wochen an unserem Unterricht teilnahmen, sodass sich die Zusammensetzung der Klasse jeden Montag änderte. Ein harter Kern von sieben Personen blieb jedoch im ersten und auch noch im zweiten Monat erhalten. Zu dieser Kerngruppe gehörten auch die beiden Victorias, die an diesem Morgen neu dazu kamen.
Sie kamen beide aus Russland, allerdings war ihr gemeinsames Auftauchen ebenso zufällig und unabsichtlich wie ihre Namensgleichheit und das Aufsehen, das ihr Erscheinen in unserer Gruppe hervorrief.
Die eine Victoria war etwa Mitte zwanzig, klein, dunkelhaarig, sehr hübsch und gab sich betont feminin. Ich habe sie nie anders als in astronomisch hohen High Heels gesehen, egal zu welcher Jahreszeit und bei welcher Witterung. Sie erwies sich als äußerst engagierte und ehrgeizige Schülerin, in den ersten Tagen sogar geradezu verbissen. Später wurde sie lockerer und gesprächiger, blieb jedoch immer von Geheimnissen umgeben: Was tat sie in Italien? Wollte sie bleiben? Was war sie von Beruf? Wo in Venedig wohnte sie? Wer war der junge Mann, der sie manchmal morgens zur Schule brachte? Im Laufe der Zeit erfuhr ich das eine oder andere von ihr und setzte mir einen Teil des Puzzles zusammen, aber das sollte noch dauern.
Die andere Victoria war eine ätherische Schönheit aus St. Petersburg, anders als ihre Namensschwester groß gewachsen, von zartem Körperbau, hellblond und blauäugig. Sie hatte vollendete Umgangsformen und verhielt sich stets ebenso höflich wie zurückhaltend. In unserer Klasse war sie die intelligenteste und immer gut für überraschende Fragen und originelle Gedanken. Auf Nachfragen der Lehrerin berichtete sie, dass sie die Wintermonate über frei hatte und bei ihrem Freund im venezianischen Hinterland an der Brenta wohnte. Die restliche Zeit des Jahres arbeitete sie irgendwo auf See als Stewardess.
Noch am ersten Tag gab die Klasse den beiden zur besseren Unterscheidung die Namen Victoria piccola und Victoria grande.
Nach der Schule im Caffè Rosso fragte ich Sabine „Na, was hältst du von unseren Neuzugängen?“
„Also, ich weiß nicht, die kleine Victoria schaut ein bisschen nuttig aus. Hast du ihre Stiefel gesehen? Bis über die Knie, und die Absätze sind mindestens 15 cm hoch.“
„Eher noch höher. Mir ist aufgefallen, dass sie mehrmals versucht hat, Carla und Paola Fehler nachzuweisen. Keine gute Idee … Sie wirkt ein bisschen übertrieben ehrgeizig, findest du nicht?“
Sabine nickte. „Unbedingt. Ich meine, wir sollten das hier generell locker angehen, schließlich werden wir nicht dafür bezahlt, das ist doch unsere Freizeit.“
„Und die andere Victoria?“, fragte ich weiter.
„Hochnäsig“, fand Sabine.
„Vielleicht ist sie ja nur zurückhaltend. Und was ist mit den anderen?“, fuhr ich fort. „Samantha zum Beispiel: Heute Morgen hat sie die Ärmel hochgekrempelt, und ich dachte, sie hätte ein geblümtes Shirt unter ihrem Pullover, aber es waren ihre Unterarme! Über und über farbig tätowiert. Matt wirkt daneben wie ein braver Schuljunge aus konservativen Kreisen.“
„Ich glaube, genau das ist er auch. Immerhin ist er höflich und freundlich, was man von Samantha nicht behaupten kann. Die beiden Japaner scheinen großen Stress damit zu haben, wenn sie etwas gefragt werden und antworten müssen. Carla sollte sie mehr schonen, finde ich, sie sterben ja beinahe vor Angst.“
„Es sind halt Perfektionisten, sie wollen bloß keine Fehler machen, nur nicht das Gesicht verlieren. Ihre Schulhefte sind das makelloseste, was ich je gesehen habe, eine echte Augenweide. Wahrscheinlich, weil unsere Schrift ja auch neu für sie ist; sie malen sozusagen alles ab …“
„Im Gegensatz zu Jacky“, bemerkte Sabine. „Bei ihm habe ich den Eindruck, dass er weder schriftlich noch mündlich folgen kann, aber er wirkt dabei vollkommen stressfrei und gut gelaunt.“
„Und Christopher? Was hältst du von ihm?“
„Ach, den finde ich ganz nett. Er war vor Weihnachten schon mal eine Woche mit mir im Unterricht, daher kennen wir uns. Er ist aus New York, ich glaube, er hat bei irgendeinem Museum gearbeitet oder so, irgendetwas in der Art hat er mal erwähnt.“
„Ich finde ihn eitel und arrogant“, hielt ich dagegen. „Vollkommen egozentriert und komplett von sich selbst eingenommen wie alle Amerikaner. Dass er gebildet ist, kann ich mir vielleicht vorstellen, aber eben auch total eingebildet.“
Die üblichen Tramezzini und den Cappuccino hatten wir nun hinter uns. „Wollen wir unvernünftig sein und einen Spritz bestellen?“, fragte ich. Sabine lächelte. „Na gut, aber auf deine Verantwortung. Eigentlich trinke ich nicht viel, schon gar nicht tagsüber.“
„Aber du hast ja eben selbst gesagt, dass wir alles locker angehen lassen sollten“, wandte ich ein und ging zur Theke, um zu bestellen.
*
Der 6. Januar war schulfrei, Epifania, das Fest der Heiligen Drei Könige, beziehungsweise – in Italien – der Befana, einer Hexe, die auf einem Besen reitet und den Kindern süße Geschenke bringt. Das ist ein malerisches und bei Jung und Alt sehr beliebtes Fest in Venedig. Alljährlich findet eine Regatta auf dem Canal Grande statt, bei dem alle Ruderer als Hexen verkleidet sind und daran viel Spaß haben.
Von der Befana wusste ich jedoch an diesem Morgen noch nichts, als ich aufstand und aus dem Fenster in das allmorgendliche Grau hinausblickte. Jemand hatte mir erzählt, dass am 6. Januar – und nur an diesem einen Tag im Jahr! – ein wunderschönes Glockenspiel mit den Figuren der drei Könige auf dem Markusplatz zu bestaunen sei, immer zur vollen Stunde. Das wollte ich mir ansehen. Fabios Bar blieb an Sonn- und Feiertagen geschlossen, und weil ich nicht wusste, wie es meinen anderen Anlaufstellen damit hielten, beschloss ich ausnahmsweise mit Kaffee und ein paar Keksen im Studentenwohnheim zu frühstücken.
Mit einem Päckchen Espresso, einer Tüte Milch und anderen Kleinigkeiten im Arm verließ ich mein Zimmer, ging den düsteren Gang entlang bis zum hinteren Treppenhaus und hinunter ins Erdgeschoss, in dem man von einem Flur aus zur Gemeinschaftsküche, einem kahlen Speisesaal und anderen Nebenräumen gelangte. Hier suchte ich für meine Utensilien ein freies Fach in einer Wand von metallenen Schließfächern, wie man sie sonst an Bahnhöfen findet. Fast alle waren belegt, und die wenigen freien Fächer hatten keine Schlösser mehr, waren verdreckt und zum Teil vermüllt. Ich ging in die Küche und verstaute meine Sachen in einen Schrank neben dem Herd. Später stellte ich noch ein Papierschild davor, auf dem „privat“ stand, aber am anderen Tag war trotzdem alles weg und ich kaufte neu ein.
Zunächst jedoch kochte ich mir einen Kaffee. Auf der Abtropffläche über der Spüle befanden sich Espressokännchen in verschiedenen Größen. Ich befüllte eines und setzte es zusammen mit einem kleinen Milchtopf auf den Herd. Während ich wartete, kam eine sehr zierliche ältere Frau, eine Australierin, die ich vom Sehen aus der Schule kannte, in die Küche und grüßte auf Italienisch. Ich grüßte zurück, musste aber passen, als sie eine Konversation auf Italienisch beginnen wollte; meine Sprachkenntnisse umfassten erst gerade mal die notwendigsten Höflichkeitsfloskeln. Sie verlor sofort das Interesse an mir und begann am anderen Ende der Küche schweigend mit ihren Frühstücksvorbereitungen; irgendwas mit Sprossen und Körnern. Als ich mich anschickte, meinen Milchkaffee auf ein Tablett zu stellen und zu gehen, wies sie mich auf Englisch darauf hin, dass Milch Gift sei. „Milk is poison, and coffee with milk is coffee with poison.” Nachdem ich oben in meinem Zimmer mit Blick auf den nebelverhangenen Klostergarten etwas lustlos mein poison getrunken hatte, machte ich mich auf den Weg ins Stadtzentrum.
Dort bot sich mir der Anblick eines verzauberten Canal Grande voller Gondeln und anderer traditioneller Boote in verschiedenen Größen, die, wie es in Venedig üblich ist, im Stehen gerudert werden. Diese Erscheinungen schwebten – durch zarten Nebel optisch von der Wasseroberfläche getrennt – wie Traumbilder über dem Kanal.
Erst auf den zweiten Blick fiel mir die Kostümierung der Ruderer und Gondoliere auf: Hexen in grobem braunem Sackleinen und Kopftuch waren ebenso unterwegs wie welche mit weißen Spitzenunterröcken und ebensolchen Hauben, viele mit faltigen Gesichtern und langen, roten Nasen. Am Fuße der Rialtobrücke hatte sich ein Männerchor (alle aus Rudervereinen, wie ich später erfuhr) aufgebaut und sang alte venezianische Volkslieder, deren Text ich natürlich nicht verstand. Immerhin hörte ich ziemlich oft das Wort gondola im Refrain, kein Wunder. Einige offiziell aussehende Honoratioren mit grünweißroter Schärpe versammelten sich auf einer kleinen Plattform am Kanal, einer davon klopfte auf sein Mikrofon und hielt eine kurze Rede. Darauf folgten ein lauwarmer Applaus und ein mit mehr Elan vorgetragenes weiteres Lied des Gesangsvereins. Dann ertönte ein Schuss und die Regatta begann. Die Hexen ruderten in Richtung Markusplatz, drehten nach kurzer Zeit um und kamen zurück zur Rialtobrücke, die zugleich Start und Ziel war, temperamentvoll angefeuert von den Kindern und Erwachsenen an den Ufern. Ich blickte mich um und sah nur ganz wenige Touristen unter den Zuschauern, wahrscheinlich waren weder Jahreszeit noch Wetter attraktiv genug. Die Venezianer blieben heute also überwiegend unter sich; viele schienen sich zu kennen, es herrschte eine fast familiäre Stimmung. Die ersten Boote kamen bereits nach kurzer Zeit wieder in Sicht, bald darauf wurden die drei Sieger aufgerufen und mit viel Applaus und Musik gefeiert.
Ich verließ meinen Platz am Kanalufer und machte mich auf den Weg zum Markusplatz. Dabei versuchte ich, mich auf dem kürzesten Weg durch das Labyrinth der kleinen Gassen zu schlängeln ohne die Orientierung zu verlieren, kein ganz leichtes, aber ein höchst reizvolles Vorhaben in der Altstadt von Venedig. Es ist immer wieder spannend und keineswegs gewiss, dass man dort ankommt, wo man hinwollte. Am liebsten mochte ich es, mich ziellos durch die Gassen treiben und überraschen zu lassen. Das war jedes Mal so, als würde ich mich in den Eingeweiden der Stadt herumtreiben, von ihr verschluckt und verstoffwechselt, um dann betört und bezaubert irgendwo wieder ausgespien zu werden. Auf diese Weise hatte ich Venedig immer weiter kennen- und lieben gelernt.
An diesem Tag jedoch hatte ich den Markusplatz im Sinn und gelangte ziemlich schnell an mein Ziel. Auch hier auf der großen Piazza war es heute nicht besonders voll. Der Touristenanteil war ein wenig höher als bei der Regatta, aber im Vergleich zu den wärmeren Monaten geradezu lächerlich gering. Kurz vor der vollen Stunde bildeten sich kleine Zuschauergruppen vor dem Uhrenturm. Darunter entdeckte ich ganz hinten auch Christopher, der fotografierte, und weiter vorn noch einige andere Schüler aus dem Istituto, eine sehr muntere Clique, die mir schon während der Pausen aufgefallen war, allesamt sehr jung an Jahren, jedoch weit fortgeschritten in der italienischen Sprache. Ich zog mich in einen Bereich außerhalb ihrer Sichtweite zurück, mir war nicht nach Kontakt zumute, ich fürchtete ihn geradezu, ohne zu wissen warum eigentlich.
Um Schlag zwölf begann das Spektakel. Feierlich kamen zu den Klängen der Marangona, der größten Glocke des Campanile, angeführt von einem Posaunenengel, die drei Könige auf einer Drehscheibe aus dem Turm und zogen langsam einmal im Kreis herum: Wunderschöne alte, reich verzierte große Figuren, die hoheitsvoll grüßten, bevor sie wieder im Dunkel des Uhrenturms verschwanden, langsam einen Arm hebend und wieder senkend. Die Mittagsglocke läutete noch einige Minuten lang, dann war es vorbei, und die Menschentrauben lösten sich auf. Ich stellte plötzlich fest, dass mir kalt war. Ein leichter Nieselregen hatte fast unmerklich eingesetzt. Wohin als Nächstes? Ich erwog kurz das Caffè Florian direkt hier an der Piazza, aber dahin strebten nun auch viele andere, und es würde voll werden. Auf einen Museumsbesuch hatte ich keine Lust, genau genommen auch auf sonst nichts, also lief ich ein wenig unschlüssig durch die Gassen, bis es mir endgültig zu kalt und zu ungemütlich wurde. Mit jedem Schritt wurde ich trübsinniger, es fiel mir einfach nichts mehr ein, außer in mein Zimmer zurückzukehren, wozu es eigentlich viel zu früh war, und in dem ich mich im Übrigen nicht besonders wohlfühlte. Irgendwo kam ich an einem geöffneten Supermarkt vorbei, kaufte mir etwas zu essen und begab mich zur nächsten Vaporetto-Anlegestelle.
*
Victorias Tagebuch
Stefano meinte, es sei an der Zeit, dass ich Italienisch lerne, also „richtig“ lerne, nicht nur solche Redewendungen, wie ich sie aufschnappe, wenn er sich abends in der Bar mit seinen Freunden unterhält. Im Prinzip eine sehr gute Idee. Ich habe noch mindestens vier Wochen Zeit, bis ich wieder nach Savona muss, genauer gesagt bis ich hoffentlich (!!!) wieder nach Savona muss, denn bisher habe ich noch nichts Offizielles gehört …
Ich hätte eigentlich schon längst Italienisch lernen können, keine Ahnung, warum ich bisher nicht auf die Idee gekommen bin … War es mir nicht dringend genug …? Stefano und ich sprechen Englisch miteinander; das ist „unsere“ Sprache, und es funktioniert perfekt.
Was steckt wohl hinter seinem Vorschlag? Will er mir damit etwas sagen? Dass ich meine freie Zeit hier besser und vor allem sinnvoll nutzen sollte? Oder dass es wichtig für mich ist, Italienisch zu können, weil ich möglicherweise für immer hierbleiben werde? Werden wir heiraten, und ich bin dann Italienerin? Ist es das, was Stefano will? Und will ich es? Ist er „der Richtige“? Drei Jahre kennen wir uns jetzt. Ich werde nie vergessen, wie das Schiff damals ganz langsam durch den Giudecca-Kanal fuhr, und ich zum ersten Mal das abendliche Venedig erblickte. Ein Traum! Und dann der Landgang spätabends mit noch zwei anderen Mädels aus der Crew! Fast menschenleere dunkle Gassen, nirgendwo ein Platz zum Einkehren, alles war bereits geschlossen. Endlich eine Reihe von helleren Lichtern und ein paar Leute kamen uns entgegen. Einer davon war Stefano. Wir gingen alle zusammen ins Orange, wenn ich mich recht erinnere, auf jeden Fall war’s am Campo S. Margherita, da bin ich ganz sicher. So fing es an. Und heute frage ich mich, ob wir an einem entscheidenden Punkt angekommen sind. Ist er „der Richtige“? Meine ich wirklich ihn oder meine ich den Sohn Venedigs? Oder beide? Wäre es dasselbe gewesen, wenn er von woanders käme – zum Beispiel aus Mailand?
Jedenfalls habe ich mich jetzt an einer Sprachschule angemeldet, schaden kann es nicht. Der Unterricht hatte bereits am Vortag begonnen, aber ich war nicht die einzige Nachzüglerin, erstaunlicherweise auch nicht die einzige Russin. Es gab noch eine, die am gleichen Tag einstieg, und sie heißt ebenfalls Victoria. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir viel miteinander zu tun haben werden; diese Victoria verhält sich mir gegenüber geradezu abweisend. Und sie ist auch nicht mein Fall. Also allenfalls jemand, mit dem ich mal ein paar Worte Russisch wechseln könnte. Besser wäre sowieso, wenn ich mehr Italienisch spräche … siehe oben.
Ansonsten ist die Klasse sehr gemischt, Nationalitäten rund um den Globus, ähnlich wie manchmal die Crew auf einem großen Schiff. Viele Asiaten, ein paar Amerikaner und dann noch zwei Deutsche und ein Franzose. Ich sitze neben einem älteren Amerikaner namens Christopher, der mich recht freundlich begrüßt hat. In jungen Jahren muss er ziemlich gut ausgesehen haben, jetzt finde ich sein Gesicht etwas verknittert. Für einen Amerikaner ist er ungewöhnlich gut angezogen, er hat zweifellos Stil. Die anderen Leute in der Klasse sind alle jung, ich bin schon unter den älteren, abgesehen von zwei deutschen Frauen über fünfzig und besagtem Amerikaner.
Weil wir Russinnen beide Victoria heißen hat ein Schüler vorgeschlagen, uns „Victoria grande“ und „Victoria piccola“ zu nennen und alle waren dafür. Ich finde eigentlich nicht, dass ich besonders groß bin, aber die andere Victoria ist tatsächlich ziemlich klein (sogar noch mit ihren hohen Absätzen) und die Namensgebung finde ich ganz lustig. Stefano wird mich bestimmt damit aufziehen, wenn ich ihm davon erzähle, „Victoria grande“, der große Sieg, wie cool ist das denn bitte?
*
Es folgten trübe Tage. Der Nebel hatte die Stadt und mein Gemüt fest im Griff. An sich gehört Nebel mit zu den schönsten Erscheinungen in Venedig: Er verhüllt die alten Paläste mit zarten, transparenten Gazeschleiern, wie sie vornehme Damen einst an ihren Hüten trugen und füllt die Gassen mit weißer Watte. Den Kanälen verleiht er einen geheimnisvollen Zauber, wenn er sich wie zu einer Liebkosung auf die Wasseroberfläche legt. Man denkt, von diesem Anblick könne man nie genug kriegen. Aber man kann.
Nach einigen Tagen fand ich den Nebel nur noch grau und bedrückend. Zu gern hätte ich mal wieder die Wintersonne und einen klaren blauen Himmel gesehen, doch der morgendliche Blick aus meinem Fenster zeigte immer nur den Klostergarten im Nebel und dahinter weitere Nebelschwaden, welche die Lagune vor meinen Augen verbargen. An der Anlegestelle am Giudecca-Kanal konnte man das gegenüberliegende Ufer überhaupt nicht mehr sehen. Die Vaporetti verkehrten nur noch in einem eingeschränkten Notfahrplan mit der Hauptinsel, was ungewohnt lange Wartezeiten zur Folge hatte, sodass ich morgens früher aus dem Haus musste und nach der Schule später zurückkam. Einmal stießen wir auf der Linie 2 beinahe mit einer großen Fähre zusammen, die wie eine Wand vor uns aus dem Nebel auftauchte und hupte. Hatte das Radar versagt? Nach diesem Vorfall war mein Vertrauen in die Verkehrssicherheit auf den Wasserstraßen jedenfalls leicht gestört …
Außer mit Sabine hatte ich mich noch nie mit jemanden außerhalb des Unterrichts getroffen, und mit ihr auch nur gelegentlich mittags im Rosso. Was sie zu anderen Tageszeiten machte, wusste ich nicht, nur, dass sie in einer sehr luxuriösen, sündhaft teuren Ferienwohnung irgendwo im Sestiere San Marco wohnte und sich ab und zu mal mit ihrer Vermieterin traf, die ebenfalls aus Deutschland kam. Sie hatte mir gegenüber eine Andeutung gemacht, die auf eine Ehekrise schließen ließ. Der Grundton unserer mittäglichen Gespräche war jedoch eher ein unverbindlicher; persönliche Themen berührten wir nie.
Mit den anderen Schülern plauderte ich manchmal ein wenig in der Kaffeepause, wenn es sich so ergab. Von mir aus suchte ich den Kontakt nicht. Die Amerikaner waren mir allesamt nicht sonderlich sympathisch, und mit den Japanern oder dem Chinesen konnte ich mich nicht unterhalten, weil sie kein Englisch und wir alle noch kein Italienisch sprachen. Nicolas, mein charmanter Sitznachbar vom ersten Schultag, schien nur noch wie ein Phantom durch die Schule zu geistern. Wie ich hörte, kannte er nach kürzester Zeit alle, wirklich alle Schüler im Istituto und führte ein sehr geselliges Leben. Im Unterricht sah ich ihn allerdings in der ganzen ersten Woche nicht mehr. Einmal begegneten wir uns mittags, als ich an der Anlegestelle auf das Vaporetto wartete. Er lud mich spontan für den späteren Abend zum Essen in ein ziemlich edles Restaurant ein, wo er mit Christopher verabredet war. Ich schützte eine andere Verabredung vor und lehnte höflich ab; mir war nicht nach vornehmen Restaurants zumute, ich war müde, und die Aussicht auf einen Abend in Christophers Gesellschaft schien mir auch nicht gerade reizvoll. Nicolas fragte mich danach nicht mehr.
So kam die Einsamkeit über mich. Lange Spaziergänge im Nebel und Nieselregen mögen romantisch aussehen, fühlten sich aber mit der Zeit zunehmend deprimierend an. Immer schon hatte ich Venedig einmal leer und ohne Touristen erleben wollen, doch nun kam es mir so trostlos vor. Viele Restaurants hatten Betriebsferien und waren mit Eisengittern oder schäbig aussehenden alten Holzläden verrammelt. Es ist eine venezianische Besonderheit, dass geschlossene Läden oder Lokale immer so heruntergekommen aussehen, als seien sie vor Jahren verlassen worden. Wenn sie dann am anderen Morgen öffnen, überraschen sie einen mit einem hellen und adretten Anblick. Überhaupt sieht die Mehrzahl der Häuser aus, als seien sie nicht mehr bewohnbar, der Putz bröckelt, Drähte hängen an den Wänden herunter … Die Innenhöfe und auch die Hausflure wirken häufig desolat. Die jeweiligen Klingelvorrichtungen, Fußmatten und Wohnungstüren sind im Gegensatz dazu meist neu und lassen hoffen. Betritt man dann die eigentliche Wohnung, findet man sie fast immer rundum saniert, geschmackvoll eingerichtet, warm und freundlich vor.
Auf meinen Nebelspaziergängen sah ich einstweilen nur das düstere Stadtbild. Vielleicht lag es auch an mir. Ich fühlte mich sehr einsam. Bei gelegentlichen Skype-Gesprächen mit Martin erwähnte ich das nicht, sondern berichtete vom Unterricht und von meinen Mitschülern. Diese Einsamkeit war etwas, womit ich allein fertig werden musste. Das war eine zu überwindende Schwelle, sozusagen das Tor zu meiner Auszeit, zu einer gänzlich neuen Erfahrung, die ich gesucht hatte. Hier war ich ein Niemand, eine geschichtslose Frau ohne den üblichen Rahmen und Kontext: keine beruflichen Termine, keine Verpflichtungen, kein Status, kein Ehemann, keine Freunde, kein Zuhause und keine Heimat, nur ich ganz allein, ohne alles. Das warf mich in eine große Leere hinein, die von der Schule und dem Unterricht nicht gefüllt werden konnte. Die Verheißung dahinter war die Ahnung einer ebenso großen Freiheit: Ich, nur auf mich allein reduziert in einer fremden Umgebung. Wie würde das sein? Wer würde ich sein?
Kapitel 2
Der reguläre Unterricht fand von neun bis dreizehn Uhr statt, mit einer Pause von zwanzig vor bis kurz nach elf, bequem ausreichend für einen Kaffee mit Mitschülern gegenüber bei Majer, die Erledigung kleinerer Besorgungen oder einen Bummel über den Campo S. Margherita.
Am Nachmittag konnte man dann als Intensivangebot Einzelstunden buchen oder aber um 15 Uhr an einem freiwilligen Kulturprogramm teilnehmen, letzteres ein kostenloses Angebot, für das man sich spätestens am Vortag in eine Liste eintragen musste, die jeweils zu Wochenbeginn am Schwarzen Brett – gleich neben der Tür zu unserem Klassenzimmer – ausgehängt wurde. Meist bestanden diese Veranstaltungen aus ein- bis zweistündigen Themenspaziergängen durch Venedig, die von Kunsthistorikern und angehenden Fremdenführern angeleitet wurden, z. B. zu den Palladio-Kirchen, zu Musikstätten in Venedig, durch den Stadtteil Castello mit dem berühmten Arsenale und vieles andere mehr. Es gab aber auch Angebote wie Exkursionen nach Padua, Kochen nach venezianischen Rezepten oder Filmvorführungen und Lesungen. All dies fand selbstverständlich in italienischer Sprache statt, was dazu führte, dass sich die Anfänger eher selten anmeldeten.
Auch ich hatte lange gezögert, bevor ich mich ausgerechnet für eine abendliche Dante-Lesung in der Wohnung einer Lehrerin eingetragen hatte. Den Ausschlag gab meine Neugier auf den Veranstaltungsort, denn Luisa, so hieß diese Lehrerin, wohnte im Piano nobile eines sehr alten Palazzo, und ich hatte bis dato noch nie eine venezianische Privatwohnung – geschweige denn in einem alten Palazzo – betreten.
Der angegebene Treffpunkt war ein kleiner Campo im Angesicht der bezaubernden Renaissancekirche Santa Maria dei Miracoli; das war einer meiner Lieblingsplätze in der Stadt und schon mal ein guter Anfang. Weniger erfreulich fand ich den Umstand, dass von den Angemeldeten außer Christopher und mir niemand sonst von den Angemeldeten erschienen war. Ich stöberte in der Auslage einer internationalen Buchhandlung, um ein Gespräch mit ihm zu vermeiden, ohne dabei allzu unhöflich zu wirken. Er studierte das Schaufenster eines Antiquitätenladens.





























