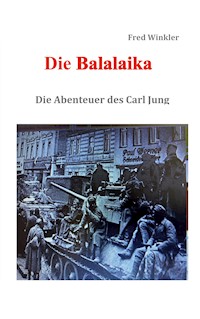
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Carl wächst in einer patriarchalisch geprägten, kinderreichen Familie auf. Er erlebt den Untergang des Nazigegimes und den Neubeginn in der sowjetisch besetzten Zone. Als der Kalte Krieg beginnt, gehen die ideologischen Gräben durch die Familie. Seinem Bruder Heiner gelingt die Flucht nach Westberlin.Vierzehnjährig sprengt Carl die väterlichen Ketten und geht seinen eigenen Weg. Er wird Student einer Eliteschule der Partei. Seine sozialistischen Ideale stoßen auf Widerspruch der Parteiführung. Ihm gelingt die Flucht nach Westberlin. Als sein Freund bei einer friedlichen Demonstration erschossen wird, stirbt sein Glaube an die Demokratie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 702
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Prolog
Das Schreiben wird mir täglich mehr zur Qual.
Nach wenigen Minuten verkrampfen sich meine Finger zu einer schmerzhaften Pfötchen-Stellung, die mir das Schreiben auf der Tastatur unmöglich macht. Ich versuche es abwechselnd mit dem Ein-Finger-Suchsystem.
Verzweifelt muss ich auch hier nach wenigen Minuten die Waffen strecken und längere Pausen einlegen.
Ich schlucke schachtelweise Magnesium-Tabletten, um die Krämpfe in den Fingern zu lindern.
Eine heimtückische Krankheit scheint die Oberhand gewonnen zu haben. Aufgeben? Nein! Ich darf noch nicht die Flinte ins Korn werfen.
Drei schwere Monate liegen hinter mir; drei Monate der Entbehrungen, Schlaflosigkeit und Schmerzen. Drei Monate habe ich der Krankheit widerstanden. Meine Kräfte schwinden; immer öfter liege ich apathisch im Bett. Die Gedanken fliehen.
Meinen Schreibtisch musste ich verlassen. Ich habe ihn gegen einen Klapptisch über dem Pflegebett eingetauscht. Den antiken Schreibtisch soll einmal meine Enkeltochter nutzen können. Viele Stunden haben wir gemeinsam an ihm zugebracht: gemalt, fabuliert und Geschichten geschrieben.
Vor langer Zeit habe ich ihn aus einem Antikladen erstanden, der Krempel und Kunstgegenstände jeder Art aufkaufte.
Ein Händler, der Ehemann meiner Arbeitskollegin, der dort angestellt war, beschaffte ihn mir. Damals wusste ich noch nicht, dass er zu Schalck-Golodkowskis Mannschaft gehörte.
Der Schreibtisch hatte einen Makel: Ihm fehlte ein Schloss an einer Schranktür. Vielleicht war das der glückliche Umstand, dass er im Lande blieb, Schalck-Golodkowski kein Interesse an ihm hatte.
Ein Schreibtisch mit einem defekten Schließfach? Nein! Das wollte ich „Minze“, wie sich meine Enkeltochter blumig nannte, als sie ihren Rufnamen noch nicht aussprechen konnte, doch nicht zumuten.
Leider waren Schlösser dieser Bauart nicht mehr im Handel zu bekommen.
Ich griff zur Selbsthilfe. Zunächst baute ich das spiegelverkehrte, aber funktionstüchtige Schloss der anderen Schranktür aus und zerlegte es in seine vielen Einzelteile.
Ich prüfte ihre unterschiedlichen Materialien, fertigte maßstabsgetreue spiegelbildliche Zeichnungen von ihnen an.
Der erste Schritt war getan!
Meine Kräfte schwanden rasant. Immer öfter musste ich Pausen einlegen. Es wurde ein erbarmungsloser Wettlauf mit der Zeit, als ich die Diagnose meiner Krankheit schwarz auf weiß akzeptieren musste.
Für die Herstellung des Schlosses benötigte ich verschiedene Materialien und Werkzeuge. Denn es war ein kompliziertes Schloss.
Meine handwerklichen Fähigkeiten überschätzte ich durchaus nicht. Was man einmal gelernt hat, vergisst man nicht, wenn man auch einige Abstriche an der ursprünglichen Perfektion machen muss.
Das Haus konnte ich nicht mehr verlassen. Ich musste den Online-Shop nutzen. Die Paketzusteller hatten Hochkonjunktur. Ulrike verzweifelte, wenn sie im Baumarkt vor Schraubenregalen stand und die richtige Wahl treffen sollte.
Mein Klapptisch über dem Pflegebett wurde zur Werkbank!
Es gelang! Nach dreimonatiger zäher Arbeit konnte ich das Schloss in die Schreibtischtür einbauen.
Ein Ei glich dem anderen – nur spiegelverkehrt! Und es funktionierte!
Es war ein wertvolles Schloss geworden. Nicht, dass ich Edelmetalle dafür verwendet hätte!
Die vielen Einzelteile hatten ihren Preis!
Würde mein Schreibtisch ein würdiger Ersatz für meinen Weggang sein?
Zweifel kamen in mir auf.
Wäre es nicht sinnvoller, Minze eine ideelle Erinnerung zu hinterlassen? Etwas Niedergeschriebenes, was sie Schwarz auf Weiß besäße, das sie in ihrem Inneren verwahren könnte?
Wird die mir verbleibende Frist dafür ausreichen?
Wie ein offenes Buch lag er vor mir – der Roman. In einem halbschlafähnlichen Dämmerzustand entstand sein Konzept. Ich brauchte ihn nur noch aufzuschreiben!
Werde ich morgen noch die Kraft dazu haben? Vor mir lag ein steiniger Weg, gepflastert mit Schmerzen und Tränen, der unweigerlich in den Tod führte.
Zermarternden Tagen und Nächten der Chemotherapie in der Klinik folgten kurze Erholungsphasen am heimischen Herd.
Auch die wenigen Stunden, die ich zu Hause verbrachte, hing ich am Tropf, musste über einen intravenösen Port zusätzlich Kalorien erhalten, da die Energiereserven im Körper restlos aufgebraucht waren. Der Tod, das unvermeidliche Ende von allem, trat mir zum ersten Male mit unverhüllter Nacktheit vor Augen. Er hauste bereits mit roher Gewalt in meinem Körper.
Schon beim Anblick der Krankenhauskost sträubte sich das Fell, drehte sich der Magen um dreihundertsechzig Grad; ich war unfähig, auch nur einen Löffel oder Bissen aufzunehmen.
Mein Kampfgewicht war auf jämmerliche fünfzig Kilogramm zusammengeschmolzen.
Am Ende fehlte mir die Kraft zum Schreiben. Meine Finger verkrampften sich zur Schwurhand, unfähig, auch nur ein Jota aufs Papier zu kritzeln. „Ich will das noch schaffen!“, hämmerte ich mir immer wieder ein.
In ungezählten schlaflosen Nächten diktierte ich der Nachtschwester den Roman „Die Abenteuer des Carl Jung“. Carli’s Weg habe ich viele Jahre mit großer Anteilnahme verfolgen können. Der Nachwelt möchte ich seine bemerkenswerte, nicht alltägliche Geschichte nicht vorenthalten. Mein Ziel war es, den Weg aufzuzeichnen, den Carl Jung als Einzelgänger bis zu seinem bitteren Ende gegangen ist.
Geduldig hat die Krankenschwester mir zugehört, meine nächtlichen Launen ertragen.
Ich bin ihr zu größtem Dank verpflichtet.
Sie bat mich, ihren Namen nicht zu nennen, da sie fürchtete von ihrem Arbeitgeber wegen Dienstpflichtverletzungen gemaßregelt zu werden.
1
Carli war ein schwächliches, unterernährtes, aber sehr lebhaftes Kriegskind – immer zu neuen Streichen aufgelegt –, das ständig an den Ohren litt.
Als Carli drei Jahre alt war, verschwand seine knielange Hose samt „großem Glück“ im Plumpsklo. Mutter bekam einen mächtigen Schreck, als er ohne Hose dastand; denn er besaß nur diese eine! Am Abend musste Eddy, der Älteste der Familie, sie mit einer langen Stange aus der Fäkaliengrube fischen.
Mutter unterzog sie mehreren Waschgängen. Am nächsten Tag bekam er sie blütenweiß zurück. Aber sie hatte einen Makel: Ein Hauch nach unverwechselbarem Fäkaliengeruch haftete ihr weiter an. Seine Geschwister machten einen großen Bogen um ihn. Marie, Carli's älteste Schwester, rümpfte die Nase und rief entsetzt:
„Carli, du stinkst!“ und setzte ihn zur Auslüftung an die frische Luft. Vor Carli waren schon sechs Geschwister da.
Die zehnjährige Marie musste Mutter bei der Hausarbeit und Kindererziehung zur Hand gehen. Carli sträubte sich öfter gegen ihre Anordnungen. Er wuchs ohne Taufe und Abendmahl heran.
Vater war ein Abtrünniger. Er verließ die „Lutheraner“, um ein „Ludendorffer“ zu werden, der sich „Bund für Gotteserkenntnis“ nannte.
Carli erblickte im zweiten Kriegsmonat das Licht der Welt. Es war an einem diesig-trüben Montagnachmittag. Der Herbst hatte die Regentschaft übernommen. Der Wind fegte mit scharfem Pfeifen über die Dächer, rüttelte an Fenstern und Türen und pfiff durch sämtliche Ritzen. Mutter hatte versäumt, rechtzeitig die Doppelfenster einzuhängen, was eigentlich Vaters Aufgabe war; aber er kämpfte auf fremder Erde für neuen Lebensraum. Ganz außer Atem betrat die Hebamme die Wohnstube, warf ihr Regencape ab und wischte sich die dicken Tropfen von der Stirn. Die Kinderschar, die ihre stöhnende Mutter auf dem Diwan umlagerte, jagte sie aus der Stube. Nur Marie, die Älteste, durfte bleiben und musste ihr zur Hand gehen. Die Wehen hatten schon vor Stunden eingesetzt, jetzt meldeten sie sich im Minutentakt. Es war höchste Eisenbahn, dass sie kam. Die Fruchtblase war längst gesprungen, der Geburtskanal weit geöffnet. Mutter hatte bis zur letzten Minute ihrer Niederkunft gerackert. Noch am Vormittag lieferte sie mit dem Handwagen Kohlen an Kunden. Beim Entladen der Kohlen platzte plötzlich die Fruchtblase. Carli machte es Mutter leicht. Seine Wiege war ein schlichter Korb, den Vater von den Weiden des Dorfbachs noch vor seiner Einberufung zum Militär geflochten hatte. Carli’s Geburt hat er nicht mehr miterlebt, da er Soldat der
ersten Stunde wurde. Mutter musste allein mit den Kindern zurechtkommen.
Vater hatte seine bescheidene Mitgift aus der väterlichen Erbschaft in eine Gastwirtschaft gesteckt. Leider war er sein bester Gast, der dem Trinken sehr zusprach. Er jagte das Erbe in kürzester Zeit durch die Kehle. Bald wurde er zahlungsunfähig. Das „Ahnenschlösschen“ kam unter den Hammer. Mittellos bezog die Familie im Oberdorf eine Wohnung, die so winzig war, dass sich jeweils zwei Kinder ein Bett teilen mussten. In den Wintermonaten hatte es durchaus Vorteile. Man wärmte sich gegenseitig. Außerdem wärmte Mutter mit einem kupfernen Wasserkessel oder angewärmten Ziegelstein die Betten vor. Denn in den Kammern war es manchmal nachts so kalt, dass das Wasser über Nacht in den Gefäßen zu Eis erstarrte und sich dicke Eisblumen an den Fensterscheiben bildeten.
Noch in Friedenszeiten hatte Vater einen Fuhrbetrieb angemeldet. Seine einzige Investition bestand aus einem Handwagen mittlerer Größe, mit dem er bis zu zehn Zentner transportieren konnte. Der Wagen wurde von Menschenhand gezogen. Wenn ihn Vater überladen hatte – und das kam oft vor –, musste sich Mutter als zweites Zugpferd vor den Wagen spannen.
Als Vater in den Krieg zog, führte Mutter das Geschäft allein weiter. Sie organisierte Umzüge, transportierte Kohlen, Holz und sonstiges bewegliches Gut. Sie hielt die Familie gerade so über Wasser, dass sie nicht verhungerte. Mutter war eine Kämpfernatur. Auf einen grünen Zweig kam sie aber nie. Die Familie lebte sprichwörtlich von der Hand in den Mund. Das erwirtschaftete Einkommen reichte nicht mal für eine zweite Hose für Carli.
Da die Familie sich wieder vergrößerte, es passierte, als Vater Fronturlaub hatte – Carli bekam im eiskalten Wintermonat Januar wieder eine Schwester –, zog sie erneut um. Im Nebenhaus wurde eine Doppelhaushälfte frei. Ein großer Gemüsegarten gehörte zum Haus. Als Vater während eines kurzen Fronturlaubs bei einem Rundgang mit Carli durchs Oberdorf einen Parteigenossen nicht vorschriftsmäßig grüßte, hielt ihm der Bürgermeister eine kräftige Standpauke. Einbuchten konnte er ihn nicht, da er ja für die Eroberung neuer Gebiete im Osten dringend gebraucht wurde. Als Sanitäter musste er aus den Schützengräben Verwundete bergen und ins nächste Lazarett transportieren.
Im Winter spielte sich das Leben der Familie in der großen Wohnküche ab. Geheizt wurde der Raum über einen eisernen Herd, an dem ein Kachelofen mit einem Warmwassertank angebaut war. Nur wenige Scheite Holz genügten, um die eiserne Herdplatte zum Glühen zu bringen. Die abstrahlende Wärme verbreitete sich rasch im Raum. Aber sie hielt nicht lange vor. Im Winter musste zusätzlich ein eiserner Kanonenofen geheizt werden, um eine erträgliche Raumtemperatur zu erreichen.
Sonntags durften die Kinder in Sonntagskleidung – neben der üblichen Alltagskleidung besaß jeder einen Sonntagsanzug – auch den „heiligen Raum“ betreten.
Er wurde die „gute Stube“ genannt. Seine tapezierten Wände – übrigens, es war der einzige tapezierte Raum im Hause – verliehen ihm den Hauch eines mondänen Fürstenzimmers und darüber hinaus eine anheimelnde Wärme.
Carli's Verlangen, hinter die Kulissen zu schauen, war unwiderstehlich. Mit seinen winzigen Fingernägeln arbeitete er sich mit Geschick und Fleiß durch die Tapete, erweiterte das Loch, bis er ein Stück von ihr zu fassen bekam und Streifen von ihr abriss. Zum Vorschein kamen Zeitungen längst vergangener Zeiten, die auf die Wand geklebt worden waren, um eine bessere Haftung der Tapete zu erreichen! Carli's Eifer kannte keine Grenzen. Er arbeitete vollständige Zeitungskolumnen heraus. Sein Interesse war ungebrochen. Es war sein erster Kontakt mit den unbekannten Schriftzeichen! Zeile für Zeile suchte er zu entziffern. Als Mutter den Schaden besah, hängte sie kurzerhand ein Bild davor. Eddy musste die abgetrennten Tapetenstreifen notdürftig wieder ankleben.
In der Sonntagsstube waren die „guten Möbel“ aufgestellt: ein Vertiko, ein kleiner Schreibtisch, in der Mitte ein Ausziehtisch mit Stühlen, eine Chaiselongue, eine Kommode und ein mechanisches Grammofon. An der Wand hing ein großes gerahmtes Ölgemälde, das einen kapitalen Hirsch – einen ausgewachsenen Mehrender – in Brunstpose zeigte und noch ein kleiner „Canaletto“, ein Bild der berühmten Silhouette des barocken Dresden.
Das Grammofon mit den gewichtigen Keramikplatten war stets dicht umlagert. Jeder wollte seine Lieblingsplatte auflegen. Mit einer Handkurbel wurde es aufgezogen. Nachdem ein eiserner Groschen in den Schlitz gesteckt wurde, begann sich die Scheibe zu drehen, und der schwere Schallkopf senkte sich automatisch auf die erste Rille der Platte. War die Stahlnadel abgenutzt, spuckte der Lautsprecher nur noch ein Gemenge kratzender Geräusche aus. Carli bevorzugte eine Platte von Imperial: „An der Ecke steht ein Schneemann“. Wenn der Streit eskalierte, mischte sich schließlich genervt Mutter ein und nahm die Aufzugskurbel an sich.
Im Obergeschoss waren drei Schlafkammern eingerichtet. Carli schlief in einem eisernen Gitterbett zusammen im Raum mit den zwei größeren Schwestern. Im elterlichen Schlafzimmer stand außer dem Ehebett ein fahrbarer, mit Tuch bezogener Weidenkorb für das Murkel, das im kalten Monat Januar des siebten Kriegsjahres zur Welt gekommen war, und ein Bett für zwei Schwestern. Alle Kinder schliefen auf Strohsäcken, nur die Eltern auf richtigen Federstahlmatratzen. Carli’s drei ältere Brüder teilten sich eine Schlafkammer.
Das Waschhaus war auch Badezimmer der Familie. Einmal in der Woche wurde im großen Waschkessel Wasser für das Familienbad erwärmt. Eine große Zinkwanne diente als Badebecken. Sie wurde nur zu einem Drittel gefüllt. Schließlich musste das Wasser für alle reichen. Die Reihenfolge war vorgeschrieben: Zuerst badeten die Jüngsten. Waren die älteren Schwestern an der Reihe, verhüllten sie das Waschhausfenster mit Decken, um neugierigen Blicken ihrer Brüder zu entgehen. Die kleinen Unterschiede waren nämlich in der Familie ein Tabuthema. Auch an den heißesten Sommertagen galt eine Kleiderordnung: Ein Lendenschurz war ein Muss!
Eines Tages bekam die Familie Zuwachs. Ein Mädchen vom „Bund Deutscher Mädchen“ – BDM – sollte Mutter in den schweren Zeiten unterstützen.
„Lorchen“ mochte kaum älter als 20 Jahre gewesen sein. Sie war sportlich durchtrainiert, sicher ein Ergebnis regelmäßiger Leibesübungen. Sie hatte ihre langen gescheitelten strohblonden Haare seitlich zu zwei Zöpfen geflochten. Einige Titusfransen hingen verstohlen über ihrer hohen Stirn. Wenn sie morgens die Wohnküche betrat, galt ihr erster Blick dem Führer an der Wand. Sie achtete streng darauf, dass er nicht in Schieflage geriet. Mit Argusaugen überwachte sie auch die allgemeine Beflaggung zu des Führers Ehrentag oder anderer staatlich verordneter Feiertage. Säumige Bürger trug sie in ihr kleines Notizbuch ein, das sie stets bei sich trug. Lorchen war immer gut gelaunt. Die blauen Augen strahlten über einer kleinen Stupsnase wie die aufgehende Sonne. Für Carli brachen goldene Zeiten an. Seine Schuhe waren am Morgen geputzt, seine Strümpfe brauchte er nicht mehr selbst zu stopfen. Kurz, Lorchen war das Heinzelmännchen der Familie.
Wenn sie ihre Arbeit, die sie scheinbar spielerisch verrichtete, beendet hatte, widmete sie sich den Kindern. Übermütig tanzten sie ihr auf dem Kopf herum. Ihre Ausgelassenheit lenkte sie ganz unauffällig gezielt in geordnete braune Bahnen.
Die Zeit vertrieben sie sich mit Gesellschaftsspielen: „Mensch ärgere Dich nicht“, „Schraps hat den Hut verloren“, „Mein rechter rechter Platz ist leer“, „Vier Ecken raten“ und vieles mehr. Dazu sangen sie Volkslieder, sicherlich auch solche vom BDM verordnete. Als der Tag zur Neige ging, verabschiedeten die Kinder Lorchen mit „Laurentia“. Einmal versuchte sie es mit einem Kanon: „O wie wohl ist mir am Abend …“. Carli fühlte sich überfordert. Er bekam von seinen Schwestern so manchen Rüffel, wenn sein Einsatz zu spät kam.
Mutter konnte sich jetzt intensiver ihrem Fuhrbetrieb widmen. Mit dem Handwagen war sie öfter unterwegs. Sie schuftete wie ein Pferd, um die Familie über Wasser zu halten. Ihr Hunger war unstillbar. Lorchen hatte die Hausarbeit im Griff: machte die Betten, wusch das Geschirr, scheuerte die Dielen, bereitete das Mittagessen zu, besserte die zerschlissene Kleidung aus und hielt Eddys Uniform in Ordnung.
Allmählich trübte sich in der Familie und im Dorf die Stimmung. Carli sah immer öfter Frauen mit schwarzen Kopftüchern und schwarzen Armbinden.
Männer vom Luftschutz ordneten an, dass an den Fenstern schwarze Rollos angebracht wurden. Sie inspizierten den Luftschutzkeller, Wasser und Sand musste zum Löschen herangeschafft werden. Für jedes Kind wurde ein Not-Paket geschnürt, das in einer Truhe auf dem Treppenaufgang aufbewahrt wurde. Bei Fliegeralarm musste jeder sein verschnürtes Päckchen mit in den Keller nehmen. Eines Nachts war es soweit. Sirenen heulten auf. Fliegeralarm zu mitternächtlicher Stunde zwang die Familie in den Luftschutzkeller zu gehen. Mutter zündete eine Kerze an. Eine Holzbank diente als Sitzgelegenheit. Eine knisternde, spannungsgeladene Atmosphäre verbreitete sich im Keller. Ängstlich hockten sie auf der Bank, wagten kaum zu atmen. Die größeren Geschwister durchbrachen schließlich die gespenstische Stille. Die Wartezeit auf die erlösende Entwarnung schien unendlich lang. Nach zwei Stunden wurde der Alarm endlich aufgehoben. Erleichtert, dass diesmal Carli's Wohnort nicht das Ziel von Bombern war, verließen sie den Luftschutzkeller. Der übermüdete Carli versank sofort in einen traumlosen tiefen Schlaf.
Eines Tages herrschte in Carli's Familie große Aufregung. Eddy bekam von behördlicher Stelle ein offizielles Schreiben. Er wurde zum Volkssturm eingezogen. Dabei hatte er gerade das 15. Lebensjahr vollendet! Seine Lehre als Tischler musste er bei Reinkober unterbrechen. Mutter war sehr traurig. Erst holten sie Vater und jetzt Eddy. Sie sorgte sich sehr um Eddy. Den Weg zu Eddys Lehrwerkstatt kannte Carli genau. Er hat ihn oft zu Fuß oder zuweilen ein Stück mit der Bahn zurückgelegt, meistens sonntags mit Wally. Wenn er mit dem Zug fuhr, war er notorischer Schwarzfahrer. Er machte sich kleiner und jünger als er war, wenn der Schaffner die Fahrkarten kontrollierte. Carli besuchte den Ort nicht wegen der Tischlerwerkstatt, sondern wegen des Kettenfliegers, der einladend vor einer Schenke stand. Sobald es sich Carli auf ihm bequem gemacht hatte, spielte sein Magen verrückt; ihm wurde speiübel. Trotzdem versuchte er es immer wieder. Für einen eisernen Groschen drehte sich der Kettenflieger fünf Minuten. Noch bevor die Tour zu Ende war, entleerte sich sein Magen. Kreidebleich verließ er den Kettenflieger. Seine guten Vorsätze, ihn künftig zu meiden, hielten nicht lange vor. Auch Carli vermisste Eddy sehr, obwohl er ihn häufig neckte. Eddy hasste Zwiebeln wie der Teufel das Weihwasser. Bevor Mutter den Speisen Zwiebeln zusetzte, trennte sie regelmäßig Eddys Portion.
Carli machte es Spaß, Eddys Speise heimlich mit Zwiebeln zu würzen. Dazu sang er wie der Rattenfänger von Hameln:
„Eni, Zweni Zwibbelstiel,
Deine Kinder fressen viel.
Jeden Tag ein Dreipfundbrot.
Morgen sind sie alle tot.“
Das brachte Eddy auf die Palme. Er packte ihn bei den Ohren und drehte sie wie eine Schraube. Carli schrie vor Schmerzen auf. Eddy rang ihm das Versprechen ab, das Spottlied zu unterlassen. Aber kaum, dass er von seinem Opfer abgelassen hatte, stimmte er mit schluchzender Stimme das Lied erneut an:
„Eni, Zweni Zwibbelstiel …“
Sichtlich genervt ließ Eddy von seinem Opfer ab. Er sah wohl ein, dass Carli so nicht beizukommen war.
Der „Volkssturm“ war das letzte Aufgebot. Er bestand überwiegend aus Invaliden und Halbwüchsigen, der den Vormarsch der Russen so lange aufhalten sollte, bis die „Wunderwaffe“ einsatzbereit sei.
Eddy kam in ein Ausbildungslager bei Lauban an der Neiße. In dem Camp sollte der Volkssturm für den Kampfeinsatz fit gemacht werden. Die Neiße war das letzte natürliche Hindernis zur Oberlausitz, das die Russen keineswegs überwinden durften. Die Väter waren ausgezogen, die engen deutschen Grenzen zu sprengen, sich mit neuem Lebensraum vollzufressen.
Davon bekamen sie Verdauungsbeschwerden, spuckten ihn halb wieder aus. Meter um Meter fraß jetzt der Feind den deutschen Boden auf.
Eines Morgens hüllte sich der Himmel in dunkle Wolken. Papierschnipsel und Lametta fielen herab. Die Kinder machten Jagd auf die glänzenden Fäden.
Die Erwachsenen tuschelten hinter vorgehaltener Hand, dass Dresden bombardiert worden sei. Die Russen hätten schon die Neiße überquert. In wenigen Wochen würden sie Carli’s Dorf erreichen, wenn ihr Vormarsch nicht durch die immer wieder angekündigte Wunderwaffe aufgehalten würde. Die Russen wurden als wilde Bestien geschildert, die jeden Deutschen töteten, der in ihre Hände fiele. Also galt es, die Russen im Osten auf jeden Fall aufzuhalten, während im Westen die deutschen Truppen scharenweise vor den anrückenden Amis zurückwichen oder kapitulierten.
Eines Tages verabschiedete sich Lorchen ohne Vorankündigung von Carli und seiner Familie. Sie sagte, dass sie nun in der Stadt dringend gebraucht würde. Carli vergoss bittere Tränen, da er seine Strümpfe wieder selbst stopfen musste. Fast täglich fand sich ein neues Loch oder eine Laufmasche in ihnen, weil er beim Herumklettern hängengeblieben war. Mit einer Schere rundete er das Loch ab, um es über dem Stopfpilz mit geeignetem Garn kunstvoll zu verschließen. Am Ende freute er sich über das gelungene rasterförmige, quadratische Kunstwerk, das nun anstelle des Lochs den Strumpf verzierte. Mutter lehrte ihn, für dünne Strümpfe dünnes und für dicke kräftiges Garn zu verwenden. Mit den Kriegsjahren wurde es immer schwieriger, die passende Wolle aufzutreiben. Der Fußmarsch ins Nachbardorf dauerte über zwei Stunden. Carli wäre lieber zwei Stationen mit der Bimmelbahn gefahren, aber Mutter musste jeden Groschen zweimal umdrehen, bevor sie ihn ausgab. Während sie hartnäckig in der Spinnerei um ein Paar Gramm Wolle feilschte – eigentlich pflegte sie ja gute Kontakte zur Fabrik, denn sie belieferte die Wollspinnerei zeitweise mit Kohlen –, vertrieb sich Carli die Zeit, um im Dorfbach Krebse zu angeln. Die Wollspinnerei musste in Kriegszeiten vorrangig Fallschirmseide spinnen. Die war zum Stopfen seiner Strümpfe gänzlich ungeeignet. Viele Abende strickte Mutter bis in die späte Nacht hinein dicke Wollsocken für die Soldaten an der Ostfront, die sie Vater mitgab, wenn er mal Fronturlaub bekam. Zwischendurch schlief sie auch mal ein, und die Nadeln verloren die Maschen, die sich allmählich wieder in ein Nichts auflösten. Ihre mühevolle Nadelarbeit begann dann von neuem.
Zu den langen Strümpfen gehörte ein Leibchen, an dem die Strumpfhalter befestigt waren. Es schnürte seinen Leib ein und behinderte den Bewegungsdrang. Carli freute sich auf Ostern, weil dann die Winterkleidung in der großen Holztruhe verschwand, die auf dem ersten Treppenabsatz zum Obergeschoss stand. Die langen Strümpfe wurden gegen Kniestrümpfe getauscht. Das Leibchen konnte Carli ablegen. Sonntags versammelte sich die Familie nach dem Frühstück zur Flick- und Putzstunde in der Wohnküche, während andere Familien im Dorf ihren obligatorischen Kirchgang antraten.
Seit Vater abtrünnig geworden war, mied die Familie eine Begegnung mit dem Pfarrer. Die einzige Ausnahme war ein Trauerfall. Starb ein Dorfbewohner, reihte sich auch Mutter regelmäßig in die Prozession zum Friedhof ein. Carli durfte Mutter einige Male begleiten. Die Daheimgebliebenen öffneten ihre Fenster, steckten die Köpfe heraus, wenn der Trauerzug an ihrem Heim vorüberzog, um dem Dahingeschiedenen die letzte Ehre zu erweisen. Die pompöse Prozession glich einem Geisterzug. Mutter war ebenso wie die anderen Trauenden ganz in Schwarz gehüllt. Auch das schwarze Kopftuch fehlte nicht. Der Sarg wurde auf einer schwarzen zweispännigen Kutsche von zwei Rappen gezogen. Ihr schwarzes ledernes Geschirr war frisch gewichst und poliert, seine Messingbeschläge glänzten im Licht, sodass die Augen geblendet wurden. Den Takt an der Spitze des Leichenzuges gab eine Blaskapelle an, die den Leichnam auf dem Wege zum Friedhof mit getragener Trauermusik begleitete. Mutter hatte stets ihr Gesangbuch, das sie zu ihrer Konfirmation geschenkt bekommen hatte, bei einer Beerdigung dabei. Oft wurden dieselben Lieder ein zweites oder drittes Mal angestimmt. Die Angehörigen des Toten opferten ihr letztes Hemd, um ihn angemessen bestatten zu können.
In den Wintermonaten war der Dachboden für die Kinder ein beliebter Aufenthaltsort. Er war mit vielerlei Gerümpel zugestellt; abgewohnte gebrauchte Möbelstücke, abgelegte Spielsachen, aber auch Getreidevorräte wurden gelagert. Die Kinder teilten sich das Terrain mit den Mäusen. Sie ließen sich einfach nicht vertreiben. Zäh behaupteten sie ihren Platz auf dem Boden. Immer wieder mussten in den Jutesäcken Löcher geflickt werden. Ungezählte Male tappten neugierige, unvorsichtige Kleinfinger – und nicht die Mäuse! – in die zahlreich aufgestellten Fallen. Es schmerzte höllisch, wenn die Falle zuschnappte und die Finger gefangen waren. Die Mäuse machten um die Fallen einen großen Bogen. Fleisch oder Röstbrot verschmähten sie. Sie hatten eine Vorliebe für Körner. Mutter geriet außer sich, wenn die Mäuse ein neues Loch in den Sack mit Weizenkorn genagt hatten und die Körner sich wie ein unaufhaltsamer Lavastrom, vermischt mit reichlich Mäusekot, auf die Dielen ergossen. Eine kleine Dampfmaschine mochte Carli besonders gern; ihr glänzender Kupferkessel, der verchromte Pleuel und die winzige Feuerluke mit der schmiedeeisernen Tür waren besondere Anziehungspunkte. Über eine Transmission konnte die Maschine ein Sägewerk in Gang zu setzen. Leider war die Welle gebrochen. Eddy versprach, sie zu reparieren. Jetzt war er aber nicht mehr da. Er sollte ja die Russen aufhalten!
Von der schrägen Dachluke hielt Carli täglich Ausschau nach den Russen. Aus Kisten baute er sich einen Turm, von dem er bequem wie ein Feldherr das Land überschauen konnte.
Carli war sehr neugierig auf die Russen. Er machte sich von ihnen die abenteuerlichsten Vorstellungen. Er wusste nicht wie eine „Bestie“ aussah, von der die Erwachsenen sprachen. Er stellte sie sich als vielarmigen gefräßigen Drachen vor.
Eines Tages kam Felix wie ein Blitz die Bodentreppe heruntergestürzt und schrie: „Die Schule brennt! Meine Schule steht in Flammen!“ Er war sehr aufgeregt. Er ging in der Stadt, aus der die funkelnden Weihnachtssterne kamen, auf eine höhere Schule. Er kannte jedes Haus, jeden Einwohner, jeden Stein.
Carli verstand ihn nicht. Er stürzte auf den Boden zu seinem Turm, um aus dem Fenster zu sehen.
Von Mittag zogen dunkle rauchgeschwängerte Wolken auf, begleitet vom Geruch verbrannten Holzes. In der Ferne loderten vereinzelt Flammen auf.
Später erzählte man sich, dass eine fanatische Gruppe von SS-Leuten die Russen vor den Toren der Brüdergemeine aufhalten wollte. Sie hätte sich auf dem Hutberg vor der Stadt verschanzt. Ein Schuss aus einer T 34-Haubitze habe genügt, um das Widerstandsnest auszuräuchern. Der hölzerne Turm des Hutberges flog davon. Carli hat oft auf der Plattform des Turmes gestanden, um in die Welt zu schauen. Weiter als bis zum Ende des Horizonts sind seine Reisen nie gegangen.
Zu Füßen des Turmes ruhten in einem Lindenhain in riesigen Sarkophagen die Gebeine der Zinzendorfer. Sieben Sarkophage für die Würdigsten der Brüderunität – für die Ordinarien und ihre Gemahlinnen – standen akkurat ausgerichtet im Zentrum des Hains! Den Gebeinen der gemeinen Mitglieder der Unität blieben einfache Grabplatten auf dem umliegenden Gottesacker vorbehalten. Ihre Inschriften waren verwittert; die Zeit hat viele Namen ausgelöscht. Beim kindlichen Spiel boten die Sarkophage ein vortreffliches Versteck. Carli's Vorfahren waren Leibeigene des mächtigen Grafen von Zinzendorf und Pottendorf. Sie wurden nicht danach gefragt, ob sie dem neuen Herrn dienen möchten, als der Graf Liegenschaften und Dorf samt Einwohnern von seiner Großmutter, der Gräfin von Gersdorf, kaufte. Aus Rache trampelte Carli 200 Jahre später dem Grafen auf dem Kopf herum, das heißt auf seiner Grabplatte. Gedankenverloren fuhr er mit den Fingern die Konturen der in Stein gemeißelten Inschriften nach, versuchte das Geheimnis zu erraten, wer unter der Grabplatte lag, das Gebet: „Vater unser …“ dabei x-mal wiederholend. In einer Strafaktion wurde das Städtchen dem Erdboden gleichgemacht. Zinzendorfs Brüdergemeine und die gesamte Innenstadt wurden ein Opfer der Feuerbrunst. Die Grabmäler blieben unversehrt. Wie viele Bürger als Nazis standrechtlich erschossen wurden, darüber schweigt die Chronik. Wie eine vom Sturm gepeitschte, unaufhaltsam vorwärts drängende Feuerwalze überrannten die Russen Niederschlesien und die angrenzende Oberlausitz. Erschüttert stellte Carli fest, dass Eddy die Russen nicht aufhalten konnte; hatte er doch so große Hoffnungen in ihn gesetzt!
Herr Hänsel hatte gesagt, dass aus jedem Haus ein weißes Tuch gehängt werden sollte. Es sei ein Zeichen dafür, dass kein Widerstand geleistet würde. Auch müsste der Führer aus den Wohnungen verschwinden. Mutter verbrannte ihn respektlos im Küchenofen. Das weiße Betttuch wurde an der Luke des Dachfensters befestigt. Carli konnte es von der Straße aus sehen. Ob es die Russen auch sehen würden? Der Geschützdonner näherte sich unaufhaltsam.
Von Stunde an erließ Mutter ein strenges Ausgehverbot. Nur für Heinrich, den Zweitältesten, galt es nicht. Mutter hatte ihn in sämtliche Läden geschickt, um noch essbare Vorräte zu besorgen. Die Kinder durften das Haus nicht mehr verlassen! Für Carli war es mit der Herumtreiberei vorbei. Die verstaubten Straßen waren wie ausgestorben. Nur die in die fest gestampfte Erde geritzten „Huppe-Kästel“ verrieten, dass noch vor kurzem die „Kästel-Hupper“ ihr Würfel-Hüpf-Spiel auf der Dorfstraße ausgefochten hatten.
Mutter ordnete den sofortigen Umzug zu Hänsel an. Hänsels Haus lag nur einen Steinwurf entfernt. Bei Herrn Hänsel glaubte sie sich und ihre Familie sicherer, denn er verstand einige Brocken Russisch. Ein kürzlich zuvor stattgefundenes Gespräch mit einem Prediger der Brüdergemeine bestärkte sie in der Hoffnung, dass gewisse Russischkenntnisse ein Vorteil im Umgang mit den in Kürze zu erwartenden Soldaten der Roten Armee sein könnten. Der Prediger erinnerte Mutter an die Ereignisse vom September 1813, als russische Kosaken das Lehndorf von Zinzendorf heimsuchten. Dem Prediger Hasse, der mehrere Jahre in der Kolonie „Sarepta“ bei Wolgograd beim Aufbau einer Brüdergemeine in Russland mitgewirkt habe, sei es zu verdanken gewesen, dass das Dorf weitgehend von Verwüstungen verschont geblieben war. Seine Sprachkenntnis sei damals segensreich für die ortsansässigen Menschen gewesen, meinte er. Mutter leuchtete ein, dass es ein Vorteil sei, wenn jemand die Sprache seiner Feinde verstehe.
Woher hatte Herr Hänsel seine Russischkenntnisse? Offensichtlich von einem früheren Kontakt mit Kriegsgefangenen! Herr Hänsel wurde nicht zum Militärdienst eingezogen, er war „uk“.
Jeder bekam seine Schlafsachen in die Hand gedrückt. Anna, das Murkel, das im kalten Monat Januar zur Welt gekommen war, wurde in den Kinderwagen gepackt. Entgegen alle Gewohnheiten verschloss Mutter beim Verlassen des Hauses Eingangs- und Kellertür. Die Türen wurden gewöhnlich niemals verschlossen, wenn niemand zu Hause war. Jeder konnte ungehindert rein- und rausgehen. Diebe und Räuber kannte man im Ort nur vom Hörensagen. Die Hasenställe hinter dem Haus wurden mit Säcken zugehängt, um sie vor neugierigen Blicken fernzuhalten.
Carli wurde mit seinen Geschwistern in einer Stube im Obergeschoss untergebracht. Mutter wies alle Kinder an, sich auf den Boden zu legen und zuzudecken. Acht Kinder und Mutter in einem Raum! Im Zimmer herrschte eine gespenstische Stille. Carli verkroch sich ängstlich unter die Bettdecke. Nur seine Nasenspitze lugte hervor.
Gegen Abend – die Sonne war bereits hinter dem Horizont verschwunden – wurde es ungemütlich. Panzerketten rasselten, Motorengeheul schwoll zu einem ohrenbetäubenden Lärm an. Das Stampfen von Militärstiefeln löste ein kleines Erdbeben aus. Schüsse krachten durch die Luft. Die Spannung erreichte ihren Siedepunkt!
Die Bestie war angekommen! Carli verschwand unter seiner Bettdecke. Gewehrkolben donnerten gegen die Haustür! Das war ein unmissverständliches Zeichen für die Bewohner, die Tür sofort zu öffnen!
Als Herr Hänsel die Tür öffnete, wurde er durch Gewehrkolben beiseite gestoßen. Soldaten in fremdländischen Uniformen schossen die Lampe von der Decke. Als Herr Hänsel versuchte, seine Sprachkenntnis an den Mann zu bringen wurde er bedroht und mit dem Gewehrkolben traktiert. Möglicherweise hatte er sich in der Wortwahl vergriffen. Die Russen durchstöberten sämtliche Räume, suchten nach Uhren und Schmuck, rissen Wäsche, Kleider und Geschirr aus den Schränken, trampelten darauf herum. Da sie nicht fündig wurden, kannte ihre Zerstörungswut keine Grenzen. Nachdem das Erdgeschoss verwüstet worden war, wurde das Obergeschoss heimgesucht. Stiefel polterten die Holztreppe herauf. Die Kinder hatten sich vor Angst bei den Händen gefasst, um sich Mut zuzusprechen. Jetzt wurde die Tür zum abgedunkelten Raum aufgerissen. Mutter, die mit ausgebreiteten Armen, wie eine Glucke ihre Küken, ihre Kinder verteidigte, wurde brutal beiseite gestoßen. Mit den Bajonetten hoben die Russen die Schlafdecken der Kinder an. Da sie kein Vergnügungsobjekt im Raum fanden, wurde Mutter aus dem Raum gestoßen. Dann knallten sie die Tür zu.
Mehrere Stunden mochten seit der Heimsuchung verstrichen sein. Keiner sprach in dieser angsterfüllten Atmosphäre ein Wort. Dann endlich erschien Mutter. Sie war aufgelöst, ihre Kleidung zerrissen, ihre Augen blutunterlaufen. Tränen rannen ihr über die Wangen. Als sie sah, dass ihre Kinder unversehrt waren, beruhigte sie sich allmählich. Marie, Carli's älteste Schwester, die die Situation offensichtlich erfasst hatte, umarmte Mutter innig.
Carli hatte nun die Bestien kennengelernt. Sie waren keine vielarmigen Kraken, sondern uniformierte Ungeheuer in Menschengestalt. Ihre Augen flackerten in der Dunkelheit wie glühende Kohlen – wie Irrlichter. Für den Rest der Nacht kehrte Ruhe ein. Am nächsten Morgen sagte Mutter:
„Kinder, wir werden noch heute nach Hause gehen. Schlimmer als letzte Nacht kann es nicht mehr kommen. Herr Hänsel war uns leider kein Schutzengel.“ Mutter inspizierte zunächst mit Heinrich das Grundstück. Die Haustür war aufgebrochen, sie stand sperrangelweit offen. Nur das Schloss war beschädigt. Sie machte sich Vorwürfe, dass sie die Tür abgeschlossen hatte.
Als sie die Wohnung betrat, griff sie sich entsetzt an den Kopf.
Überall Chaos und Unordnung, Berge von Müll und Schmutz türmten sich auf, als hätte hier eine Horde Wandalen genächtigt. Der Küchenschrank war umgestürzt, überall nur Scherben und wieder Scherben – ein schreckliches Durcheinander. Mutter kämpfte mit den Tränen.
Gestohlen wurde nichts aus der Wohnung. Der billige Hausrat lockte auch keine Diebe ins Haus. Der Kellertür fehlte die Türfüllung. Rahmen und Schloss waren intakt. Die Fahrräder waren verschwunden. Nur Mutters Damenrad stand noch am alten Platz. Dafür hatten die Russen keine Verwendung. Mutter benutzte es, um ihren Schrebergarten, der ganz in der Nähe des Stadtbades am Waldrand lag, gut eine Meile von der häuslichen Behausung entfernt, bequem und schnell zu erreichen. Carli begleitete sie oft durch die Felder zum Schrebergarten, um im angrenzenden Waldpark herumzutoben.
Heinrich, der das Haus hinten inspizierte, stellte mit Entsetzen den Verlust der sächsischen Silberriesen fest. Alle Boxen waren leer. Das war ein herber Verlust. Hatten die Hasen doch in den Kriegsjahren die Familie mit Fleisch versorgt.
Carli durchstöberte den Garten. Sein frisch gepflanztes Gemüsebeet war abgeerntet. Am Gartenzaun raschelte es.
„Ein Hase!“, schrie er aus Leibeskräften. Heini eilte herbei. Sämtliche sächsische Riesen wurden eingesammelt. Kein einziger fehlte. Die Russen hatten den Tieren die Freiheit geschenkt, damit sie nicht verhungerten. Mutter war über diese Nachricht sehr erleichtert.
„So, Kinder, jetzt schaffen wir Ordnung!“, sagte sie. Alle packten mit an. Die Dielenbretter der Wohnküche wurden intensiv geschrubbt, die Zimmer gut gelüftet, das noch brauchbare Geschirr eingeräumt. Nach getaner Arbeit setzten sie sich an den Tisch. Mutter bereitete aus den Nahrungsmittelresten eine Mehlsuppe. Die letzten Brotreste wurden verzehrt. An den nächsten Tag dachte im Moment keiner. Der Müller mahlte kein Mehl, und der Bäcker buk kein Brot. Alle Läden waren geschlossen. Die gesamte Infrastruktur lag am Boden. Wer keine Nahrungsmittelvorräte angelegt hatte, musste Hungers sterben.
Auf den Feldern gab es noch nichts zu ernten. Die frische Saat war zum großen Teil vernichtet. Russische Kettenfahrzeuge durchpflügten die Felder, hinterließen schwere Flurschäden.
Nachts krachten erneut schwere Gewehrkolben gegen die Haustür. Carli erwachte aus tiefem Schlaf, rieb sich erschrocken die Augen. Vier bewaffnete russische Soldaten – offensichtlich eine Militärstreife – polterten mit ihren schweren Schaftstiefeln durch die Schlafzimmer, hoben die Bettdecken an:
„Alles Kinder!“, sagte der Natschalnik in gebrochenem Deutsch. Carli bibberte. Vor Angst hatte er sich in die Hose gemacht.
Eines Tages hielt um die Mittagszeit ein Motorrad vor Carli's Haus. Ein Mann in Uniform stieg ab und näherte sich gemächlich dem Eingang. Seine halbhohen schwarz lackierten Stiefel glänzten in der Mittagssonne. Er trug eine Schirmmütze, kein Käppi, wie es die Soldaten üblich trugen. Er sah anders aus als die Russen, die bisher das Haus heimsuchten. Über seiner Schulter hatte er ein Musikinstrument umgehängt. Es war kein Gewehr! Mutter bekam einen mächtigen Schreck, schickte alle außer Carli in die Betten. Glaubte sie doch, die Tragödie würde sich jetzt fortsetzen. Der Russe klopfte an die Küchentür und öffnete sie unaufgefordert. Er trat einen Schritt in die Wohnküche, musterte kurz den Raum, schloss die Tür hinter sich und sagte:
„Guten Tag, ich Freund, heiße Konstantin.“ Er nahm das Instrument von der Schulter und setzte sich auf das Kanapee, das zur Rechten neben der Tür stand. Es war ein Eigenbau von Eddy. Den Rahmen hatte er selbst gezimmert. Eine Matratze aus Haferstroh diente als Sitzfläche. Eine schwere Decke, mit diversen Stickereien verziert, gab ihr den Hauch eines mondänen barocken fürstlichen Möbels. Danach legte er Koppel mit der Pistolentasche neben sich und nahm die Mütze ab. Sein gescheiteltes, kurz geschnittenes, leicht gelocktes schwarzes Haar glänzte. Seine dunkelbraunen Augen unter einem Busch schwarzer Augenbrauen schienen verschmitzt zu lächeln. Er musterte Mutter und Carli eine Zeit lang. Mutter hatte sich rücklings schutzsuchend an den schweren ovalen Eichentisch gelehnt. Carli hing an ihren Beinen, versteckte sich unter ihrem langen dunklen Überrock. Nachdem eine Weile vergangen war, nahm er das Instrument, das einer Geige ähnelte, aber nur drei Saiten und einen dreieckigen Resonanzkörper hatte und spielte getragene Melodien, die nach Sehnsucht klangen. Nachdem er eine halbe Stunde gespielt hatte, kramte er aus seiner Uniformbluse ein Foto hervor.
„Zu Hause meine Frau und zwei Kinder“, sagte er, auf das Bild zeigend. Mutter beruhigte sich allmählich. Erleichtert nahm sie zur Kenntnis, dass Konstantin ein anderer Mensch war, zivilisierte Manieren hatte, nichts von ihr verlangte. Er zeigte mit dem Finger auf Carli und sagte:
„Komm her, Kind! Wie heißt du?“ Mutter antwortete statt seiner:
„Das ist Carl. Er ist fünf Jahre alt.“ Sanft schob sie Carli in Richtung Diwan. Widerstrebend, zentimeterweise, bewegte sich Carli vorwärts. In Reichweite blieb Carli stehen. Konstantin musterte ihn von Kopf bis Fuß. Dann zog er ihn an sich und setzte ihn auf seinen Schoß. Er holte eine Mundharmonika hervor, spielte unbekannte getragene, schwermütige Melodien, die nach Sehnsucht klangen. Vielleicht war es ein Kinderlied. Allmählich löste sich Carli's Scheu vor dem fremden Mann, und er wandte sich seinen goldenen Uniformknöpfen zu. Er betastete jeden sichtbaren Knopf und zählte sie laut der Reihe nach durch: „eins, zwei, drei…“ „Один, два, три“ (Odin, dwa, tri) wiederholte Konstantin. „Odin, dwa, tri“, sprach Carli nach. „Да, правильнo!“, rief Konstantin freudestrahlend. Interessiert beobachtete Konstantin Carli's Spiel. Seine Schulterstücke zierten mehrere goldene Sterne. Beide schienen aneinander Gefallen gefunden zu haben. Sie wechselten sich in den Konversationen ab. Carli plapperte Vokabeln in Russisch nach. Beide schienen voneinander lernen zu wollen. Nach geraumer Zeit stand Konstantin auf, legte sein Koppel samt Pistolentasche an. Aus einer Uniformtasche holte er eine Tafel Schokolade und reichte sie Carli. Mutter nahm sie ihm erst einmal ab, da sie fürchtete, Carli würde sie auf der Stelle mit Heißhunger verschlingen. Zum Abschied strich Konstantin über Carli's semmelblondes halblanges Haar. Er sagte:
„Auf Wiedersehen! До свидания! Ich komme wieder!“ Er nahm seine Schirmmütze und verschwand durch die Tür. Sekunden später heulte der Motor seines Motorrades kurz auf und verlor sich in der Ferne. Mutter war sehr erleichtert und entspannt über Konstantins Verhalten. Als Konstantin gegangen war, krochen Carli's Geschwister neugierig aus ihren Schlupflöchern, bestürmten Mutter und Carli mit tausend Fragen.
Mutter bestand darauf, die Schokolade brüderlich zu teilen. Am nächsten Tag kam Konstantin um die Mittagszeit mit seiner Balalaika wieder. Er brachte einen großen Sack mit, den er auf den Tisch stellte. Mutter packte ihn aus. Die Kinder standen neugierig um den Tisch herum. Heute hatte sie Carli's Geschwister nicht weggeschickt. Ihre Augen wurden immer größer, als begehrte Lebensmittel zum Vorschein kamen: Mehl, Zucker, Kartoffeln, ein großes schwarzes kastenähnliches Brot. Sogar ein Päckchen mit echtem Bohnenkaffee war dabei. Mutter bedankte sich artig. Während sie auspackte, war Konstantin bereits mit Carli beschäftigt. Sie übten sich in Konversationen. Alle russischen Wörter, die Carli im Gedächtnis behalten hatte, schnurrte er herunter. Konstantin hatte seine wahre Freude daran. Schließlich forderte er Carli auf, ein Lied zu singen. Da Carli gern sang, ließ er es sich nicht zweimal sagen: „Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum“, stimmte er mit seiner hohen Sopranstimme an. Konstantin lauschte gespannt. Nachdem die erste Strophe verklungen war, begleitete er Carli auf seiner Balalaika. Anerkennend spendete er Beifall. Konstantin besuchte Carli jetzt regelmäßig. Seine Balalaika begleitete ihn stets, und er vergaß nie, kleine Geschenke auszupacken. Carli konnte sein Kommen kaum erwarten. Wenn Konstantin sich verspätete, lief er aufgeregt wie ein Tiger im Käfig umher. Eines Tages sagte Konstantin zu Carli:
„Du mit mir kommen, Carl!“ Carli war über diesen Vorschlag nicht abgeneigt. Er fühlte sich bei Konstantin geborgen. Nur Mutter war skeptisch. Schließlich gab sie nach, willigte ein. Konstantin setzte Carli auf den Sozius seines Motorrades und startete den Motor mit einem Fußhebel. Schon setzte sich das Vehikel in Bewegung. „Carl, immer an mir festhalten“, sagte er. Da er wegen Carli sehr langsam fuhr, zeichnete das Motorrad Schlangenlinien auf die regennasse Fahrbahn. Schlammspritzer, die das Hinterrad durch seine Zentrifugalkraft kreisförmig nach oben schleuderte, besprengten Carli’s Rücken. Auf Gegenverkehr brauchte er nicht zu achten, kein Fahrzeug begegnete ihnen. Nach einer kurzweiligen Fahrt auf der Dorfstraße erreichten sie das Schloss, vor dem ein russischer Soldat mit einer Kalaschnikow postiert war. Das Tor öffnete sich, Konstantin fuhr in den Hof, stellte sein Fahrzeug ab und hob Carli vom Sozius. Linker Hand stand ein imposantes, mit Schmuckelementen verziertes Gebäude. Zwei dorische Säulen mit aufgesetztem Kapitell begrenzten ein geräumiges Portal, das ins Innere des Schlosses führte. Ein breiter steinerner Treppenaufgang führte zum Obergeschoss. Carli hatte das Gefühl zu schweben. Da die Stufen niedriger als zu Hause waren, hätte er durchaus zwei auf einmal nehmen können. Aber er bezähmte seinen Sturmdrang und blieb folgsam an Konstantins Seite. Eine weit geöffnete zweiflügelige Tür gab den Blick in einen prunkvoll eingerichteten Fürstensaal frei. Ein Kronleuchter mit Hunderten funkelnden Glassteinen spendete warmes Licht. Inmitten des Saales stand ein riesiger längsovaler Tisch, an dem viele reich verzierte gepolsterte Stühle standen. Sie glichen eher Thronsesseln. An den Wänden hingen goldumrahmte große Gemälde, wahrscheinlich Abbilder früherer Schlossherren. Die Decken schmückten allegorische Darstellungen, Fantasiebilder mit Engeln. Konstantin platzierte Carli auf einen Sessel längsseits der Tafel. Leider war Carli dafür noch eine Nummer zu klein. Sein Kinn reichte gerade bis an die Tischkante. Konstantin schaffte Abhilfe. Er befahl einem Diener, also einem Soldaten, ein Podest zu holen, auf das er den Sessel stellte. Jetzt konnte Carli die reich gedeckte Tafel überblicken. Sie war reichlich mit den feinsten Speisen gedeckt. Konstantin forderte Carli auf, kräftig zuzulangen. Er ließ sich das nicht zweimal sagen. Wie ein Hamster stopfte er sich die Backen voll, als müsste er für den Winter vorsorgen. Nach dem Festmahl übermannte ihn der Schlaf. Konstantin bettete ihn auf einen Sessel. Als er aufwachte – Stunden waren inzwischen verstrichen –, bekam er heftiges Heimweh. Konstantin brachte ihn unversehrt nach Hause. Carli's Geschwister platzten vor Neugier. Sie wollten alles wissen. Konstantin hatte die Tafelreste für die Familie eingepackt. Carli's Geschwister stürzten sich auf sie wie ein halb verhungertes Wolfsrudel.
Eddy kehrte Ende Mai vom Volkssturm gesund zurück. Kurze Zeit war er in einem Lager interniert. Zu einem Fronteinsatz kam er nicht mehr, da Waffen und Munition fehlten. Bald wurde er zu den Russen ins Feldlager abkommandiert, um dort Küchenarbeiten zu verrichten. Eine motorisierte Schützen-Division hatte im Wald ihr Feldlager aufgeschlagen. Carli war oft im Lager, er gehörte schon fast zum Inventar. Weißkohl war die Hauptspeise der Russen. Er dampfte in den Gulaschkanonen. Carli bekam seinen Teil davon ab, obwohl er Weißkohl gar nicht mochte. Er klaubte sich die wenigen Kartoffel- und Fleischstückchen akribisch heraus.
Während eines Schlossbesuchs verlangte Konstantin nach Papier und Tinte. Sorgfältig schrieb er den Bogen halb voll. Er versah ihn mit Amtssiegel und Stempel. Noch einmal überflog er das Dokument, löschte vorsichtig die noch feuchte Tinte mit einem Löschblatt. Schließlich reichte er Carli das Papier und sagte:
„Carl, trag das Dokument immer bei dir. Es wird dich vor russischen Soldaten beschützen.“ Carli faltete das Blatt zusammen und steckte es wie befohlen in eine seiner Hosentaschen.
Eines Nachts klopfte es an der Haustür. Mutter bekam einen gewaltigen Schreck. Das war ungewöhnlich. Seit Konstantin in Carli's Familie regelmäßig ein- und ausging, hielten sich russische Soldaten vom Haus fern. Sollte das ungeschriebene Gesetz nicht mehr gelten? Mutter weckte Carli und nahm ihn mit zur Tür. Offenbar war Carli ihr Schutzengel. Vorsichtig öffnete sie die Haustür. Ein fremder Mann in Uniform stand mit geschultertem Gewehr vor ihnen. Als Mutter ihn sah, wich sie vor Schreck oder Überraschung einen Schritt zurück.
„Du?“, brachte sie mühsam heraus. Der fremde Mann musterte Carli.
„Das ist wohl Carl?“, fragte er unsicher. Mutter stammelte leise, kaum hörbar:
„Carli, das ist dein Vater. Du brauchst keine Angst zu haben. Du kannst jetzt wieder schlafen gehen.“
Unsicher schlurfte Carli die Treppen herauf zum Schlafraum. „Das soll mein Vater sein?“, kam er ins Grübeln.
Vater war in den letzten Kriegsmonaten Sanitäter in einem Lazarett in Eilenburg. Weiter als bis zum Sanitätsgefreiten hat er es nicht gebracht. Obwohl der Krieg zu Ende war, Dönitz die bedingungslose Kapitulationsurkunde unterschrieben hatte, wurde das Lazarett nicht aufgelöst. Wo sollten die Verwundeten auch hin? Alles blieb beim Alten. Die meisten Krankenhäuser waren zerstört, die wenigen noch funktionstüchtigen überfüllt.
Es mangelte an Ärzten, Pflegepersonal, Verbandstoffen, Medikamenten und Instrumenten, kurz: an allem.
Die Sanitäter pflegten ihre verwundeten Kameraden in ihrer Uniform aus dem dritten Reich, standen weiter unter dem Befehl ihrer faschistischen Vorgesetzten. Die alten Dienstvorschriften galten weiter!
Vater setzte sich eines Nachts in voller Montur mit geschultertem Gewehr von seiner Truppe ab. Auf Fahnenflucht stand noch immer die Todesstrafe! Nachts marschierte er, tagsüber versteckte er sich in Feldscheunen, um nicht von russischen Patrouillen aufgegriffen und nach Sibirien verschleppt zu werden. Nach einwöchiger abenteuerlicher Flucht kam Vater zu Hause an.
Mutter musste ihm von Konstantin erzählt haben. Immer, wenn Konstantin Carli besuchte, verschwand Vater in Windeseile aus dem Haus. Alles blieb zwischen Carli und Konstantin beim Alten. Für Carli war Konstantin mehr als ein Spielgefährte, er war ihm wie ein Vater. Sein richtiger leiblicher Vater blieb ihm fremd. Mit Konstantin verbrachte er glückliche Stunden.
Die beschauliche Mittagsruhe wurde plötzlich durch heftige Böllerschüsse, die aus der Richtung des Dorfteichs kamen, unterbrochen, die Carli neugierig machten. Er schlüpfte durch ein Loch im Maschendrahtzaun, überquerte den Bahndamm und rannte mit Volldampf über die Wiese zum Weiher. Im Teich standen drei Russen mit freiem Oberkörper, emsig bemüht, auf der Wasseroberfläche treibende leblose Fische mit einem Netz einzusammeln. Ein Vierter warf Flaschen ins Wasser, die kurz danach mit einem dumpfen Knall explodierten. Wasserfontänen spritzten auf. Nach jeder neuen Explosion kamen tote Fische an die Wasseroberfläche. Die Russen fischten den Teich leer. Keiner konnte sie daran hindern, auch Carli nicht, der so gern einen Fisch abbekommen hätte.
Als er genug gesehen hatte, machte er sich auf den Heimweg. Die Russen, die emsig mit dem Fischen beschäftigt waren, hatten ihn nicht bemerkt.
Der Herbst kündigte sich an. Stürmische Windböen fegten bunte Blätter von den Bäumen. Der Wind rüttelte an Türen und Fenstern. Die Doppelfenster wurden vom Boden geholt und eingehängt, um den Wind von den Räumen fernzuhalten. Es war Pilz-Zeit. Aus Angst vor den Russen mieden die Erwachsenen den Wald. Carli war die berühmte Ausnahme. Er kannte den Wald zu gut, um sich in ihm zu verlaufen. Seine zwei Körbe waren schnell gefüllt. Er hatte keine Konkurrenten zu fürchten. Als er sich gerade bückte, um einen besonders geratenen Steinpilz zu schneiden, zappelte er plötzlich wie ein Krebs an der Angel. Er wurde an seinen Hosenträgern gepackt und von fremden Händen in die Lüfte gehoben. Der Fremde fluchte laut auf Russisch. Ein zweiter Russe warf mit seinem Knobelbecher den Pilzkorb um. Carli schrie, so laut er konnte:
„Moi drug est Konstantin!“ Verdutzt über die ihm vertrauten russischen Laute, setzte er Carli auf den weichen Waldboden ab. Carli nutzte die kurze Verwirrung aus, um aus seiner Hosentasche Konstantins Dokument zu ziehen. Als der Soldat es studierte, verformten sich seine Gesichtszüge zu einer steinernen Maske. Sorgfältig faltete er das Dokument zusammen und gab es Carli zurück, murmelte in seinen Bart:
„Iswenitje“ (Entschuldigung). Der andere Russe sammelte hastig die ausgeschütteten Pilze ein. Sie hatten es plötzlich eilig und verschwanden im Dickicht. Konstantins Schreiben musste Zauberkräfte freigesetzt haben. Erst viel später konnte Carli den Inhalt des Schreibens entziffern:
Der Inhaber dieses Dokuments steht unter dem Schutz der sowjetischen Militäradministration. Wer ihm auch nur das geringste Leid zufügt, wird nach den Gesetzen des sowjetischen Militärgerichts bestraft.
Sowjetische Militärkommandantur
Oberst G. Konstantin Jegorow
Carli hat das Schreiben noch viele Jahre aufbewahrt. Beim großen Umzug ging es ihm leider verloren.
Auch in den Folgetagen ernteten Carli und seine Geschwister viele Pilze, so viele, wie nie mehr in ihrem Leben. Sie fuhren mit dem Handwagen in den Wald, um die Pilze einzusammeln.
Zwei große Äsche waren im Nu gefüllt. Mutter hatte Carli eingeschärft, Fächerpilze zu meiden. Also sammelte Carli nur Röhrenpilze.
Die ganze Familie wurde in die Verarbeitung der leicht verderblichen Pilze einbezogen. Die großen wurden in Streifen geschnitten und zum Trocknen an der Luft aufgefädelt, die mittleren zum Sofortverzehr zubereitet, die kleinen Pilze in Gläser eingeweckt. Der Pilzvorrat war erst im Frühjahr aufgebraucht.
Getrocknete Pilze waren quasi in der Küche ständig vorrätig.
Nach der Pilzernte waren die Bucheckern an der Reihe. Die kleinen dreikantigen braunen Samenkörner der Buchen waren auf dem Waldboden schwer zu finden. Sie waren gut getarnt. Kinderaugen waren am besten geeignet, sie aufzuspüren.
Im Jahr der Kapitulation hatten die Buchen reichlich Samen abgeworfen. Im Volksmund nannte man solch ein ertragreiches Jahr: ein Schweinejahr. In der Ölmühle wurde aus den Bucheckern Speiseöl gepresst. Es schmeckte leicht bitter.
Für einen Liter Öl musste sich ein Kinderrücken oft krümmen.
Eines Tages legte Konstantin eine besonders feierliche Stimmung an den Tag. Auf der einen Seite wirkte er aufgeräumt und traurig, auf der anderen jedoch freudig erregt.
Nachdem er sich wie üblich längere Zeit mit Carli unterhalten, Lieder auf seiner Balalaika gespielt hatte, wurde er still, geradezu feierlich.
Nach geraumer Zeit sagte er:
„Der Krieg ist aus. Ich fahre nach Hause zu Frau und Kindern.“
Carli maß dem nicht viel Bedeutung bei, da er die Tragweite seiner Worte nicht verstand.
Konstantin stand auf, machte sich zum Weggehen bereit.
Er strich wie üblich über Carli's semmelblonden Schopf und sagte: „Auf Wiedersehen!“ und gab Mutter zum Abschied die Hand.
Daraufhin verschwand er mit seinem Motorrad. Es sollte ein Abschied für immer werden!
Täglich hielt Carli um die Mittagszeit Ausschau nach Konstantin. Als er nach einer Woche noch immer kein Lebenszeichen von sich gab, machte er sich auf die Suche nach ihm.
Den Weg zum Schloss kannte er zur Genüge. Nach einer einstündigen Wanderung auf der Dorfstraße erreichte er das Schloss.
Das Tor war weit geöffnet. Kein Posten bewachte es. Auch der Schlosshof war wie leergefegt: keine Fahrzeuge, keine Soldaten. Die Pforte zum Schloss war geöffnet, der Treppenaufgang mit Unrat, Müll und zerschlagenem Mobiliar zugestellt.
Der Prunksaal glich einem Trümmerberg. Wertvolle Intarsien waren aus dem Fußboden herausgerissen, offenbar ein Opfer der Heizöfen geworden. Die meisten Wandgemälde fehlten oder waren schwer beschädigt. Der Kristallleuchter, der dem Saal seinen Glanz verlieh, war verschwunden.
„Wer hat das angerichtet?“, fragte sich Carli. Fassungslos starrte er auf den zerstörten Parkettboden Von Konstantin und seiner Balalaika keine Spur. Keiner Menschenseele war er begegnet. Niedergeschlagen machte er sich auf den Heimweg. Am Ortseingang besuchte er seinen Freund, den Schuster Schönberner. Sein Umgebindehaus hatte keinen Keller, nur ein Geschoss, auf das ein mit Schilf gedecktes überhängendes Spitzdach aufgesetzt war. Seine Vorväter haben es gebaut. Die Jahre waren nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Der grüne Teppich aus Wildkräutern, Gräsern und Moosen hatte das Schilfdach durchlässig gemacht. Die Farben der Balken waren verblichen. Das bloße Holz konnte der rauen Natur auf Dauer nicht standhalten, tiefe Risse hatten sich ins Holz gefressen. Carli betrat den niedrigen Hausflur. Linker Hand klopfte er an die Tür, die in die Werkstatt führte. Ohne auf eine Antwort zu warten, trat er ein. Der Meister saß mit dem Rücken zur Tür an seiner Werkbank.
„Guten Tag, Meister!“, begrüßte ihn Carli. Der Meister erkannte ihn sofort an seiner Knabenstimme.
Der Schuster knurrte nur als Antwort. Auf einen Dreifuß hatte er einen Schuh aufgesetzt. Das schwarze Oberleder eines Schaftstiefels bekam gerade eine neue Sohle.
Carli setzte sich auf einen dreibeinigen Schemel direkt neben der Werkbank. Der Meister unterbrach einen Augenblick seine Arbeit.
„Carli, bringst du mir Arbeit? Zeig her deinen Schuh!“ Der Meister besah sich Carli's Schuhe. „Ah, hier fehlt ein Niet. Das erledigen wir gleich. Das Oberleder ist auch nicht mehr der neuste Schrei. Sobald ich das passende für deine Schuhgröße habe, tauschen wir es aus.“ Im Nu hatte der Meister einen passenden Niet aus einem Wandschrank ausgewählt und mit ein paar gezielten Schlägen das Leder an der Holzsohle befestigt.
„Hier hast du deinen Schuh gratis zurück“, sagte der Schuster.
„Danke, Meister! Eigentlich – er holte tief Luft – bin ich nicht nur wegen des kaputten Schuhs zu dir gekommen. Ich wollte mich bei dir ein bisschen ablenken. Ich sehe gern deiner Arbeit zu.“
„Das freut mich, Carl“, schnurrte der Schuster in seinen Bart.
„Minna wird dir eine erfrischende Waldmeisterlimonade zubereiten.“ Der Schuster widmete sich wieder seinem Schaftstiefel. Nachdem er einen Faden durch flüssiges Bienenwachs gezogen hatte, fädelte er ihn in eine Ahle ein. Stich um Stich wurden Oberleder und Sohle durch Matratzennähte vereinigt. Danach überpinselte er die sichtbaren Stiche mit schwarzer Farbe. Ein passender Absatz war schnell gefunden und mit Holznägeln an der Sohle befestigt. Jetzt sah der Stiefel wie neu aus. Zufrieden nickte der Meister.
„Carli, du brauchst keine Angst mehr zu haben. Die Russen haben unsere Gegend verlassen Das Feldlager im Wald wurde geräumt.“ Carli nickte zustimmend. Für ihn war es seit einigen Stunden die bittere Wahrheit.
„Die Kommandantur ist geräumt. Im Schloss haben Wandalen gehaust, Meister.“
„Ja, die Russen waren Schweine“, knurrte der Schuster.
„Meister, das waren nicht die Russen!“, brauste Carli auf. „Als sie noch dort wohnten, herrschte Ordnung. Ich habe Konstantin oft im Schloss besucht.“
„Ach –, was weißt du schon, du Naseweis! Geh mir weg mit deinem Konstantin!“, antwortete Schönberner gereizt, während er den neuen Absatz mit schwarzer Farbe bestrich. Er legte den Pinsel beiseite und begutachtete kopfnickend seine Arbeit. „Der mag ja in Ordnung gewesen sein“, beschwichtigte er nach einer längeren Kunstpause, „aber die Masse der Russen war Barbaren. Die wussten nicht mal, was eine Klosettspülung ist.“
„Klosettspülung? Was ist das, Herr Schönberner?“
„Ach, das ist so eine Wasserspülung in vornehmen Häusern, die den Stuhlgang automatisch aus dem Klosettbecken spült“, entgegnete der Schuster verlegen.
„Aber Meister, dein Klo sieht doch auch nicht anders aus als unser Klo!“, gab Carli zur Antwort.
„Hab ich auch nicht behauptet!“, antwortete er gereizt. Sein Gesicht verfinsterte sich.
„Wie sollen dann alle Russen wissen, dass es Klosettspülungen gibt, wenn wir selber keine haben?“, entgegnete Carli trotzig.
„Du Neunmalkluger, was weißt du schon!“, schrie der Schuster aufgebracht, wütend über den aufsässigen Carli.
Erschrocken zog sich Carli in sein Schneckenhaus zurück.
Er begann zu schluchzen, erste Tränen rollten über seine geröteten Wangen.
„Warum ‘notschst’ du?“, fragte der Schuster verständnislos.
Carli wischte sich mit dem Ärmel die Tränen aus dem Gesicht und rutschte vom Schemel.
„Meister, ich muss jetzt gehen. Mutter weiß nicht, dass ich hier bin. Sie wird sich über mein langes Wegbleiben sorgen“, schluchzte er, einen Grund für seinen schnellen Abgang suchend.
„Auf Wiedersehen!“ Geräuschvoll schlug er die Tür hinter sich zu. Carli konnte sich nicht erklären, warum der Schuster über die Klosettspülung so aufgebracht war.
Die Nachricht vom Abzug der Russen verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Die Dorfstraße belebte sich wieder. Die Kinder nahmen zuerst von ihr Besitz. Autoverkehr mussten sie nicht fürchten. Mit den Russen waren auch die Fahrzeuge auf den Straßen verschwunden. Im Dorf gab es nur einen einzigen Kraftfahrzeughalter.
Die Nachbarinnen krochen aus ihren Schlupfwinkeln, wagten ein erstes Schwätzchen. Mit jedem Tag wurden die braven Bürger mutiger, riskierten immer öfter eine Lippe.
Erst tuschelten sie hinter vorgehaltener Hand, dann zeigten sie unverhohlen mit den Fingern auf junge Frauen, die mit russischen Offizieren eine Verbindung auf Zeit eingegangen waren. Diese Frauen wählten das kleinere Übel, um sich vor Massenvergewaltigungen durch russische Soldaten zu schützen. Bei den Soldaten sprach es sich in Windeseile herum, wenn ein Offizier Quartier bei einer Deutschen bezogen hatte. Das Haus war dann ein striktes Tabu für den gemeinen Soldaten.
Auch Carli's Mutter geriet ins Visier der Klatschmäuler. Als sie davon erfuhr, warf sie wütend ihren Kopf zurück. Ihr kräftiger langer Zopf, nach bäuerlicher Art auf dem Hinterkopf zu einem Kranz gesteckt, hatte sich spontan gelöst. In ihrer Erregung versuchte sie vergebens mit ihren von vielen Hornhautschwielen überwucherten Händen den Zopf zu ordnen. Tränen des Zorns rollten über ihr Gesicht. Carli, der neben ihr stand, bemerkte ihre Erregung:
„Mama, warum weinst du?“
„Ach Carli, wir haben nichts mehr!“, schluchzte sie. „Der ganze Schmuck ist im Kamin verbrannt. Auch mein Ehering ist weg. Das Mutterkreuz! Alles ist weg!“ Mutter hatte ihren Schmuck vor den Russen im Schornstein versteckt. Sie fanden ihn nicht. Sie hatte aber vergessen, ihn vor der Heizperiode aus dem Schornstein zu holen. Jetzt war er wertlos.
Eine regelrechte Hexenjagd auf die vermeintlichen Kollaborateure begann. Dünnhäutige Charaktere zerbrachen daran oder verließen fluchtartig das Dorf, um in der Anonymität unterzutauchen.
Vater übernahm zu Hause wieder das Kommando, als feststand, dass Konstantin nicht wiederkommen würde. Er machte seinen Handwagen einsatzfähig, schmierte die Radlager, damit der Wagen besser rollte, scheuerte das Holz, bis es glänzte. Ein selbst gemaltes Firmenschild brachte er am Wagen an, allerdings mit erheblichen orthografischen Mängeln behaftet. Vater brachte es fertig, in eine Briefseite zwanzig Fehler einzuschmuggeln. Er hoffte auf Aufträge. Im Dorf begann sich das Leben zu normalisieren. Die meisten Männer waren im Krieg geblieben, unter fremder Erde begraben oder in Gefangenschaft geraten.
Als Konstantin noch bei Carli ein- und ausging, hielt sich Vater im Hintergrund, da er den Russen nicht traute. Noch immer wurden Männer im wehrfähigen Alter von der Straße rekrutiert und nach Russland abtransportiert. Aber jetzt zeigte er sein wahres Gesicht. Carli blieb er zeitlebens ein fremder Mann. Carli hatte den Eindruck, dass Vater ihm nicht verzeihen konnte, dass er sich Konstantin an Vaters Stelle wünschte.
Eines Tages setzte er Carli auf einen Küchenstuhl und stahl ihm mit der Haarschneidemaschine seine halblangen leuchtenden, semmelblonden Haare. Sie fielen achtlos zu Boden. Vater trampelte auf ihnen verächtlich herum. Lediglich am Stirn-Haar-Ansatz blieb eine nach hinten gestutzte Bürste stehen. Ganz nach Vaters Ebenbild! Als sich Carli im Spiegel betrachtete, brach er in Tränen aus. Schamröte überzog sein Gesicht. Seinen kahlen Kopf vergrub er tage- und nächtelang unter einer Mütze. Schließlich vergaß er seinen Kummer. Die Zeit heilte alle Wunden.
Kirmes war nah. Vater holte „Weißschwänzchen“ aus dem Stall. Er befahl Carli, seine Ohren festzuhalten. Mit einem Nudelholz versetzte er dem Hasen einen Schlag auf den Kopf. Carli und der Hase zitterten am ganzen Körper. Vor Schreck hatte er Weißschwänzchens Ohren losgelassen. Er war wie betäubt. Seine Hosen waren nass geworden. Mit dem Taschenmesser schnitt Vater Weißschwänzchens Kehle durch. Stoßweise entwich sein Blut aus dem warmen Körper. Mit jedem Herzschlag wurde der Blutstrahl aus der durchtrennten Halsschlagader schwächer, bis er endlich versiegte. Das Blut wurde in einem Gefäß aufgefangen. „Carl, was stehst du unnütz herum! Nimm den Quirl und rühr kräftig!“, schrie Vater. Carli nahm hastig den Quirl, den Vater vom letzten Weihnachtsbaum geschnitzt hatte und begann hektisch zu rühren. Am Quirl sammelte sich ein Blutkuchen an. Das Rühren wurde mit der Zeit für Carli immer beschwerlicher. Sein erlahmender rechter Arm schmerzte ihm. Jetzt versuchte er mit dem linken zu rühren. Das Unglück nahm seinen Lauf. Der Topf fiel um, Weißschwänzchens körperwarmes, dampfendes Blut verteilte sich über die Dielenbretter. Als Vater das Malheur sah, packte er Carli, vor Wut schäumend, am Hosenboden und stürzte mit ihm zwölf Stufen abwärts in das Waschhaus. Dort warf er Carli bäuchlings auf den „Opferstein“, riss ihm die Hose vom Leib. Mit einem Ochsenziemer schlug er auf sein Opfer ein. Die Schläge waren so heftig, dass die Haut aufsprang und sich Rinnsale von Blut auf dem geschundenen Gesäß bildeten. Carli schrie vor Schmerzen laut auf. Mutter hatte seine Schreie in der Küche gehört. Sie stürzte in das Waschhaus und warf sich schützend wie eine Glucke über Carli's Leib.
„Es ist genug!“, schrie sie verzweifelt. Vater hatte sich in einen Blutrausch gesteigert und die Kontrolle über sich verloren. Nun schlug er aus Leibeskräften auf Mutter ein. Als sie sich verzweifelt wehrte, hielt er überrascht inne und verschwand wortlos nach oben. Er setzte das Abhäuten von Weißschwänzchen fort, als sei nichts geschehen. Der Opferstein war ein kniehoher Holzklotz von einer hundertjährigen Buche, auf dem das Feuerholz für den Kessel zubereitet wurde.
Mutter hatte inzwischen das Blut vom Fußboden aufgesammelt. Wochenlang pflegte Mutter Carli's lädierten Hintern. Er konnte weder auf ihm sitzen noch liegen.
Als zur Kirmes der Hasenbraten aufgetischt wurde, verweigerte ihn Carli hartnäckig. Bis heute hat er nie mehr Hasenbraten angerührt. Am liebsten hätte er allen Hasen die Freiheit geschenkt. Vater hätte ihn aber dafür sicher totgeprügelt. Das wollte er doch nicht riskieren. Beim Schlachten der Hasen musste er seinem Vater nicht mehr zur Hand gehen.
Carli's längst vergessenes Ohrenleiden meldete sich über Nacht zurück. Heftig pochende Schmerzen rissen ihn aus dem Tiefschlaf. Er kletterte aus seinem Gitterbett, durchquerte barfuß auf leisen Sohlen das elterliche Schlafzimmer und tastete sich im Dunkeln die Treppen herunter. In der Wohnküche waren unter dem Diwan Ziegelsteine deponiert. Er legte einen Stein auf die Herdplatte, um ihn zu erwärmen. Im Ofen war noch Glut. Zwei Holzscheite legte er nach. Es vergingen nur wenige Minuten, bis die eiserne Platte glühte. Carli bettete sein schmerzendes Ohr auf den warmen Ziegelstein. Nach einer halben Stunde machte es im Ohr „klick“, und es begann zu laufen. Der pochende Schmerz ließ schlagartig nach. Erschöpft schlief Carli auf dem Diwan ein. Mutter fand ihn am Morgen schlafend in der Küche. Nach drei Tagen glaubte er das Ohrenleiden hinter sich zu haben. Der Ausfluss aus dem Ohr versiegte. Es war ein Trugschluss! Nach einem kurzen beschwerdefreien Intervall meldete sich das Leiden mit gesteigerter Heftigkeit zurück. Ein warmer Ziegelstein verschaffte Carli keine Linderung mehr. Er jammerte still vor sich hin. Die Schmerzen raubten ihm den Nachtschlaf. Am Morgen, als Mutter ihn weinend in der Küche fand, hatte Carli hohes Fieber. Mutter sagte:





























