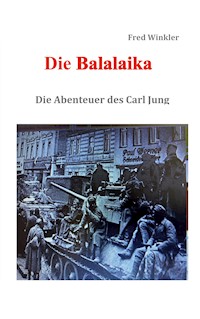Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Carl Jung hat das Krankenhaus am Rande der Stadt aus dem Dornröschenschlaf geweckt, was nicht bei jedem auf Gegenliebe stieß. Konflikte waren unausweichlich. Sein Chef beobachtet mit Misstrauen seine schwindende Reputation unter dem Personal, das für Jung bereit ist, auch durchs Feuer zu gehen. Gestörte zwischenmenschliche Beziehungen unter dem Personal führen zur Tragödie. Als Jung über Nacht zu einem Reservistenlehrgang der Nationalen Volksarmee einberufen wird, setzt er sich zwischen zwei Stühle, da er sich dem Eid des Hippokrates verpflichtet fühlt. Er verzögert den Termin, um einen schwer erkrankten Patienten zu behandeln. Von seinem Kreisarzt wird er später mit einem strengen Verweis gemaßregelt. Die Repressalien gegen Jung nehmen einen dramatischen Verlauf, als er seine Kündigung einreicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
1
Als ich am Montag in der Früh, noch vor Tagesanbruch, die Wohnung überstürzt verließ, verspürte ich ein nie dagewesenes Unbehagen, das mir regelrecht auf den Magen schlug. Noch nie hatte ich mich mit so großer Ungewissheit und böser Vorahnung auf den Weg zur Arbeit begeben wie an diesem trüben, wolkenverhangenen Morgen des 12. Juni. Der stille Beobachter hätte meinen erbärmlichen Gemütszustand direkt von meinem Gesicht ablesen können. Das Wetter war nicht schuld. Nein! Es war die Ungewissheit einer unsicheren Zukunft, die mir bevorstand. Ich hatte Gewissensbisse, machte mir Vorwürfe, weil ich meine Ehefrau darüber im Unklaren gelassen hatte. Warum musste ich den behüteten Schoß der Universitätsklinik verlassen? Warum hatte ich mich für den Weg ins Ungewisse entschieden? Für und Wider für den Wechsel meines Arbeitgebers wog ich mehrere Wochen immer wieder ab, ehe ich mich zu dieser verhängnisvollen Entscheidung durchrang. Als ich meine Ausbildung an der Uni begann, war ich ein Himmelsstürmer. Stetig ging es bergan; ich wurde bereits Stationsarzt, als ich noch keinen Facharzt in der Tasche hatte. Plötzlich kam es zu einem Knick in meiner Karriereleiter. Mein Oberarzt, mein eigentlicher Förderer meiner Karriere, ein international anerkannter Gefäßchirurg, verließ über Nacht seinen Posten. Die Spatzen pfiffen es von den Dächern. Nach einer flüchtigen Romanze mit der Krankenschwester Barbara während einer Brigadefeier explodierte neun Monate später die Bombe. Gleich für zwei Bambini meldete sie unzweifelhafte Vaterschaftsansprüche an. Seine Stelle besetzte ein in der Gefäßchirurgie unerfahrener Kollege, weil er die geforderten gesellschaftlichen Meriten vorzuweisen hatte. Die Partei schickte ihn 2 Jahre nach Sansibar, um dem jungen sozialistischen Staat beim Aufbau eines Gesundheitswesens unter die Arme zu greifen. Nach seiner Rückkehr in den Schoß der Klinik war sein beruflicher Aufstieg beschlossene Sache. Hinzu kam noch das plötzliche Ableben des Klinikchefs, was ihm auch noch zur kommissarischen Leitung der Klinik verhalf.
Gefäßchirurgische Misserfolge häuften sich, die an meinem Nervenkostüm zerrten. Es war die Zeit des Generationswechsels. Ältere Assistenten besetzten diverse freigewordene Chefarztstellen in den umliegenden Provinzkrankenhäusern. Dabei buhlten sie unter den Ausbildungsassistenten um einen willfährigen Adlatus. Ich blieb davon keineswegs verschont. Unter dem neuen Interimschef hatte meine Kaderakte entscheidende Makel aufzuweisen: fehlendes Treuebekenntnis zum sozialistischen Staat und keine abgeschlossene Promotion. Der letzte Punkt war nicht der gravierendste. Er konnte bereinigt werden. Denn ich hatte dafür schon entscheidende Vorarbeiten geleistet.
Warum hatte ich mich für Dr. Kremer, den alle Kollegen abwertend „Pfiffi“ nannten – „Pittiplatsch“ wäre allerdings zutreffender gewesen –, in Schönwalde entschieden? Für und Wider hatte ich mehrfach gegeneinander gewichtet. Wochenlang zögerte ich die Entscheidung hinaus. Steter Tropfen höhlt den Stein. Fast täglich sprach er bei mir vor. Auf seine verlockenden finanziellen Angebote fiel ich schließlich herein. Auf mein Argument eines längeren Arbeitsweges wies er auf die Möglichkeit einer Mitfahrgelegenheit in seinem Dienstwagen hin. Da ein Wohnortwechsel bei ihm in Bälde nicht zur Debatte stünde, könnte ich auf halbem Wege zusteigen. Ein Umzug in den neuen Arbeitsort kam für meine Familie ohnehin nicht infrage, jedenfalls nicht so bald. Wir waren selig, vor einem knappen Jahr einen Glückstreffer gelandet zu haben, nachdem wir uns jahrelang vergeblich um eine Wohnung bemüht hatten. In den beengten Verhältnissen der elterlichen Wohnung kam es zunehmend zu Reibereien. Vor vier Jahren hatte ich mich in die Liste der Wohnungsuchenden bei meiner Betriebswohnungskommission eingeschrieben. Ich blieb in ihr abgeschlagen im unteren Drittel hängen. Stets wurden andere bevorzugt. Eines Tages platzte mir der Kragen. Ich schrieb an den Staatsrat der DDR und drohte mit einem Ausreiseantrag, falls mir in der Wohnungsfrage keine Gerechtigkeit widerführe. Nach 6 Wochen bekam ich Bescheid. – Ich bekam Bescheid! Meine Angelegenheit würde geprüft, hieß es! Innerhalb weniger Wochen bekam ich mehrere Wohnungen angeboten! Die meisten waren in desolatem Zustand und wohl deshalb schwer vermietbar. Schließlich bezogen wir zwei Räume im Erdgeschoss in einer riesigen, verwahrlosten, dreigeschossigen Villa aus der Gründerzeit, im neoklassizistischem Stil erbaut, die die Gestalt eines herrschaftlichen Palais erhielt, unmittelbar neben der ausgebrannten Trinitatis-Kirche, ganz in der Nähe meiner Arbeitsstelle. Das hohe, bogenförmige, zweiflügelige Eingangsportal, flankiert von je drei Fenstern, war von zwei dorischen Säulen umrahmt. Zwei weitere waren auf diese aufgesetzt; zwischen beiden war in Höhe des ersten Stockwerks eine mit einem Ziergitter abgesicherte begehbare Plattform angebracht, ein Söller in Höhe des zweiten Obergeschosses schloss das Säulenensemble ab. Die Villa wirkte dadurch schlanker und eleganter. Der schmale Hausflur war mit einer reichen Decken- und Wandgliederung, sowie mit üppigen Stuckelementen dekoriert. Das verblichene Deckengemälde des hinteren Bereichs des Flures zeigte einen luftigen Himmel. In den Wolken tummelten sich zwei nackte Putten. Die eine hielt Blütenzweige mit Rosen in den Händen, die andere spielte mit einer Taube. Unser Wohnzimmer glich einem Palazzo mit einer hohen, stuckverzierten Zimmerdecke und mit einem Mosaikfußboden aus Parkett. Einen wiederholten Blick nach oben auf die stuckverzierte Zimmerdecke unterließen wir tunlichst, denn wir glaubten durch ein Weitwinkelobjektiv zu blicken, wenn wir einen Blick nach oben riskierten. Mit den weiß getünchten, zweiflügeligen Türen und den hohen Fenstern erinnerte es an ein Gesellschaftszimmer einer untergegangenen Kulturepoche. In einem winzigen Abstellraum, am Ende eines ellenlangen, dunklen Korridors, richtete ich eine Behelfsküche ein, stemmte mit Hammer und Meißel einen Durchbruch durch das meterdicke, gemauerte Kellergewölbe für die Anbindung eines Drainagerohres sowie Wasseranschlusses. Der erste Versuch misslang. Mein Durchbruch landete im Keller eines Hausbewohners, da meine Berechnungen nicht aufgegangen waren. Meine Überredungskünste hielten ihn schließlich davon ab, die Polizei zu rufen. Einer meiner dankbaren Patienten – manus manum lavat – besorgte mir auf dem Schwarzmarkt ein schneeweißes, lasiertes, glänzendes Keramik-Waschbecken, dazu noch erste Wahl! Es war sicher eines von vielen, das später bei der Einrichtung einer Neubauwohnung fehlte. Vulgär ausgedrückt: Es handelte sich unzweifelhaft um Diebesgut. Eines auf legalem Wege zu beschaffen, wäre einem Lottogewinn gleichgekommen. Aber das interessierte mich nicht. Ich fragte nicht nach seiner Herkunft. Von Beginn an betrachteten wir die bezogenen Räume als Interimslösung. Als wir die erste Nacht im neuen Heim verbrachten, wurden wir unsanft aus dem Schlaf gerissen, weil das Bett heftig wie bei einem Erdbeben vibrierte. Ich bekam einen mächtigen Schreck, glaubte ich doch zuerst, der baufällige Turm der Trinitatis-Ruine nebenan sei eingestürzt. Aber es war eine Straßenbahn, die unmittelbar am Haus vorüberraste, so heftig, dass sie in der Linkskurve entgleiste und mit lautem Knall am Laternenmast landete. An viele Geräusche konnte man sich gewöhnen, um sie später zu überhören, aber nicht an diese! Jede Nacht, wenn die letzte Straßenbahn gegen 2:00 Uhr an unserem Schlafzimmer vorüberdonnerte, wurden wir unsanft aus dem Schlaf gerissen. Wir hatten das Gefühl, als sei sie mitten durch das Schlafzimmer gefahren. In den Wintermonaten glich der riesige Raum einem Eispalast. Wenn die nächtliche Kälte bizarre Eisblumen an die Fensterscheiben und funkelnde Eiskristalle an die Wände des Schlafzimmers gemalt hatte, fühlte ich mich in meine Kindheit versetzt. Stundenlang hauchte ich mit meinem Atem winzige Löcher in die Eisgardine, um die Schneekönigen nicht zu verpassen, wenn sie mit ihrem Rentierschlitten unser Haus passieren sollte, um mich von ihr in ihr Reich entführen zu lassen. Im fast bis zur Zimmerdecke hinaufreichenden Fayenceofen, aus lasierten weißen Meißner Kacheln gefertigt, ging die Glut nicht aus. Trotzdem wurden zur Winterszeit im Raum nie mehr als 15°C gemessen. Um nicht in Kältestarre zu verfallen, hüllten wir uns in Pelze. Schon bald löste sich der Gordische Knoten. Die Interimslösung von zirka einjähriger Dauer hatte auch ihre guten Seiten. Entwöhnte sie doch unseres kleinen Pius des Daumenlutschens. Eines Tages klemmte er sich am schweren Eisentor den Lutschdaumen ein. Das Daumenlutschen endete von Stunde an. Eine weitere gute Seite war, dass ich meine Arbeitsstelle bequem zu Fuß erreichen konnte. Nach Dienstschluss schlenderte ich oft über den nahegelegenen, geschichtsträchtigen Trinitatisfriedhof. Da lagen sie friedlich nebeneinander gebettet: Barrikadenkämpfer der Mairevolution 1849 und ihre erbitterten Gegner, aber auch die Gebeine von zahlreichen Künstlern, Literaten, Malern und Bildhauern. Der Friedhof war ein friedlicher Ort. Der dichte Baumbestand verschluckte den Lärm des angrenzenden Straßenverkehrs. Vogelgezwitscher begleitete meinen Rundgang. Zwei Obelisken erinnerten an 76 gefallene Barrikadenkämpfer: „Den Toten der Maikämpfe 1849“. Am Grabstein von Wilhelmine von Bock-Schröder-Devrient, auf dessen Sockel eine Pflanzschale mit frisch gepflanzten Blumen stand, blieb ich längere Zeit stehen und ließ meine Gedanken in ihre Vergangenheit schweifen. Die Mezzosopranistin soll eine bezaubernde Frau von reizendem Äußeren gewesen sein. In der Gemäldegalerie fand sich von ihr ein Ölgemälde, das durchaus diese Vermutung bestätigte. Mit Leib und Seele engagierte sie sich für die Anerkennung der Reichsverfassung von Frankfurt. Damals tobte in den Parlamenten Sachsens ein heftiger Kampf der Befürworter und Gegner der Reichsverfassung. Bei einer Kampfabstimmung der II. Kammer votierten 60% für die Reichsverfassung. Ein Siegesrausch setzte ein. Das gewählte Parlament sei der Souverän, hieß es. König August reagierte mit Entsetzen auf das Abstimmungsergebnis und löste die Kammern kurzerhand auf und erklärte das Abstimmungsergebnis für null und nichtig. Das war der Anlass der Mairevolution von 1849 in Sachsen. „Verrat! Verrat! Verrat!“, schrien die Republikaner, die plötzlich mit leeren Händen dastanden. In der Nacht tobte der Mob. Fensterscheiben gingen zu Bruch, Geschäfte wurden geplündert. Das auf dem Altmarkt ausharrende Volk wartete auf ein Zeichen! Wilhelmine Schröder-Devrient gab dieses Zeichen! Vom Balkon ihrer Wohnung am Altmarkt rief sie das Volk zum aktiven Widerstand, zur Revolution auf: „Gott mit uns! Greift zu den Waffen. Stürmen wir das Zeughaus!“ Eine Woche tobte der Kampf der Aufständischen auf den Barrikaden gegen einen übermächtigen Gegner. Wilhelmine und viele andere konnten dem Gemetzel durch Flucht aus Sachsen entkommen. Unweit von Wilhelmine lag die Grabstätte von Könneritz, königlich-sächsischer Staatsminister. Über die Ermordung von Robert Blum durch die österreichische kaiserliche Soldateska entblödete sich Ludwig von der Pfordten nicht, ein Minister unter der Regierung Könneritz, zu verbreiten, Könneritz habe wenigstens Robert Blums Rock und Stiefel gerettet; sogar einen Stein auf sein Grab bezahle man. Auf meinem Weg von der Uni musste ich auch an Caspar David Friedrichs Grab vorüber. Wer kennt sie nicht, seine romantischen Gemälde in Öl: „Wanderer im Nebelmeer“, „Das Eismeer“, „Mondaufgang am Meer“, „Kreidefelsen auf Rügen“, „Klosterruine Oybin“, nicht zu vergessen, der „Friedhofseingang“ des Trinitatisfriedhofes, den der bekannte Bildhauer Thormeier entworfen hat. C. D. Friedrichs Lebensweg war gekennzeichnet durch eine endlose Kette von Depressionen, die er in seinen Gemälden auch zum Ausdruck bringt. Carl Gustav Carus schrieb an einen Freund über ihn: „Über Friedrich hängt seit ein paar Jahren eine dicke, trübe Wolke geistig unklarer Zustände, dieweil sie ihn zu schroffen Ungerechtigkeiten gegen die Seinigen verleiten.“ In den ‘Literarischen Blättern’ schrieb Carus: „Schon hatte er sich in einer einsamen Klause eine tiefe Wunde am Hals beigebracht, konnte aber noch rechtzeitig gerettet werden.“ Carl Gustav Carus, dessen Name meine Uni trägt, hatte an der Friedhofsmauer seine Grabstätte. Er war ein berühmter Arzt und Maler, Professor im Kurländer Palais, der Heimstatt der königlichen Chirurgisch- Medizinischen-Akademie. Die Mairevolution lehnte er ab; in der Zeit des Aufruhrs flüchtete er sich in die „Ordnung seiner Kupferstiche“ für die Nachwelt.
Ein mir freundschaftlich verbundener Kollege, der mich gerne als sein Adlatus gehabt hätte, übernahm in Berlin eine Klinik als Chefarzt. Rein formell beantragte ich beim Wohnungsamt einen Wohnungstausch. Es genehmigte ihn! Ich zog mit meiner jungen Familie in seine Wohnung und er nach Berlin! Wir richteten uns in der geräumigen neuen Wohnung ein und schlossen schnell Freundschaft mit einem Ehepaar desselben Hauses, glaubten wir doch, auf gleicher ideologischer Wellenlänge und gleichem intellektuellen Niveau zu liegen. Die fast gleichaltrigen Kinder mochten sich und spielten oft zusammen. Die Westverwandtschaft des Ehepaares bereicherte das Spielzeugland unseres Sohnes ungemein. Die Fischertechnik war die Attraktion, die beide Kinder stundenlang fesselte. Dieses Nest der Geborgenheit sollten wir so schnell wieder aufgeben? Nein, das konnte ich meiner Familie nicht zumuten.
Während ich so in Gedanken versunken war, fuhr der Vorortzug schnaufend in den Bahnhof ein. Die Bremsen quietschten, sodass die Ohren schmerzten. Seine doppelstöckigen Waggons waren bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Luft war rauchgeschwängert. Nur schemenhaft waren die Silhouetten der Fahrgäste in den Abteilen erkennbar. Ich blieb ganz nahe an der Tür, nach Luft schnappend, stehen. Meine Augen fingen an zu tränen. Da der Zug keine abgetrennten Abteile hatte, war es aussichtslos, ein Nichtraucherabteil zu finden. Die wenigen Stationen, die ich mit dem Zug bis zum Hauptbahnhof zu fahren hatte, musste ich durchhalten. Ich hasste die Raucher wie der Teufel das Weihwasser. Seit meiner frühesten Jugend hatte ich eine Antipathie gegen das Rauchen. Mit 12 Jahren machte ich meine ersten Erfahrungen. Es waren äußerst negative! Nach dem Genuss von einem halben Dutzend Zigaretten wurde mir speiübel und schwindlig. Sechs an einem Nachmittag waren zu viel für einen kindlichen Organismus. Ich lag Stunden halb bewusstlos auf dem Schelsberg in einem Schützengraben, in dem sonst russische Soldaten für den III. Weltkrieg gedrillt wurden, bevor sich mein Kreislauf einigermaßen erholt hatte. Es war eine heilsame Lehre. Nie wieder hatte ich das Bedürfnis zu rauchen. Als Student startete ich mit Gleichgesinnten Kreuzzüge gegen Raucher, die auch gelegentlich in kleinere Handgreiflichkeiten exaltierten. Auch meiner künftigen Braut gewöhnte ich dieses Laster durch drakonische Maßnahmen schnell ab. Frauen fanden das Rauchen damals schicklich, sie glaubten wohl, es sei Teil ihrer Emanzipation.
Der Zug hatte nur wenige Minuten Aufenthalt. Nicht viele Fahrgäste, nur einige, waren auf diesem Haltepunkt in der frühen Morgenstunde zugestiegen. Der Schaffner hatte es eilig, rannte den Zug entlang, schlug die geöffneten Türen zu und sprang auf den letzten Waggon auf, nachdem er die grüne Kelle gehoben hatte. Ich schaute auf meine Uhr. Der Zug hatte bis hierher den Fahrplan eingehalten. Ich werde also den Chef am vereinbarten Treffpunkt, wo ich zusteigen sollte, nicht verpassen, ging mir durch den Kopf. Andernfalls bliebe noch die Möglichkeit, den Linienbus nach Schönwalde zu nehmen. Dann wäre ich allerdings eine halbe Stunde zu spät dran. Das würde kein gutes Licht auf meine Person werfen. Peinlich, sich gleich am ersten Arbeitstag zu verspäten!
Ich wartete bereits 15 Minuten unter der Bahnunterführung mit meiner prall gefüllten Arzttasche, als ein blauer Moskwitsch-408 quietschend neben mir hielt. Es war der Dienstwagen meines neuen Chefs, der vorn neben dem Chauffeur saß. Kremer muss kurz eingenickt gewesen sein. Denn er fuhr erschrocken hoch, als der Chauffeur hart auf die Bremsen trat. Der Fahrer stieg aus und stellte sich mit Gustav vor. Er war schon in den 60ern, mochte wohl bald das Renteneintrittsalter erreichen. Der bebrillte, hagere Mann wirkte unsicher und zuckte fortwährend mit den Augenlidern. Ich wunderte mich, dass er mit seinem auffälligen Tremor den Schalthebel seines Fahrzeuges noch fehlerfrei bedienen konnte. Er platzierte mich auf den Rücksitz hinter dem Chef, der keine Anstalten gemacht hatte, auszusteigen. Lässig reichte er mir seine linke Hand zur Begrüßung. Sie war seidenweich. Ich nahm sie widerwillig.
In gemächlichem Tempo erreichte der Moskwitsch die Europastraße E 55. Auch jetzt gewannen wir nicht an Fahrt. Hast war fehl am Platze; sie war der größte Feind. Im Schneckentempo kroch eine Karawane von Transitfahrzeugen auf der einspurigen, kurvenreichen Straße den Bergen entgegen. Auf der Räcknitzhöhe thronte linker Hand ein dreiundzwanzig Meter hoher Turm. Jeder Bürger wusste, dass er dem Fürsten Bismarck gewidmet wurde. Die Stadtväter tauften ihn in Friedensturm um, aber sie unternahmen niemals den Versuch, dieses Kunstwerk zu zerstören. In der westlichen Welt wird die Diktatur des Proletariats, gern als Herrschaft des ungebildeten Pöbels verunglimpft. Gustav nahm mehrmals Anlauf, ein Fahrzeug zu überholen. Aber für die kurzen Überholstrecken war der Motor seines Moskwitsch offensichtlich zu schwach. Immer, wenn er am Berg zum Überholen ansetzte, seinen Motor laut aufheulen ließ, erhöhte das vor ihm fahrende Transitfahrzeug ebenfalls sein Tempo, ein böses, vorsätzliches Spiel mit dem Moskwitsch treibend. Der Fahrer steckte seinen Kopf aus dem Fenster und zeigte ihm die lange Nase. Um nicht mit dem Gegenverkehr zu kollidieren, musste Gustav den Überholvorgang abrupt abbrechen. So ging das Katz-und Mausspiel bis Schönwalde. Für 20 km hatte der Fahrer 45 Minuten gebraucht.
Gustav setzte uns am Hintereingang des Krankenhauses ab. Der Chef steuerte direkt linker Hand im Erdgeschoss den Operationstrakt an. Jeder andere Besucher hätte ebenfalls ungehindert Zutritt zum Heiligtum einer chirurgischen Einrichtung gehabt. Ich war einigermaßen schockiert. Es gab keine Barriere. Eine bissige Bemerkung starb mir in letzter Sekunde auf den Lippen. Ich wollte nicht gleich ins Fettnäpfchen treten. Vor meinem Dienstantritt hatte ich das Krankenhaus einmal kurz besucht und einen flüchtigen Blick in verschiedene Räume geworfen. Dass es sich aber in einem so desolaten Zustand befand, hatte ich nicht erwartet. In einem Raum wies er mir einen Umkleidespint zu. Ich war nicht allein. Eine Sekretärin hämmerte auf einer altersschwachen Optima-Schreibmaschine gerade Operationsberichte der Vorwochen ins Reine, die ihr die Operateure diktiert hatten. Sie war eine perfekt ausgebildete Stenotypistin. Ihr gegenüber stand ein weiß lackierter Schreibtisch, der mein künftiger Arbeitsplatz werden sollte, wenn ich nicht im Operationssaal oder auf den Stationen zu tun hatte. Zum weiteren Inventar gehörten ein Aktenschrank, sowie ein gynäkologischer Untersuchungsstuhl.
In der sogenannten Kleiderkammer – eine Behelfsbaracke hinter dem Hauptgebäude, die zugleich Wäscherei und Plätterei war – wurde Maß für meine Dienstkleidung genommen. Drei weiße Leinenhosen, Hemden und Kittel, fein säuberlich in ein Buch eingetragen und mit Unterschrift für den Erhalt gegengezeichnet, gehörten jetzt mir. Beim Wäschetausch sollte ich nicht vergessen, meinen Namen einzusticken, riet man mir beim Verabschieden.
Die Wäscherinnen waren schon bei der Arbeit. Ihr Alltag begann morgens halb sechs. Heißer Dampf und der Geruch von Seifenlaugen umhüllten mich. Das Atmen fiel mir schwer.
Neu eingekleidet, machte ich mich auf den Weg zu den Stationen. Dr. Kremer wartete bereits im Stationszimmer auf mich. Er stellte mich als künftigen Oberarzt den anwesenden Schwestern, Ärzten sowie der Oberschwester Elly vor. Lori war der Hahn im Korbe. Außer dem Chef duzte er alle.
Langsam setzte sich die Stationsschwester mit dem Visitenwagen in Bewegung. Eine Rangordnung bei dieser Prozession einzuhalten, war ungeschriebenes Gesetz. Der Wagen rumpelte über das faltige Linoleum. Das sterile Gefäß mit der Kornzange drohte umzukippen. Um das Ärgste zu vermeiden, griff die Schwester rasch nach dem Gefäß. Die erste Tür führte in ein 4-Bett-Zimmer. Die Patienten erwarteten in ihren Betten die Visite. Der Chef begrüßte jeden Patienten mit Handschlag. Die Stationsschwester legte ihm die jeweilige Fieberkurve vor. Nach einer halben Stunde war der Visitengang beendet. Schweigsam, aber mit wachsamem Auge, hatte ich die Chefvisite begleitet. Der große Zeiger der Uhr ging auf neun zu. Es war höchste Zeit, mit den Operationen zu beginnen.
„Kollege Jung, ich habe Sie heute noch nicht als Operateur eingeteilt. Ich möchte, dass Sie sich mit den hiesigen Gepflogenheiten erst vertraut machen. Sie werden mir bei den Operationen assistieren. Ich hoffe, das ist auch in Ihrem Sinne“, teilte mir der Chef kurz mit, als er den Operationstrakt betrat. Ich nickte als Zeichen meiner Zustimmung wortlos mit dem Kopf. Im sogenannten kleinen Saal waren die Assistenten bereits mit kleineren Routineeingriffen beschäftigt. An einer schwarzen Tafel war mit Kreide das aktuelle Operationsprogramm, einschließlich Operateuren und Assistenten, dokumentiert. Auch das Operationsprogramm des Vortages war noch unscharf erkennbar. Meine weißen Leinensachen hatte ich inzwischen gegen grüne eingetauscht. Während ich mich umzog, hämmerte die Sekretärin unbeirrt auf der Schreibmaschine, von mir keine Notiz nehmend, als sei ich Luft. Wo hätte ich mich sonst umziehen sollen? Die Toiletten befanden sich im Keller! Schleusen, also Barrieren zwischen steriler und unsteriler Zone, existierten nicht. Die Übergänge waren fließend. Im Foyer hatten sich inzwischen Patienten zur ambulanten Behandlung eingefunden. Sie beobachteten interessiert das rege Treiben auf dem Gang vor den Operationssälen. Soeben wurde auf einer Trage der erste Patient von zwei Schwestern zum sogenannten aseptischen Saal gebracht. Die Trage mit dem Patienten hielt direkt neben dem Operationstisch. Während die Instrumentenschwester die Instrumente für die nächste Operation vorbereitete, bettete die „Unsterile“ die Patientin auf den Operationstisch um. Sie fixierte ihre Beine mit einem Ledergurt und fesselte ihre Hände. Die Patientin war dem Personal schutzlos ausgeliefert. Ich verfolgte die ungewöhnlichen Vorbereitungen vom Waschraum aus, während ich meine Hände und Unterarme fünfzehn Minuten lang intensiv mit Seife unter fließendem Wasser bürstete. Es durfte kein Quadratmillimeter ausgespart bleiben. Das waren instinktmäßige Handlungen, Automatismen, die in Jahren chirurgischer Tätigkeit erworben wurden, wie ein bedingter Reflex. Der dicke Winny beschwerte sich an der Uni immer über das veraltete, zeitraubende Desinfektionsritual der Hände, das Paul Fürbringer 1888 in einer medizinischen Zeitschrift veröffentlicht und innerhalb kurzer Zeit weite Verbreitung gefunden hatte. Im Westen benutze man neuerdings ein Schnelldesinfektionsmittel, was das zeitraubende, umständliche Händewaschen überflüssig mache, meinte er. Nur der Oberarzt von der Unfallstation besaß ein Schnelldesinfektionsmittel aus dem Westen, das er aber mit niemandem teilte. Er fuhr auch einen schicken Fiat. Seine Ehefrau führte in eigener Regie ein Damenkonfektionsgeschäft direkt am Blauen Wunder, das offenbar Devisen erwirtschaftete. Der Chef sprach, während wir nebeneinander am Waschbecken saßen und uns wuschen, kein Wort mit mir. Er stierte fortwährend auf die Sanduhr, die an der Wand neben dem Becken hing. Offenbar beobachtete er das feine, hellrot gefärbte Schüttgut, das kontinuierlich durch die Engstelle des Glases nach unten rieselte. Nach dem fünfzehnminütigen Waschvorgang desinfizierten wir die Hände mit 70%igem Alkohol. Während wir in die sterilen blauen Mäntel schlüpften, hüllte uns von draußen ein Lkw mit Kohlenstaub ein, der gerade vor dem Operationssaal Braunkohle abschüttete. Ich drehte mich erschrocken um. Das war doch zu viel für mich. „Das ist ja Wahnsinn!“, schrie ich. Ein Kohlebunker direkt vor dem Operationssaal! Ich zweifelte an der Dichtheit des einfach verglasten Fensters. Sein Rahmen aus Holz sah nicht gerade vertrauenswürdig aus. Alle schauten mich verständnislos an. Offenbar hatten sie nicht kapiert, was mich so echauffierte. Für das Operationspersonal war es wohl normaler Alltag, dass draußen vor ihrem Fenster Kohlenstaub abgekippt wurde. Auch der Chef schwieg sich aus.
Während wir uns auf die bevorstehende Operation vorbereiteten, begann die Narkoseschwester, die Patientin einzuschläfern. Sie setzte das mit Mull bespannte Drahtgestell – die Schimmelbuschmaske – auf ihr Gesicht und begann in rascher Folge Chloräthyl auf die Maske zu träufeln.
„Zählen sie laut!“, forderte Marlis die Patientin auf. Bei 24 blieb sie hängen. Ihr Körper spannte sich und bäumte sich auf. Ingelore sprang hinzu und drückte sie mit ihren satten 75 Kilo auf den Operationstisch zurück. Marlis hatte inzwischen den Choräthylspray mit dem Äthertropf getauscht. Sie erhöhte die Tropfenzahl, um das ungeliebte, gefährliche Exzitationsstadium rasch zu passieren.
„Können wir mit der Desinfektion beginnen?“, fragte ich. Denn das war Aufgabe des ersten Assistenten. Marlis nahm die Maske ab und betrachtete ihre Pupillen.
„Ja, Herr Oberarzt, sie können beginnen!“ Ich war etwas irritiert, denn es war das erste Mal, dass mich jemand mit „Herr Oberarzt“ ansprach. Die Bezeichnung wirkte auf mich wie ein Fremdkörper, wie ein Stich in die Haut. Marlis hielt die Uhrzeit des Beginns auf ihrem Narkoseprotokoll fest. Mit einem in die Kornzange eingespannten Mulltupfer strich ich das zu behandelnde Hautareal mit der braunen Jodlösung intensiv ein. Nach Trocknung derselben auf der Haut wurde die Patientin mit sterilen blauen Tüchern aus Leinen vollständig abgedeckt. Lediglich das Operationsfeld blieb frei. Die Operationsschwester schob den stummen Assistenten über den mit sterilen Tüchern abgedeckten Körper der Patientin. Als erster Assistent stand ich ihr genau gegenüber. Für einen Augenblick begegneten sich unsere Blicke. Ihre lang bewimperten großen, dunklen Augen, vom klarsten Braun, senkten sich tief in die meinen.
„Skalpell!“ Penelope war wie versteinert. Ihr Blick war festgefroren. In ihr regte sich sofort ein unbeschreibliches Gefühl von Furcht und Freude. Das Kommando ihres Chefs zum Operationsbeginn hatte sie offenbar überhört.
„Skalpell!“, wiederholte der Chef nach einer kurzen Pause in einem schärferen Ton, wobei er fortwährend mit der Fußspitze auf den gefliesten Boden trommelte. Während sein Blick auf das Operationsfeld gerichtet war, bewegte sich seine halb zur Faust geformte rechte Hand nach links in Richtung Operationsschwester. Penelope zuckte zusammen. Rasch wandte sie sich ihrer Aufgabe zu, dem Chef das Skalpell zu reichen. Die öfter bei der jeweiligen Operation benötigten Instrumente lagen auf dem stummen Assistenten sortiert ausgebreitet. Sie lagen immer am selben Platz. Der Chef hätte auch blind das Skalpell selbst vom Instrumententisch nehmen können. Bei dem anstehenden Eingriff war der Chef in seinem Element. Er war Standard jedes Chirurgen und wurde häufig durchgeführt. Die „Mamma-Radikaloperation“ nach Rotter Halsted ist ein radikaler, verstümmelnder Eingriff. Mit der linken Hand spannte er die Brust zeltartig und durchtrennte mit geübtem Handgriff die Haut wetzsteinförmig vom Brustbein bis zur Achselhöhle. Ich hatte Mühe, mit der Blutstillung nachzukommen. Die Brustdrüse war an der Faszie des großen Brustmuskels fixiert. Beide mussten nun „en bloc“ entfernt werden. Das Karzinomgewebe durfte keineswegs malträtiert werden, da sonst die Gefahr einer Streuung von Tochterzellen ins Blut bestand. Mit dem Skalpell und einigen geübten Handgriffen löste der Chef den großen Brustmuskel vom Brustbein, trennte ihn von der Faszie des kleinen Brustmuskels und danach schließlich vom Oberarmknochen. Triumphierend hielt er das Brustdrüsen-Muskel-Präparat in die Höhe. Penelope reichte ihm eine große Schale, in die er das Präparat warf. Jetzt folgte der schwierigere Teil der Operation: die Entfernung der Lymphknotenkette entlang der Achselvene. Bei der kleinsten Unachtsamkeit konnte die große Körpervene verletzt und eine verheerende Blutung ausgelöst werden. Mit den Fingern versuchte der Chef blind, vergrößerte Lymphknoten zu ertasten.
„Chef, es ist sicherer, wenn wir unter Sicht die Lymphknotenkette entfernen“, meldete ich mich zu Wort, als ich merkte, dass er vergeblich im Trüben fischte. Erstaunt blickte er auf und hielt inne zu tasten.
„Wie meinen Sie das?“
„Es ist sicherer, wenn wir den kleinen Brustmuskel nahe am Rabenschnabelfortsatz abtrennen und umschlagen. Dann können wir den Venenwinkel einsehen und gefahrlos die befallenen Lymphknoten entfernen.“
„Das Verfahren kenne ich nicht“, antwortete er leicht gereizt. Ich blickte auf und schaute in Penelopes fragenden großen, klaren, braunen Augen.
„Bei der Operation einer Achselvenensperre gingen wir stets so vor. Wenn Sie erlauben, darf ich Ihnen die Methode kurz demonstrieren.“ Unsicher geworden, blickte der Chef in Richtung Penelope. Sie nickte mit dem Kopf.
„Gut, zeigen Sie es mir!“, sagte er nach einer kurzen Denkpause.
„Chef, ich bin leider Rechtshänder. Wir müssten kurz die Plätze tauschen.“ Mit einer mürrischen Bemerkung machte er knurrend seinen Platz für mich frei. Jetzt war ich der Operateur und der Chef mein Assistent! „Per aspera ad astra“, fügte ich so nebenbei beim Platzwechsel an. Der Chef stutzte:
„Was sagten Sie soeben?“
„Mit Mühsal gelangt man zu den Sternen, sagte Seneca in seiner Tragödie Hercules. Oder vulgär ausgedrückt: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Danach möchte ich handeln.“ Vorsichtig löste ich den kleinen Brustmuskel mit den Fingern stumpf von seiner Unterlage und hob ihn leicht an.
„Secarex!“ Penelope reichte mir das elektrische Schneidgerät. „Ich durchtrenne jetzt den Muskel quer, etwas unterhalb seines Ansatzes am Kronenfortsatz“, beschrieb ich meine Vorgehensweise. Danach klappte ich ihn nach unten und sagte: „Jetzt haben wir die nötige Übersicht, um gefahrlos die Lymphknoten entlang des Gefäß-Nerven-Bündels schrittweise zu entfernen. Das Risiko, einen befallenen Lymphknoten übersehen zu haben, sinkt dadurch erheblich.“ Der Chef bemerkte erstaunt:
„Kollege Jung, ich danke Ihnen für den guten Rat. Man lernt nie aus.“ Wir wechselten erneut die Plätze, und der Chef führte die Operation ohne Zwischenfälle zu Ende. Penelope kam, nachdem sie die Instrumente weggeräumt hatte, zu mir und sagte:
„Herr Oberarzt, das haben Sie wirklich exzellent gemacht. An Ihrer Seite wirkte der Chef überaus ruhig, was sonst bei der Revision der Lymphknoten nie der Fall war.“
„Ach, das war nur eine unbedeutende Variation, um das operative Vorgehen zu erleichtern“, versuchte ich den Chef vor der Schwester in Schutz zu nehmen. Sie schien das aber anders gesehen zu haben.
„Nein, nein, ich instrumentiere dem Chef nun schon ein Jahr. Heute war er anders. Bei der Operation hat er heute nicht geschwitzt. Stets mussten wir ihm zwischendurch die Schweißperlen von der Stirn wischen.“ Nach einer längeren Pause sagte sie, während sie die Instrumente putzte: „Es ist schön, dass Sie da sind.“ Ihre großen, klaren, braunen Augen glitten ungeniert an mir herab. Sie irritierten mich.
Während der nächste Patient auf seinen Eingriff vorbereitet wurde, hatte sich der Chef in sein Zimmer zurückgezogen, um sein Frühstücksbrot einzunehmen. Er wurde erst gerufen, als die Narkoseschwester das Signal zum Operationsbeginn gab. 14:00 Uhr war das laufende Tagesprogramm abgearbeitet. Es war für mich Zeit, etwas für das leibliche Wohl zu tun. Der Speisesaal war in einer betagten Baracke neben dem Hauptgebäude eingerichtet. Ich stellte mich Frau Schüler als der neue Chirurg vor. Es war Eintopftag, wie immer montags, wie ich später feststellte, da die genaue Anzahl der Esser montags vorher nie auszumachen war. Denn Eintopf ließ sich immer strecken, wenn Not am Mann war. Die Portionsgröße war sehr variabel. Als Nachtisch gab es einen „Gelben Köstlichen“ aus der Region. Er war allgegenwärtig. Der Volksmund nannte ihn etwas abwertend der „Grüne Hässliche“. Heute traf diese Bezeichnung für meinen Apfel nicht zu. Er war köstlich gelb und schmeckte vorzüglich. Frau Schüler hatte ihn für mich, den Neuen, extra ausgesucht. Nach der Einnahme des Mahls kam ich mir verlassen vor. Der Chef und die Assistenten hatten sich in ihre Bereitschaftsräume zurückgezogen. Der Chef hielt regelmäßig Mittagsruhe, wie ich später feststellte. 16:00 Uhr war die Abendvisite angesetzt. Ich begab mich an meinen Schreibtisch, um die Krankenakten einiger Patienten durchzusehen, die am nächsten Tag operiert werden sollten. Fräulein Bartsch schrieb ellenlange Arztbriefe ins Reine, die ihr die Assistenten diktiert hatten. Offenbar hatte sie auf mein Erscheinen nur gewartet, denn sie unterbrach augenblicklich ihre Arbeit an der Schreibmaschine.
„Herr Oberarzt, im Fach unten links liegen die Meldebögen, die bei Krebserkrankungen auszufüllen sind. Wir sind in Verzug! Die Meldebögen müssen an das Zentrale Krebsregister gesandt werden. Der Chef hat mich beauftragt, Sie einzuweisen.“ Ich stutzte. Vor Überraschung brachte ich kein Wort heraus. Sie stand auf, öffnete die linke Schreibtischtür und kramte einen Packen Formulare hervor. „Das ist das Formular, das bei jeder Verdachtsmeldung auf Krebs auszufüllen ist.“ Sie legte mir ein DIN A5-Formular auf die Schreibtischplatte. „Hier ist das nächste Formular, das Sie ausfüllen müssen, wenn sich der Verdacht auf Krebserkrankung bestätigt hat.“ Und so ging es fort. Ich sagte kein Wort, war aber erstaunt über ihre Courage. Sie schien außer Acht gelassen zu haben, dass ich ihr Vorgesetzter war und sie von mir Anweisungen entgegenzunehmen hatte. Danach zeigte sie auf einen Berg von Krankenakten, die auf der linken Seite des Schreibtisches aufgestapelt waren: „Diese Akten müssen Sie noch durchsehen, Herr Oberarzt. Es sind die Krebspatienten, von denen noch keine Meldebögen ausgefüllt wurden oder die unvollständig sind.“
„Warum haben Sie den Berg so anwachsen lassen, Fräulein Bartsch?“, bemerkte ich ironisch.
„Ach, die Stationsärzte haben eine Abneigung gegen Bürokratie und Schreibkram. Außerdem sind sie überlastet. Wer nimmt die Arbeit schon gern mit nach Hause.“
„Fräulein Bartsch, Sie werden künftig die Formulare ausfüllen und mir zur Unterschrift vorlegen. Alle notwendigen Unterlagen und Anhaltspunkte finden Sie in den Krankenakten.“ Nach dieser Zurechtweisung war sie sprachlos. Zerknirscht und mit finsterer Miene begab sie sich wieder auf ihren Platz, mich ignorierend, um mit Inbrunst noch intensiver auf ihrer Maschine zu hämmern, offenbar so ihren Unmut über meine Anweisung äußernd.
Ich säuberte indes meinen Arbeitsplatz, leerte die Schubfächer von überflüssigem Kram, machte sie frei für meine Akten und diverse Utensilien. Die verbleibende Zeit bis zur Abendvisite döste ich vor mich hin, verstaute den Inhalt meiner Aktentasche in die leeren Schubfächer: atraumatisches Nahtmaterial, Gefäßklemmen, Heparin-Ampullen, diverses chirurgisches Kleinod, das ich aus der Uniklinik abgestaubt hatte, sowie Lochkarten meiner umfangreichen Literatursammlung. Nebenan ging es in der Ambulanz während der Kaffeepause hoch her. Lori unterhielt seine Mitstreiterinnen mit Witzen der Marke „Sender Jerewan“. Seine Lautstärke drang ungehindert durch die angrenzende Tür, sodass ich sie einfach mit anhören musste: „Stimmt es, dass der Kapitalismus am Abgrund steht?“, fragte Lori an. „Im Prinzip ja. Aber wir sind bereits einen Schritt weiter!“, kam prompt seine schlagfertige Antwort. Und so ging es eine halbe Stunde im Schweinsgalopp weiter. Es folgte eine Anfrage an den berüchtigten Sender nach der anderen. Die Lacher hatte er stets auf seiner Seite. Nach jedem Witz folgten Lachsalven seiner Zuhörerinnen, die bis auf die Straße drangen und Passanten anlockten. Lori war ein älterer Assistent, nervlich angeschlagen und Stresssituationen nicht mehr gewachsen. Wochenlang lag er nach einer Hirnblutung im Koma. Ein unerkanntes Hirnbasisaneurysma wurde ihm zum Verhängnis. Eines Tages platzte es. Wie durch ein Wunder hatte er das Bewusstsein wiedererlangt und sich soweit aufgerafft, dass er mit gezogener Handbremse stufenweise wieder in seinen Beruf einsteigen konnte. Da ihm als Operateur größere Operationen nicht mehr zuzumuten waren, wurde er in die ambulante Abteilung versetzt. Nur an einem Tage in der Woche beteiligte er sich an kleineren Eingriffen. Sein liebstes Kind war ein Skoda „Felicia“ mit aufklappbarem Dach. Mit ihm machte er nur bei Schönwetter Sonntagsausflüge. Ich lernte ihn schon flüchtig als Assistent in der Uniklinik kennen. Er musste dort eine mehrwöchige Hospitation ableisten, da er seine Facharztprüfung verhauen hatte. Erst im zweiten Anlauf hatte es geklappt.
Pünktlich 16:00 Uhr fanden sich die Kollegen zur Abendvisite ein. Frischoperierten, Neuzugängen sowie Problempatienten galt unsere Aufmerksamkeit. In einer halben Stunde war der Spuk vorüber.
„Kollege Jung, wir sehen uns im Anschluss in meinem Zimmer wieder“, bemerkte er wie beiläufig beim Gang durch die Stationen. Eigentlich hatte ich vor, die für den nächsten Tag zur Operation ausgewählten Patienten aufzusuchen und mit ihnen ein Aufklärungsgespräch zu führen. Aber das war wohl hier nicht üblich. Als ich ins Chefzimmer kam, waren die anderen Assistenten im Halbkreis um den Chef vor dem Röntgenbildbetrachter versammelt. Lori heftete ihm die Aufnahmen an den Bildschirm, der Chef diktierte die Befunde auf ein Aufnahmegerät. Die anderen saßen tatenlos daneben. Es gab keine Diskussionen. Lori gab den Takt vor. Viertel nach fünf war die Dienstzeit beendet. Ich schlüpfte soeben in meine Zivilsachen und zog in Gedanken Bilanz des ersten Tages, als Lori aufgeregt hereingebraust kam:
„Herr Oberarzt, kommen Sie schnell! Der Krankentransport hat ein Kind mit einer starken Blutung eingeliefert.“ Er war aufgelöst. Schweißperlen der Angst rannen ihm von der Stirn.
Ich stutzte.
„Warum teilen Sie mir das mit? Hintermanndienst hat heute der Chef“, wies ich ihn zurecht.
„Penelope hat mich beauftragt, Sie zu informieren“, gestand er kleinlaut. Ich überlegte kurz. Eine Ablehnung hätte mich von Beginn an ins Abseits befördert. Schließlich war es mein erster Arbeitstag. Meine Reputation durfte ich nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.
„Ich komme sofort. Ich ziehe mich nur um. Kümmern Sie sich inzwischen um das Kind!“ Ich schlüpfte in die grüne Operationswäsche und begab mich in den Ambulanzraum. Auf der Trage lag ein wimmernder Junge mit leichenblassem Gesicht. Er war im Schockzustand. Marlis hielt seinen linken Arm in die Höhe. Im Bereich der Achselhöhle befand sich ein mit Blut durchtränkter Verband.
„Herr Kollege, warum haben Sie noch keine Infusion angelegt. Sie sehen doch, dass der Patient sich im Schockzustand befindet. Der Puls ist kaum noch spürbar“, wies ich Lori zurecht, während ich den Puls tastete.
„Wir haben es ja versucht, konnten aber keine Vene punktieren“, gestand er kleinlaut.
Ich war ziemlich ungehalten.
„Dann schaffen wir uns rasch einen Venenzugang! Holen Sie das Besteck für eine Venae sectio!“ Penelope verstand nicht.
„Besteck?“
„Ja, ein Besteck!“, schob ich nach.
„Herr Oberarzt, ein solches Besteck existiert nicht“, bemerkte sie.
„Gut, dann müssen wir improvisieren. Leider verlieren wir wertvolle Zeit.“ Penelope rannte in den Sterilisationsraum, um die notwendigen Instrumente zusammenzustellen, die ich verlangte. Nachdem wir die Infusion angelegt und Blut für Untersuchungen abgenommen hatten, musste ich die verletzte Stelle inspizieren. Eine Blutsperre im Bereich der Achselhöhle anzulegen, war nicht möglich. Um das Ausmaß der Verletzung festzustellen, musste der Druckverband gelöst werden. Das war aber nicht ohne die strikte Einhaltung steriler Kautelen nicht möglich. „Übergeben Sie das Blut der Laborantin. Sie soll unverzüglich Erys, Hämatokrit und Blutgruppe bestimmen.“
„Herr Oberarzt, so rasch geht das nicht. Die Laborantin ist nicht mehr im Hause. Sie hat längst Dienstschluss.“
„Es geht um Leben und Tod!“, schrie ich aufgebracht. „Lasst sie unverzüglich herbringen!“
„Der Bereitschaftsfahrer ist mit dem Chef unterwegs“, entgegnete Ingelore.
„Dann schickt einen Krankenwagen zu ihr! Bringen Sie den Jungen in den Operationssaal und bereiten Sie alles Notwendige für eine Operation vor. Wir müssen unter möglichst steriler Kautel vorgehen, um die Risiken einer Infektion zu minimieren“, befahl ich. Mir war klar, dass noch eine gute halbe Stunde vergehen würde, ehe ich mit der Wundrevision beginnen konnte. Bei all der Hektik fiel mir noch ein, meine Ehefrau zu informieren, dass ich heute später nach Hause kommen würde. Ich versuchte mehrmals, Lilofee telefonisch zu erreichen. Leider war das Telefon laufend besetzt, sodass ich es nach mehreren Versuchen entnervt aufgab. Als ich nach einer halben Stunde den Operationsaal betrat, war alles für den Eingriff bereit. „Sind Blutkonserven da?“, vergewisserte ich mich.
„Nein, die müssten erst geholt werden. Wir besitzen kein Blutdepot“, klärte mich Marlis auf.
„Woher nehmen wir Blutkonserven? Wir benötigen mindestens zwei.“
„Herr Oberarzt, der Bereitschaftsfahrer, der den Chef nach Hause fährt, kann auf dem Rückweg die Blutspendezentrale anfahren. Sobald die Laborantin die Blutgruppe des Jungen bestimmt hat, können wir sie telefonisch bestellen.“
„Mein Gott, da vergehen ja Stunden, ehe wir einen Tropfen Blut für den Jungen zur Verfügung haben. Beiläufig schaute ich auf den stummen Assistenten, auf dem Penelope die Instrumente ausgebreitet hatte.
„Sie haben keine Gefäßklemme auf dem Tisch? Warum nicht?“, tadelte ich sie.
„Wir haben keine Gefäßklemmen im Sortiment. Ich habe mehrfach versucht, welche zu bestellen. Aber in unseren Instrumentenkatalog sind keine aufgeführt. Auf meine Anfrage teilte man mir mit, dass sie aus dem NSW importiert werden müssten und nur auf Sonderantrag lieferbar sind“, verteidigte sie sich.
„Gut, dass ich heute Morgen daran gedacht habe, aus meinem privaten Besitz zwei Klemmen für den Notfall einzupacken. Ich habe sie mir aus der Uni ausgeborgt, das heißt, mitgehen lassen. Ingelore holen Sie sie aus meinem Schreibtischfach. Ich glaube, sie sind sogar noch steril verpackt.“ Ich hatte ein äußerst ungutes Gefühl in der Magengrube. Da wir keinen Narkosearzt zur Verfügung hatten, musste ich den Eingriff in örtlicher Betäubung durchführen. Eine Maskennarkose mit Äther verbot sich bei dem 13jährigen Jungen, der sich noch immer im Schockzustand befand. Das Risiko musste ich eingehen. Ich musste unverzüglich handeln. Ich bewunderte den Jungen, denn er war ein tapferer. Nachdem die notwendigen Vorkehrungen zum Entfernen des Druckverbandes in der linken Achselhöhle getroffen wurden, wies ich Ingelore an, den Verband vorsichtig zu entfernen. „Saugung!“ Vorsichtig saugte ich das tennisballgroße Blutkoagulum ab, um mir einen Überblick über die Verletzung zu verschaffen. Nachdem ich das letzte Koagulum abgesaugt hatte, kam das Blut plötzlich wie aus einem Springbrunnen geschossen. „Gefäßklemme!“, schrie ich. Mit der linken Hand presste ich den quellenden Blutstrom ab und setzte blind die die Gefäßklemme oberhalb davon an. Alles ging in Sekundenschnelle. Die Blutung stand! Ich löste die rechte Hand und konnte mir nun einen Überblick über die Verletzung verschaffen.
„Das Gefäß-Nerven-Bündel des Armes ist vollkommen durchtrennt, die Arterie und Vene ebenfalls. Der Arm ist nur noch ein blutleerer und gefühlloser Fleischklumpen. Die Glasscheibe hat ganze Arbeit geleistet“, demonstrierte ich Lori den Befund, der wie gelähmt neben mir saß.
„Mein Gott! Der Junge wird den Arm einbüßen!“, klagte Penelope.
„Nein! Das wird er nicht. Wir werden die Blutversorgung des Armes wiederherstellen. Aber zuerst spritzen wir um die Läsionsstelle ein Lokalanästhetikum, um in Ruhe mit der Gefäßversorgung zu beginnen. Denn es wird einige Zeit dauern. Atraumatisches Nahtmaterial haben Sie doch?“
„Ja, 3 x 0.“
„Das Nahtmaterial ist viel zu dick! Ein Strick! Er taugt höchstens zum Aufhängen! Aus jedem Stichkanal würde es wie aus einem Born sprudeln. Marlis, holen Sie aus meinem Schreibtisch die Stärke 5 x 0!“ Nachdem die Anästhesie ihre volle Wirkung entfacht hatte, entnahm ich ein Venensegment aus einem Seitenast, um es als Interponat mit den beiden Arterienstümpfen spannungsfrei zu verbinden. Nach dreißig Minuten hatte ich die Kontinuität der Arterie wiederhergestellt und konnte die Gefäßklemme entfernen. Nach wenigen Augenblicken setzte die Pulsation in der Armarterie ein. „Marlis, versuchen Sie, den Puls zu tasten“, forderte ich sie auf. Nach wenigen Augenblicken schrie sie:
„Ich taste ihn! Ich taste ihn!“ In ihren Augen spiegelte sich ein unbeschreibliches Glücksgefühl wider.
„Gut, jetzt haben wir das Spiel halb gewonnen. Wir können ohne Hektik in Ruhe die verletzten Strukturen rekonstruieren.“ Die nervliche Anspannung meiner Mitarbeiter war einer gelösten Atmosphäre gewichen. Die Naht der verletzten Armvene war Routine. Größere Mühe bereitete mir die Sortierung der durchtrennten Nerven im Bereich der Medianusschlinge.
„Marlis, holen Sie aus dem Chefzimmer ein Anatomiebuch. Es ist schon ziemlich lange her, als ich das letzte Mal die Armnerven seziert habe. Da war ich noch Student. Es ist leicht möglich, die falschen Enden zu vereinen. Anstatt Streicheleinheiten zu verteilen, könnte er mit dem Arm heftige Schläge austeilen.“ Als wir gegen 22:00 Uhr die letzte Hautnaht gelegt hatten, war auch der Fahrer mit dem Blut eingetroffen.
„Herr Kollege, legen Sie eine Kreislaufkurve an, lassen Sie stündlich Blutdruck und Puls messen. Sollte der Puls am verletzten Arm nicht mehr zu tasten sein, informieren Sie mich sofort.
Denn es könnte sich um einen Thrombus im Bereich der Nahtstelle handeln. Um das Risiko zu senken, geben wir ihm Heparin."
„Heparin haben wir nicht“, entgegnete Lori.
„Aber ich habe Heparin!“, konterte ich. „Als hätte ich es geahnt. Gestern habe ich an meinem letzten Arbeitstag im letzten Moment noch einige Ampullen abgestaubt!“ Gegen 22:30 Uhr fuhr mich Gustav nach Hause. Meine Frau empfing mich aufgelöst: „Ich habe mir große Sorgen gemacht. Was ist passiert? Du wolltest doch halb sieben zu Hause sein?“
„Ich habe ja versucht, dich telefonisch zu erreichen, aber das Telefon war laufend besetzt!“
„Besetzt?“
„Ja, besetzt. Du hast wieder mal Dauergespräche geführt.“
„Nein, heute habe ich überhaupt kein Telefongespräch geführt“, entgegnete sie trotzig.
„Haben wir eine Störung?“ Ich ergriff spontan den Telefonhörer. „Die Leitung ist frei!“ Sonderbar, ging mir durch den Kopf. Ich teilte Lilofee kurz den Grund für meine ungewöhnliche Verspätung mit.
Als ich am nächsten Morgen die Station betrat, auf der der verletzte Junge lag, kam ich aus dem Staunen nicht heraus. Das Personal empfing mich mit einem außergewöhnlichen Respekt, ja, mit Ehrfurcht, als sei ich der Papst persönlich. Alle waren sich einig, dass ohne mein Eingreifen der Arm des Jungen hätte geopfert werden müssen. Dem Jungen ging es den Umständen entsprechend gut. Ich legte der Prozedere für die nächsten Tage fest. Ich musste feststellen, dass meine Vorräte an Heparin bald aufgebraucht sein und nur noch für den nächsten Tag reichen würden.
„Besorgen Sie noch heute Heparin! Für den Jungen ist es unverzichtbar“, wies ich die Stationsschwester an. Eine Stunde nach meiner Anweisung suchte mich die Stationsschwester auf. Ihre Hilflosigkeit war ihr ins Gesicht geschrieben. „Was haben Sie auf dem Herzen?“, fragte ich, als sie nicht gleich mit der Sprache herausrücken wollte. Sie druckste herum. „Reden Sie!“, forderte ich sie auf.
„Herr Oberarzt, es gibt kein Heparin“, sagte sie kleinlaut.
„Was heißt, es gibt kein Heparin?“
„Na ja, unsere Apotheke hat kein Heparin. Sie kann es nicht liefern. Heparin würde nur an medizinische Zentren geliefert. Unser Kreiskrankenhaus gehöre nicht dazu.“ Betreten stand sie da. Ich war verblüfft. Ich hatte nicht erwartet, dass Selbstverständliches eben doch nicht überall selbstverständlich ist.
„Schwester, ich danke Ihnen für Ihre Bemühungen. Ich werde Heparin über die Regierungsapotheke anfordern.“ Ich stürmte sofort wutschnaufend in die Telefonzentrale:
„Marianne, ich benötige sofort ein Gespräch mit der Regierungsapotheke in Berlin!“
„Berlin?“ Sie glaubte nicht recht verstanden zu haben.
„Ja, ich sagte Regierungsapotheke Berlin.“ Sie sah mich erschrocken an. „Das ist kein Spaß!“, wiederholte ich meine Forderung in einem forscheren Ton. Nach längerem Zögern wählte sie endlich die Vermittlung und verlangte die Regierungsapotheke. „Gedulden Sie sich bitte etwas. Wir rufen zurück, wenn wir die Verbindung hergestellt haben.“ Ich saß wie auf Kohlen. Es dauerte eine halbe Stunde bis die Leitung nach Berlin stand. Und es dauerte noch einmal zwanzig Minuten, bis eine kompetente Person an der Leitung war, der ich mein Anliegen glaubhaft vortragen konnte.
Sie versuchte, mir zu erklären, dass Heparin kontingentiert sei und daher nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehe. „Das weiß ich inzwischen!“, konterte ich. „Ich beanspruche das Heparin nicht für mich, sondern für einen 13jährigen Jungen. Bei ihm besteht die Gefahr eines Gefäßverschlusses. Der betroffene Arm würde dann nicht mehr mit Blut versorgt und müsste amputiert werden. Das wollen Sie doch sicher nicht auf Ihre Kappe nehmen?“ Nach längerem Zögern ließ sie sich erweichen:
„Gut, ich werde veranlassen, dass an Ihre zuständige Apotheke Heparin geliefert wird. Reichen Sie bitte den Dringlichkeitsantrag für den Jungen nach.“
2
Das rhythmische Trommeln der Regentropfen an das Fenster riss mich aus tiefem Schlaf. Aus dem Radio strömten heiße Rock-and-Roll-Rhythmen von Bill Healy. Es war „Tea time“, wie der Engländer zu sagen pflegt. Seit Freitag hatte ich das Krankenhaus nicht mehr verlassen. Erst am Montagabend wird mein Dienst enden. Eigentlich hätte ich zwischendurch auch mal nach Hause fahren können. Riskant war es aber allemal, da mein Partner erst im ersten Ausbildungsjahr war. Es wäre unverantwortlich von mir gewesen, ihn allein ohne Aufsicht, Patienten versorgen zu lassen. Außerdem wäre es nicht einfach, bei einem Notfall die 25 km mit dem Auto im Eiltempo zu bewältigen. Die schlechten Landstraßen sowie die Behinderungen durch viele Transitfahrzeuge ließen ein zügiges Tempo nicht zu. Engpässe gab es außerdem bei Autoersatzteilen, lange Wartezeiten bei anfallenden Reparaturen und hohe Benzinkosten würden eine größere Lücke in meinen Geldbeutel reißen. Für die Einrichtung der gerade neu bezogenen Wohnung wurde jeder Groschen benötigt. So entschied ich mich, sehr zum Unmut meiner Familie, meinen langen Wochenenddienst ohne Unterbrechung im Krankenhaus zu verbringen. Letzte Nacht kam das Operationsteam erst spät zur Ruhe. Deshalb war mein Mittagsschlaf unüblich tief und lang. Im Bereitschaftsraum der Schwestern wartete bereits der gedeckte Kaffeetisch auf mich. Der Fernseher lief. Er lief eigentlich immer, bis zu nachmitternächtlicher Stunde der Sender das Programm einstellte und sein Testbild erschien.
Penelope hatte die sonntägliche Kaffeetafel mit vielen Naschereien und Nippes gedeckt. Die Mitte der mit Kerzen ausgeleuchteten Kaffeetafel zierte ein einzigartiges Bijou, eine Figurengruppe im Rokoko-Stil aus feinstem Porzellan. Ein Pudel lauscht unter dem Klavier einem Musikstück, das von einer Pianistin und einem Geiger vortragen wird. Mein geliebter Streuselkuchen fehlte auch nicht. Überhaupt, sie richtete es in letzter Zeit so ein, dass ihr Dienst mit dem meinen zusammenfiel. Dabei war sie nie aufdringlich. Auch wenn sie nicht selbst anwesend war, spürte ich doch ihre Nähe: ihren Rosenduft, der sie stets umgab, die „rote Linie“ auf dem Gang unmittelbar vor den Operationssälen, vor der man automatisch stoppte, die sie auf meinen Wunsch hin sofort anzubringen veranlasste, sowie meine immer sorgfältig geputzten Operationsgaloschen. Die Schwesternhaube hatte sie heute abgelegt. Ihr schulterlanges, glänzendes, dunkelbraunes, volles, glattes Haar kam voll zur Geltung. Es bildete den Rahmen für ihr anmutiges längsovales Pastellgesicht. Mit der lässigen Neugier ihrer fließenden, dunklen Augen musterte sie mich ungeniert, als ich das Zimmer betrat. Wie eine Raubkatze, die zum Sprung auf ihre Beute ansetzte, ließ sie mich nicht mehr aus den Augen.
„Herr Oberarzt, es ist schön, dass Sie unsere Einladung angenommen haben“, raspelte sie Süßholz. Ihre vollen Lippen formten sich zu einem feinen, spielerischen, einnehmenden Lächeln. Hinter dem leicht geöffneten Mund zeigten sich gepflegte weiße Zähne.
„Ich bin nur der verführerischen Duftnote des Kaffees gefolgt, die mich zwangsläufig zu Ihnen geführt hat“, wehrte ich verlegen ab. Penelope hatte vor meinem Erscheinen ausgiebig das Zimmer gelüftet. Sie hatte längst gemerkt, dass ich eine Antipathie gegenüber Rauchern hatte. Obwohl sie Gelegenheitsraucherin war, rauchte sie nie in meiner Gegenwart. Im Bereitschaftszimmer der Schwestern stand gewöhnlich der Qualm. Alle rauchten ohne Ausnahme. Es war ihre Raucherinsel, da im Krankenhaus nur in den Bereitschaftsräumen geraucht werden durfte. Und das nutzten die Schwestern ausgiebig. Beim Betreten tränten mir die Augen. Aber nicht so heute. Heute schien ein außergewöhnlich ruhiger Tag zu sein. Kein Wunder. Bei dem Sauwetter traute sich kaum jemand auf die Straße. Die Herbststürme rüttelten an den Fensterläden. In den Bergen ging der Regen in Schnee über. Die Straßen wurden im Nu zu einer tückischen Eisbahn. Wohl zwei Stunden mochten in der gemütlichen Kaffeerunde vergangen sein, als das Telefon schrill klingelte. Die lebhafte Unterhaltung wurde jäh unterbrochen. Penelope war sorgsam darauf bedacht, die üblichen „Linchen-Trinchen-Gespräche“, wie Tolstoi ziellosen Tratsch in „Anna Karenina“ umschreibt, während meiner Anwesenheit auszuklammern. Sie hatte das richtige Gespür, dass sie mich langweilten. Sie hatte Recht. Der Alltagstratsch nervte mich. Marlis riss hastig den Hörer von der Gabel. „Ja!“ Sie wurde nervös und nervöser. Ansteigende Herzfrequenz färbte ihr Gesicht hochrot.
„Die Medizinische Hilfe ist auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall. In zirka einer Stunde wird sie hier eintreffen“, berichtete sie, nachdem sie den Hörer aufgelegt hatte. Jutta schaute auf ihre Uhr:
„Wir haben genügend Zeit, um uns darauf vorzubereiten“, zeigte sie sich erleichtert.
„Nur keine Hektik. Noch kennen wir nicht die Zahl der Verletzten und ihr Ausmaß“, entgegnete ich.
„Der Unfall soll sich auf der Transitstrecke ereignet haben“, gab sie zu bedenken.
„Das Instrumentarium für eine Notoperation ist jedenfalls einsatzbereit“, bemerkte Penelope.
„Ich denke, wir heben jetzt die Kaffeetafel auf, und jeder begibt auf seinen Posten und trifft die nötigen Vorbereitungen“, entschied ich. Als ich den Raum verließ, bemerkte ich noch beiläufig: „Penelope, sorgen Sie dafür, dass die Laborantin und die Röntgenassistentin informiert werden. Wir wollen keine Zeit vergeuden, wenn der Unfall eintrifft.“ Diese Zusatzbemerkung brauchte ich eigentlich nicht zu machen. Sie erwiderte dann auch leicht gereizt:
„Herr Oberarzt, das ist bereits geschehen.“ Gegen 19:00 Uhr übernahm das Team den Verletzten. Der begleitende Arzt war erleichtert, dass er ihn noch lebend übergeben konnte. Ich überblickte sofort die Situation. Ein flüchtiger Blick genügte, um den Ernst der Lage einzuschätzen.
„Herr Kollege, warum haben Sie keine Infusion angelegt?“, tadelte ich ihn.
„Wir haben es ja mehrfach versucht, konnten aber keinen venösen Zugang finden“, entschuldigte er sich, den Angstschweiß von der Stirn wischend. Nachdem er mir kurz den vermutlichen Unfallhergang geschildert hatte, verließ er schnellen Schritts die Klinik, ohne sich zu verabschieden. Der Patient war ansprechbar, aber er befand sich im Schockzustand.
„Legt seine Beine hoch!“, befahl ich, während ich mir in aller Eile einen venösen Zugang verschaffte. „Gebt das Blut ins Labor zur Bestimmung der Blutgruppe und des HB-Wertes! Erst nachdem die Infusion lief, untersuchte ich den Patienten.
„Der Bauch! Der Bauch!“, stöhnte er fortwährend. Sein leichenblasses Gesicht war mit kaltem Schweiß bedeckt. Vorsichtig tastete ich seinen Bauch ab. Die Bauchdecke war gespannt. Beim geringsten Druck wehrte er ab.
„Dieser dicke Bauch!“, knurrte ich, für jeden Chirurgen ein rotes Tuch. Bei der klinischen Untersuchung war es unmöglich sich einen genauen Überblick über die Art innerer Verletzungen zu verschaffen. „Bringt ihn zum Röntgen!“, befahl ich. „Vielleicht kann uns eine Aufnahme des Abdomens weiterhelfen. „Lagern Sie den Oberkörper des Patienten etwas erhöht, damit sich eventuell vorhandene freie Luft unter dem Zwerchfell sammeln kann.“ Nach zehn Minuten konnte ich endlich das Bild betrachten. „Das Bild ist ja kaum auswertbar!“, schalt ich die Röntgenassistentin. „Die Aufnahme ist unterbelichtet!“
„Herr Oberarzt, bei der extremen Adipositas des Patienten war nicht mehr herauszuholen“; verteidigte sie sich.
„Unter dem Zwerchfell ist jedenfalls keine Luftsichel sichtbar“, stellte ich fest, also kein sicheres Perforationsgeschehen.
„Penelope, bereiten Sie eine Parazentese vor! Ich muss wissen, ob sich Blut in der Bauchhöhle befindet.“
„Herr Oberarzt, das Besteck ist einsatzbereit. Wir können sofort beginnen“, zeigte sie sich zufrieden. Offenbar ahnte sie meinen zweiten Schritt zur Diagnostik im Voraus. Als ich mich umgezogen und gewaschen hatte, lag der Patient bereits im Operationssaal. Er stöhnte immer noch:
„Mein Bauch! Mein Bauch!“
„Lokalanästhesie!“ Eigentlich konnte ich mir die Anordnung ersparen. Ich hatte die Spritze bereits in der Hand, bevor ich anfing zu sprechen. Nach wenigen Minuten war der infiltrierte Bezirk betäubt. „Skalpell! Es kann jetzt etwas schmerzen“, sagte ich zum stöhnenden Patienten. Kraftvoll, mit einem kurzen Ruck, stieß ich den spitzen Trokar gewaltsam durch die Bauchdecken und schob vorsichtig seinen Tubus in den Bauchraum vor. Danach zog ich den Trokar aus der Hülse und schob einen Infusionsschlauch in den Bauchraum hinein. „Führen wir eine Lavage durch. Marlis, lassen Sie einen Viertelliter Kochsalz rasch hereinlaufen!“ Die Spannung stieg auf den Siedepunkt. Nachdem der letzte Milliliter eingelaufen war, sagte ich scherzhaft: „Jetzt kommt der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt.“ Penelope reichte mir die leere Spritze, die ich an den liegenden Drain anschloss. Beim Ansaugen des Kolbens bekamen alle einen mächtigen Schreck.
„Blut!“, schrie Penelope.
„Verdammter M…!“, platzte ich heraus. „Wir müssen den Bauch öffnen. Das kann ja bei dieser Fettwanne heiter werden. Ich werde den Chef informieren. Zu zweit schaffen wir das nicht.“ Ich eilte in die Telefonzentrale. „Marianne, verbinden Sie mich mit dem Chef!“ Nach wenigen Minuten übergab sie mir den Hörer.
„Kremer am Apparat.“
„Guten Abend, Frau Kremer. Jung vom Krankenhaus Schönwalde. Ich möchte Ihren Gatten sprechen.“ Sie stutzte einen Augenblick.
„Ist es etwas Dringendes?“
„Ja!“, antwortete ich kurz angebunden. Sie ließ mich etwa 10 Minuten warten.
„Kremer.“ Seine mürrische, kratzige Stimme verdarb mir sofort die Laune.
„Chef, wir haben ein Problem. Allein werde ich es nicht bewältigen.
„Was gibt es, Kollege Jung?“
„Wir haben einen Unfall bekommen mit einer intraabdominalen Verletzung, eine innere Blutung, Milz oder Leber. Wir müssen laparotomieren. Allein schaffen wir es nicht. Der Patient ist sehr dick.“ Großes Schweigen in der Runde. Er schwieg lange. Dann antwortete er:
„Sie können den Patienten verlegen.“
„Chef, das können wir nicht. Der Patient befindet sich im Schock. Sie wissen wie ich, dass in diesem Zustand ein Transport mit dem Sanka viel zu gefährlich ist. Es könnte Stunden dauern, bis er in der Uniklinik ankommt. Auf den Straßen ist es heute chaotisch. Die Fahrzeuge liegen quer. Blut haben wir bis jetzt auch nicht. Ich frage mich, warum haben wir es bis heute nicht geschafft, eine eigene Blutbank einzurichten.“
„Kollege Jung, ich kann Ihnen nicht helfen, ich habe Gäste. Als diensthabender Oberarzt sind Sie verantwortlich. Die Entscheidung liegt bei Ihnen.“ Das Gespräch wurde abrupt beendet. Ich stand da wie ein begossener Pudel.
„Der Chef hat aufgelegt“, sagte ich zu Marianne konsterniert. Es war ein bitterer Moment. Die Haltung meines Chefs erboste mich über alle Maßen. Seine Gleichgültigkeit brachte meine Seele zum Kochen. Ich war zu allem entschlossen. Ich wollte den Patienten retten. „Marianne, versuchen Sie, Dr. Siegemund in Burgk zu erreichen. Ich möchte ihn dringend sprechen.“ Nach kurzer Wartezeit hatte ich ihn am Telefon. Ich kannte ihn noch aus meiner Zeit an der Uniklinik. Wir waren uns sympathisch.
„Herr Kollege. Ich habe hier in Schönwalde ein Problem, das heißt einen Patienten mit einer intraabdominalen Blutung. Ich müsste eine Laparotomie durchführen.“
„Haben Sie Blut?“
„Der Fahrer ist auf dem Weg in die Blutspendezentrale.“
„Gut, ich werde in zirka einer Stunde da sein.“
„Ich danke Ihnen, Herr Siegemund.“ Erleichtert übergab ich Marianne den Hörer. Jetzt musste alles für den Eingriff vorbereitet werden.
„Penelope, wir werden ihn laparotomieren. Bereiten Sie alles vor. Dr. Siegemund wird in einer Stunde eintreffen.“
„Der Chef?“ Fragend blickte sie mich an.
„Der Chef wird nicht kommen. Wir müssen es allein schaffen. Versuchen Sie, Elke zu erreichen. Sie ist robust und wird nicht gleich umkippen, wenn es hektisch zugeht.“ Es verging keine Stunde, als der Anästhesist ankam. Nachdem er den Patienten untersucht hatte, sagte er:
„Ich benötige Plasmaexpander und Blut. Bevor Sie anfangen können, muss ich erst den Kreislauf auffüllen. Der Patient sieht nicht gut aus.“ Wir saßen wie auf Kohlen. Endlich kam Gustav mit den sehnsüchtig erwarteten Blutkonserven. Bevor sie der Anästhesist anschloss, prüfte er mit dem „Bedside-Test“ ihre Verträglichkeit mit dem Blut des Patienten. Schon nach einer halben Stunde sagte er: „Ich habe die Kontrolle über den Patienten. Sie können beginnen. Aber es müsste zügig vorangehen. Der Blutdruck wird wieder abfallen, wenn die Blutung nicht bald zum Stehen kommt. Herr Kollege Jung, ich weiß, dass Sie sich beeilen werden.“
„Alles startklar?“ Ich blickte Penelope in die Augen. Sie strahlten Ruhe und Zuversicht aus.
„Ja!“, war spontan ihre knappe Antwort. In wenigen Augenblicken hatte ich das Abdomen eröffnet. Ein Schwall Blut ergoss sich aus dem Bauchraum, wie aus einem Geysir.
„Saugung!“, schrie ich. Um Übersicht zu bekommen, stopfte ich die vorquellenden Darmschlingen mit Bauchtüchern ab. Vorsichtig tastete ich mit der flachen Hand die Leberoberfläche ab. „Die Leber scheint nicht betroffen zu sein“, stellte ich befriedigt fest. „Die Milz ist defekt. Zieht kräftig am Haken, damit ich sie sehen kann! Ich muss den Schnitt erweitern. So kommen wir nicht ran.“ Ich wusste nicht, ob mein Herz stärker anfing zu klopfen. Eine neue Bewährungsprobe stand mir bevor. Ein- oder zweimal hatte ich bei einer Milzextraktion schon assistiert, aber noch keine Milz selbst entfernt. Als Operateur ist man anders gefordert. Man steht mehr in der Verantwortung. Das Team wusste das natürlich nicht. „Arterienklemme!“, schrie ich, nachdem ich mit der linken Hand die Stielgefäße der Milz blind zwischen zwei Fingern umfasst hatte. Ich spürte mein Herz klopfen. Ich durfte die Arterie nicht verfehlen, musste die Arterienklemme korrekt ansetzen. Sofort sistierte die Blutung. „Die Blutung steht!“, sagte ich zum Anästhesisten und holte tief Luft.
„Ja, der Blutdruck steigt. Er stabilisiert sich“, zeigte sich Siegemund erleichtert.
„Wir haben jetzt genügend Zeit, die Milz zu mobilisieren und zu exstirpieren.“ Es gelang mir ohne Mühe, die Milz aus ihrem Bett zu lösen und sie vom abgedrosselten Gefäßstiel zu trennen. Mit der rechten Hand barg ich sie und demonstrierte die Verletzungen: „An der Milzoberfläche finden sich mehrere tiefe, lange Einrisse im Verlaufe der Rippen. Der Fahrer muss mit großer Wucht mit der seitlichen Brustregion auf einen harten Gegenstand aufgeprallt sein“, demonstrierte ich dem Team die Verletzung. „Ihre Entfernung war unumgänglich.“ Die übrige Revision der Bauchhöhle ergab keine weiteren Verletzungen, sodass wir beruhigt die Bauchwunde wieder verschließen konnten. Geschafft! Eine Zentnerlast fiel mir von den Schultern. „Ich danke dem Team, es hat mich hervorragend unterstützt. Ohne Ihre tatkräftige Unterstützung hätte ich es nicht geschafft.“ Meine Hände berührten Penelopes als Zeichen des Dankes. Das war keine bloße Floskel, sondern es war ehrlich gemeint. Obwohl wir behandschuht waren, fühlte ich bei der Berührung einen elektrischen Funken überspringen, der mich unwillkürlich zusammenzucken ließ, so als hätte ich einen Zitteraal berührt. Obgleich die Berührung nur flüchtig war, einen Augenblick nur, spürte ich ein heftiges Herzstechen, verbunden mit Herzjagen, das in mir ein Angstgefühl auslöste. Meine Aufmerksamkeit galt sofort dem elektrischen Schneid- gerät, das noch angeschaltet war.
„Schalten Sie das Gerät aus!“, schrie ich. Erschrocken drehte sich Penelope um und trat mit dem Fuß heftig auf den Schalter.
„Herr Oberarzt, was haben Sie?“, fragte sie mit unschuldiger Mine, sich keiner Schuld bewusst.
„Ich habe gerade einen heftigen Schlag gespürt. Ist der Operationstisch nicht geerdet?“
„Geerdet?“
„Ich meine die Ableitung gefährlicher Ströme durch Erdung des Operationstisches.“
„Das höre ich das erste Mal. Bisher hatten wir nie Probleme mit dem Secarex. Sie sind offenbar eine sehr sensible Kreatur, Herr Oberarzt.“
„Erdungen sind dazu da, um gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden. Ich werde dafür sorgen, dass der Operationstisch geerdet wird. Auch für den Patienten kann ein nicht geerdeter Tisch gefährlich werden, wenn wir mit elektrischen Geräten arbeiten“, belehrte ich sie. Ich kam ins Grübeln. Warum hatte Penelope nichts bemerkt, als ich sie berührte. Der Funke war doch von ihr übergesprungen! Um mich abzulenken, wandte ich mich Elke zu, die gar keinen Bereitschaftsdienst hatte, und trotzdem gekommen war, um uns beizustehen. Sie hatte sich am Platz des zweiten Assistenten hervorragend bewährt.
„Elke, Ihnen gilt mein besonderer Dank! Sie waren mehr als nur ein Ersatz! Ich werde mich dafür einsetzen, dass man bei der nächsten Prämierung nicht an Ihnen vorbeikommt.“ Wir hatten es ohne den Chef geschafft! Das musste gefeiert werden! Nachdem der Patient aufgewacht und auf die Wachstation gebracht wurde, lud ich das Team zu einem kleinen Umtrunk ein. Denn es war bei den Chirurgen Sitte, dass der Operateur nach seiner ersten gelungenen neuen Operation sich bei dem Team auf diese Weise bedankt. „Ich lade das Team zu einem kleinen, kurzen Umtrunk ein“, bemerkte ich im Vorbeigehen. „Es war meine erste Milzexstirpation. Ihnen habe ich zu danken. Sie haben es mir leichtgemacht. Allein hätte ich es nie geschafft. Sie alle waren großartig!“
„Herr Oberarzt, das kann nicht sein, dass es Ihre erste Milz war. Sie waren zielstrebig, zu keiner Zeit unsicher oder nervös. Es war mir eine Freude, Ihnen zu instrumentieren.“ An Penelopes Augen las ich ab, dass sie es ehrlich meinte, dass es keine bloße Höflichkeitsfloskel war. In Sekundenschnelle hatte sie eine Tafel hergerichtet. Ich holte aus dem Kühlschrank die Flasche Krimsekt, die von meinem Einstand ins Kollektiv übrig geblieben war und wir prosteten uns zu. Es entwickelte sich eine kurzweilige, lockere Unterhaltung. Als ich auf meine Uhr sah, war es zwei.
„Es wird Zeit, den Umtrunk zu beenden. Der heutige Tag wird noch anstrengend genug werden. Erst am Abend wird mein Dienst enden.“