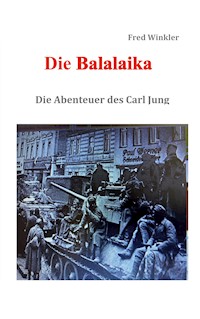Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1848 schwappte die Welle der revolutionären Erhebung über den Rhein und erschütterte die absolutistischen Fürstentümer Europas. Als die Nachricht von der heimtückischen Ermordung Robert Blums Sachsen erreichte, wurde auch dieses Königreich in den revolutionären Strudel hineingerissen. Der Autor lässt den Leser den heißen Atem der Personen spüren, die versuchten, in das Rad der Geschichte einzugreifen. Eine Woche tobte der Kampf der Aufständischen auf den Barrikaden gegen eine militärisch überlegene preußische Armee.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
1
„Robert Blum …“ –
„Paula, hast du das gehört?“ Erschrocken hielt Clara die vor ihr durch die engen Gassen der Marktstände drängelnde Köchin – eine vierschrötige, untersetzte, energisch wirkende Person mit runden Hüften und reichlicher Körperfülle – krampfhaft am Arm fest. Verdutzt drehte sie sich um:
„Was soll ich gehört haben, Clärchen?“ Verunsichert blieb sie stehen, stellte den halb vollen Einkaufskorb ab, streckte sich kurz, holte tief Luft und blickte Clara fragend an, als habe sie sie nicht verstanden, um daraufhin sofort wieder auf ihren Korb zu stieren.
„Paula, hast du nicht den Namen ‘Robert Blum’ in der Ferne gehört?“
„Robert Blum?“
„Ja, Robert Blum!“
„Nein, Clärchen! In diesem Gedränge und bei dem Gebrüll der Marktschreier versteht man sein eigenes Wort nicht mehr. Außerdem, du weißt doch, durch die wiederholten Mittelohrentzündungen in Kindheitstagen ist mein linkes Ohr fast taub. Die ganze Zeit musste ich außerdem auf meinen Einkaufskorb achten. Es treiben sich in letzter Zeit so viel Taugenichtse und Strauchdiebe auf den Wochenmärkten herum, die es auf unsere gefüllten Körbe abgesehen haben. Kommt endlich weiter! Beeilt euch! Bauer Schumann verkauft heute Kartoffeln. Auf uns muss er nicht warten, um sie loszuwerden. Unsere Vorratskammer ist fast leer! Und heute Abend hat Robert wieder Gäste eingeladen. Ich muss ihnen ja immer etwas Besonderes vorsetzen, sonst mäkelt Robert.“
„Ja, ja, Paula! Er muss doch die Gastfreundschaft pflegen, muss immer neue Gäste einladen, die seinen leeren Geldbeutel mit füllen helfen sollen! Hin und wieder bekommt er auch eine neue zahlungskräftige Schülerin. Seine Liedertafel bringt nicht viel ein. Das ist nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Er ist doch auf Nebeneinkünfte angewiesen.
Die Mietschulden wachsen uns jetzt schon über den Kopf. Wir hätten auf der Waisenhausstraße bleiben und nicht in die teure Mietwohnung auf der Reitbahnstraße ziehen sollen!“
„Aber da haben wir doch einen schönen Garten am Haus und können viel Gemüse selbst anbauen!“, konterte die Köchin.
„Mariechen, zerr nicht so arg an meinen Schürzenbändern! Am Ende stehe ich ohne Schürze da.“
„Mama, du hast mir doch versprochen, auf dem Markt einen Lebkuchen zu kaufen“, zeterte Marie, die sich an Claras Schürze festklammerte, um im Gedränge ihre Mutter nicht zu verlieren.
„Deinen Lebkuchen bekommst du, wenn wir alles Nötige eingekauft haben, also auf dem Rückweg.“
„Ich möchte aber meinen Lebkuchen jetzt haben. Ich habe Hunger“, antwortete sie trotzig.
„Robert Blum ist …“ –
„Wieder dieser Robert Blum! Hast du das nicht gehört, Paula?“
„Ja, jetzt habe ich auch ‘Blum’ gehört! Der Ruf kam vom Justitia-Brunnen!“
„Justitia-Brunnen? Ich kann ihn nicht sehen! Das trübe Novemberwetter hat uns ein dichtes Nebelmeer beschert, sodass man kaum die eigene Hand vor den Augen sehen kann. Es will heute gar nicht weichen.“
„Eilen wir zum Brunnen!“, rief Clara.
„Nein, Clara! Zuerst müssen wir die Kiepe mit Kartoffeln füllen lassen. Wenn wir uns nicht beeilen, kommen wir zu spät, und der Bauer dreht uns eine lange Nase!“
Die Köchin griff nach ihrem Korb und bahnte sich energisch einen Weg durch das Gedränge der Marktfrauen in Richtung Gespann des Bauern Schumann, ohne Claras Einspruch zu beachten. Dabei setzte sie ungeniert resolut ihre Ellenbogen ein, um rasch voranzukommen. Clara blieb keine andere Wahl als ihr mit Mariechen durch das Gedränge zu folgen. Des Bauern Gespann stand etwas abseits der Verkaufsstände auf dem Marktplatz. Die Köpfe der beiden „Jütländer“ steckten in umgehängten Hafersäcken. Das braune Fell der Kaltblüter dampfte noch nach der anstrengenden Fahrt in die Stadt. Es roch nach frischem Pferdedung. Paula rümpfte ihre Nase; sie hatte eine starke Abneigung gegen diesen starken Ammoniakgeruch. Eine dicke Menschentraube umlagerte sein Gespann.
Paula bahnte sich rücksichtslos einen Weg hindurch.
„Schumann, räum gefälligst den Pferdedung weg! Er stinkt zum Himmel!“, schimpfte sie aufgebracht.
Der Bauer unterbrach das Abwiegen der Kartoffeln für eine Kundin und wandte sich der Köchin zu: „Sieh mal an“, schmunzelte er in seinen Bart, „der feinen Gesellschaft sind neuerdings Pferdeäppel ein Dorn im Auge. Noch vor wenigen Monaten hätte man sich um sie gerissen. Keine Sorge Paula, ich überlasse sie dir nicht gratis.“
„Schumann, du bist ein gar zu gerissener Gauner. Sogar Kartoffelschalen machst du zu Geld. Füll mir die Kiepe mit Kartoffeln, aber von der besten Sorte!“, sagte sie drohend, aber mehr mit schelmischem Unterton. Wenn sich die zwei begegneten – und sie kannten sich schon lange, stammten aus demselben Dorf und saßen auch noch lange genug zusammen auf einer Schulbank –, hakelten sie sich immer. Lange konnte er ihr nicht verzeihen, dass sie einen Jugendfreund vorzog zu heiraten. Er wurde jedoch während der Juliereignisse 1831 getötet, als die sächsische Armee gegen Aufständische eingesetzt wurde. Paulas Mann, August, diente damals im 2. Schützenbataillon der sächsischen Armee. Paula blieb kinderlos und heiratete nicht wieder. Sie verdingte sich als Köchin und Haushaltsgehilfin in verschiedenen Haushalten. Als Clara mit Robert im Jahre 44 in die Stadt zog, wurde sie sofort als Köchin eingestellt, da sie hervorragende Zeugnisse vorlegen konnte.
Der Bauer nahm ihr die Kiepe vom Rücken, stellte sie auf die Waage und füllte sie bis zum Rand mit Kartoffeln der besten Sorte. Nachdem er genügend Gewichte aufgelegt hatte, runzelte er die Stirn: „In der Kiepe sind über 240 Unzen, also 20 Zollpfund, das Kiepengewicht natürlich abgezogen.“
„Was bin ich dem Geizkragen schuldig?“
„Das hängt davon ab, womit du zahlen willst.“
„Natürlich mit den in Sachsen üblichen Neugroschen!“
„Die sind doch nur noch aus Blech; jedes Jahr wird ihr Silbergehalt zugunsten des Kupfers reduziert: von außen hui, aber innen pfui! Statt Silber ist nur noch Zinn und Kupfer drin! Die Inflation hat Schwindsucht. Das spürt doch jeder in seinem Geldbeutel. Hast du nicht Kreuzer bei dir? Die sind heute gefragter denn je, oder – vielleicht – einen Louisdor?“
„Louisdor?“
„Ja, ich meine die französische Goldwährung!“
„Bei dir tickt es nicht richtig im Kopf! Wir sind arme, aber ehrbare Leute. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Louisdor besessen! Ich zahle mit den hier üblichen Neugroschen. Basta! Nenn sie ruhig Blechgroschen! Also Spaß beiseite, Bauer Schumann. Was verlangst du heute für eine Kiepe Kartoffeln?“
Der Bauer kratzte sich am Kopf – er schien angestrengt zu rechnen –, runzelte seine Stirn, sagte dann spontan, wie aus einer Pistole geschossen: „einen Taler!“
Die Köchin schluckte, fand zunächst keine Worte. Ihr Hals schwoll an, ihr Gesicht färbte sich blaurot. Dann brach aus ihr alle aufgestaute Wut wie aus einem Vulkan explosionsartig heraus: „Du Gauner, Halsabschneider! Du bist nicht bei Sinnen! Nimmst dem Toten noch das Leichentuch! Vor vier Wochen hast du noch für dieselbe Kiepe, die ich auf meinem Rücken schleppe, einen halben Taler verlangt. Jetzt willst du plötzlich einen Taler?“ Die Köchin fuchtelte wild mit den Armen und drohte mit der rechten Faust.
Der Bauer nahm ihren Zornesausbruch gelassen hin, zuckte nur mit der Schulter.
„Ja, recht hast du. Alles ist teurer geworden: der Schmied, die Eisen an den Hufen meiner Jütländer, der Müller, der Hafer für die Pferde; sogar die Standgebühr hier auf dem Markt hat sich innerhalb eines Jahres verdoppelt. Ich muss meine Preise dem Markt anpassen, um existieren zu können. Ohne Hafer können meine Pferde keinen vollen Wagen ziehen! Ohne Pferde stünde der Karren mit Kartoffeln gar nicht hier. Du müsstest deiner ehrenwerten Musikus-Familie anstelle von Kartoffeln geröstete Kastanien vorsetzen, die es ja heuer reichlich gibt.“ Er beendete seinen Redeschwall, holte tief Luft. Offensichtlich war er mit seiner Gardinenpredigt am Ende. Er stutzte einen Augenblick. Dann fiel ihm noch etwas Besonderes ein, das er Paula unter die Nase reiben wollte:
„Übrigens, als ich neulich beim Bäckerladen vorbeiging, flog mir plötzlich etwas Unangenehmes ins Auge, das mich störte. Ich bat meinen Kompagnon, der mich begleitete, nachzusehen, ob er was sieht. Er antwortete: ‘Nee, ich säh nischt! Doch halt, do hob ich’s! Weeß Gott! S’is äh Vier-Groschen-Brod nooch der neusten Preisliste!’“
„Nichts für ungut, du Halsabschneider“ – Paula musste über seinen Witz herzhaft lachen –, „ich sehe ja ein, dass du auch leben musst. Ich gebe dir für die Kiepe Kartoffeln zwanzig Neugroschen. Ich denke, damit ist die Teuerungsrate der letzten vier Wochen abgegolten.“
Der Bauer schwankte einen Augenblick, dann gab er sich geschlagen:
„Gegen dich kratzbürstiges, durchtriebenes, mit allen Wassern gewaschenes Weibsbild ist kein Kraut gewachsen. Gib mir schon deine zwanzig Groschen und zieh Leine!“
Paula brach in ein herzhaftes, schallendes Gelächter aus.
„Heute habe ich dir wieder einmal eine lange Nase gedreht. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, Bauer! Der Musikus wird dir als Dank eine Sonatine komponieren, die kannst du deiner Liebsten bei Mondschein vorspielen.“
„Mach dich vom Acker, du kleines Scheusal!“, rief er ihr nach und warf ihr eine faule Kartoffel hinterher. Er verfehlte sie. Ihr herzhaftes, kirrendes Lachen versöhnte den Bauer. Er war ihr nicht gram.
Clara hatte das Feilschen um den Kaufpreis der Kartoffeln außerhalb der Menschentraube, die sich um den Karren geschart hatte, gespannt verfolgt. Sie konnte sich auf Paula verlassen. Sie würde nicht umsonst zu viel Geld ausgeben. Sie lachte sich ins Fäustchen, dass ihre Köchin den Bauer übertölpelt hatte.
„Das Wichtigste haben wir!“, sagte die Köchin triumphierend, auf die volle Kiepe zeigend. Sie ächzte unter der Last der Kartoffeln. „Jetzt können wir uns Zeit nehmen.“
„Paula, du warst hinreißend! Ich umarme dich.“
„Robert Blum ermordet!“ –
Von der Nordseite des Marktes vervielfachte sich das Echo. Es klang furchterregend.
„Komm Paula, lass uns zum Brunnen eilen!“, rief Clara aufgeregt.
„Lauft schon vor. Mit der vollen Kiepe auf dem Rücken geht’s bei mir nicht so flink.“
Clara zerrte Mariechen hinter sich her. Sie sträubte sich, da sie sich immer weiter von der Lebkuchenbude entfernten. Der Justitia-Brunnen war von einer dichten Kinderschar umringt.
„Das ist doch der Peter!“, rief sie erstaunt, als sie den Brunnen erreichten.
„Der Peter?“, wiederholte die außer Atem geratene, stark nach Luft schnappende Köchin.
„Ja, Peter Groll, unser Falstaff!“
„Der Prahlhans?“
„Der Kinderschreck! Da steht er auf dem Sockel unter Justitia und hält aufrührerische Reden.“
Clara bahnte sich eine Gasse durch die laut durcheinanderschreiende Kinderschar, die Groll umringt hatte.
„Groll, was posaunst du heraus? Ist es wieder eine deiner vielen Enten, die du täglich flattern lässt?“
„Was heeßt hier Ente! Dos is die bittere Wohrheet. Robert Blum ham se gestern abgemurkst.“
„Groll, du spinnst! Setz nicht solche Lügen in die Welt! Die Patrioten nehmen dir so etwas übel!“, drohte Clara.
„Was weeßt du Weibsbild schon! Ich hob die Nochricht heute in der Frieh von een Major erfohrn, der mich aus dem Böhm’schen Bohnhof gefegt hat, wo ich die letzte Nacht gepennt hob!“
„Das kann nicht sein!“, schrie Clara aufgebracht.
„Es ist aber wohr. Ich lüge nich. Der Robert ist tot. Gestern Nachmittag wurde er von der kaiserlichen Soldateska in der Nähe von Wien erschossen.“
„Robert Blum erschossen? Das kann nicht sein!“, murmelte sie leise. „Das darf nicht sein!“, schrie sie so laut, dass die Kinder ängstlich zurückwichen.
„Ich hob Offiziere belauscht, die aus dem Zug von Wien auf dem Böhm’schen Bohnof ausgestiegen sinn. Sie sohgten, der Blum sei off der Flucht erwischt worden, als er sich über de Grenze mogeln wollte.“
Clara war wie vor den Kopf gestoßen. Sie konnte und wollte es nicht wahrhaben, dass man Robert Blum, einen offiziellen Gesandten, den Vizepräsidenten des Frankfurter Vorparlaments, der eine Vermittlerrolle bei der Wiener Oktoberrevolution zwischen Barrikadenkämpfern und Monarchen übernehmen sollte, einfach ohne Gerichtsverhandlung exekutiert habe.
Im letzten Sommer gab sie in Leipzig ein Klavierkonzert. Da traf sie das erste Mal mit dem untersetzten, stämmigen Rotschopf zusammen. Mit einem begnadeten Redetalent ausgestattet, zog er die Zuhörer magisch in seinen Bann. Er war damals sehr zuversichtlich, dass man in Frankfurt eine für alle deutschen Länder verbindliche Verfassung ausarbeiten könnte, die Grundlage für eine Vereinigung ohne die Vormundschaft Preußens sein würde.
Und jetzt? Haben sich die Träume der deutschen Patrioten in ein Nichts aufgelöst? Clara begann zu schluchzen. Tränen bahnten sich einen Weg über ihr Gesicht. Sie suchte instinktiv Halt bei der Köchin.
Der kleine Groll stand betreten auf dem Sockel. In seinem sauerkrautfarbenen Frack, der bis an die Knöchel reichte – auf dem übergroßen Kopf saß ein dreizackiger Stürmer, dazu ein himmelblaues Wams, seine Säbelbeine in überlange gespornte Kanonenstiefel gepresst –, bot er ein groteskes Bild unter der Göttin der Gerechtigkeit. Die Frackschöße, in denen seine Fäuste steckten, standen so weit vom Leibe ab, als wollte er gerade zum Fluge abheben.
Wer Peter Groll war, wusste jedes Kind. Dass dieser Mann aber weder Peter noch Groll hieß, und nur die Kinder ihm diesen Namen verliehen hatten, das wussten nur die Wenigsten! Früher war er Schirrmeister bei der königlich-sächsischen Post. Wegen seiner Grobheit und Ungeschliffenheit häuften sich die Beschwerden der Fahrgäste, und er wurde gefeuert. Seitdem fristete er auf Märkten als Possenreißer und vielgeschätztes Original sein Dasein. Besonders die Kinder hatten es auf ihn abgesehen. Sie verfolgten ihn so hartnäckig wie Krähen ein Käuzchen. Wenn sie ihm zu nahe auf die Pelle rückten, schlug er mit seinem Stock nach ihnen, oder er vertrieb die Meute mit Steinen, die er für den Notfall stets in seiner Fracktasche vorrätig hatte.
„Groll, deine Hiobsbotschaft hat mich zwar schockiert und traurig gestimmt, aber ich will dich dafür trotzdem mit einer Handvoll Kartoffeln belohnen. Das Neuste erfährt man immer zuerst aus erster Hand: nämlich von Groll!“ Clara warf einige Kartoffeln in den noch nicht mit Wasser gefüllten Brunnen, die Groll eilig aufsammelte.
„Dos wird e Festmohl heute am Obend am offenen Feuer!“, rief er freudestrahlend und warf Clara einen Handkuss zu.
„Mama, wer war der Zwerg da oben auf dem Brunnen?“, wollte Mariechen wissen.
„Ach, das ist der ulkige Peter, den alle Kinder gernhaben, weil er sie zum Lachen bringt.“
„Kaufst du mir jetzt einen Lebkuchen?“
„Ja, du kleiner Quälgeist!“
„Clara, wir müssen noch zu den Arkaden. Am Freitag ist Schlachttag. Da gibt’s Fleischbrühe für einen Pfennig und Knochen noch gratis dazu! Fleisch können wir uns nicht leisten.“
„Paula, schlachte doch ein Huhn für heute Abend. Die Hühner sind in der Mauser und legen kaum noch Eier. Im Frühjahr können wir Küken kaufen. Heute Abend wird Röckel unter den Gästen erwartet. Er möchte aus Roberts neuster Komposition ‘Album für die Jugend’ Ausschnitte hören. Ich persönlich werde sie auf dem Piano vortragen. Den ersten Satz schrieb er für unsere Marie; er begleitet sie auf ihrem ersten Schultag.“
„Clara, ich dachte an Markklößchen. Der Metzger schlachtet unter den Arkaden. Frischer Markknochen vom Kalb oder Rind eignet sich hervorragend für solche Klöße! Ich verspreche dir, unsere Gäste werden bestimmt begeistert sein. Fleisch können wir uns im Augenblick bei unserer prekären Finanzlage gar nicht leisten.“
„Koch, was du für richtig hältst! Du bist schließlich unsere Köchin. ‘Mehrere Köche verderben den Brei’, heißt ein bekanntes Sprichwort.“
2
Im Hause auf der Reitbahnstraße herrschte ein emsiges Treiben. Paula hatte in der Küche, die zu ebener Erde lag, vollauf zu tun. Nachdem sie frische Buchenholzscheite aufgelegt hatte, glühte die eiserne Herdplatte. Anheimelnde Wärme verbreitete sich rasch im Raum. Bei ihrer Körperfülle kam sie schnell ins Schwitzen. Sie wischte sich mit dem Handrücken die Schweißperlen von der Stirn. Im flackernden Kerzenschein wirkte die glühende eiserne Platte gespenstisch wie ein Fegefeuer. Sie öffnete das Fenster. Klirrende feuchte Kälte begleitete die hereinbrechende Dunkelheit. Nach wenigen Minuten musste sie das Fenster wieder schließen. Die Kerzen flackerten bedrohlich, schienen durch die intervallartig einsetzenden Windstöße außer Kontrolle zu geraten. Die Fleischbrühe dampfte im übergroßen Topf. So schnell sollte sie sich doch nicht erwärmen. Bis zum Servieren der Speise – gewöhnlich nicht vor mitternächtlicher Stunde – blieb noch reichlich Zeit. Im Salon sollte es ja zuvor, wenn Clara Roberts neueste Kompositionen auf dem Klavier vortragen wird, Süßigkeiten geben. Sie zog vorsichtig den Topf an den Rand der Herdplatte und widmete sich wieder ihren Kalbsknochen, die auf dem großen Küchentisch gestapelt waren. Mit einem scharfen Löffel kratzte sie akribisch das Knochenmark heraus – sie wollte kein Gramm des wertvollen Marks vergeuden –, zerstampfte es sorgfältig in einem Mörser und stellte anschließend den dicken Brei in ein Dampfbad. Er verflüssigte sich allmählich, sodass er sich durch ein Sieb passieren ließ. Maskierte kleine Knochensplitter konnten dadurch getrennt werden. An einem Knochensplitter sollte schließlich kein Gast der Musikerfamilie ins Gras beißen müssen, wenn auch die meisten, die an diesem Abend erwartet wurden, Revoluzzer – Aufrührer! – waren. Unter Zusatz von zerdrückten Semmelbröseln, Mehl und Eiern knetete sie schließlich einen klebrigen, gut formbaren Teig, schmeckte ihn mit Pfeffer, Salz, Muskat und reichlich Petersilie ab und fertigte aus ihm mehrere Dutzend kreisrunde tischtennisballgroße Klößchen. Zufrieden betrachtete sie ihr Werk.
„Paula, bist du schon fertig mit der Zubereitung?“, stürmte Clara in die Küche. „O, wie schön!“, rief sie entzückt. „Lass mich ein Markklößchen probieren!“
„Aber nur eins! Drei sind für jeden Gast vorgesehen.“
„Ja, ja, ich weiß schon, du bist eine kühle Rechnerin. Es darf nichts übrigbleiben! Hast du aber auch an das Mariechen gedacht? Der Herr Hofapotheker meinte, das Mariechen solle wegen seiner Hautblässe Kalbsmark essen. Davon bekäme es rosige Bäckchen.“
„Aber ja, unser Mariechen vergesse ich nie. Für sie habe ich sogar vier Klößchen, extra groß, geformt.“
Zehn Uhr waren die Gäste anlässlich Mariechens Schuleinführung zum Hausball geladen.
Der königliche Musikdirektor August Röckel hatte sich in der Zeit geirrt. Schon neun Uhr begehrte er um Einlass. Er läutete Sturm. Clara öffnete.
„Herr Professor, entschuldigen Sie meinen Aufzug, aber wir haben Sie erst ab zehn erwartet!“ Sie war sichtlich erschrocken, als Röckel vor der Tür stand. Sie war noch im Morgenmantel, gerade mit der Abendtoilette beschäftigt. Vor Schreck verdeckte sie ihren ungeschminkten Mund mit der Handfläche. Schamesröte überzog ihr Gesicht. Glücklicherweise bemerkte es der Professor in der Dunkelheit nicht. Sie hatte eigentlich den Bäckerburschen erwartet, der die bestellten „Süßigkeiten“ bringen sollte.
„Bei diesem Schweinewetter musste ich meinen Spaziergang abbrechen, und bin gleich in die Reitbahnstraße eingebogen“, entschuldigte er sich. „Lass mich nicht im Regen stehen! Die Straßenbeleuchtung ist katastrophal – wie eine trübe Funzel. Die Gaslaterne spendet weniger Licht als ein Glühwürmchen. Man sieht die Hand vor den eigenen Augen nicht. Da muss man sich ja verlaufen! Die Stadt spart an allen Ecken und Enden!“, fluchte er. Clara führte ihn in den Flur, wo er seine verschmutzten Überzieher und den Regenmantel ablegte.
„Robert hat sich in seinem Zimmer verbarrikadiert. Er möchte nicht gestört werden, er komponiert gerade ‘Freiheitgesänge’ für die Liedertafel“, entschuldigte sich Clara im Voraus für seine Unhöflichkeit, die Gäste nicht zu empfangen. „Vielleicht wird er sich heute Abend den Gästen gar nicht zeigen. Wenn er komponiert, vergisst er sogar zu essen.“
„Da tut er recht daran. Robert ist ja in Gesellschaft oft so schweigsam, dass man seine Anwesenheit gar nicht bemerkt“, meinte er scherzhaft. „In diesen chaotischen Zeiten, in denen Reaktionäre wie Metternich mit allen Mitteln versuchen, die Uhren zurückzudrehen, benötigt die Revolution jede Form von Unterstützung. Nicht nur Waffen brauchen die Barrikadenkämpfer. Auch die Musik kann eine wirksame moralische Stütze sein! Chopin wurde wegen einer Mazurka vom russischen Zaren zum Staatsfeind erklärt; und er musste sein Land verlassen. Die Marseillaise ist in aller Munde! Sie hat die Kommunarden stark gemacht. In Wien toben heftige Barrikadenkämpfe, ihr Ausgang ist ungewiss. Parlamentäre aus Frankfurt wollen die Revolutionäre moralisch unterstützen.
Umso gesprächiger und unterhaltsamer ist die charmante Hausherrin.“ Seine Augen blinzelten listig. Mit einem Taschentuch wischte er sich die Regentropfen aus seinem unrasierten stoppeligen Gesicht.
„Lieber Herr Professor, ich erlaube mir, Sie in den Musiksaal zu begleiten. Am Kamin können Sie sich aufwärmen. Ich muss Sie leider einige Minuten sich selbst überlassen. Sie sehen ja, ich bin noch nicht gesellschaftsfähig. Sie können sich ja die Zeit mit dem Studium der neusten Ausgabe des ‘Vaterlandes der Sachsen’ vertreiben.“
Gegen elf Uhr war die illustre Gesellschaft, die zum Hausball geladen war, in dem großen dreifenstrigen Salon komplett versammelt. Zu Claras Überraschung zählten auch der Pianist Ferdinand Hiller und seine Frau, die Sängerin Antolka Hogé, zu ihren Gästen. Zufällig weilten sie zu einem Kurzbesuch an ihrer früheren Wirkungsstätte. Seit Jahren verband sie eine innige Freundschaft. Ferdinand war es schließlich mit zu verdanken, dass Robert mit der Leitung der „Liedertafel“ beauftragt wurde, was ihm ein regelmäßiges, wenn auch geringes, Einkommen sicherte.
Antolka glich einer edlen Rose. Sie zog nicht nur alle Männer, sondern auch viele Frauen an. Sie war jung und schön noch dazu. An ihren Augen konnte man sich nicht sattsehen. Ihre sanfte und weiche Sopranstimme ließ die Männerherzen in Verzückung geraten. In Wilhelmine Schröder-Devrient hatte sie auch eine hervorragende Lehrmeisterin. Wilhelmine war in die Jahre gekommen; von den großen Rollen, die sie einst berühmt machten, hat sie sich zurückgezogen.
Clara ist glücklich, dass heute Abend beide berühmten Sängerinnen bei ihr zu Gast sind.
Ein ganz Großer der städtischen Kunstszene fehlte jedoch. Clara hat ihn bewusst ausgeladen. Nach einem ersten gemeinsamen Spaziergang im „Großen Garten“ war sie von ihm maßlos enttäuscht. Er gab sich rechthaberisch, wollte niemanden neben sich gelten lassen, redete wie ein Wasserfall, nur immer über sich selbst. Sie empfand ihn als höchst arroganten, unappetitlichen Mann. Mendelssohn war für ihn ein rotes Tuch. Er ließ nur den toten Carl Maria von Weber neben sich gelten. Der heutige Tag war ihrer Tochter Marie gewidmet. Heute wollte sie keinen Zankapfel um sich wissen. Als die Hausherrin nach elf das Kaminzimmer betrat, verstummten die Gespräche schlagartig; man erhob sich, dankte artig für die Einladung. Die Gäste überhäuften Clara mit Komplimenten und bestürmten sie, aus Roberts neustem „Album für die Jugend“ auf dem Piano zu spielen. Clara ließ sich nicht lange darum bitten. Aus diesem Grunde hatte sie ja ihre intimsten Gäste eingeladen. Nur Robert verweigerte sich. Mehrmals hat sie vergeblich an die Tür seiner Bodenkammer geklopft.
Der erste Teil – „der kleine Morgenwanderer“ – spielte auf Mariechens ersten Schultag an. Die Sonate, ein schwungvoller Melodienbogen, begleitete sie auf ihrem mit vielen kleinen Abenteuern und Missgeschicken gepflasterten Schulweg. Für Augenblicke entführte Clara ihr Publikum in eine märchenhafte Zauberwelt. Die Zuhörer waren über Claras gefühlvolle Virtuosität fasziniert. Die elegant wogenden Bewegungen ihrer schönen zarten Hände lösten allgemeine Bewunderung aus. Als sie endete, erntete sie herzlichen Applaus. Sie musste die üblichen Gratulationskuren ihrer Gäste über sich ergehen lassen. Hiller erhob sich und umarmte sie spontan.
„Clara, ich bewundere dich. Keiner erreicht zurzeit deine Vollkommenheit. Die romantische Sonate, die Robert komponiert hat, ist dir wie auf den Leib geschneidert.“
„Mein lieber Hiller, du übertreibst ein wenig. Du bist heute als Pianist nicht weniger gefragt!“, wehrte Clara liebenswürdig ab. „Lass uns doch gemeinsam das ‘Allegro brillant’ zu vier Händen von unserem leider viel zu früh von uns gegangenem Freund Felix Mendelssohn vortragen, das wir vor Jahren im ‘Hôtel de Saxe’ mit großem Erfolg aufgeführt haben!“ Ferdinand war Feuer und Flamme! Er fühlte sich geehrt, an der Seite der europaweit bekannten Pianistin musizieren zu dürfen.
„Gern, meine liebe Clara! Unser gemeinsamer Freund Felix würde sich sehr darüber freuen. Leider weilt er seit einem Jahr nicht mehr unter uns.“
Nicht alle Anwesenden waren musikbegeistert. August Grahl saß still in einer Ecke und zeichnete auf einen Block Skizzen der illustren Gesellschaft. Eigentlich war für ihn die Malerei nur ein kurzweiliger Zeitvertreib. Um seine Existenz musste er sich keine Sorgen machen. Als Schwiegersohn des Bankiers Oppenheim war er in einem sicheren Hafen; wirtschaftlich gut abgefedert, wohnte in einem nagelneuen repräsentativen, herrschaftlichen venezianischen Renaissance-Palais. Außerdem war seine Miniatur- und Porträtmalerei ein einträgliches Geschäft. Clara wusste um seine republikanische Vergangenheit. Er machte um sie nicht viel Aufhebens. 1813 kämpfte er in den Reihen der Schwarzen Husaren an der Seite Lützows und seiner Jäger gegen die napoleonische Fremdherrschaft. Schon deshalb hegte Clara für ihn viele Sympathien.
Ihm gegenüber, ganz am anderen Ende des Raumes, stand lässig an die Wand gelehnt sein Pendant, Alfred Rethel, ein junger verschrobener, in sich gekehrter, menschenscheuer Historienmaler, der durch Illustrationen des Nibelungenliedes bekannt wurde. Er war für das Große, Gigantische! Malte großflächige Fresken an die Wände des Aachener Rathauses und Doms. Nicht, dass sie sich nicht mochten! Ganz im Gegenteil. Sie achteten sich, hatten großen Respekt voreinander. Rethel machte einer seiner zahlreichen Töchter sogar den Hof! Seine überaus feinen Gesichtszüge erinnerten an einen französischen Marquis vom ältesten Adel. Er machte den Eindruck höchster Vornehmheit. Bei seiner betont langsamen, streng ausformulierten Sprechweise fiel er oft ins Französische. Er weilte nur in den Wintermonaten in der Residenzstadt. Für seinen „Totentanz“ hoffte er hier auf neue Inspirationen. Auf dem Wochenmarkt war er Stammgast, ohne jemals etwas gekauft zu haben. Ihn interessierten mehr die keifenden und feilschenden Marktweiber. Offenbar betrieb er Milieustudien, fertigte im Stehen Skizzen, um sie in seinem Atelier in sein Monumentalgemälde einzufügen. So auch an jenem Abend. Vielleicht hatte er Clara aufs Korn genommen. Denn immerzu waren seine Blicke auf sie gerichtet.
Clara hatte alles mit Bedacht arrangiert!
Auch Karl Gutzkow war eine in sich gekehrte Natur – dem äußeren Schein nach –, aber eben ganz anders als ihr Robert! Er nahm gewohnheitsmäßig alles auf, hatte nie taube Ohren. Im Gegenteil: für alles ein offenes Ohr! Er konnte komplizierte Themen sekundenschnell verarbeiten, explodierte förmlich nach wenigen Minuten des Schweigens. In der Diskussion führte er eine scharfe Klinge, hatte ein außerordentlich scharfes Urteilsvermögen. Geringste Verzierungen der nackten Wahrheit – man könnte sie auch Lügen nennen – entgingen ihm nicht. Er ging jedem überschwänglichen Schwulst aus dem Wege, bevorzugte es, sich in epigrammatischer Kürze auszudrücken.
Er kam fast zur selben Zeit wie Robert in die Residenzstadt; wurde als Dramaturg an der Bühne bestallt. Mit Leib und Seele glaubte er an eine Wiederbelebung der deutschen Dramatik. Gutzkow hatte in Emil Devrient aber einen gefährlichen Widerpart, der hinter den Kulissen Intrigen spann. Er war ein Meister der Kabale und Liebe, ein Abgott der Frauen. Seine Größe schien unbestritten. Er war der Hamlet unter den Schauspielern – ein göttlicher Emil. Mit diesem Handicap musste Gutzkow wohl oder übel leben, musste ihm nach Belieben die Paraderollen überlassen. In seiner Eitelkeit war Devrient unersättlich. Trotzdem mochte ihn Clara. Eben wie die meisten Frauen!
Dicht um den Kamin hockte ein Dreigespann. Es schien unzertrennlich zu sein. Alle drei waren passionierte Zigarrenraucher. Sie wussten, dass Clara auf Zigarrenrauch allergisch reagierte. Deshalb hatten sich die drei am Kamin niedergelassen. Professor Röckel streifte unschlüssig die Asche seiner Zigarre an den Rand des Aschenbechers. Verlegen strich er sich über die schütter behaarten Wangen, die ständig wie unrasiert aussahen. Er war gerade im Begriff, einen Kommentar über die Ereignisse der letzten Tage abzugeben, aber Heubner kam ihm zuvor:
„Den Könneritz hätten wir ja los“, meinte er gedankenverloren.
„Ja, Julius Traugott hat sich schmollend auf sein Rittergut in Erdmannsdorf zurückgezogen, wie ich hörte. Der König hat ihm den Rücktritt nahegelegt, nachdem die Proteste in der Kammer zu eskalieren drohten. Es herrschten zuletzt tumultartige Zustände. Im Frühjahr hat er das Handtuch geworfen. In Erdmannsdorf kann er mit dem Preußenkönig Gedanken austauschen, wenn er denn mal sein Landgut besucht“, grübelte Röckel gedankenverloren.
„August, wo denkst du hin! Der Könneritz ist ein Stehaufmännchen. Er ist jetzt sächsischer Gesandter in Wien!“, gab Heubner zum Besten.
„Wenn ich an das Jahr 1845 denke, geht mir heute noch der Hut hoch. Vielleicht war ihm am Leipziger Gemetzel am 12. August keine direkte Tatbeteiligung nachzuweisen, aber er hatte als Ministerpräsident eine wesentliche Mitverantwortung. Die Hauptschuld an dem Massaker, bei dem acht unbewaffnete Demonstranten starben, wurde später dem damaligen Kriegsminister von Nostitz-Wallitz, ein bloßer Soldat und blind ergebener Diener seines Dienstherrn, angelastet. Sehr gut möglich ist auch – die wahren Umstände wurden bis heute nicht aufgeklärt –, dass der Kriegsminister vom Prinzen Johann, dem Bruder des Königs Friedrich August, direkt persönlich den Befehl erhalten hat, den Platz räumen zu lassen.“
„Welche Umstände hatten damals zu diesem verheerenden Zwischenfall geführt?“, wollte Semper wissen.
„Prinz Johann speiste an jenem Abend im ‘Hotel de Prusse’ am Rossplatz. Als Generalkommandant sämtlicher Kommunalgarden Sachsens besuchte er eine Revue, zu der ihn die Leipziger Kommunalgarden eingeladen hatten. In der Nähe sammelten sich Demonstranten, die patriotische Lieder sangen und Hasstiraden gegen die Jesuiten ausstießen und wohl auch gegen den unbeliebten Prinzen, der ja bekanntermaßen ein orthodoxer Katholik ist. Schließlich flogen Steine gegen die Fenster des Hotels. Als der Prinz hastig das Hotel verließ, das heißt flüchtete, gab er dem Kriegsminister den verhängnisvollen Befehl, den Platz räumen zu lassen. Er rief das königliche Militär, das die Demonstranten in die Lerchenallee trieb. Dann krachten plötzlich Schüsse. Das Militär richtete ein Blutbad an den unbewaffneten Demonstranten an. Die traurige Bilanz: acht Tote und viele Verletzte. Der Einsatz des Militärs warf viele Fragen auf und erhitzte die Gemüter. Denn zuständig für Recht und Ordnung war die Kommunalgarde, die einfach übergangen wurde.“
„Ja, Könneritz war untragbar geworden. An seinen Händen klebte Blut! Das zu Leipzig so frevelhaft vergossene Blut hatte eine nicht mehr zu füllende Kluft zwischen dem Königshause und dem sächsischen Volk gerissen, durch die fort und fort dieser rote Blutstrom dahinfloss. Jetzt ist sie bis zum Rand gefüllt. Aber, ich denke, wir sind vom Regen in die Traufe gekommen. Braun ist auch nicht besser. Er hat bis heute keine unserer Forderungen erfüllt!“, meinte Otto Heubner süffisant. „Dabei geht es mir nicht nur um die allgemeinen bürgerlichen Freiheiten, die seit dem Abgang von Oberländer arg beschnitten wurden. Nein, es geht mir vor allem um die Anerkennung der in Frankfurt erarbeiteten Reichsverfassung und der in ihr verbürgten Grundrechte durch den sächsischen König! Braun blockiert sämtliche unserer Forderungen. Lediglich zwei Gesetzesvorlagen hat er bisher in seiner Amtszeit zustande gebracht, die einzig allein dem König zugutekamen: eine über die Erhöhung der Einkommenssteuer und die andere über die Verstärkung des stehenden Heeres.“
„Ja, es ist bisweilen wahr, dass ein Teufel den anderen austreibt. Aber man hat dafür den anderen“, meinte Semper lakonisch, während er interessiert den Weg seiner genüsslich ausgestoßenen Rauchringe verfolgte, die im Aufwind der Kaminwärme zur Raumdecke hin strebten, sich dort wie dichte Regenwolken festsetzten.
„Ich erinnere mich noch sehr genau an die Ereignisse, die sich im Frühjahr abgespielt haben. Als Könneritz durch Dr. Braun am 12. März ersetzt wurde, schwamm ganz Dresden, trunken vor Begeisterung über den unblutig errungenen Sieg, in einem Lichtermeer, und der König, wo er sich auch zeigte, wurde überall mit lautem Jubel begrüßt, während zur selben Zeit in Wien die furchtbarsten Kämpfe tobten“, bekräftigte Stöckel Heubners Standpunkt.
„Ja, der König zeigte sich damals dem Volke im Schafpelz. Dem ganzen Theater war ein monatelanges Tauziehen um die Aufhebung der strikten Pressezensur vorausgegangen. Unter Robert Blum und Arnold Ruge trat am 29. Februar eine Leipziger Bürgerversammlung zusammen und verabschiedete eine Resolution an den König mit der Forderung nach Pressefreiheit und Einberufung eines deutschen Parlaments. Dieser Forderung fügten Leipziger Buchhändler noch eine besondere Erklärung ‘gegen die Schmach der geistesmörderischen Zensur’, sowie ‘gegen die willkürliche Unterdrückung von Büchern und Zeitschriften’ hinzu. Die Leipziger Stadtverordneten gingen sogar noch weiter mit ihren Forderungen! Sie verlangten den Rücktritt des Ministeriums, ein allgemeines Wahlrecht, die Freiheit des Wortes, politische Gleichberechtigung aller Staatsbürger und schließlich die Herstellung eines einigen deutschen Vaterlandes. Diese gewaltige Flutwelle an Forderungen suchte man von Seiten der Regierung einzudämmen, indem man sämtliche Zensoren damit beauftragte, die jüngsten revolutionären Ereignisse in Frankreich, Baden und Württemberg totzuschweigen!“ Heubner schäumte vor Wut.
„O tempora! O mores! Es ist zum Haare raufen!”, fluchte Röckel. „Die Unterdrückung des freien Wortes, das bis ins Heiligtum des Hauses und der Familie eindringende Spionier- und Denunziationswesen – kurz: dieser ganze Pfuhl von Abscheulichkeiten – musste die Seele jedes Zugewanderten, wie ich einer bin, zum Kochen bringen. So ist denn auch leicht begreiflich, dass meine Seele der gewaltigen erlösenden Bewegung der Märztage wonnetrunken entgegenschlug und jubelnd den finsteren Alp abschüttelte, der sie schwerer wohl bedrückt hatte als viele andere.“ Plötzlich kam ihm eine Erleuchtung. Seine Augen funkelten. Er klopfte den neben ihm sitzenden Heubner beherzt auf die Schulter: „Otto, starten wir eine Unterschriftenaktion für die Reichsverfassung!“, rief er triumphierend, als hätte er den Stein der Weisen gefunden.
„Du meinst, eine Adressbewegung anschieben?“, fragte Heubner zweifelnd.
„Ja, Sammeln wir in ganz Sachsen Unterschriften für die Annahme der Frankfurter Reichsverfassung! Legen wir das Votum dieser Unterschriftenaktion dem sturen Kanzler Braun auf sein Rednerpult, damit er sich von der realen Stimmung im Lande überzeugen kann.“ August Röckel blickte fragend in die Runde, zog an seiner Zigarre und blickte befriedigt dem aufsteigenden Rauch hinterher.
Semper war kein Jurist und auch kein Kammermitglied. Er war in seinem Herzen Republikaner, auf der anderen Seite aber weitestgehend loyal gegenüber seinem König, dem er seine Anstellung zu verdanken hatte. In den juristisch-salvatorischen Klauseln kannte er sich nicht aus.
„Meine Herren, für die Annahme der Reichsverfassung stimme ich auch, aber nur unter der Bedingung, dass ein Monarch ihr vorsitzt“, mischte er sich ein.
„Du meinst, eine Monarchie? Keine Republik?“, vergewisserte sich Röckel, als habe er Semper nicht verstanden. Sempers Einstellung enttäuschte ihn über alle Maßen. „Wenn nicht mal drei an einem Tisch zu den Grundfragen der künftigen deutschen Nation Übereinstimmung bekunden, wie soll in Frankfurt unter mehreren Hundert Delegierten eine tragfähige Mehrheit zustande kommen?“
„Für Frankfurt sehe ich schwarz. Die Delegierten haben sich in drei Lager gespalten: links, mittig und rechts außen. Man kann auch sagen: in die Radikalen, die Gemäßigten und die Königstreuen. Die Abgeordneten sind so zerstritten, dass sie sogar getrennt in verschiedenen Gaststätten speisen“, sagte Otto Heubner resigniert, der sich selbst zum linken Flügel in der Paulskirche zählte.
„Die Radikalen wollen eine wirkliche Volksrepublik. Die Zugehörigkeit der österreichischen Monarchie zum künftigen Deutschen Bund hat sich bereits überlebt! Schwarzenberg hat ihm eine klare Absage erteilt. Viele slawische Völker bestehen auf ihrer Eigenständigkeit. Also bliebe nur eine abgespeckte deutsche Republik – eine Republik ohne die k.u.k.-Monarchie. Die Anhänger des gemäßigten Flügels haben einen letzten Versuch unternommen, durch Zugeständnisse an die österreichischen Gesandten, in letzter Minute doch noch einen Konsens zu erreichen. Als Kaiser Franz I. nach der Niederlage Napoleons das Heilige Römische Reich Deutscher Nation restaurierte, sicherte er Habsburg die führende Position. Die deutschen Völker protestierten dagegen nicht, da sie sich noch in einem Tiefschlaf befanden. Aber jetzt sind die ‘Deutschen Völker’ aufgewacht, und der König von Preußen schickt sich an, die Hohenzollern an die Spitze eines vereinigten Deutschlands zu stellen. Ein Vielvölkerstaat unter einem Dach? Für eine Bruthenne wohl einige Eier zu viel, um sie alle ausbrüten zu können. Am besten wäre es, einige nicht zu bebrüten, zum Beispiel die Ungarn und die Balkanvölker. Robert Blum weilt zurzeit in Wien zu Verhandlungen. Wir hoffen sehr, dass er mit verwertbaren Ergebnissen nach Frankfurt zurückkommt“, ergänzte Otto Heubner seine Ausführungen. Seine Diskussionspartner wussten, dass sich keiner so vehement wie Heubner für eine republikanische Verfassung einsetzte.
„Semper, es gibt nur schwarz oder weiß! Wer nicht für uns ist, ist gegen uns! Du musst dich entscheiden, wo du stehst! Für die Republik oder für die Monarchie!“, redete Röckel auf den wankelmütigen Semper ein. „In meinen jungen Jahren bin ich viel in der Welt herumgekommen. Den großen Lafayette, der an der Seite Washingtons für die amerikanische Unabhängigkeit gekämpft hat – den Schöpfer der ‘Trikolore’ –, habe ich seinerzeit im Juli 1830 in Paris getroffen. Ihm war es letztlich zu verdanken, dass in Frankreich die konstitutionelle Monarchie eingeführt wurde. Er wollte keine Republik! Er hat den Despoten Karl X. vom Sockel gestoßen und Louis-Philippe auf den Thron gehievt, aber er hat ihm dafür auch Fesseln angelegt.“
„Zweifelt ihr etwa an meiner republikanischen Loyalität?“, wehrte sich Semper energisch gegen diese Verdächtigung.
„Nein, keineswegs, Gottfried!“, beeilte sich Röckel, seine Kritik an Semper zu relativieren. „Wir wissen, dass du prinzipiell für eine freie Entfaltung des Bürgertums bist. Ohne bürgerliche Freiheiten kann unsere Industrie den gewaltigen Rückstand gegenüber England nicht wettmachen. Und die Bauern verharren noch immer teilweise in der nicht mehr zu tolerierenden Abhängigkeit ihrer Gutsbesitzer. Nur ein freier Bauer kann die Ernährung der explodierenden Bevölkerung sicherstellen. Ein weiteres Hungerjahr würde das Fass in Sachsen zum Überlaufen bringen.“
Die drei waren so intensiv in Diskussionen verstrickt, dass sie die hinter ihrem Rücken stehende Clara nicht bemerkten. Da sie glaubte, sie ignorierten ihre Anwesenheit, klopfte sie Röckel auf die Schulter. Der ließ vor Schreck seine Zigarre auf den Fußboden fallen und drehte sich um.
„Entschuldige meine Unhöflichkeit, liebe Clara, aber ich habe dich nicht bemerkt“, antwortete er ratlos. Die drei erhoben sich brav. Jeder bot ihr seinen Sitzplatz an.
„Danke meine Herren. Ich möchte Sie zum Mitternachtsmahl einladen. Die Köchin hat angerichtet. Sie möchte die Suppe warm servieren.“ Es mochte nach der Aufforderung noch eine viertel Stunde vergangen sein, bevor sich der Salon gelehrt hatte. Gustl betrat den Raum und riss die Fenster auf. Die Luft war stickig, schwere Rauchschwaden hingen an der Zimmerdecke.
Wie durch ein Wunder tauchte Robert plötzlich wie aus dem Nichts auf. Er strahlte über das ganze Gesicht. Clara wusste sofort, dass etwas Großartiges geschehen war. Sie ging ihm entgegen. „Chiara, es ist vollbracht!“
„Du hast die Sonate fertig?“, fragte sie ungläubig.
„Ja!“ – Clara war außer sich vor Freude. Sie rannte mehrmals, mehr tanzend wie ein ausgelassenes Kind, um die bereits am Tisch versammelte Gesellschaft. Dabei schrie sie fortwährend:
„Robert hat die Freiheitssonate fertig!“ Keinen hielt es mehr auf seinem Platz. Alle umringten Robert, gratulierten ihm. Keiner der Anwesenden hatte damit gerechnet, Robert an diesem fortgeschrittenen Abend jemals noch zu Gesicht zu bekommen. Clara eilte in die Bodenkammer, um die Partitur zu holen. Triumphierend schwenkte sie die Blätter über ihren Kopf. Die Köchin und die Gouvernante standen schüchtern an der Türschwelle. Ratlos betrachteten Sie die aufgelöste Gesellschaft. Dann fasste die Köchin Robert resolut am Arm und zerrte ihn auf seinen Platz.
„Das Essen ist fertig!“, rief sie in den Tumult. Das zeigte Wirkung. Jeder begab sich auf seinen Platz. Paula hätte sich schwarz geärgert, wenn Klagen über eine kalte Suppe ihr zu Ohren gekommen wären. Flugs servierte sie der nächtlichen Tischgesellschaft die noch dampfende Brühe mit den Markklößchen. Als Beilage gab es Schwarzbrot. Die Diskussionen verstummten.
Nach dem Mahl zog man sich wieder in den Salon zurück, um an die zuvor abgebrochenen Diskussionen anzuknüpfen. Zwischendurch wurde schwarzer Kaffee mit Pralinen gereicht. Clara bat Robert inständig, aus seiner neusten Komposition vorspielen zu dürfen. Nach einigen Minuten des Zögerns nickte er mit dem Kopf als Zeichen seiner Zustimmung. Während sich Clara ans Piano setzte, verzog sich Robert in einen stillen Zimmerwinkel. Clara überflog kurz die sauberen Notenblätter, die kaum Korrekturen enthielten, als wären sie druckreif, strich sich danach mit beiden Händen über ihr mittig gescheiteltes glattes Haar, machte noch einige Fingerübungen. Dann spielte sie wie aus einem Guss. Der Marsch riss alle Anwesenden im Saal von den Sitzen. Als sie plötzlich verstummte, stürmten sie auf Robert zu, der still und bescheiden in seiner Ecke ausharrte, und überschütteten ihn mit stürmischen Ovationen. Plötzlich stimmte Röckel die Marseillaise an, vielstimmig fielen die anderen ein, als ob ein Sturm losbräche. Das Echo drang durch die geöffneten Fenster weit bis ins Zentrum der Stadt. Bestürzt stürmte die Köchin ins Zimmer und schloss eilig die Fenster.
„Die Wände haben Ohren!“, rief sie ängstlich. „Die Langohren und Spitzel sind derzeit überall.“ Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Die Sturmflut ließ sich nicht mehr aufhalten. Clara kramte eilig aus einer Kommode eine schwarz-rotgoldene Fahne und schwenkte sie im Kreise.
Robert packte indessen das nackte Entsetzen. Für ihn war es unfassbar, dass seine Freiheitsgesänge diesen Exorzismus auslösen konnten. Das hatte er nicht gewollt! Panik erfasste ihn. In Gedanken sah er auf den Straßen ein Heer randalierender Vermummter, die in ihrer zerstörerischen Wut Andersdenkende federten, wie Vieh vor sich hertrieben, Bücher verbrannten und Paläste den Flammen opferten. Voller Verzweiflung riss er die Notenblätter an sich, warf sie in den Kamin und flüchtete in seine Dachkammer, wo er sich geborgen fühlte. Solche Anfälle von Panik und Angst häuften sich in letzter Zeit. – Neben vielen positiven Charaktereigenschaften sei seine Ängstlichkeit Teil seines Gesamtcharakters, der sich in seiner besonderen Schädelform verinnerliche. Das habe vor zwei Jahren der englische Arzt und Phrenologe Robert R. Noël herausgefunden, als er in Maxen Roberts Kopf vermessen durfte. .
„Liberté, égalité, fraternité!“, riefen die in Ekstase geratenen fröhlichen Zecher frenetisch, die zu spätmitternächtlicher Stunde dem Wein sehr zugesprochen hatten. Die Parole wie eine Endlosplatte wiederholend, lagen sie sich bis zum Morgengrauen seufzend in den Armen. Robert hatten sie nicht vermisst.
3
„Es tut mir sehr leid, Clara! Nirgendwo gibt es goldfarbenes Tuch. Auf dem Markt nicht, im Kaufhaus Renner nicht und bei den Tuchhändlern auch nicht; zumindest nicht die Stoffe, die sich als Fahnenstoff eignen“, klagte Paula, die von Clara den Auftrag erhalten hatte, für Gustl Fahnenstoff zu besorgen.
„Paula, du machst Scherze!“, antwortete Clara.
„Nein, Clara, ich habe mir die Füße wund gelaufen. In sämtlichen Geschäften bekam ich immer nur dieselbe Antwort!“
„Welche?“
„Die Nachfrage nach Fahnenstoff sei in den letzten Tagen und Wochen so gestiegen, dass die Weber und Färber mit der Produktion nicht nachkämen.“ Seit die Nachricht vom Tode Blums durchgesickert war, überrollte eine nie dagewesene Sympathiewelle die Sachsenresidenz. An Fenstern, an Fassaden, ja überall, wohin man auch schaute, wehten nur noch Fahnen in den Farben Schwarz, Rot und Gold! Die grün-weiße „Bicolore“ thronte dagegen einsam, schlaff, trotzig, wie eine Reliquie aus grauer Vorzeit, über dem Schlossturm. Da musste man sich nicht wundern, dass die Weber mit ihren altertümlichen klapprigen Webstühlen den in kurzer Zeit erheblich gestiegenen Bedarf an Fahnenstoff nicht decken konnten.
„Ja, aber liebe Paula, es gibt doch auch Importstoffe aus England!“, konterte Clara.
„Denkst du! Der König hat urplötzlich hohe Importzölle auf Fahnenstoffe verhängt.“
„Sachsen ist doch Mitglied des ‘Deutschen Zollvereins’. Ein Land kann doch nicht einfach ausscheren und aus der Reihe tanzen!“
„Kann es, liebe Clara! Ich habe im Rathaus nachgefragt. Zum Schutze einheimischer Produkte und in Entwicklung begriffener Industrien, kann jedes Land, jedes Fürstentum der deutschen Zollunion, ausländische Waren nach Belieben mit Importzöllen belegen. Die Zollunion gelte nur für die Länder, die ihr angehören“, belehrte die sich fachkundig gemachte Köchin ihre Vorgesetzte.
„Wie kommen wir zu Fahnenstoff?“, fragte Clara ratlos. „Du weißt doch, dass Gustl sich nebenbei etwas verdienen muss. Von der Kinderbetreuung allein kann sie nicht leben. Am Sonntag soll für Robert Blum die Trauerfeier in der Frauenkirche stattfinden. Bis Sonntag will sie ein Dutzend Fahnen nähen, um sie vor der Kirche den Besuchern des Gottesdienstes anzubieten.“
„Ich habe einen Färber gefunden, der Stoffe umfärbt. Der Nachteil ist, dass seine Farben nicht wetterfest sind, sodass bei länger andauerndem Regen heiße Tränen über den Stoff fließen könnten.“
„Paula, geh zum Färber, am Sonntag muss es ja nicht gerade Bindfäden regnen!“, meinte Clara scherzhaft.
Auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche herrschte emsige Betriebsamkeit. Überall, an jeder Ecke, wohin man auch schaute, Polizeipräsenz! Alle Zugänge waren abgesperrt worden. Generalleutnant August v. Schubert, der für die Sicherheit des Königs verantwortlich war, hatte diverse Barrieren und Schikanen aufgestellt, um Massenansammlungen am Neumarkt vorzubeugen. Wer ihn passieren wollte, musste sich Gepäckkontrollen und Leibesvisitationen gefallen lassen. Der Bärenzwinger und die unterirdischen Zugänge zur Elbfestung wurden in aller Eile zugemauert. Lediglich der Fluchttunnel, der von den Gemächern seiner königlichen Hoheit zum Fluss führte, blieb offen. Am Flussufer bewachten Posten den Zugang zum Tunnel und das königliche Dampfschiff, das gegenüber am Kadettengarten vor Anker lag. Schon seit einer Woche durften die Händler nicht mehr auf den Neumarkt, sie mussten auf den Altenmarkt ausweichen. Aber da gab es Reibereien mit den Alteingesessenen. Neue Konkurrenten schmälerten ihre Umsätze. Fast stündlich musste die herbeigerufene Polizei Auseinandersetzungen zwischen den Händlern schlichten und Platzverweise aussprechen.
Am liebsten hätte ja der Kriegsminister von Buttlar, die Totenmesse für Robert Blum verboten. Aber der König wollte es auf das Äußerste doch nicht ankommen lassen. Aus Blum war ein Märtyrer geworden. Ein lebender Blum wäre dem König tausendmal lieber gewesen. Warum hat man ihn nicht wie seinen Begleiter Froebel einfach abgeschoben? Nun musste er mit dem Schlimmsten rechnen. Das aufgebrachte Volk ließ sich so leicht nicht beschwichtigen. Er suchte deshalb durch Kompromisse, eine unkontrollierte Gärung im Weinfass zu verhindern. Der Stadtkommandant ließ sämtliche verfügbaren Truppen am Stadtrand zusammenziehen, um im Notfall, wenn der König in Gefahr geriete, mit Gewalt Tumulte niederzuschlagen. Der Kriegsminister befahl seinen Stadtkommandanten mehrmals zum Rapport. Er wollte auf Nummer sicher gehen. Alle Varianten wurden bis ins Detail durchgespielt. Um den Marktplatz herum sollten an den höchsten Punkten Scharfschützen postiert werden. Ein Jägerbataillon sollte das angrenzende Zeughaus besetzen. Von Buttlar zeigte sich zufrieden über die geplanten Sicherheitsmaßnahmen. Am Tage der Totenfeier sollten außerdem die Zufahrtsstraßen zur Residenz kontrolliert werden, da man mit einem Zustrom von mehreren Tausend Teilnehmern rechnete.
Als Paula und Clara die Absperrungen passieren wollten, um ihre Einkäufe unter den Arkaden zu tätigen, wurden sie von Polizisten daran gehindert.
„Heute ist hier kein Markttag!“, sagte er. „Alle Händler verkaufen heute auf dem Altmarkt ihre Ware.“
„Warum nicht?“, wollte Clara den Grund wissen.
„Es ist so befohlen!“, antwortete der Posten ausweichend. Die Frauen schüttelten verständnislos ihre Köpfe. Clara konnte nicht verstehen, dass ein toter Robert Blum für die Monarchie eine Gefahr darstellte.
Sicher war, dass am kommenden Wochenende die Residenz mit Touristen überfüllt sein würde. Sämtliche Hotels und Herbergen waren im Voraus ausgebucht. Ein Sonderzug aus Leipzig sollte eingesetzt werden. Leipzig war die Redner-Bühne des ehemaligen Rheinländers. Von Leipzig eilte sein Ruf als Vordenker der deutschen Republik bis in die entferntesten Winkel aller deutschen Länder. In Leipzig hatte er auch die meisten Anhänger.
Der Kriegsminister rannte offene Türen ein, um den Sonderzug aus Leipzig zu verbieten. Aber der Präsident der Eisenbahngesellschaft ließ sich nicht umstimmen. Geschäft sei Geschäft, behauptete er. Im Herzen war er ein kühl kalkulierender Geschäftsmann, der Veränderung wollte. Die bürokratischen Hürden im Lande behinderten den Ausbau des Schienennetzes nach Böhmen aufs Äußerste. Dahinter steckte die Königliche Dampfschifffahrt, die den neuen Konkurrenten fürchtete. Jämmerliche zwanzig Kilometer Schienennetz wurden vor einem Monat übergeben – eine Strecke gerade bis Pirna. Jahrelang lagen die Genehmigungsverfahren in verschlossenen Schubfächern. Auch der Brückenbau, der für die Anbindung beider Bahnhöfe nötig wurde, lag im Argen, weil die Dampfschifffahrt auf einer nicht zu realisierenden sogenannten lichten Höhe beharrte. Architektonisch wäre es nach dem Willen der Dampfschifffahrt eine Monsterbrücke geworden, die das harmonische Stadtbild gesprengt hätte, von den Kosten ganz zu schweigen.
„Deutschland ist noch immer wie ein großer Wald, aber voll von Schlagbäumen!“, schimpfte er wie ein Rohrspatz.
Zwei Tage vor der anberaumten Totenfeier für Robert Blum verwandelte sich die Residenzstadt in ein schwarz-rot-goldenes Fahnenmeer. Claras und die anderen Kinder auf der Reitbahnstraße rannten aufgeregt schreiend mit Fähnchen der Freiheitsfarben in den Händen durch die Straßen: „Es lebe die Republik! Es lebe die Republik! Es lebe die …!“
Hillers hatten sich bei Schumanns einquartiert. Während Ferdinand ausgelassen mit den Kindern auf der Straße herumtobte, probierten Antolka und Clara Kleider für eine Wohltätigkeitsveranstaltung, die im „Hotel de Saxe“ stattfinden sollte. Als Solisten waren auch Emil Devrient und Wilhelmine Schröder bereit, ihr Honorar den Hinterbliebenen zu spenden. Das Benefizkonzert war bereits ein Tag nach der Vorankündigung ausverkauft. Die Sympathiewelle, die von dem Märtyrer ausging, drohte überzuschwappen.
Die Spendenbereitschaft der Bürger war grenzenlos. Die Ärmsten opferten ihr letztes Hemd. Spendensammler der Montagsgesellschaft, Liedertafel, Vaterlands- und Handwerkervereine gingen von Haus zu Haus, standen auf den Märkten, ja fast an jeder Straßenecke. Eine nie zuvor gekannte Solidaritätsaktion war angelaufen. Trauer, aber zugleich auch endlose Wut, hatte die Republikaner über den infamen, hinterhältigen Mord ihres Idols erfasst.
Bereits kurz nach Mitternacht war eine Abordnung der Silberberger Bergknappen in die Residenzstadt aufgebrochen. In einem Meer unzähliger Fackeln und Lichter glich ihr Aufzug eher einer entschlossenen militanten Einheit. Jeder Bergknappe hatte sein Fäustel und Bergeisen als Zeichen seiner Zunft bei sich. An der Spitze des Zuges marschierte die Bergkapelle. Sie stimmte beim Auszug aus der Stadt das Hohelied der Bergleute an. Der Bergmannsmarsch ließ die Herzen der begeisterten Zuschauer, die zur feierlichen Verabschiedung der Bergknappen zur Geisterstunde gekommen waren, höher schlagen. Nicht verschwiegen werden darf, dass bei der Auswahl der limitierten Abordnung ein heftiger Streit entbrannt war. Da Tausende Bergknappen beim Marsch in die Residenz dabei sein wollten, musste schließlich das Los entscheiden. Aus der Knappschaftskasse wurden nur die Kosten für zweihundert Knappen genehmigt. In einer feierlichen Zeremonie, die im Dom durch den Bischof vorgenommen wurde, erhielten die Delegierten den Segen des Heiligen Stuhls.
Etwa zur selben Stunde wurden Abordnungen der Hüttenknappschaften aus Schneeberg und Annaberg von ihren Bürgern feierlich verabschiedet, die Insignien ihrer Zunft – Furkel, Stecheisen und Glätthaken – bei sich führend. Ihr Marsch glich einem Triumphmarsch. Die Einwohner strömten zu nachmitternächtlicher Stunde aus ihren Hütten, um die Marschkolonnen frenetisch zu begrüßen und zu bewirten. Schon von weitem kündigte ein vorauseilendes Wetterleuchten ihr Kommen an, ein Lichtermeer aus brennenden Fackeln und Laternen. Der Musikchor begleitete sie mit munteren Marschliedern. Es war kein Trauermarsch! Nein! Der Marsch der Knappschaften in die Residenzstadt gestaltete sich zu einem wahren Triumphmarsch. Die Bewohner der Ortschaften, die sie passierten, solidarisierten sich mit ihnen und füllten ihre Spendenkassen. Die Knappschaften trugen den Keim der bürgerlichen Revolution von Ort zu Ort. Er breitete sich wie eine Infektionskrankheit endemisch aus. Kaum einer war gegen den hoch virulenten Keim „Revolution“ gefeit. Seit den Bauernkriegen hat das Sachsenland diese Welle der Sympathie und Begeisterung nicht mehr erlebt.
In den frühen Morgenstunden hatten die ersten Abordnungen das Weißeritztal erreicht, wo Gottlieb Traugott Bienert seine Mühle betrieb. Er hatte indes eine schlaflose Nacht hinter sich. Er buk Brote ohne Unterlass. Er gehörte zur Gilde der „Platzbäcker“, die nur Schwarzbrot backen durften. Es war Ehrensache, die vorübermarschierenden Knappschaften zur Einkehr einzuladen. Am Fluss konnten sie sich erfrischen, in der Mühle ausruhen, sättigen und für bevorstehenden anstrengenden Tag neue Kraft schöpfen.
Amtshauptmann Heubner war mit einer Droschke unterwegs, um die Knappen vor den Stadttoren herzlich zu empfangen. Die letzten Marschkilometer legte er in den Reihen der Knappen zurück. Gegen Mittag erreichte der feierliche Zug das Stadtzentrum. An jeder Straße, die der Bergmannszug passierte, bildete sich ein dichtes Spalier begeisterter Zuschauer. Im Meer der schwarz-rot-goldenen Fahnen legte er die letzten Meter bis zum Neumarkt im Triumphzug hin. Alle Glocken läuteten Sturm. In der Mittagssonne des strahlenden Novembertages glänzten ihre Paradeuniformen. Die Bergmannskapelle stimmte die Marseillaise an. Eine Welle der Verbrüderung setzte ein. Alles schrie – erst durcheinander, dann im Chor – „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!“ Die Parole der Pariser Kommune wurde, unzählige Male wiederholend, zu einer Endlosplatte.
In unübersehbaren Scharen überschwemmte das schwarz gekleidete Volk den Neumarkt. Es glich von fern einer Invasion unzähliger Rabenvögel, einer einzigen schwarzen Wolke. Das Pack hatte sich nicht aufhalten lassen, ihrem Robert die letzte Ehre zu erweisen. Die polizeilichen Absperrungen wurden durchbrochen. Der König weigerte sich, von Buttlar den Schießbefehl zu erteilen. Seine Knie wurden weich, da er die Verantwortung über seine Folgen scheute. Nur eine schmale Gasse zum Portal der Frauenkirche blieb offen. Durch sie marschierten unter kräftigen Hurra-Rufen die Bergknappen aus Silberberg, dahinter die Abordnungen der Hüttenknappen.
Der Stadtkommandant hatte sich auf Befehl des Kriegsministers mit seinen zweitausend Grenadieren auf die andere Elbseite zurückziehen müssen. Sie schlugen ihre Zelte am Blockhaus auf. Sollte der König durch den Tunnel fliehen müssen, würde der Kommandant, ohne zu zögern, den Schießbefehl auf die Demonstranten erteilen.
Mindestens fünftausend Leiber drängten sich in die Frauenkirche, obwohl nur Platz für zweitausend war. Bis auf die reservierten Ehrenplätze waren die Sitzplätze bereits zur Mitternachtsmesse besetzt worden. Keiner verließ danach mehr die Kirche, wohl wissend, dass er keine Platzgarantie hatte. Viele dösten bis zur ersten Frühmesse vor sich hin; viele schliefen auf ihren Plätzen ein, andere palaverten in Gruppen über das bevorstehende Großereignis.