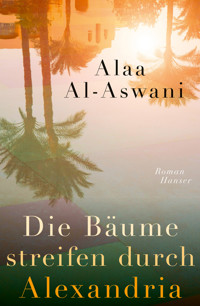
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Diese Stadt wird dich umfangen – ganz gleich, welche Sprache du sprichst oder woher du stammst.« Ein Abgesang auf das kosmopolitische Alexandria von Alaa al-Aswani Der große Alexandria-Roman des bedeutendsten arabischsprachigen Autors der Gegenwart: In den sechziger Jahren trifft sich eine Gruppe von Freunden – ein Grieche, ein Italiener, eine Französin sowie ein Jude und ein Araber – in einem Café in Alexandria, um Widerstand zu leisten gegen die ausländerfeindliche Politik der Regierung Nassers. Die bunte Gesellschaft spricht Arabisch miteinander, sie alle verstehen sich als Teil des kosmopolitischen Alexandria. Doch der Nationalismus der verblendeten Herrscher treibt sie auseinander und zerstört nicht nur ihre kleine Gemeinschaft, sondern die multikulturelle Essenz der legendären Hafenstadt. Spannend und mit schwarzem Humor erzählt Alaa al-Aswani von der vergebenen Chance einer offenen Gesellschaft in Nahost.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
»Diese Stadt wird dich umfangen — ganz gleich, welche Sprache du sprichst oder woher du stammst.« Ein Abgesang auf das kosmopolitische Alexandria von Alaa al-AswaniDer große Alexandria-Roman des bedeutendsten arabischsprachigen Autors der Gegenwart: In den sechziger Jahren trifft sich eine Gruppe von Freunden — ein Grieche, ein Italiener, eine Französin sowie ein Jude und ein Araber — in einem Café in Alexandria, um Widerstand zu leisten gegen die ausländerfeindliche Politik der Regierung Nassers. Die bunte Gesellschaft spricht Arabisch miteinander, sie alle verstehen sich als Teil des kosmopolitischen Alexandria. Doch der Nationalismus der verblendeten Herrscher treibt sie auseinander und zerstört nicht nur ihre kleine Gemeinschaft, sondern die multikulturelle Essenz der legendären Hafenstadt. Spannend und mit schwarzem Humor erzählt Alaa al-Aswani von der vergebenen Chance einer offenen Gesellschaft in Nahost.
Alaa al-Aswani
Die Bäume streifen durch Alexandria
Roman
Aus dem Arabischen von Markus Lemke
Hanser
Für meinen guten Freund John-Paul Capitani, der diesen Roman liebte, als er noch eine Idee war, und aus unserer Welt schied, ehe er ihn lesen konnte
Die Stadt wird dir folgen. In Straßen wirst du umherirren,
dieselben sind’s. Und wirst in denselben Vierteln alt;
und einst in denselben Häusern ergrau’n.
Immer kommst du an in dieser Stadt. Auf eine andere —
hoffe nicht —
es gibt kein Schiff für dich, keine Straße.
Konstantinos Kavafis, Die Stadt
1
10. September 1964
Würde man zum ersten Mal im Artinos vorstellig, kein Zweifel, man bekäme gesagt, ohne vorherige Reservierung sei dort kein Tisch zu bekommen. Und zweifellos würden sie einem auch erzählen, was prominenten ägyptischen und ausländischen Persönlichkeiten dort schon widerfahren war, die ohne Reservierung erschienen waren. Der Inhaber Georges Artinos persönlich hatte sie begrüßt, hatte sich entschuldigt, höflich und voller Bedauern, und sie eingeladen, ihr Essen doch an der Bar einzunehmen, so ihnen beliebte. Einige nahmen das Angebot an, andere lehnten ab und zogen von dannen, aber alle lernten sie, Regeln waren im Artinos geschaffen, um durchgesetzt zu werden. Doch sobald man durch die Tür tritt, geht einem auf, der Ruf des Artinos ist nur zu begründet, und gewiss gehört es zu den besten Restaurants in Alexandria, ja in ganz Ägypten. Jeden Abend werden die Speisen dort zur Klavierbegleitung des armenischen Pianisten Aram serviert, und an jedem ersten Freitag des Monats organisiert das Restaurant ein Tanzdinner. Ganz zu schweigen von den feierlichen Empfängen zu Weihnachten und Neujahr, zum Sham an-Nassim und zum Osterfest. An den Wänden wird man Bilder ägyptischer und internationaler Prominenz sehen, ehemalige Gäste, Filmstars, gefeierte Sänger und Musiker, Sportstars und Staatsmänner. An der Wand gegenüber der Eingangstür hing einst im Goldrahmen ein großes Porträt Seiner Majestät König Faruqs I., dessen erhabene Güte im Jahre 1947 der Belegschaft des Artinos zuteilwurde, als er sie mit seinem königlichen Besuch beehrte. An jenem Tag war das gesamte Restaurant ausschließlich Seiner Majestät dem König und dessen Entourage zu Diensten, worauf Seine Hoheit erlaubte, sein Porträt zur Erinnerung aufzuhängen. Im Jahre 1952 putschte sich das Militär an die Macht, zwang den König abzudanken und rief die Republik aus, was Georges Artinos bewog, das Porträt abzunehmen und an seine Stelle ein Gemälde gleicher Größe zu hängen, das die Mitglieder des Revolutionären Kommandorats in Uniform zeigte, umgeben von der Volksmenge. Dieses Bild sollte einige Jahre hängen bleiben, bis Gamal Abd an-Nasser ganz allein die Macht übernahm und zu Ägyptens Präsidenten wurde. Georges Artinos weilte da schon nicht mehr unter den Lebenden, und das Restaurant wurde von seiner Tochter Lydda übernommen. Sie war dem Ratschlag einiger alter Kunden gefolgt und hatte das Gemälde des Revolutionären Kommandorats durch ein Porträt des Präsidenten Abd an-Nasser ersetzt, in Originalgröße und prächtigem, vergoldetem Rahmen, der mit einem ganzen ägyptischen Pfund zu Buche geschlagen hatte. Die Abbildungen der Mächtigen konnten wechseln, doch blieb das Artinos, was es immer gewesen war, nämlich ein erstklassiges Lokal. Einige der alten Kunden verließen wohl Ägypten, doch viele hielten ihrem Lieblingsrestaurant weiter die Treue, sosehr auch die Angehörigen der neuen Führungsschicht (die Offiziere und ihre Familien) das Artinos ablehnten. Sie genossen zwar ein sorgenfreies Leben und eiferten der Aristokratie darin in allem nach, bezogen Häuser und Prachtappartements, welche die Enteignungsbehörde von »Staatsfeinden« beschlagnahmte und ihnen umsonst oder gegen eine symbolische Miete überließ, so wie sie auch in den Genuss kostenloser Mitgliedschaften im mondänen Gezira Sporting Club oder dem Alexandria Sporting Club kamen und ihre Kinder auf die besten Schulen des Landes schickten. All dies war den neuen Machthabern wohl verfügbar, im Artinos jedoch begegnete ihnen eine reservierte und abweisende Atmosphäre. Die Speisekarte war auf Französisch, schwierig zu behalten und auszusprechen, und auch sonst hatten die neuen Herren mit einer Vielzahl von unvertrauten Gepflogenheiten zu kämpfen. All dies vergällte ihnen den Genuss, weswegen sie die einschlägigen Restaurants orientalischer Provenienz bevorzugten, wo man sie uneingeschränkt herzlich begrüßte, und sie das Essen vorfanden, das sie liebten.
Im Artinos indes war alles elegant und von penibelster Sauberkeit: angefangen von den Tischdecken, Gläsern und Tellern bis hin zu den blank geputzten, wohlriechenden Toiletten. Die Angestellten waren die Höflichkeit in Person, angefangen von Kamil, dem Concierge, über die schöne Cristina, die einen mit ihrem bezaubernden Lächeln begrüßte, einem den Mantel abnahm und dafür eine Nummer aushändigte, bis hin zu den Kellnern in ihren roten Jacketts und blütenweißen, gebügelten Hemden, ihren schwarzen Fliegen und akkurat rasierten, geschniegelten Schnurrbärten, dem stets ordentlich gekämmten Haupthaar und den mustergültig geschnittenen Fingernägeln, die Georges Artinos höchstpersönlich zu kontrollieren pflegte, ehe er sie ihren Dienst antreten ließ. Die Kellnerinnen dagegen, ganz in Rot und Weiß gekleidet, waren allesamt ausgesuchte Schönheiten, trugen das Haar aufwendig frisiert, waren im Gesicht nur dezent geschminkt, hatten aber schlank zu sein, darauf legten der Patron Georges Artinos und später seine Tochter Lydda nachdrücklichen Wert. Es ging so weit, dass sie dafür jemanden kündigen konnten.
Das Gebäude, in dem das Artinos residierte, verfügte über zwei Etagen. Im Erdgeschoss befand sich das Restaurant, mit Eingang von der Corniche her, und einem zweiten, der auf die Tram-Straße ging, und im oberen Stockwerk befanden sich zwei kleinere Säle für besondere Anlässe und eine kleine Bar.
Neben dem guten Essen, den exquisiten Alkoholika, den vorzüglichen Weinen und der Musik schätzten die Gäste des Artinos vor allem das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Kaum hatte man das Restaurant betreten, fühlte man sich, als sei man eine wichtige, hochgestellte Persönlichkeit, als stünde man vor einer Kamera oder erlebte einen bedeutenden historischen Augenblick. Doch der ausgesucht freundliche Empfang war weder gekünstelt noch berechnend, war vielmehr ein Verdienst Georges Artinos’, der nicht müde wurde, seinen Angestellten zu sagen: »Vergiss nicht: Der Gast ist es, der deinen Lohn zahlt, der Dutzende andere Lokale hat liegen lassen und sich für unser Restaurant entschieden hat. Du musst ihm immer das Gefühl geben, dass du erfreut und geehrt bist, ihn zu begrüßen.«
*
Wer einen Tisch am Fenster mit Blick aufs Meer hat, wird abends um sechs ein weißes Ford Thunderbird Cabrio (Modell 1957) mit luxuriöser roter Lederpolsterung erblicken. Kaum ist der Wagen aufgetaucht, so kommt schon Arabi, der Parkplatzanweiser, angehastet, um die Tür zu öffnen, und ein junger, berückend gut aussehender Mann steigt aus, dessen Garderobe alles andere als konventionell und von nachgerade chaotischem und rebellischem Charakter ist und seine besondere Anmut erst zu komplettieren scheint. Wüsste man nicht, wer dieser junge Mann ist, man wäre der festen Überzeugung, es handele sich um einen Filmstar oder einen verwöhnten reichen Schnösel und nicht um einen Restaurantangestellten. Und nur wenig später steht dieser vor einem im roten Jackett und blütenweißen Hemd mit schwarzer Fliege, verbeugt sich und sagt mit gewinnendem Lächeln: »Bonsoir. Ich bin Carlo Sabatini, der Maître d’Hôtel. Ich hoffe, es ist alles nach Ihren Wünschen.«
Denn Lydda Artinos führt das Restaurant vom Vormittag bis abends um sechs, um danach die Leitung Carlo Sabatini zu übertragen. Würden wir das Restaurant mit einem Orchester vergleichen, dann wäre Carlo der Maestro, der die Musiker anleitet und den Takt vorgibt, um eine mächtige, beeindruckende Komposition zur Aufführung zu bringen. Carlo begutachtet alle und alles: angefangen von den Köchen, bei denen er immer wieder nicht nur ihre Kleidung kontrolliert, sondern all ihre Verrichtungen überwacht; als Nächstes hat er die Kellner besonders im Auge, damit sie sich an die Servicevorschriften halten, und schließlich die Gäste, denen Carlo mit Ehrerbietung zur Verfügung steht, insbesondere den neuen Gästen. Diese sind oft eingeschüchtert von seiner strahlenden Schönheit und der packenden kinoreifen Erscheinung, doch immer wieder gelingt es ihm schnell, sie für sich zu gewinnen: So trägt er mit einer Hand Teller ab, tauscht eigenhändig einen vollen Aschenbecher gegen einen leeren aus oder beugt sich vor und steckt mit seinem Feuerzeug die Zigarre eines Gastes an, als wollte er sagen: »Ja, wie Sie sehen … Ich bin hier zu Ihren Diensten.«
Offiziell schließt das Artinos um Mitternacht. Dann legt Carlos Gesicht den protokollarischen, wohlerzogenen und angelegentlichen Ausdruck ab und nimmt stattdessen eine milde, freundschaftliche Miene an, mit der er zu der kleinen Bar im oberen Stockwerk emporsteigt, wo ihn eine kleine Schar von Freunden freudig begrüßt, die ihre Zusammenkunft auf Englisch als »the Caucus« zu bezeichnen pflegen — »der Ausschuss«.
Diese Bezeichnung hatte ihnen vor Jahren, spaßeshalber, ihr Freund, der amerikanische Konsul in Alexandria, beschert: Der Begriff »Caucus« meine die regelmäßige Zusammenkunft einer Gruppe von Menschen, die ein gemeinsames politisches Interesse verbinde. Der amerikanische Konsul hatte seinen Dienst schon lange beendet und Alexandria verlassen, doch die Mitglieder des »Ausschusses« hatten ihre Sitzungen beibehalten, kamen spätabends zusammen und ließen ihren Gedanken die Zügel schießen, die mit jedem Drink ohne Aufpasser und ohne Grenzen losstoben. Einige der Anwesenden pflegten im Restaurant zu Abend zu essen und sich dann über die Haupttreppe zu der kleinen Bar im Obergeschoss zu begeben, während andere direkt dorthin gelangten, durch eine kleine Tür zur Tram-Straße und über eine wenig bekannte Treppe. Die Ausschussmitglieder widmeten sich Gespräch und Umtrunk, solange sie wollten, und wurden von Carlo höchstpersönlich bedient, gegen ein großzügiges Bakschisch.
In jener Nacht waren die Mitglieder des Caucus vollzählig zugegen. Am äußersten Ende der Bar saß der Rechtsanwalt Abbas al-Qoussi, im grafitfarbenen Anzug und weißen Hemd mit akkurat gebundener blauer Krawatte, und neben ihm seine Gattin Noha ash-Shawarabi (die Tochter des verstorbenen Ismail Pascha ash-Shawarabi). Madame Noha war eine dunkelhäutige Schönheit in ihren Dreißigern und arbeitete als Reiseleiterin. Am anderen Ende der Bar saß Lydda Artinos, die Inhaberin des Restaurants, und neben ihr, wie immer, der bildende Künstler Anis as-Sayrafi, der eine weinrote Fliege zu weißem Hemd und blauer Baumwolljacke trug. In der Mitte der Bar saß Tony Kazan, ein sanftmütiger und beleibter Mann um die vierzig, dessen Hemd und Hose breit in Weiß und Blau gestreift waren. Er hatte ein Paar schwere Augenbrauen, und seine üppige Brustbehaarung reichte hinauf bis zum Halsansatz. Auf seinem Gesicht spielte ein argloser, aber verschmitzter Ausdruck. Jede Nacht pflegte Tony einen Abstecher ins Artinos zu machen, um sich ein paar Gläschen zu genehmigen, bevor er nach Hause ging. Mit dem ersten Schluck Whiskey hellte sich Tonys Stimmung auf, und er sah sich neugierig um. Zwischen Tony Kazan und Noha ash-Shawarabi saß Madame Chantal Le Maître, Inhaberin der allbekannten Buchhandlung Balzac in der Fuad-Straße, eine schlanke Französin von Mitte vierzig, deren schöne Gesichtszüge aber eine gewisse Verwirrung widerzuspiegeln schienen. Ja, ihre Erscheinung strahlte etwas Sonderbares aus, eine abweichende, wie aus dem Zusammenhang gerissene Note, die Verärgerung oder im Gegenteil Mitgefühl zu wecken vermochte. Die Ausschussmitglieder unterhielten sich in Chantals Gegenwart auf Französisch, und sie liebten sie und bedauerten, wenn sie fehlte, trotz ihrer Macken. Chantal war in Alexandria eine Persönlichkeit und erfreute sich großer Beliebtheit unter Intellektuellen und Gebildeten, die bei ihr französische Bücher und Magazine erstanden. Dank ihrer weitverzweigten Kontakte blieb sie von dem Ausreisedekret verschont, das die Regierung gegen alle im Land lebenden Franzosen verhängt hatte infolge der Beteiligung Frankreichs an der militärischen Aggression des Jahres 1956, die in Europa als Suezkrise bekannt ist. Chantal trank über die Maßen, und ihre Trunkenheit kannte mehrere Phasen: Die ersten Gläser riefen eine Art verträumter Wehmut bei ihr hervor und ließen sie schüchtern und sanftmütig wirken; trank sie weiter, trat die zweite Phase ein, die sie ausgelassen und laut werden ließ, bis sie klatschte oder tanzte oder so viel lachte, dass ihr die Augen tränten; und schließlich, in der dritten Phase, überkamen Chantal Gefühle der Verbitterung, verfolgte sie nur noch das Geschehen um sie herum, und auf ihrem Gesicht zeigten sich Groll und Abscheu, als hätte sie ein großes Unrecht erlitten. In dieser Nacht hatte Chantal eine ganze Flasche Rosé getrunken, war leicht schwankend zur Toilette gegangen, und als sie zurückkam, verlangte sie ein neues Glas, nahm einen Schluck davon, betrachtete die Tischgesellschaft mit zum Sprung bereitem Lächeln und rief plötzlich laut: »Attention tout le monde!«
Als alle Anwesenden sich ihr zuwandten, fuhr sie aufgekratzt fort: »Das ist eine Warnung von mir an alle Mitglieder des Caucus … Jeder Mann, der ein Paar schöne Augen hat, muss diese hinter einer schwarzen Sonnenbrille verbergen, andernfalls wird ihn die Militärpolizei verhaften.«
Abbas al-Qoussi lachte und sagte: »Carlo ist der Einzige hier, der schöne Augen hat. Wir anderen haben nichts zu befürchten.«
»Der Offizier der Militärpolizei ist der Einzige, der die Schönheit deiner Augen beurteilt«, gab Chantal zurück.
Tony flachste: »Meine liebe Chantal, bist du schon wieder betrunken und redest Stuss?«
»Tony! Ich rede keinen Stuss. Du bist derjenige, der nicht weiß, was in Alexandria vor sich geht.«
Da mischte sie Anis mit seiner heiseren Stimme ein: »Was Chantal sagt, ist tatsächlich letzte Woche am Maamura-Strand passiert. Zwei junge Männer haben darum gewetteifert, wer die schönsten Augen in Alexandria hat. Und als Abd an-Nasser davon in der Zeitung las, hat er die Militärpolizei losgeschickt, und die haben die beiden festgenommen.«
»Wie sonderbar«, meldete sich Lydda. »Warum sollten sie die beiden denn festgenommen haben?«
Anis’ Antwort troff von Ironie: »Weil es einem jungen Mann nicht ansteht, mit der Schönheit seiner Augen zu prahlen. Wenn er mit etwas prahlen sollte, dann mit der Gründlichkeit seiner Arbeit oder seinen Leistungen im Studium. Das andere zeugt von Liederlichkeit und Unverschämtheit, wie sie in unserer sozialistischen Gesellschaft verpönt sind.«
»Und was haben sie mit den beiden Burschen gemacht«, fragte Carlo perplex.
Anis ließ das Glas in seiner Hand kreisen:
»Sie haben ihnen die Köpfe kahl rasiert und sie in ein Armeelager gesteckt, damit sie etwas über Männlichkeit lernen …«
Für einen Moment herrschte Schweigen, ehe Anis fortfuhr: »Unser Herr Präsident Abd an-Nasser wacht nun einmal über die Bildung und Erziehung der Ägypter.«
Noha ash-Shawarabi lachte: »Unser Herr Präsident schützt uns vor dem Schlechten in uns.«
Anis nahm einen Schluck aus seinem Glas, steckte sich eine weitere Zigarette an und sagte:
»Was in Ägypten passiert, ist eine Groteske … Abd an-Nasser beruft eine Gipfelkonferenz ein, an der die Präsidenten und Monarchen von dreizehn arabischen Staaten teilnehmen. Das Sonderbare aber ist, dass die Hälfte dieser Herrscher ein schlechtes Verhältnis zu Abd an-Nasser pflegt und er sie in seinen Reden stets wild angreift. Doch kaum schickt er ihnen eine Einladung, kommen sie angebuckelt …«
Chantal sagte: »Diese arabischen Herrscher sind gezwungenermaßen nach Kairo gekommen, denn Abd an-Nassers Popularität in der arabischen Welt ist überwältigend, und wären sie seiner Einladung nicht gefolgt, hätten ihre eigenen Völker gegen sie revoltiert.«
Anis schwieg für einen Moment und sagte dann:
»Ich nehme an, deine Analyse trifft zu, aber das erklärte Ziel dieser Konferenz ist der Kampf gegen den Imperialismus, und das verstehe ich nicht … Wenn Abd an-Nasser einen Plan vorlegt zum Kampf gegen den Imperialismus, warum wird dieser dann nicht stiekum umgesetzt und stattdessen auf einer Konferenz vor laufenden Fernsehkameras verkündet?«
Abbas lachte nur:
»Abd an-Nasser will doch bestätigt bekommen, dass er der Führer der arabischen Nation ist. Außerdem ist er, wie jeder Diktator, ein Narziss und erträgt es nicht, auch nur für eine Sekunde fern der Scheinwerfer und Kameras zu sein.«
Da rief Chantal plötzlich aus:
»Abbas und Anis … Seid ihr der Angriffe auf Abd an-Nasser nicht irgendwann müde?! Ich habe ehrlich Mitleid mit euch. All dieses Geschwätz ist nutzlos. Das gesamte ägyptische Volk liebt Abd an-Nasser.«
Noha ash-Shawarabi widersprach sogleich: »Das stimmt nicht. Es gibt auch Ägypter, die ihn hassen.«
»Das ist eine verschwindend kleine Minderheit ohne Einfluss«, hielt Chantal dagegen.
»Die Frage ist aber nicht Liebe oder Hass, sondern grundsätzlicher Natur«, wandte Abbas ein. »Ich lehne jeden Diktator ab, ganz gleich wie groß seine Popularitätswerte oder seine Leistungen sind.«
»Ich stimme mit Abbas überein«, sagte Anis. »Ich lehne die Diktatur ebenso ab, wie ich Phrasen hasse, weil sie der Verübung von Verbrechen den Weg ebnen, wie uns die Geschichte gelehrt hat.«
Chantal lachte geringschätzig: »Ihr könnt protestieren, soviel ihr wollt. Das sind die Tatsachen … Die Ägypter glauben an Abd an-Nasser, beten ihn an, wie eure pharaonischen Vorfahren den Gottkönig angebetet haben. Abd an-Nasser kann Millionen von Ägyptern mit einem Wink seiner Hand mobilisieren, während die Mitglieder des Caucus jede Nacht ins Artinos kommen, um Whiskey zu trinken und Theorien vom Stapel zu lassen, von denen außer ihnen noch nie jemand gehört hat. Ist das nicht ein Elend?«
»Ich werde meine Überzeugungen niemals aufgeben«, gab Abbas zurück.
»Bestreitest du etwa, dass Nasser nützliche Projekte in Angriff genommen hat?«, wollte Chantal wissen.
»Von größtem Nutzen für die Ägypter ist eine Umsetzung der Demokratie …«
»Abbas, sei bitte objektiv! Hältst du nichts von der kostenlosen Schulbildung und den neuen Fabriken? Und findest du nicht, dass der Assuan-Staudamm eine historische Leistung ist?«
»Alle Errungenschaften eines Diktators sind wie Sandburgen. Eine Welle genügt, um sie zu zerstören.«
Lächelnd wandte sich Anis an Tony Kazan: »Warum beteiligst du dich nicht an der Diskussion?«
»Ich interessiere mich nicht für Politik.«
»Mein lieber Tony, mit Verlaub … Ich muss das Geheimnis gelüftet haben, das du hütest.«
»Welches Geheimnis? Was soll das alberne Gerede?«
»Tony Kazan, du bist einer der größten Unterstützer Abd an-Nassers. Mit eigenen Augen habe ich die Arbeiter deiner Fabrik ein großes Transparent tragen sehen mit der Aufschrift: ›Wir huldigen dem Führer Abd an-Nasser, dem Helden des arabischen Nationalismus‹.«
»Darüber will ich nicht sprechen«, gab Tony verärgert zurück.
Anis lachte und schlug Tony auf die Schulter: »Aber deine Liebe für Nasser wird dir niemals schaden. Du bist ja bekanntermaßen ein Kämpfer, der es mit dem Imperialismus aufnimmt, wo immer du ihn findest.«
Alle lachten, doch Tony gab ernst zurück:
»Erstens ist dein Scherz albern, und zweitens bin ich weder für Nasser noch gegen ihn. Mich interessiert nicht, wer Ägypten regiert, und wäre ich in einem anderen Land, wäre mir egal, wer dort herrscht. Ich will nur ungestört arbeiten und Erfolg haben.«
»Ich stimme mit Tony überein«, rief Lydda mit Nachdruck. »Und ich meine, die Mehrheit der Ägypter denkt wie wir. Das Wichtigste ist, dass wir arbeiten und unser Auskommen haben.«
Chantal kippte den Rest in ihrem Glas herunter und bedeutete Carlo, ihr ein letztes Mal auszuschenken, ehe sie entschieden sagte:
»Bei all meinem Respekt für Anis und Abbas … aber ihr beiden lebt in einer gedanklichen Blase. Ihr seid vollkommen fern der Realität und versteht das Volk nicht. Die Ägypter haben in ihrer Geschichte nichts als Willkür erfahren, und deshalb sind sie von Natur aus unterwürfig und fühlen sich im Schatten des Diktators sicher.«
»Das stimmt nicht«, widersprach Abbas.
»Die Unterwürfigkeit der Ägypter ist eine historische Tatsache«, beteuerte Chantal, doch Anis lächelte und sagte ruhig:
»Meine liebe Chantal, ich werde dir ein paar Bücher über den Freiheitskampf der Ägypter vorbeibringen. Dann wirst du deinen Irrtum feststellen und bist uns eine öffentliche Entschuldigung schuldig.«
»Du hast doch gesagt, du hasst Phrasen, und jetzt verwendest du sie selbst. Ich liebe die Ägypter sehr, aber ich sehe sie, wie sie wirklich sind, und nicht, wie ich sie gern hätte. Die Ägypter sind zivilisiert, klug, gutherzig und charmant, aber sie sind dem Herrscher ergeben. Das ist ihr Naturell, und ich nehme sie, wie sie sind. Ich lese gerade die Erinnerungen von Antoine Claude Bek, dem französischen Arzt, der in den Tagen Muhammad Ali Paschas hier lebte und die erste Schule für Heilkunde im Land gegründet hat. Claude Bek schreibt etwa, die ägyptischen Fellachen seien für die Revolution nicht zu gewinnen. Sie würden sich zwar zuweilen empören und sich gegen Unrecht wehren, aber sobald sie an die Folgen einer Revolte dächten, bekämen sie es mit der Angst zu tun und unterwürfen sich von Neuem der Macht.«
»Soll Claude Bek schreiben, was er will«, erwiderte Anis ungehalten. »Aber die Geschichte belegt, die Ägypter haben sehr wohl gewaltige Revolutionen hervorgebracht.«
Worauf sich ein Stimmengewirr aller Anwesenden erhob, bis Carlo sich genötigt sah, mit einem Löffel gegen ein leeres Glas zu schlagen: »Ruhe bitte.«
»Ehrlich gesagt überrascht mich diese Diskussion nicht«, rief Lydda gereizt. »Warum betrachtet ihr die Ägypter entweder als Helden oder als Duckmäuser? Warum beurteilen wir den Ägypter nach unseren eigenen Erwartungen?! Und warum verstehen wir seine besondere Logik nicht?! Der ägyptische Mensch hat Prioritäten in seinem Leben, die wir respektieren müssen. Er kämpft jeden Tag, um seine Kinder zu ernähren und ihnen die bestmögliche Ausbildung zu ermöglichen. Ist das allein nicht schon ein gewaltiges Ringen?«
»Chantal ist der Meinung, die Ägypter benötigen die Freiheit nicht wie die westlichen Völker«, warf Anis ein. »Und das ist eine rassistische Haltung.«
Was wiederum Chantal aufbrachte: »Ich bin keine Rassistin! Das erlaube ich dir nicht!«
»Darf ich meine Meinung äußern?« Das kam von Noha ash-Shawarabi, die einen Schluck aus ihrem Bierglas nahm und dann fortfuhr:
»Seid mir nicht böse, aber ich bin sicher, Chantal hat recht. Die Ägypter sind von Natur aus unterwürfig und ergeben sich jedem Machthaber. Als Reiseleiterin habe ich viel über die Geschichte gelesen: Die Ägypter haben stets den Kampf um die Macht von Weitem verfolgt und dann dem Sieger Gehorsam erwiesen.«
»Das ist leeres Gerede ohne Beweise«, bemerkte Anis ruhig.
»Du willst Beweise?«, gab Noha erregt zurück. »Na schön, der Beweis ist, was meiner Familie passiert ist. Mein Vater, Ismail ash-Shawarabi, ein aufrechter Patriot, hat, nachdem er seinen Doktor in Rechtswissenschaften an der Sorbonne gemacht hatte, alle Angebote abgelehnt, die sich ihm in Frankreich boten, und hat stattdessen beschlossen, nach Ägypten zurückzukehren, um sein Wissen an ägyptische Studenten weiterzugeben. Und als man ihn zum Justizminister ernannte, wurde, einer offiziellen Forderung seinerseits gemäß, sein Gehalt vollständig an die Boten im Ministerium verteilt. Mein Vater hat im wahrsten Sinne des Wortes sein Leben in den Dienst der Heimat gestellt. Dann putschten die Militärs, verhafteten meinen Vater und enteigneten seine geerbten Ländereien. Fünftausend Feddan konfiszierten sie an nur einem einzigen Tag. Wenn ich jetzt zurückdenke, was damals passiert ist, weiß ich nicht, wie mein Vater bis zum Ende unbeugsam bleiben konnte. Denn sie brachten ihn vor ein Militärgericht und bezichtigten ihn der Korruption. Mein Vater lächelte und sagte: ›Ich habe unentgeltlich gearbeitet und nicht eine Guinee von der ägyptischen Regierung bekommen. Wo soll da Korruptheit sein?‹ Und als der Richter fortfuhr: ›Sie sind der politischen Verkommenheit angeklagt‹, erwiderte mein Vater im Gerichtssaal mit lauter Stimme: ›Ich war Minister in der Wafd-Regierung. Wir sind durch freie Wahlen in unsere Regierungsämter gekommen, ihr aber auf dem Rücken der Panzer. Wer von uns also ist verkommen?‹«
»Was für ein Mut«, sagte Anis.
Und Abbas bekräftigte: »Er war ein großer Mann, möge Gott ihm gnädig sein.«
»Und was haben sie mit ihm gemacht?« Es war Tony, der das fragte. Noha lächelte traurig:
»Natürlich gab es Aufruhr im Gerichtssaal, und der Richter verlangte vom Sitzungssekretär, die Worte meines Vaters aus dem Protokoll zu streichen. Er wurde zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Und als er herauskam, war er krank und verstarb wenig später.«
»Eine Tragödie«, murmelte Carlo und zapfte das Bier so ungestüm, dass der Schaum überlief. Ungefragt stellte er Noha das Glas hin, die einen Schluck nahm und sagte:
»Die Frage hier ist doch, meine Freunde: Was hat das großartige ägyptische Volk für meinen Vater getan, der sein ganzes Leben für es gekämpft hat? Haben sich seine Kollegen und seine Studenten an der Rechtsfakultät mit ihm solidarisiert? Hat ihn einer unterstützt, da er unrechtmäßig eingesperrt war? Hat einer mich und meinen Bruder Mustafa unterstützt, als wir nach der Gefängnishaft meines Vaters und der Enteignung seiner Ländereien in Not und Elend lebten? Mitnichten! Abgesehen von ein, zwei Freunden haben uns alle verleugnet, ist nicht einer uns zu Hilfe gekommen. Die Leute, deren Rechte zu verteidigen mein Vater sein ganzes Leben geweiht hatte, haben sich nicht damit begnügt, sich in seinem Unglück von ihm loszusagen, nein, viele haben sich gefreut, als sein Besitz konfisziert wurde und man ihn als Symbol einer untergegangenen Epoche verunglimpfte. Haben jede weitere Zusammenarbeit mit ihm vermieden. Die Undankbarkeit der Leute hat meinen Vater am meisten geschmerzt. Wenige Tage vor seinem Tod habe ich ihn gefragt: ›Könntest du die Zeit zurückdrehen, würdest du Frankreich noch einmal verlassen?‹ Worauf er sagte: ›Ich würde genau dasselbe tun, denn es ist meine Pflicht gegenüber meinem Land. Doch ich würde weder Dankbarkeit noch Unterstützung von den Ägyptern erwarten, weil ich sie jetzt kenne.‹«
Noha schwieg für einen Moment und fuhr dann traurig fort:
»Die Ägypter haben mehr Unrecht an meinem Vater begangen als Abd an-Nasser.«
»Eine traurige Geschichte, aber sie bestätigt meine Ansicht zu den Ägyptern«, meldete sich Chantal zu Wort. »Die Religiosität ist meiner Meinung nach der Grund für ihre Unterwürfigkeit. Erst wenn sie sich davon befreien, werden sie Gerechtigkeit und Freiheit erlangen.«
»Verzeihung — was hat die Religion mit dem Thema zu tun?«, fragte Lydda.
»Sie lässt einen Unrecht akzeptieren und auf Gerechtigkeit im nächsten Leben warten. Die Religion erzieht einen zum Gehorsam. Du gehorchst dem Herrn, gehorchst den Klerikern, gehorchst deinem Ehemann und wirst danach natürlicherweise auch dem Diktator gehorchen. Die Ehe wie die Religion führen zur Unterwürfigkeit.«
»Chantal. Ich bin sicher, du wirfst da einiges durcheinander.«
»Denk mal darüber nach: Die Ehe ist ihrem Wesen nach ein Besitzkontrakt des Mannes über die Frau.«
Noha warf Abbas einen Blick zu, lächelte und sagte:
»Abbas, reich mir doch bitte einmal den Kontrakt, mit dem du mich gekauft hast.«
Alle lachten, und dann wechselte Tony das Thema: »Noha, du bist ja die Kinoverantwortliche des Caucus. Welcher Film hat dir zuletzt gefallen?«
»Leider werden internationale Filme hier lange nach ihrem Erscheinen im Ausland gezeigt«, schränkte Noha ein.
»Der Zensor muss sich ja erst einmal davon überzeugen, dass der Inhalt eines Films für den Staat nicht bedrohlich ist und nicht die Heimatfront entzweit«, kommentierte Anis sarkastisch.
»Letzte Woche habe ich mit Abbas Antonionis Film Die Nacht gesehen«, fuhr Noha aufgeräumt fort. »Der läuft im Amir-Kino.«
»Liebe Freunde, ich warne euch vor diesem Film«, rief Abbas. »Zwei Stunden reinste Folter.«
Chantal sah ihn entgeistert an: »Dir hat ein Film von Antonioni nicht gefallen?«
»Ein sehr langweiliger Streifen.«
»Aber Antonioni zeigt Charaktere, die an Langeweile leiden.«
»Wenn seine Charaktere an Langeweile leiden, muss er die Langeweile nicht auf seine Zuschauer übertragen.«
»Richtig«, rief Anis. »In der Kunst gibt es einen Unterschied zwischen Inhalt und Stil. Beschreibt ein Künstler eine anrüchige Person, muss die Darstellung nicht anrüchig sein. Durch künstlerisches Talent kann man den hässlichsten Dingen einen Ausdruck von Schönheit verleihen.«
»Aber Antonioni ist einer der bedeutendsten Regisseure der Welt«, stichelte Chantal.
Worauf Tony verärgert kommentierte: »Chantal, warum musst du uns immer provozieren? Selbst wenn Antonioni der größte Regisseur aller Zeiten wäre, hat noch jeder Mensch das Recht, seine Filme abzulehnen.«
Noha aber lächelte und sagte: »Abbas und ich mögen bei Antonionis Film verschiedener Meinung gewesen sein, aber dafür hat uns beiden ein anderer Film sehr gut gefallen. Er heißt Der römische Frühling der Mrs. Stone und läuft im Metro. Vivien Leigh spielt eine alternde Theaterschauspielerin, die nach dem Tod ihres Mannes in Rom bleibt und sich in einen jungen italienischen Gigolo verliebt, der sie ausnutzt und leiden lässt.«
Chantal sprang gleich darauf an und sagte:
»Ich habe den Film bereits in Paris gesehen und mochte ihn, aber ich bin nicht sicher, ob ihr die Gefühle der Heldin versteht.«
»Meine liebe Chantal, was gibst du heute Nacht wieder die Gouvernante«, rief Anis.
Alle lachten ausgelassen. Chantal leerte ihr Glas, bedeutete Carlo, ihr ein neues zu reichen, und verkündete:
»Lacht, so viel ihr wollt. Aber ich sage die Wahrheit … Ihr habt den Film so verstanden, dass die Heldin von dem italienischen Gigolo betrogen und ausgenutzt wird. Und das stimmt nicht. Sie wusste von Anfang an, dass er nur ein billiger Gigolo ist, und hat ihm nicht vertraut, aber dieser unbedeutende junge Mann vermag ihre Begierde zu wecken. Das sexuelle Verlangen aber ist ein unergründliches Thema, das niemand ganz verstehen kann …«
Als wollte er sie provozieren, meldete sich sogleich Anis zu Wort:
»Der Film ist einfach und klar: Ein Gigolo betrügt eine ältere Frau. Wozu dann diese Pedanterie?«
»Ich bin nicht pedantisch, Anis«, rief Chantal aufgebracht. »Wie ich schon sagte: Die Elemente der Begierde sind komplex, und ich könnte dir dafür viele Beispiele aus meinem Leben geben. Ich habe etliche Jahre mit einem Mann zusammengelebt, und unsere sexuelle Verbindung war ausgezeichnet. Dann fand ich heraus, dass er auch mit Jünglingen gerne verkehrt … Doch ich habe nicht kapituliert, wollte ihn behalten. Ich habe mir die Haare kurz geschnitten, um wie ein Knabe auszusehen, und von ihm verlangt, im Bett dasselbe mit mir zu machen, was er mit den Jünglingen …«
Hier unterbrach Carlo sie charmant:
»Madame Chantal, soll ich Ihnen ein Taxi rufen?«
»Ich fahre meinen eigenen Wagen. Gib mir ein letztes Glas.«
Doch Carlo sah sie lächelnd an und sagte:
»Madame Chantal, bitte … Ich bestelle Ihnen ein Taxi.«
Da schlug Chantal mit der flachen Hand auf die Bar und schrie Carlo ins Gesicht:
»Ich allein bestimme, wann und wie ich mich verabschiede! Verstanden?!«
Carlo senkte den Kopf und sagte leise:
»Es tut mir leid.«
»Carlo möchte doch nur dein Bestes«, beschwichtigte Abbas.
»Oh, verflucht seid ihr alle«, kollerte Chantal. »Hört endlich mit dieser verdammten männlichen Bevormundung auf … Ich würde mich schon melden, wenn ich Unterstützung brauche. Gib mir ein letztes Glas und die Rechnung.«
Das galt Carlo, der ihr ein neues Glas eingoss, das sie in einem Zug hinunterstürzte, dann die Rechnung beäugte, ein paar Geldscheine zutage förderte und sie auf die Bar warf. Sie musste einige Mühe darauf verwenden, bis sie ihre Autoschlüssel hervorgezogen hatte, und sagte schließlich noch gerade so hörbar:
»Ich entschuldige mich bei euch, wenn ich heute Nacht verbohrt war.«
Allgemeines Gelächter hob an, gefolgt von Kommentaren aller Anwesenden:
»Du bist doch immer verbohrt …«
»Wir sehen dir deine Verbohrtheit nach.«
»Gute Nacht, du gehörst sofort ins Bett.«
Chantal lächelte und winkte zum Abschied, machte sich dann schwankend auf den Weg, bis sie durch die Tür war, deren beider Flügel hinter ihr erbebten. Dann erst fragte Tony:
»Warum hat sich Chantal bei uns entschuldigt und nicht bei Carlo?«
Carlo lächelte. »Ich denke, sie war böse auf mich. Dabei habe ich nur meine Arbeit gemacht. Wenn ein Gast zu viel trinkt und anfängt, seine Geheimnisse zu enthüllen, muss der Barkeeper eingreifen.«
Anis wirkte nachdenklich, als er sagte:
»Sie muss irgendein Problem haben, das sie so übermäßig trinken lässt.«
»Sie steht unter großem Druck«, bestätigte Carlo. »Ihre Buchhandlung hat zuletzt viele Kunden verloren.«
»Wir sollten sie anrufen, um sicherzustellen, dass sie zu Hause angekommen ist.« Tony schien ehrlich besorgt.
Carlo dachte kurz nach und sagte:
»Das letzte Mal, als sie betrunken war, habe ich sie angerufen, und sie hat mich ermahnt, dies nie wieder zu tun.«
»Carlo …«, rief da Abbas. »Eine letzte Runde für alle bitte, damit wir vergessen, was mit Chantal passiert ist.«
2
Die Mitglieder des Caucus verabschiedeten sich gegen drei Uhr morgens, und Carlo räumte die leeren Flaschen weg und stellte die benutzten Gläser ins Becken, damit die Spülkraft sie am Morgen abwusch; dann vermerkte er die Getränke im Bar-Buch, zählte die Einnahmen, legte sie in die Schublade und schloss sie ab. Zuletzt löschte er alle Lichter, stieg die Treppe hinab und trat auf die Straße. Amm Arabi, der Parkplatzanweiser, eilte herbei, um ihm den Wagenschlag zu öffnen, und Carlo drückte ihm zum Dank einen Geldschein in die Hand.
Auf der Corniche beschleunigte Carlo seinen Wagen auf Höchstgeschwindigkeit, bis er den Montazah-Palast erreicht hatte, machte dann kehrt und fuhr in Richtung des Raml-Bahnhofs. Es herrschte wunderbares, winterliches Wetter, ein kühler, belebender Wind schlug ihm ins Gesicht und ließ Carlo ein Gefühl von perfekter Harmonie verspüren. Sein Sportwagen war, obschon ein älteres Modell, noch immer zu einem schönen Sprint in der Lage. Und plötzlich wurde Carlo bewusst, er würde niemals außerhalb von Alexandria leben können. Hier war er geboren, und hier hatte er bis zu diesem Tag gelebt. Jede Straße und jede Ecke war Zeuge eines Teils seines Lebens gewesen, und mit seiner Arbeit im Artinos war er vom Glück beschenkt. An keinem anderen Ort konnte er sich sich selbst sonst vorstellen. Er war gerne Barmann, doch wenn er die Angehörigen des Caucus bediente, war es, wie unter Freunden zu sein. Er dachte an die erste Begegnung mit Georges Artinos zurück. Carlo war damals noch keine achtzehn gewesen, hatte gerade seinen Abschluss am »Don Bosco« gemacht, der renommierten Schule des Salesianerinstituts, und kam, um nach einer Anstellung zu fragen. Georges Artinos hatte ihn mit einer Mischung aus Neugier und Mitleid angesehen und gefragt:
»Als Absolvent des ›Don Bosco‹ kannst du Arbeit in jedem Betrieb finden und dort viel verdienen. Warum willst du bei uns arbeiten?«
»Ich liebe die Arbeit in Restaurants und Bars«, hatte Carlo schnell geantwortet.
»Warum?«
»Um Menschen zu dienen und sie glücklich zu machen.«
»Was von beidem ist dir wichtiger, der Dienst am Gast oder das Geldverdienen?«
»Ehrlich gesagt liebe ich beides.«
Georges Artinos hatte gelacht und gefragt:
»Hast du schon einmal in einem Restaurant gearbeitet?«
»Ich habe in einer Bar gearbeitet, die meinem Vater in Camp Chezar gehörte.«
»Und warum hast du die Bar deines Vaters verlassen?«
»Mein Vater ist verstorben, und meine Mutter hat die Bar verkauft.«
Georges Artinos hatte genickt, und auf seinem zerfurchten Gesicht spielte ein verständnisvoller Ausdruck. Und tatsächlich war er von Anfang an zufrieden mit Carlo gewesen und hatte dessen Ausbildung gefördert. Zunächst hatte er ihn für die Arbeit in der Küche eingeteilt:
»Du musst die Leiter von unten erklimmen, damit du das Geschäft von der Pike auf lernst.«
Doch Carlo ertrug bereitwillig das Joch der Arbeit in der Küche, verbrachte Stunden mit dem Schälen von Kartoffeln und dem Schneiden von Gemüse, vergoss Ströme von Tränen beim Kleinhacken der Zwiebeln und wusch so lange Teller ab, bis seine Finger von dem heißen Wasser aufgedunsen waren. Nach ein paar Monaten Fron stieg er vom Küchenjungen zum Gehilfen des Kochs auf und war ein Jahr später bereits selbst Koch. Dank seiner Schaffenskraft und seines Einsatzes kam er schnell voran. Danach versetzte ihn Georges an die Bar und machte ihn zum Gehilfen von Fabio, dem legendären Barmann des Artinos, der ihn alle Geheimnisse seines Fachs lehrte. Und als er verstarb, nahm Carlo seinen Platz ein. Niemals würde er die Großherzigkeit Georges Artinos’ vergessen, der ihn wie einen Sohn geliebt hatte, ihn oft zu sich nach Hause einlud. Einmal, als sie zusammen etwas tranken, hatte er gesagt:
»Wenn ich sterbe, weiß ich das Restaurant in guten Händen. Lydda und du, ihr wisst alles.«
Georges wollte dann auch wissen, warum Carlo nach einer Wohnung für sich suchte. »Ich möchte nahe zum Restaurant wohnen«, antwortete dieser.
Georges sah in zweifelnd an und sagte:
»Aber du wohnst mit deiner Mutter in Camp Chezar. Das ist doch ganz in der Nähe.«
»Ehrlich gesagt möchte ich allein wohnen.«
Hätte Georges gefragt, hätte Carlo ihm von seinem Problem mit seiner Mutter erzählt, aber Georges hatte nur einen Augenblick überlegt und dann das Gespräch mit dem Ratschlag beendet:
»Mach, was du willst, aber bewahre dir ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter.«
Das war die letzte Lektion, die Carlo von Georges erlernte: die Privatsphäre anderer zu respektieren und sich nicht in ihr Leben einzumischen, sosehr man sie auch liebt. Nicht ein Tag war seither vergangen, an dem Carlo nicht an Georges Artinos gedacht hätte, seinen Lehrer und großherzigen Freund. Der Wagen schoss jetzt auf die Qaitbay-Zitadelle zu, und Carlo wendete und brauste ein letztes Mal in entgegengesetzter Richtung die Corniche entlang. Er war hungrig und verspürte noch kein Verlangen nach Schlaf. Für gewöhnlich ging er erst am frühen Morgen zu Bett, eine Angewohnheit, die ihm seine nächtliche Arbeit eingebracht hatte. Er würde zum Hotel San Giovanni fahren, wo er einige seiner Freunde antraf, mit ihnen aß und hernach noch etwas trank und redete, bis der Tag anbrach. Als er schließlich seinen Wagen nach Hause lenkte, begannen sich die Straßen bereits mit Menschen zu füllen. Er überlegte, vor dem Schlaf noch ein heißes Bad zu nehmen. Er stellte den Wagen in der Garage ab, schritt zum Eingang des Gebäudes und nahm den Aufzug in den vierten Stock, wo er auf einem Stuhl vor seiner Wohnungstür Samicha fand, die dort sitzend auf ihn gewartet hatte.
3
Chantal war vollkommen betrunken. Nur mit Mühe lenkte sie ihren Wagen ans Ziel, stellte ihn vor der Buchhandlung ab und stieg schwankend die Treppe hinauf zu ihrer Wohnung im ersten Stock. Sie brauchte einige Zeit, um die Tür aufzuschließen, stolperte hinein und warf sich aufs Sofa. Jetzt würde sie sich zusammennehmen müssen, um die gewohnten Maßnahmen durchzuführen: die Suppe warm machen und sie schnell essen, bis sich ihr Magen aufgewärmt hätte, dann eine Schüssel Naturjoghurt verspeisen (ohne Zucker oder Honig) und als Letztes vor dem Schlafen mehrere Gläser Wasser trinken. Am Morgen würde sie auf nüchternen Magen zwei Verdauungstabletten nehmen, die Albert, der Apotheker, extra für sie herstellte, und danach ein kräftiges Frühstück (ein Omelett aus drei Eiern). Bei ihrem morgendlichen Bad würde sie den Kopf mehrere Minuten lang unter den heißen Duschstrahl halten und danach drei Tässchen starken Espresso schlürfen. All dies war ihre erprobte Routine, dem mörderischen Kopfschmerz zu begegnen, der sie nach einer durchzechten Nacht befiel. Dennoch würde der Rausch nicht ganz bis zum Abend von ihr weichen, die verfinsterte Miene etwa, ein bleiernes Gefühl der Erschöpfung und ein leichtes Zittern der Hände. Wog der Genuss des Trinkens denn all diese Qualen auf? Und warum betrank sich Chantal in diesem verheerenden Maße? Warum begnügte sie sich nicht mit zwei oder drei Gläsern, die sie eine angenehme Berauschtheit erreichen ließen? Stellte man Chantal diese Frage, warf sie einem einen verärgerten Blick zu und blaffte dann, jeden Buchstaben betonend, als wollte sie einen mit ihren Worten durchbohren:
»Verzeih, mein Lieber, ich weiß, wie sehr du die Rolle des Moralpredigers genießt, aber ich versage dir diesen Genuss. Und spar dir deine lächerlichen Ratschläge. Ich allein entscheide, wie ich trinke und wann ich aufhöre.«
Diese barsche Erwiderung diente Chantal als Abschreckungswaffe, dabei wusste sie in ihrem tiefsten Inneren um die Wahrheit: Es gab immer das eine Glas, das zwischen dem netten, erfreulichen Trinken und dem tosenden, von Gefahren umstellten Rausch trennte. Chantal kannte die Grenze dieses Glases, aber sie überschritt sie immer wieder, weil der gewöhnliche Rausch ihr nicht genügte. Sie trank, um eine vollkommene Gefühlstaubheit zu erreichen, eine geistige Verdunkelung, in der das Denken aufhörte, die Erinnerung verschattete und alles einerlei wurde. Dieser dunkle Zustand war anfangs leicht zu erreichen gewesen, die Grenze hatte sich dann aber nach und nach verschoben, sodass Chantal immer weiter trinken musste, bis zur vollkommenen Trunkenheit.
Dabei war Chantal nicht einfach eine Säuferin. Was auch immer sie bei den nächtlichen Sitzungen des Caucus tat, am nächsten Morgen verwandelte sie sich in eine würdevolle, ehrsame Dame, schlüpfte in ein schlichtes, elegantes Kleid, legte ein dezentes, kaum wahrnehmbares Make-up auf, band ihr kastanienbraun gefärbtes Haar zum Pferdeschwanz, setzte ihre runde, schwarze Hornbrille auf und wirkte wie eine fürsorgliche Mutter oder eine verantwortungsbewusste Direktorin.
Bald darauf würde sie in ihrer Buchhandlung in der Fuad-Straße stehen und den Verkauf von Büchern und Schulsachen überwachen oder Malwerkstätten beaufsichtigen, die sie dort für Kinder organisierte. Und jeweils dienstags und donnerstags trat Chantal vor die Schüler des Collège Saint-Marc, um Französisch zu unterrichten. Dann erhob sie ihre vom Rauchen ein wenig heisere Stimme zur Klasse und legte Grammatikregeln oder Verbdeklinationen dar oder las La Fontaines Fabel vom Raben und vom Fuchs vor.
Warum aber hatte Chantal Paris verlassen und war in Alexandria heimisch geworden? Sosehr wir uns auch um eine Erklärung bemühen, die Gründe werden immer unvollständig bleiben, denn die Liebe zu Alexandria kann — wie jede Liebe — nicht gänzlich erklärt werden. Das Meer, die Sonne, die strahlend klaren Tage und das gemäßigte Wetter, all das sind gewiss gewaltige Vorzüge, doch finden sich diese in etlichen Städten. Alexandria aber ist einzigartig in seinem schwer definierbaren Reiz. Am ehesten lässt es sich mit Vertrautheit oder Familiarität beschreiben (das Gegenteil von Einsamkeit). In Alexandria wird man so gut wie nie allein sein, sich ausgegrenzt oder ausgestoßen fühlen. Jederzeit lässt sich mit jedem ein Gespräch anfangen, mit dem Garçon im Restaurant oder dem Tankwart oder dem Zeitungsverkäufer. Sie alle behandelten Chantal wie eine alte Freundin, teilten Ansichten über das Leben mit ihr und erzählten ihr von ihren Familien und ihren Kindern. Wohl hatte Chantal Arabischunterricht genossen, sodass sie mühelos las und verstand, was man ihr sagte, aber wenn sie etwas erwiderte, weckten ihre strauchelnden, holprigen arabischen Wendungen bei ihren Zuhörern immer eine Mischung aus Belustigung und Mitleid (wie bei den ersten Sprechversuchen eines Kindes).
Wie liebte sie diese einfachen, armen Menschen, die sie stets lächelnd begrüßten: »Willkommen, Madame Schantl, Erleuchtete von Alexandria.« Bei der Aussprache ihres Namens brachen sie sich fast die Zähne, und sie erwiderte in ihrem gebrochenen Arabisch: »Einer Jasminmorgen dir, Bursche.«
Vor jetzt zwanzig Jahren war Chantal mit ihrem Geliebten Olivier nach Alexandria gekommen. Sie hatte all ihre Ersparnisse aufgewendet und dazu etwas Geld, das Olivier ihr lieh, und gemeinsam hatten sie die Buchhandlung Balzac eröffnet, die ihnen ein akzeptables Einkommen ermöglichte und Chantal schon bald einen großen Kreis aus alexandrinischen Bekannten bescherte. Ihr Verhältnis zu Olivier war wunderbar gewesen, hatte sich jedoch geändert, als sie herausfand, dass ihr Geliebter bisexuellen Neigungen frönte. Zweimal erwischte sie ihn mit jungen Geliebten. Nach einem Sturm aus Streit und gegenseitigen Beschuldigungen hatte Olivier provozierend gemeint:
»Chantal, ich sage es dir ganz offen, ich liebe auch Männer. Das ist meine Natur. Du kannst sie akzeptieren oder ablehnen, aber ich werde mich nicht ändern.«
Einige Monate danach hatte Olivier beschlossen, nach Frankreich zurückzukehren. Sie trennten sich und kamen überein, dass sie ihm seinen Anteil an der Buchhandlung in Raten auszahlen würde. Danach ging das Leben weiter wie zuvor, ohne Störungen, doch Olivier hatte sie verloren. Im Bett war er ein kundiger Liebhaber gewesen, hatte sich ihres Körpers mit Erfahrung, Zärtlichkeit und Selbstvertrauen angenommen und war mit ihr in Himmeln der Lust gekreist. Später hatte sie gelesen, Bisexuelle zeichneten sich durch besonders geschickte Sexualpraktiken aus, weil sie die Geheimnisse beider Geschlechter erfahren hätten.
Neben ihrer Arbeit in der Buchhandlung hatte Chantal an einer Reihe von Schulen unterrichtet, bis sie schließlich dauerhaft am Collège Saint-Marc blieb. Auch hatte die Balzac-Buchhandlung regelmäßig Signaturabende für französisch schreibende Autoren ausgerichtet. Chantal lud sie ein, reservierte ihnen Zimmer im Hotel Continental in Manshiya und organisierte Leseabende, die zumeist gut besucht waren. Der Umsturz von 1952 jedoch machte diese Attraktion zu einem Ding der Unmöglichkeit, da die Einladung an einen ausländischen Literaten zu einer komplizierten Angelegenheit wurde, die der Bewilligung gleich mehrerer Sicherheitsorgane bedurfte.
Die schwerste Zeit hatte Chantal erlebt, als Ägypten 1956 in der Suezkrise sich einer militärischen Aggression ausgesetzt sah, an der auch Frankreich beteiligt war, was zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern und zur Ausweisung aller in Ägypten lebenden Franzosen führte. Aufgrund ihrer Kontakte zu einflussreichen Persönlichkeiten aber war es Chantal gelungen, eine Ausnahme für sich zu erwirken.
»Madame Chantal … Wir wissen doch, dass Sie eine Freundin Ägyptens sind. Machen Sie sich keine Sorgen, und sollte Ihnen irgendein Problem entstehen, rufen Sie mich unverzüglich an.« So hatte der Sicherheitschef von Alexandria, dessen Sohn sie am Collège Saint-Marc unterrichtete, zu ihr gesagt. Doch in jenen Tagen hielt Chantal die Buchhandlung geschlossen, zog sich in ihre eigenen vier Wände zurück und verließ das Haus nur, wenn es unbedingt nötig war. Sicher, einige behandelten sie mit Reserviertheit, andere auch offen feindselig und mit Verdächtigungen, doch andererseits fanden sich viele unter den einfachen Alexandrinern, die ungeachtet der militärischen Aggression weiter gut mit ihr umgingen, sowohl weil sie sie schon lange kannten als auch instinktiv erfassten, dass sie nicht verantwortlich war für die Ränke ihrer Regierung. Was ein Beweis für die Zivilisiertheit der Ägypter war, den sie nie vergessen sollte. Denn Eigenverantwortung ist ein Grundprinzip aller Zivilisation. Jeder Mensch ist verantwortlich nur für seine eigenen Taten. Die Ägypter mögen arm sein und in ihrer Mehrheit auch ungebildet, aber sie sind intelligent und gehören zu den gütigsten Völkern der Welt. Ihre Menschlichkeit und Zivilisiertheit offenbart sich vor allem in Krisenzeiten. Das war es, was Chantal versuchte, Anis und Abbas bei den nächtlichen Sitzungen des Caucus darzulegen, aber die beiden verstanden das ägyptische Volk einfach nicht. Romantische Intellektuelle waren sie und mit theoretischen Ideen fernab der Realität befasst. Jeder Versuch, die Demokratie in Ägypten umzusetzen, war ihrer Meinung nach zum Scheitern verurteilt. Die Ägypter haben im Verlauf ihrer Geschichte nichts als Tyrannei erfahren, und sie werden immer die Ungerechtigkeit, die Stabilität bringt, der Gerechtigkeit vorziehen, die einen Kampf erforderte, der zu Unruhe und Aufruhr führen würde.
Was aber belastete Chantal und brachte sie dazu, ihre Sorgen im Alkohol zu ertränken?
Anis hatte einmal zu ihr gemeint: »Weißt du, dass deine Schönheit eine dramatische ist?«
Worauf sie ihn erstaunt angesehen und gesagt hatte: »Was meinst du?«
»Die Trauer vermischt sich bei dir mit Schönheit.«
»Woher weißt du das?«
»Ich bin Künstler. Meine Arbeit ist es, Gesichter zu lesen.«
Und tatsächlich hatte Anis recht. Sie durchlebte seit geraumer Zeit schon eine mysteriöse Krise, verdrängte die naheliegenden Gründe. Sehnte sie sich tief in ihrem Inneren nach einer Familie? Brauchte sie einen Mann und Kinder? Die Antwort war definitiv nein! Schließlich lehnte sie das Konstrukt der Ehe ab und betrachtete es als absurd und rückständig. Und was Kinder anging, so hätten ihr diese anfangs vielleicht Glück beschert, sie aber, wenn sie erst älter geworden wären, mit Kälte und Undankbarkeit behandelt. Was war es dann, das Chantal bekümmerte? Die Erträge der Buchhandlung waren stark zurückgegangen. Waren also Geldsorgen das Problem? Wohl kaum. Sie war ja schon geübt darin, Ausgaben zu minimieren. Abgesehen von dem, was sie bei den nächtlichen Sitzungen des Caucus zahlte, hatte sie so gut wie keine Ausgaben. Auch ernährte sie sich bescheiden und hatte seit Jahren keine neuen Kleider mehr gekauft. Oder litt sie unter sexueller Enthaltsamkeit? Wohl kaum, sie hätte sich mit Leichtigkeit einen Liebhaber angeln können und hatte tatsächlich schon einige Male schnelle, flüchtige Erfahrungen gehabt, war aber danach depressiv geworden. Oder wollte sie etwa zurück nach Paris? Aber was sollte sie dort tun? Auf das Alter warten? Bloß eine weitere betagte Pariserin sein, die allein in einem dürftigen Studio lebte und sich ein paar Katzen als Gesellschaft hielt? Niemals würde sie in Paris so fantastische Freunde finden wie die Mitglieder des Caucus. Sie würde wohl jede Nacht alleine trinken, lesen und fernsehen, bis sie einschlief, und wenn sie endlich stürbe, würden die Nachbarn vielleicht erst nach Tagen wegen des Verwesungsgeruchs davon erfahren. Am 26. Mai würde sie sechsundvierzig sein. Ja, sie wurde älter, ihr Körper veränderte sich mit jedem Tag. Zuweilen hatte sie das Gefühl, als altere auch ihr Geist, als finge sie an, einer verschwundenen Zeit anzugehören. Als nähere ihre Reise sich dem Ende. Denn sie war Atheistin und glaubte nicht an ein Leben danach. Der Tod würde ein Erlöschen und Verschwinden sein, und dann nähme die Energie ihres Körpers in der Natur andere Formen an. Sie fürchtete sich nicht vor dem Tod, hatte aber Angst vor Krankheit und Siechtum. Der Schmerz und die Invalidität. Sie hoffte, ihr Tod würde plötzlich und still und würdevoll kommen: eine Nacht, in der sie etwas trinken würde, sich schlafen legen und nie wieder aufwachen würde. Sie würde hier in Alexandria sterben, inmitten ihrer Freunde und Geliebten.
*
Ein neuer Tag. Es war schon fast elf, als Chantal sich nach unten in die Buchhandlung begeben wollte. Sie trug eine weiße, langärmelige Bluse und einen blauen Plisseerock. Sie trat aus der Wohnung und war schon im Begriff, die Tür abzuschließen, als sie eine Überraschung vorfand. An der Tür ihrer Wohnung war ein großes Bildnis von Präsident Abd an-Nasser befestigt. Sie starrte das Plakat eine Weile an und bekam es dann mit der Angst zu tun. Denn ihr wurde klar, ihre Trunkenheit war mitnichten verflogen. Sie erinnerte sich an einen Artikel in Le Monde, in dem sie gelesen hatte, übermäßiges Trinken könne zu akustischen und optischen Halluzinationen führen. War dieses Bildnis Abd an-Nassers Wirklichkeit oder Einbildung? Sie dachte einen Moment lang nach und streckte dann die Hand aus, um es zu befühlen, sich von seiner Echtheit zu überzeugen und es hernach erneut zu betrachten. Auf der Aufnahme stand Abd an-Nasser, winkte mit einer Hand und sah sie an, als beobachtete er sie oder forderte sie heraus. Chantal blieb eine geschlagene Minute vor dem Bildnis stehen und wusste nicht, wie sie sich verhalten sollte. Sie schaute zu den Türen der Nachbarwohnungen und fand dort nichts Entsprechendes. Man hatte also dieses hier bewusst an ihre Tür gehängt. Wer tat so etwas und warum? Sie konnte das Plakat nicht einfach ignorieren und sich in die Buchhandlung begeben, um ihren Tag zu beginnen, als sei nichts geschehen. Niemand, egal wer, hatte das Recht, ohne ihre Erlaubnis irgendein Bildnis an ihre Tür zu hängen. Und selbst wenn es eines von Präsident Abd an-Nasser war … Plötzlich spürte sie Wut, streckte erneut die Hand aus und griff nach dem unteren Rand des Plakats, um es von der Tür zu reißen, musste aber feststellen, dass es mit Leim daran geklebt war. Worauf sie die Tür aufstieß, zurück in ihre Wohnung marschierte und zum Telefon stürzte. Hastig blätterte sie das Verzeichnis durch, fand den Namen, nahm den Hörer auf und wählte die Nummer.
4
Dimitri Kazan war 1915 aus Anatolien nach Alexandria gekommen, vor den Massakern fliehend, die die Osmanen an den Griechen verübten. Der junge, wohlhabende Kaufmann vermochte (wie genau, das gab er nie preis) sein Vermögen außer Landes zu schaffen. Sein Geld investierte er in den Baumwollhandel, und das mit immensem Erfolg, was ihn in nicht einmal zehn Jahren zu einem der wichtigsten Kaufleute Alexandrias werden ließ und in die Lage versetzte, sich ein elegantes Büro am Manshiya-Platz zu nehmen und dazu eine prachtvolle Villa, die er im Stadtteil Moharam Bek erwarb. Seine Gattin Gala hatte Dimitri in der Wohnung von Freunden kennengelernt. Sie gefiel ihm, man heiratete und bekam zwei Söhne: Philip, der ältere, und Tony, der zwei Jahre jünger war. Dimitri war darauf bedacht, seinen Söhnen die bestmögliche Ausbildung zukommen zu lassen, und schickte sie auf die Privatschule Victoria College, die auch als das Eaton des Orients bezeichnet wurde. Zusätzlich zu den enormen Kosten ertrug Dimitri auch den beharrlichen Gefühlskrieg, mit dem seine Gattin Gala ihn überzog, die ihn beschuldigte, ihr ihre Söhne gestohlen zu haben, da diese die Woche über im Internat blieben. Doch Dimitri parierte Galas Angriffen mit Verstand, rauchte seine Zigarre, schwieg, und wenn das Weinen und Wehklagen aufgehört hatte, entgegnete er ruhig:
»Ich liebe Philip und Tony doch auch, und es schmerzt mich, dass die beiden entfernt von mir leben, aber ich urteile rational und erliege nicht wie du unüberlegten Gefühlen. Der Erfolg der beiden verlangt, dass sie auf dem Victoria College bleiben und eine gute Ausbildung erhalten, bis sie in der Lage sind, auf eigenen Füßen zu stehen.«
Am Freitagabend, wenn Tony und Philip aus dem Internat nach Hause kamen, empfing ihre Mutter sie, als wären sie Soldaten, die aus einem Krieg heimkehren: Mit Schreien und Weinen, Umarmungen und Tränen, Freudenausbrüchen und einer mit ihren Lieblingsspeisen überladenen Tafel, die sie dem Koch auftrug zuzubereiten. In der Schule aber trat schon sehr bald der große Unterschied zwischen den beiden Brüdern zutage. Während Tony brillante Intelligenz mit erstaunlichem Arbeitseifer vereinte, was ihn herausragen ließ, blieb sein Bruder Philip ein durchschnittlicher, unauffälliger Schüler. Tony wurde mit Auszeichnungen und Präsenten für seine schulischen Leistungen nur so überhäuft, bis Dimitri sich genötigt sah, seine Frau zu warnen, sie solle Tonys außerordentliche Begabung mit mehr Zurückhaltung feiern, damit sein älterer Bruder nicht seelischen Schaden nähme.
Tonys einziges Problem war sein beträchtliches Übergewicht, weshalb er von seinen Schulkameraden auch nur »Fat Tony« genannt wurde. Jeden Tag verspeiste er große Mengen an Schokolade aller Art, und sämtliche Bemühungen seines Vaters, dieses Heißhungers Herr zu werden, waren gescheitert, bis ihm schon Zweifel kamen, sein Sohn könnte unter einer psychischen Störung oder einer Fehlfunktion der Hormondrüsen leiden, weshalb er ihn eines Tages in die Praxis von Dr. Cabis nach Mahatet ar-Raml brachte.
Der Doktor untersuchte den wohlbeleibten Knaben ausgiebig, lächelte dann und sagte:
»Monsieur Kazan, machen Sie sich keine Sorgen. Tony ist in einem ausgezeichneten Zustand. Es stimmt, dass er ein wenig übergewichtig ist, aber man kann ihn jetzt keiner Diät unterwerfen, da sein Körper sich ja noch im Wachstum befindet. Er sollte allerdings regelmäßig Sport treiben.«
Doch Tony bewahrte sich sowohl seine schulische Ausnahmestellung wie seine Leibesfülle, bis er das Victoria College abgeschlossen hatte und von seinem Vater an die Universität von Oxford geschickt wurde, während sein Bruder Philip die Amerikanische Universität in Kairo besuchte. Nach vier Jahren kehrte Tony mit einem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften aus Oxford zurück und schien nun zwei unterschiedliche Charaktere in seinem massigen Körper zu tragen. Er hatte sich einen näselnden britischen Akzent zugelegt und einen hochmütigen aristokratischen Charakter, hatte sich zugleich aber auch die offene Liebenswürdigkeit Alexandrias bewahrt, und nicht selten wechselte er von einem Zustand übergangslos in den anderen. So begann er etwa eine Unterhaltung mit Leuten in unterkühlt britischer Distanziertheit, bis ihm plötzlich ein Scherz einfiel, den er zum Besten gab, um dann selbst so laut und ausgelassen zu lachen, dass sein mächtiger Körper bebte.
Nach einem Monat der Feierlichkeiten aus Anlass seiner triumphalen Rückkehr aus Oxford lud ihn sein Vater zum Mittagessen in den Automobilclub ein, damit sie ungestört miteinander reden konnten. Sie saßen an einem Tisch am äußersten Ende des Royal Quay, auf drei Seiten vom Meer umgeben, genossen zwei Flaschen eiskaltes Bier und labten sich an einer üppigen Fischplatte. Nach dem Essen bestellte Tony ein Gateau Mousse au Chocolat. Sein Vater gönnte sich derweil ein Glas Cognac und rauchte eine Zigarre, ehe er sich räusperte und aufgeräumt meinte:
»Tony … Du bist mein Sohn, und dir kann ich die Wahrheit sagen. Ich komme langsam in die Jahre und kann nicht mehr so arbeiten wie früher. Es wird Zeit für mich, mich zurückzuziehen und dir und deinem Bruder das ganze Geschäft zu übergeben. Philip arbeitet jetzt seit zwei Jahren mit mir zusammen und hat schon eine Menge gelernt. Wann stößt du zu uns?«
Tony ließ das letzte Stück des Schokoladenkuchens im Mund zergehen, wischte sich die Lippen mit der Serviette ab, nahm dann einen gemächlichen Schluck von dem eisgekühlten Wasser und verspürte eine wohltuende Belebung, ehe er sagte:
»Herr Papa, ich danke dir für dein Vertrauen, aber es gibt da ein Thema, über das ich mit dir reden möchte.«
Sein Vater sah ihn erwartungsvoll an, und Tony fuhr mit gesenkter Stimme fort:
»Ehrlich gesagt fasziniert mich der Baumwollhandel nicht.«
»Die Profession deines Vaters gefällt dir nicht?«
»Im Gegenteil, es ist eine großartige Profession, aber ich sehe mich darin nur nicht. Ich denke über ein anderes Tätigkeitsfeld nach.«
»Und das wäre?«
»Ich möchte eine Schokoladenfabrik eröffnen.«
Der Vater brauchte einige Momente, bis er die Idee erfasst hatte, um sie alsdann entschieden zu missbilligen. Tony versuchte, etwas zu sagen, doch sein Vater unterbrach ihn ungehalten:
»Wenn du am Ende Konditor wirst, wozu dann all das Geld, das ich in deine Ausbildung gesteckt habe? Für eine Schokoladenfabrik braucht es kein Diplom aus Oxford. Und selbst wenn wir annähmen, ich würde deiner abstrusen Idee zustimmen, so würdest du sie niemals in Ägypten umsetzen können. Vielleicht könnte ich verstehen, hättest du vor, eine solche Fabrik in Europa zu errichten, aber du willst sie in einem instabilen Land eröffnen, in dem es jederzeit zu einer Revolution oder einem Bürgerkrieg kommen kann, und dann würdest du alles verlieren. Würde Ägypten im Chaos versinken und dein Geschäft wäre in deinem Verstand und dein Geld im Ausland, wie bei mir, dann könntest du dich in Sicherheit bringen. Aber hast du hier eine Fabrik, wirst du alles verlieren, weil niemand dir eine Fabrik in einem Land abkauft, das von Unruhen zerrissen wird.«
Tony hörte seinem Vater geduldig zu und erwiderte dann höflich:
»In Oxford habe ich gelernt, die erste Voraussetzung für Erfolg ist, dass du bei deiner Arbeit tust, was du liebst, und nicht, was andere wollen. Ich werde die Fabrik in Alexandria errichten, erstens, weil es meine Stadt ist, die ich gut kenne, und zweitens, weil Europa voll von berühmten Schokoladenfabriken ist, mit denen ich nicht konkurrieren könnte, während es in Ägypten nur eine einzige Schokoladenfabrik gibt, die leicht zu übertreffen ist.«
Doch die Diskussion wuchs sich erst zu einem Wortgefecht aus, dann zum offenen Streit und endete schließlich im Bruch. Verwandte und Freunde traten auf den Plan, um eine Annäherung herbeizuführen. Doch die Weigerung des Vaters war endgültig, zumal er nicht nur Ärger und Enttäuschung verspürte, sondern auch das Gefühl hatte, hintergangen worden zu sein, als sich herausstellte, dass Tony bereits heimlich in London eine Ausbildung zum Chocolatier absolviert und eine Machbarkeitsstudie für die Fabrik erstellt hatte.
Die Vermittler beschied der Vater mit den Worten:
»Ich habe diesem betrügerischen Jungen nichts mehr zu bieten. Ich habe meine Pflicht an ihm wahrlich erfüllt und ihm ein angenehmes Leben ermöglicht, wie ich es in meiner Kindheit nicht gekannt habe, habe ihm die bestmögliche Ausbildung der Welt gegeben. Er weigert sich, seinem Vater im Alter zu helfen, und lehnt den sicheren Wohlstand ab, den der Baumwollhandel ihm bescheren würde. Und das alles, um Pistazienschokolade herzustellen?!! Nun gut, ich wünsche ihm viel Glück als Konditor, aber ich werde ihn nicht mit einer Guinee unterstützen.«
Tony benötigte gut und gerne 10.000 ägyptische Pfund zum Erwerb des Geländes, der Errichtung des Fabrikgebäudes und für den Import der erforderlichen Maschinen, und als er keine Hoffnung mehr in seinen Vater setzte, machte er sich daran, seine Mutter zu beknien und zu umgarnen, bis sie ihm den Betrag aus ihrem Privatvermögen zur Verfügung stellte, ihn aber verpflichtete, seinem Vater nichts davon zu sagen. Und so eröffnete Tony Kazan seine Schokoladenfabrik auf einem Gelände, das er am Mahmudiyya-Kanal erwarb. Anfangs nur mit zwanzig Arbeitern, fünf von ihnen Griechen, drei Italiener und zwei Armenier und der Rest Ägypter. Er ließ einen kleinen Hörsaal einrichten, mit Stühlen, Stiften und Papier für alle Arbeiter, trat dann vor sie und legte ihnen an der Tafel detailliert die einzelnen Schritte der Schokoladenherstellung dar, angefangen vom Ernten der Kakaobohnen, ihrer Fermentierung und Trocknung, dann über die Röstung, Zerkleinerung und das Mahlen, die Beigabe von Zucker, Milch und Caramel bis hin zur Fertigung in geeigneten Gussformen. Danach machte sich Tony geduldig und beharrlich an die Schulung seiner Arbeiter, bis diese den Fertigungsprozess beherrschten. Im ersten Jahr machte die Fabrik keinen Gewinn, und im zweiten kamen empfindliche Verluste hinzu, was Tony zwang, seine Mutter ein zweites Mal um einen Kredit anzugehen. Sie lehnte zuerst vehement ab, am Ende aber erhörte sie sein Flehen, warnte ihn jedoch unmissverständlich:
»Das ist das letzte Mal, dass ich dir Geld gebe. Entweder du verdienst etwas, oder du schließt diese Fabrik.«
Im dritten Jahr machte das Werk zum ersten Mal Gewinne, die es im darauffolgenden Jahr verdoppelte, als die Bestellungen gar nicht mehr abreißen wollten und endlich auch Order aus den arabischen Staaten eingingen. Tony hatte die Idee, sich der religiösen Feste zu bedienen: zu Ostern wurde Schokolade in Ei- und Hasenform gefertigt, zum jüdischen Chanukkafest in Form von Geldstücken und zum Geburtstag des Propheten und dem Fest des Fastenbrechens fertigte man Halbmonde, Rösser und Säbel aus Schokolade. Die Idee wurde ein voller Erfolg, und vor den religiösen Festen explodierte die Nachfrage nach Kazan-Schokolade förmlich. Mit dem wachsenden Erfolg war auch der Grund bereitet für eine Aussöhnung zwischen Tony und seinem Vater, der einsah, sein Sohn dachte zwar unkonventionell, vermochte aber Erfolg zu haben. Doch sieben Jahre nach Eröffnung der Fabrik verstarb Dimitri plötzlich an einem Blutgerinnsel im Gehirn, und nur zwei Jahre später folgte ihm seine Frau Gala nach.





























