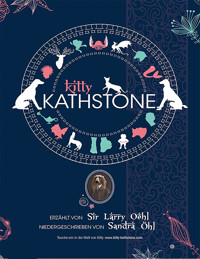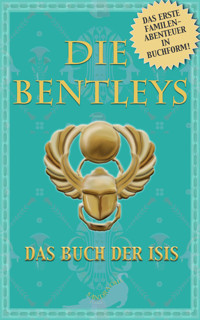
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sommer 2021. Es ist heiß. Es ist langweilig. Es ist so wie immer in Manhattan. Charlotte stellt an ihre Sommerferien nicht allzu große Erwartungen. Als mitten in der Nacht eine bis über beide Ohren vermummte Person an die Tür der Familie Bentley klopft und sich als ägyptische Katzengöttin Bastet entpuppt, die bei ihrer Suche nach dem gestohlenen Buch der Isis um Hilfe bittet. Bald befinden sich Charlotte, ihre Eltern George und Henrietta, und drei gar nicht so göttliche Götter – die selbstmitleidige Bastet, der antiautoritäre Anubis und der in sich zerrissenen Horus – auf einer atemberaubenden Jagd, die sie von Manhattan, nach London, über Kairo bis in das Tal der Toten führt … DIE BENTLEYS UND DAS BUCH DER ISIS ist ein humorvolles, actiongeladenes Familienabenteuer, das nicht nur für junge Leser gedacht ist, sondern für die ganze Familie!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
DIE BENTLEYS
UND
DAS BUCH DER ISIS
1.Auflage
© der Originalausgabe 2017 by Sandra Charlotte Öhl-Wögerbauer
© Illustrationen by Nanshe Öhl
Lektorat & Korrektorat: Lisa Helmus
Impressum: Sandra Öhl, 4312 Reid in der Riedmark/ Zirkingerstr. 51
INHALT
Der unheimliche Besuch
Mr. Wang und das Long-Orakel
Der MET Coup
Der Londoner Zirkel
Horus und Anubis
Die Nacht der Isis
Turbulenzen
Willkommen in Kairo!
Der Ramses Bahnhof
Soul Train
Susie von Luxor
Das Haus von Howard Carter
Nefertaris Grab
Das Küchlein an der Waage
ANHANG
Der unheimliche Besuch
Mein Name ist Charlotte. Noch vor wenigen Tagen hätte ich meine Eltern mit den Worten langweilig und merkwürdig beschrieben.
Merkwürdig vor allem deshalb, weil sie ihr einziges Kind nach ihrer Lieblingssüßspeise, einem Biskuitkuchen mit Schokoladenfüllung, benannt haben. Ihr solltet mal die Gesichter der Leute im Supermarkt sehen, wenn Mom lauthals: ”Wo bist denn du, mein Küchlein?!”den Gang entlangbrüllt. (Küchlein ist übrigens der Kosename meiner Eltern für mich.)
Und langweilig, da meine Eltern nichts anderes machen, als den lieben langen Tag im Met alten verstaubten Krempel zu sortieren, zu katalogisieren oder zu restaurieren. Mom versucht mich zwar ständig zu überreden, sie doch wieder mal bei ihrer Arbeit zu besuchen, aber nach meinem letzten Aufenthalt habe ich ein für alle Mal beschlossen, der Kammer der absolut tödlichen Langeweile fernzubleiben – und zwar für immer! Ständiges Stillsitzen untermalt von dem nicht enden wollenden Sing-Sang fass dies oder das nicht an, war eben nicht so mein Ding.
Met ist übrigens die Abkürzung für das Metropolitan Museum of Art, wo meine Mom und mein Dad als Archäologen und Restauratoren arbeiten. Allerdings haben die beiden die Welt der Antike bis dato nur im gesicherten Museumsbereich erlebt, da sie in der Feldforschung gleich zu Beginn ihrer Karriere grandios versagt hatten. Das hängt vor allem damit zusammen, dass mein Dad (George) ein wenig tollpatschig ist, und meine Mom (Henrietta) hoffnungslos nervös, was wiederum ein bisschen mit der Art meines Dads zu tun hat.
Auf Dads offiziellem Diplom befindet sich in der unteren rechten Ecke sogar eine kleine kaum lesbare Notiz seines Professors, in der er ihn eindringlich bittet, sich in Zukunft von jeglicher Ausgrabung fernzuhalten. Dad war blöderweise bei seiner ersten Ausgrabung ein winziges Missgeschick passiert. Bei dem Versuch, sein Kamel zu bändigen, hatte er unter Beihilfe meiner nervösen Mom den kompletten Eingang zu einer Grabkammer verschüttet – inklusive des Professors, der sich dummerweise zu diesem Zeitpunkt in der Kammer befunden hatte. Das hatte sich natürlich rasch herumgesprochen. Seitdem war es für die beiden so gut wie unmöglich, eine Anstellung bei einer Ausgrabung zu finden, und so waren sie eben im Met gelandet, das übrigens das größtes Kunstmuseum der Vereinigten Staaten mit Sitz in Manhattan, New York, ist.
Meine Eltern hegen und pflegen aber nicht nur im Museum altertümliche Gegenstände, sondern auch bei uns zu Hause. Zu Hause, das ist ein zweistöckiges, mit altem, teils echt gruseligem Zeugs vollgestopftes Appartement mitten in Manhattan. Und wer jetzt denkt, dass wir richtig reich sind, dem muss ich hier mitteilen, dass er sich leider gewaltig täuscht! Im Grunde genommen sind wir arm wie Kirchenmäuse, denn das bescheidene Gehalt meiner Eltern lässt uns in einer Stadt wie New York nicht unbedingt wie Gott in Frankreich leben. Das zweistöckige Wohnhaus, das sich nicht unweit vom Met befindet, hatte mein Vater von seinem Vater geerbt, der anscheinend ein wenig vermögender war als wir. Leider habe ich meinen Großvater Henry nie kennengelernt, denn er ist vor meiner Geburt bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Mein Vater hat das Erdgeschoß, inklusive Geschäftsfläche und Lagerraum, aus Geldmangel an Mrs. Norris, eine ältere, pummlige Dame vermietet, die dort einen Laden für Wahrsagerei – Mrs. Norris’ Fortune Telling und Psychic Reading – betreibt.
Gerade hatten die Sommerferien begonnen. Das bedeutete, dass Mrs. Norris tagsüber – wie auch an diesem Tag – immer wieder nach mir sah, während meine Eltern im Museum arbeiteten. Dabei hielt sie mir wiederholt Vorträge, was die heutige Jugend so alles verpasst, weil wir ja nur auf unsere Handys gucken, anstatt mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Meist ließ ich die Anti-Socialmedia-Moralpredigt über mich ergehen und nickte ab und zu höflich. Einzig das Angebot, mir das Kartenlegen beizubringen, lehnte ich auch dieses Mal dankend ab.
»Na gut, ich habe dann gleich einen Kunden«, murmelte Mrs. Norris, schob ihren Turban zurecht und wackelte mit ihrem ausladenden Hintern zur Tür hinaus, wobei ich sie noch säuseln hörte: »Die sollten das arme Kind in ein Sommercamp schicken, aber wenn das Geld nicht reicht …« »Diese Hitze«, schnaubte sie zuletzt, ehe die Tür endlich ins Schloss glitt und ich wieder allein war.
Ganz ehrlich, ein Sommercamp war so ziemlich der letzte Ort, an den ich wollte! Ich sah mich gelangweilt im Appartement um und fächerte mir Luft zu. Mom hatte mir trotz dieser unglaublichen Hitzewelle wiederholt verboten, allein nach Coney Island zum Schwimmen zu fahren (und das, obwohl ich bereits dreizehneinhalb bin und jeden Tag alleine mitten durch Manhattan zur Schule gehe). Ich warf einen kurzen Blick auf mein Handy und beneidete meine Freunde, die mir unentwegt Fotos aus ihren aufregenden Urlauben schickten. Genervt, aber vor allem gelangweilt, legte ich mein Handy auf den Küchentisch, an dem ich saß, und sehnte mich danach, dass die Schule bald wieder beginnen würde. Von der gegenüberliegenden Wand starrte mir eine indische Maske entgegen, deren grellrote Zunge frech herausgesteckt war. Ich streckte ihr meine ebenso keck entgegen, stieß mich vom Küchentisch ab und stand auf. Angesichts meines absurden Wunsches (die Ferien hatten gerade mal vor zwei Tagen begonnen) beschloss ich, zum Rollschuhfahren in den Central Park zu gehen – egal, was Mom dazu sagen würde! Kein Mensch konnte erwarten, dass ich die ganzen Ferien über hier im Appartement herumsitzen würde. Ich schnappte mir meine Rollschuhe und griff nach dem Helm, der am Knauf der einzig versperrten Tür baumelte, die es hier gab.
Meine Eltern waren eigentlich nicht so die geheimniskrämerischen Typen, aber solange ich zurückdenken kann, war diese Tür verschlossen gewesen, und ich hatte im Grunde genommen nie die Gelegenheit gehabt, auch nur einen Blick in den Raum zu erhaschen. Mom und Dad erinnerten mich mindestens einmal im Monat daran, dass es mir strengstens verboten war, diesen Raum zu betreten. Angeblich lagerten sie dort unterschiedliche Museumsstücke zur Restauration und daher gefährliche Chemikalien, die sie für ihre Arbeit brauchten. Und obwohl mich der Kram im Zimmer eigentlich nicht interessierte, konnte ich mir nicht helfen. Zum allerersten Mal juckte es mich gewaltig in den Fingern, die verbotene Tür zu öffnen und die einzige heilige Regel in unserem Haushalt zu brechen. Während in der einen Hand meine Rollschuhe an ihren Schnüren baumelten, zog ich mit der anderen bedacht den Helm vom Knauf und legte ihn beiseite. Für einen kurzen Augenblick studierte ich eingehend den abgenutzten Messingknauf, bevor ich behutsam meine Hand darum schloss. Mein Herz schlug schneller, als ich ihn um 90 Grad drehte. Endlich hörte ich ein leises Klicken und versuchte die Tür aufzudrücken. Vergebens!
Mit einem frustrierten Schnauben ließ ich den Knauf los und beschloss, mich lieber etwas Aufregenderem als dem alten Museumskrempel und ein paar stinkenden Chemikalien zu widmen – nämlich meiner geplanten Rollschuhtour und einer Tüte Eis im Central Park (vielleicht würde auch noch ein Hot Dog hinzukommen, immerhin hatte mir Mrs. Norris fünf Dollar zum Ferienbeginn zugesteckt).
Ich hatte vollkommen die Zeit vergessen und es war beinahe schon dunkel, als ich es gerade noch rechtzeitig schaffte, knapp vor meinen Eltern und natürlich von Mrs. Norris unbemerkt, durch die Appartementtür zu schlüpfen. Ich warf mich aufs Sofa und starrte so unschuldig wie möglich in die Luft, als meine Eltern nur wenige Sekunden später die Tür aufstießen. Mom wackelte mit einem Stapel Arbeitsunterlagen herein, während Dad versuchte, drei Pizzaschachteln unfallfrei in Richtung Esstisch zu balancieren. Bemüht gelangweilt aussehend und gähnend hievte ich mich vom Sofa hoch und nahm Dad die Schachteln ab, bevor sie noch auf dem Boden landeten. »Endlich seid ihr da! Es war so langweilig!«, flunkerte ich und schielte zu Mom, um zu sehen, ob sie mir meine Story abkaufte.
Denn wer konnte schon wissen, vielleicht würde sie mich doch in ein Feriencamp schicken, wenn sie herausfand, dass ich mich den ganzen Tag unbeaufsichtigt im Central Park herumgetrieben hatte. Ich beschloss aufgrund von Mom’s ausbleibender Reaktion meiner Langeweile noch ein wenig mehr Nachdruck zu verleihen und gähnte erneut herzhaft – was mir eigentlich gar nicht so schwerfiel, denn ich war aufgrund meines Rollschuhtrips hundemüde.
Und genau aus diesem Grund wollte ich mich nach dem Essen auch so schnell wie möglich auf mein Zimmer verdrücken. Doch bevor ich auch nur annähernd dazu kam, bestand Mom darauf, bei mir Fieber zu messen. Ihr war aufgefallen, dass ich außergewöhnlich ruhig und mein Gesicht besorgniserregend rot war. Ich hatte mir wohl im Central Park einen leichten Sonnenbrand zugezogen und würde morgen vorsichtshalber Sonnencreme mitnehmen, oder vielleicht sogar einen Hut aufsetzen, denn ich hatte das Gefühl, dass die Sonne mein Gehirn teilfrittiert hatte.
Nachdem das Fiebermessen ergebnislos verlaufen war, ließ mich Mom endlich auf mein Zimmer. Todmüde fiel ich auf mein Bett und schlief sofort ein. Es war mitten in der Nacht, als ich schweißgebadet aufwachte. Anscheinend war mal wieder die Klimaanlage ausgefallen. Dad hatte sie zwar schon lange reparieren lassen wollen, aber entweder reichte das Geld nicht aus, oder er hatte es schlicht und ergreifend vergessen. Immerhin war ja nicht er derjenige, der seine Sommerferien in einem überhitzten New Yorker Appartement aussitzen musste!
Ich ging in die Küche, um mir ein Glas kaltes Wasser zu holen, als jemand ungeduldig an unsere Wohnungstür klopfte. Nur wenige Sekunden später öffnete sich die Tür des verbotenen Zimmers zu einem schmalen Schlitz. Es war Dad, der sich durch den schummrigen Spalt schob, ehe er äußerst behutsam die Tür wieder ins Schloss zog und auf Zehenspitzen zum Eingang schlich. Anscheinend hatte er mich nicht bemerkt, sonst hätte er sicher auf die ganze Heimlichtuerei verzichtet. Ich verharrte regungslos an der Spüle.
»Wer ist da?«, flüsterte Dad.
Jemand zischte etwas zurück, aber ich konnte kein Wort verstehen. Dad öffnete umgehend die Eingangstür. Ich nutzte die Gelegenheit und verschanzte mich hinter dem Küchentisch, um unentdeckt zu bleiben. Vorsichtig schielte ich am Tischbein vorbei.
Im Flur stand eine vollkommen in Schwarz gehüllte Frau, deren rechter Fuß nervös auf und ab tappte, wobei ihr langer Rocksaum im Takt mitschwang. Der Kragen ihrer Jacke war hochgeschlagen und ihre Hände steckten in schwarzen Handschuhen. Ihr Kopf war mit einem schwarzen Tuch verhüllt und ich konnte mir nicht helfen, irgendwie erinnerte sie mich an eine Mumie – nur eben in Schwarz. Aber was ich noch eigenartiger fand, und jetzt kommt der Knaller: Sie trug eine große schwarze Sonnenbrille und das mitten in der Nacht! Ich blinzelte aus meinem Versteck zur Uhr unseres Küchenherds. Es war 23:48! Die Sonnenbrille war um diese Uhrzeit selbst für einen Einwohner Manhattans übertrieben!
Dad winkte die Frau hektisch in unser Vorzimmer herein und ging raschen Schrittes mit ihr in den verbotenen Raum. Als er die Tür sorgfältig hinter sich ins Schloss gedrückt hatte, herrschte plötzlich eine beklemmende Stille im Flur, aber selbst die konnte mich nicht davon abhalten innerlich zu explodieren!
Ich meine, war denn das zu glauben? Da spazierte mitten in der Nacht irgendeine Fremde einfach so mir nichts dir nichts direkt von unserer Wohnungstür in die verbotene Kammer, während ich mein Leben lang ausgesperrt war! Der Zeitpunkt, an dem ich wissen musste, was da drinnen vor sich ging, war definitiv gekommen! Langsam und auf Zehenspitzen schlich ich aus meinem Versteck zur Tür und bückte mich zum Schlüsselloch hinunter. Doch als ich durchsah, herrschte am anderen Ende Dunkelheit. Na toll – die Frau in Schwarz versperrte mir jetzt also auch noch den Blick auf das wohlgehütete Familiengeheimnis!
»Das Buch der Isis ist verschwunden«, zischte die mir fremde Frauenstimme unterdessen hinter der Tür.
Ich verlagerte das Gewicht, um mein Ohr an die Tür zu legen. Wenn ich schon nichts sehen konnte, dann wollte ich zumindest alles hören. Blöderweise knarrte die verdammte Holzdiele unter meinem Gewicht und nicht mal eine Sekunde später folgte ein lauter werdendes Fauchen, das in meine Richtung zielte. Ich erschrak so sehr, dass ich von der Tür zurücksprang, dabei über meine eigenen Rollschuhe stolperte und auf den Boden krachte.
Die Tür sprang auf und ein riesiger fauchender Katzenkopf schoss mir entgegen.
»Nicht, das ist unser Küchlein!«, hörte ich Mom verzweifelt aus dem Hintergrund rufen, ehe sie sich hastig an dem riesigen Katzenvieh, dessen bernsteinfarbene Augen mir entgegenfunkelten, vorbeidrängte.
Meine Mom streckte mir ihre Hand entgegen, um mir wieder auf die Beine zu helfen, aber ich war starr vor Schreck. Ich meine, vor mir stand ein riesiges Katzenmonster mit menschlichen Händen, die es in seine Hüfte gestemmt hatte, während es auf mich hinabsah! Verdammt noch mal, was ging hier vor?! Ich war knapp davor, mir in die Hosen zu machen.
»Küchlein, ist alles in Ordnung?«, fragte Mom besorgt.
»Sie hat uns belauscht«, fauchte die Katzenfrau und sah vorwurfsvoll zu Dad, der soeben zu Mom in den Flur trat. »Ich dachte, es wäre hier sicher!«
»Das ist Charlotte – unsere Tochter«, entgegnete Dad ein wenig gereizt und zog mich gemeinsam mit Mom auf die Beine. »Ich habe dir doch bereits von ihr erzählt!«
Die Katze beäugte mich skeptisch. Ich glaubte sogar, ein kehliges Knurren gehört zu haben, als mich Mom und Dad an ihr vorbei ins Zimmer schoben. Allerdings hatte ich keine Zeit, mich damit aufzuhalten, denn was ich dort sah, ließ mich wie am Spieß schreien. Dad presste umgehend seine Hand auf meinen Mund.
In der Mitte des Raumes befand sich ein Steintisch, auf dem eine Mumie lag. Aber es war nicht so eine alte Mumie, wie ich sie aus dem Museum kannte, sondern ein frisches Exemplar. Woher ich das wusste? Na ja, einerseits waren die Bandagen nigel-nagel-neu, und andererseits, und das war der weitaus schlimmere Teil, war der Kopf noch nicht vollständig bandagiert, sodass ich das verschrumpelte Gesicht des alten Mannes erkennen konnte. Es war Mr. Humphrey, der meine Mom und meinen Dad regelmäßig im Museum besuchte, bevor er sich bei Mrs. Norris die Karten legen ließ.
Dad drehte mich behutsam zu sich um. »Küchlein, beruhig dich doch! Es ist alles gut! Wir werden dir alles erklären – in Ordnung?«
Draußen klopfte es an der Tür.
»Ist bei Ihnen alles in Ordnung?«. Es war Mrs. Norris, die durch meinen Schrei alarmiert worden war.
»Ja, alles bestens! Charlotte hatte nur einen Albtraum!«, rief Dad und wandte seinen Blick abwartend in Richtung Flur, zugleich weitete ich angesichts Dads dreister Behauptung ungläubig meine Augen.
»In Ordnung!«, rief Mrs. Norris durch die geschlossene Tür hindurch. »Vielleicht sollten Sie ja doch mal drüber nachdenken, das Kind in ein Sommercamp zu schicken – Sie sehen ja, wo diese Handysucht hinführt!«
»Ja, das werden wir uns überlegen, danke Mrs. Norris!«, antwortete Dad und lauschte den sich entfernenden Schritten von Mrs. Norris, ehe er sich mir wieder zuwandte. Inzwischen war Mom hinter Dad aufgetaucht und blickte mir besorgt entgegen.
»Wenn ich jetzt meine Hand von deinem Mund nehme, versprichst du mir, mit dem Schreien aufzuhören?«, fragte mich Dad ernst.
Während Mom im Hintergrund verzweifelt »George, sie wird uns für immer hassen!« schluchzte.
»Nein, das wird sie nicht«, entgegnete Dad, ohne seinen Blick von mir abzuwenden. »Richtig?«
Ich zögerte mit meiner Antwort einen Moment lang, denn ich wog gerade ab, ob meine Eltern verrückte Serienkiller waren, oder ob sie tatsächlich alles erklären konnten. Ich entschied mich angesichts der Katzenfrau, die soeben erneut neben Mom auftauchte, für Zweiteres und nickte Dad zu.
Er nahm vorsichtig seine Hand von meinem Mund und bedeutete mir, auf dem mit Hieroglyphen verzierten Stuhl nicht unweit vom toten Mr. Humphrey Platz zu nehmen. Schweigend setzte ich mich und sah konzentriert zu Dad hoch, um den dahingeschiedenen Mr. Humphrey so gut wie möglich aus meinen Gedanken zu verbannen.
»Du versprichst mir, Ruhe zu bewahren, wenn ich dir sage, was Mom und ich hier machen?«, erkundigte sich Dad eindringlich, unterdessen leckte sich die Katzenfrau über ihre Pfote und glotzte mich dabei ungeniert an.
Erneut nickte ich Dad irritiert zu, denn ruhig zu bleiben, war angesichts der Gesamtsituation gar nicht so einfach. Ich fragte mich, ob er überhaupt bemerkt hatte, dass direkt neben Mom eine riesige Monsterkatze stand, und ein toter Mr. Humphrey in nächster Nähe vor mir auf einem Tisch lag.
»Also, deine Mom und ich sind Balsamierer, sowas wie ägyptische Leichenbestatter«, begann Dad vorsichtig. »Nachdem dein Großvater Henry so plötzlich verstorben war, mussten Mom und ich relativ rasch die Entscheidung treffen, ob wir seine Arbeit als Balsamierer fortführen wollten, oder ob wir diese Verpflichtung an eine andere Familie in Manhattan übergeben würden. Mom und ich entschieden damals, seine Pflichten und die damit verbundenen Aufgaben voll und ganz zu übernehmen, da wir bereits dem ägyptischen Glauben angehörten. Seitdem mumifizieren wir in Manhattan alle Angehörigen der ägyptischen Glaubensrichtung.« Dad sah abwartend in meine Richtung, während Mom laut schniefte und ihre Tränen wegtupfte.
Ich blieb trotz der unglaublichen Offenbarung stumm, denn ich brauchte definitiv ein wenig Zeit, um das Ganze zu verdauen. Sprachlos sah ich mich im Raum um, immerhin war es das erste Mal, dass ich diesen verbotenen Ort sah. Zugleich überlegte ich, ob Dad vielleicht nur einen schlechten Scherz gemacht hatte. Doch das, was ich sah, überzeugte mich vom Gegenteil.
Die sorgfältig aufgereihten Kanopen, die nicht unweit von Mr. Humphrey standen, fielen mir als Erstes auf und das kleine Stückchen Hirn, das noch an seiner Nasenscheidewand klebte. (Hatte ich schon erwähnt, dass ich außergewöhnlich gute Augen habe?)
»Küchlein, so sag doch was!«, wisperte Mom unterdessen verzagt.
Ich wandte meinen Blick wieder meinen Eltern zu. »Wer von euch beiden zieht den Leuten das Hirn aus der Nase? Wollen die das wirklich so?« Wenn ihr mich fragt: Ich stand definitiv unter Schock, ansonsten hätte ich über sowas nicht nachgedacht, oder es auch nur im Entferntesten laut ausgesprochen.
Gerade als Dad etwas erwidern wollte, drängte sich die Katzenfrau in den Vordergrund.
»Es tut mir leid, dass ich euch an dieser Stelle unterbreche, aber wir haben momentan wirklich ein dringlicheres Problem. Sie wird es schon verkraften.« Bestärkend klopfte sie Dad auf die Schulter.
»Nein, werde ich nicht!«, mischte ich mich empört ein.
»Siehst du, George, ich hatte dir gesagt, dass wir es ihr längst hätten sagen sollen!«, schrillte Moms Stimme durch den Raum, die nun fast so sehr durch den Wind war wie ich.
»Und wer ist das eigentlich?« Mit ausgestrecktem Finger zeigte ich auf das Katzenmonster, in diesem Augenblick war es mir nämlich egal, ob sich so etwas gehörte oder nicht!
»Du willst wissen, wer ich bin?«, schnappte die Katzenfrau und baute sich vor mir auf. »Ich bin Bastet, die Tochter des Sonnengottes Re«, verkündete sie voller Stolz. »Und ich bin hier, weil ich die Hilfe deiner Eltern benötige. Das Buch der Isis wurde aus meinem Besitz entwendet und wenn ich es nicht rasch wiederfinde, schweben vielleicht alle ägyptischen Götter in«, sie überlegte für einen Augenblick, »Lebensgefahr.« Sie fixierte mich mit ihren glühenden Augen. »Noch Fragen, oder können wir weitermachen?«
Ich schüttelte rasch den Kopf. Und ich schätze mal, an dieser Stelle wird klar, dass Bastet nicht so der sensible Typ ist – egal was andere behaupten!
»Aber wie genau können wir dir helfen?«, warf mein Vater ein. »Wir sind doch nur Balsamierer! Wäre es nicht besser, die anderen Götter zu Rate zu ziehen? Wer immer das Buch nun hat, sollte rasch gefunden werden. Wir wissen nicht, was sein Ziel ist, und du weißt so gut wie ich, dass die Geheimnisse, die das Buch birgt, nicht nur die Welt der ägyptischen Götter, sondern die gesamte Welt in seinen Grundfesten erschüttern kann.«
»Außer euch weiß noch niemand von dem Diebstahl«, gestand Bastet kleinlaut und sah hilflos zu Dad. »Und ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich muss das Buch bereits in sieben Tagen an Horus übergeben. Er ist der nächste, der darüber wachen soll. Ich stecke echt in der Klemme und ihr seid meine Freunde, deshalb bin ich hier.« Sie machte eine kurze Pause. »Was denkt ihr, wäre los, wenn die anderen wüssten, dass wegen meiner Nachlässigkeit das Buch der Isis verschwunden ist … und im schlimmsten Fall vielleicht sogar ihre eigene Existenz auf dem Spiel steht. Sie halten mich doch ohnehin schon für eine Versagerin – die Göttin der Unwichtigkeiten des Lebens, so nennen sie mich «, jammerte Bastet, während ihre Katzenohren auf Halbmast sanken. »Ich kann es ihnen unmöglich gestehen, bevor ich nicht wirklich alles versucht habe. George, ich wusste nicht, zu wem ich sonst gehen sollte. Du bist mein Patenkind, ich habe immer über dich gewacht – so wie ich es deinem Vater Henry versprochen hatte«, setzte sie eindringlich nach.
Dad musterte Bastet, wobei er seine Augenbrauen hob und laut schnaubte, ehe er sich stumm an Mom wandte. Mit einem Schulterzucken gab er ihr zu verstehen, dass es nun an der Zeit war, sich einzumischen.
»Denkst du denn nicht, dass die anderen das Recht haben, es zu erfahren?«, erkundigte sich Mom mit Nachdruck. »Immerhin geht es in der Angelegenheit nicht nur um dich, Bastet.«
Ich räusperte mich und schaute ungläubig in die Runde – schließlich war Bastet hier nicht die Einzige, die Informationen zurückhielt.
»Du weißt doch, wie die anderen sind«, erwiderte Bastet betreten. »George«, setzte sie flehend nach. »Henry und ich haben uns immer sehr nahegestanden, und du weißt, ich habe immer alles getan, worum er mich gebeten hat.«
Dad rieb sich am Unterarm – das tut er übrigens immer, wenn er überlegt. »Na gut«, entgegnete er. »Erzähl uns, was passiert ist, und dann lass uns überlegen, wie wir dir in der Sache helfen können.«
Ich blieb die ganze Zeit über still auf meinem Stuhl sitzen und hörte genau zu. (Okay, ab und zu schielte ich zum toten Mr. Humphrey, nur um sicherzugehen, dass er nicht plötzlich von den Toten wiederauferstehen würde.)
Neben der Tatsache, dass Bastet das Buch nicht gerade fachmännisch aufbewahrt hatte – ich zumindest finde einen Schuhkarton unter dem Bett nicht ausreichend – stellte sich heraus, dass sie bereits seit zwei Tagen versucht hatte, es im Alleingang wiederzufinden.
»Und du hast wirklich nicht den geringsten Hinweis gefunden?«, hakte Dad nach.
Bastet schüttelte verdrossen den Kopf.
»Hm.« Dad rieb sich weiter am Unterarm. »Ich fürchte, das wird schwierig. Und ich habe ehrlich gesagt nicht die geringste Idee, wie wir dir da helfen könnten. Du musst den anderen die Wahrheit sagen, das ist das Einfachste für uns alle.«
Bastets Augen füllten sich mit Tränen und ich bekam fast ein bisschen Mitleid – aber nur fast!
Bei Dad funktionierte der Trick anscheinend besser. »Na gut, eine Möglichkeit fällt mir noch ein. Wir werden morgen zu Mr. Wang gehen und sehen, ob er was für uns hat. Sobald wir eine Spur haben, kontaktiere ich dich.«
»Wie soll bitte ausgerechnet Mr. Wang helfen?«, warf ich verblüfft ein.
Mr. Wang war der Besitzer eines kleinen Ladens in Chinatown, wo wir immer unsere Gewürze und Nudelsuppen kauften. Er war so ziemlich der unfreundlichste Mensch, den ich in Manhattan kannte, und selbst das war noch eine Untertreibung. Ich wusste wirklich nicht, wie gerade er bei dieser Sache helfen sollte.
Bastet verließ nach Dads Vorschlag auf alle Fälle sichtlich erleichtert unser Appartement. Sie musste der wöchentlich nächtlichen Versammlung des göttlichen Buchclubs von Manhattan beiwohnen, denn just in diesem Monat hatte sie die Moderation der Leserunde übernommen und wollte durch ihr Fernbleiben keinesfalls Verdacht erregen.
Im Anschluss fand noch eine ausgedehnte Sitzung zwischen meinen Eltern und mir am Küchentisch statt. Ich meine, ich konnte unmöglich bei dem, was ich soeben gehört hatte, seelenruhig schlafen gehen!
Bei meiner Befragung erfuhr ich, dass es weltweit Balsamierer gab. Meine Eltern waren für den Bezirk Manhattan verantwortlich. Mom erzählte mir, dass noch überraschend viele Menschen die ägyptischen Gottheiten verehrten und ebendieser Glaube verlieh den Göttern die notwendige Energie, um zu existieren. Die Anhänger der ägyptischen Religion fanden durch Insider zu meinen Eltern. Sie beauftragten Mom und Dad bereits zu Lebzeiten mit ihrer Balsamierung, da sie die Überzeugung der alten Ägypter teilten, dass man sich im Diesseits auf das Jenseits vorbereiten sollte. Allerdings war ihnen, im Gegensatz zu meinen Eltern, der Zutritt zu den Tempeln verwehrt – was ich ein bisschen unfair fand.
Übrigens stand mir echt die Kinnlade offen, als Dad mir von den geheimen Tempelanlagen erzählte, die es weltweit noch vereinzelt gab. Meine Begeisterung schwand allerdings, als Mom mir auf eine meiner Fragen zögerlich offenbarte, dass mit ihrer Verpflichtung als Balsamierer ein Schwur einherging. Dieser band auf gewisse Art das Schicksal meiner Eltern an das der Götter.
Dad versuchte zwar sofort meine Bedenken zu zerstreuen, indem er mehrmals beteuerte, dass ihre Zusatzbeschäftigung nun wirklich nichts Außergewöhnliches war. Aus seiner Sicht gab es absolut keinen Anlass zur Besorgnis und er meinte, es würde sich ohnehin alles in Kürze klären. Um das Ganze noch abzurunden, fügte er hinzu, dass sie im Grunde genommen ja nichts anderes waren als Leichenbestatter und die gab es nun wirklich überall.
Ich sah das allerdings ein bisschen anders! Erstens war ich davon überzeugt, dass die Kinder eines Leichenbestatters nicht mit Toten unter einem Dach schlafen mussten. Zweitens zogen deren Eltern bestimmt niemandem nachts heimlich das Gehirn aus der Nase. Und drittens – und da war ich mir absolut sicher – war das Schicksal eines Leichenbestatters bestimmt nicht an das eines Gottes gebunden. Als ich Mom und Dad fragte, warum sie den geleisteten Schwur nicht einfach brachen, wollten sie nicht weiter darauf eingehen. Die einzige Antwort, die ich bekam, war, dass dies für sie der allerletzte Ausweg wäre. Meine Eltern waren also anscheinend echt gläubig – ich konnte es nicht fassen! Immerhin hatten sie mich bis dahin ohne irgendeine Art von religiösem Einfluss aufgezogen! Aber irgendwann war ich einfach so müde, dass mir trotz der tausend Fragen, die mir noch durch den Kopf schwirrten, einfach die Augen zufielen – was aus meiner Sicht echt ärgerlich war! Allerdings hatte ich mir vor meiner komatösen Tiefschlafphase noch eines vorgenommen: Ich würde am nächsten Tag keinesfalls von der Seite meiner Eltern weichen!
Mr. Wang und das Long-Orakel
Am nächsten Morgen schleppte ich mich mit meinen Eltern in aller Herrgottsfrüh nach Chinatown. Als wir bei Mr. Wangs Spezialitäten angekommen waren, war der Laden allerdings noch geschlossen. Und nun, wo ich Mom und Dad so vor mir stehen sah, fiel es mir schwer zu glauben, was ich letzte Nacht erfahren hatte.
»Werdet ihr mich auch mal mumifizieren?«, platzte es aus mir heraus.
Meine Mom sah überrascht zu mir. »Küchlein, wie kommst du denn auf die Idee?!«
Ich zuckte mit den Schultern. »Na ja … das ist doch das, was ihr tut«, ergänzte ich zögerlich.
»Ich hoffe, dass wir vor dir gehen«, mischte sich Dad ein und blickte vom Eingang des Geschäfts zu mir. »Und du kannst das handhaben, wie du willst, Küchlein.«
»Wie meinst du das?«, fragte ich Dad.
»Es ist schon richtig, dass du dich dementsprechend auf das Leben nach dem Tod vorbereiten wirst, solltest du den ägyptischen Glauben wählen. Aber«, Dad hob seinen Zeigefinger und legte dabei eine winzige Pause ein, »vielleicht schlägst du einen anderen Weg ein. Du weißt doch, es gibt die verschiedensten Religionen und ich denke, keine sollte für sich beanspruchen, die einzig wahre zu sein. Die Aufgabe des Glaubens besteht meines Erachtens nach darin, dass er den Gläubigen auf dem Weg zu seinem wahren Selbst begleitet. Er sollte dich einfach zu einem besseren Menschen machen. Welchen Pfad du hierfür einschlägst, ist aber ganz dir überlassen. Mom und mir war es immer wichtig, dass du diesbezüglich vollkommen unbeeinflusst deine Wahl triffst. Aus diesem Grund hatten wir dir auch verschwiegen, dass wir Balsamierer sind. Auf alle Fälle solltest du immer auf dein Herz hören, das ist das Wichtigste.« Dad tippte mit seinem Zeigefinger gegen die Stelle, wo mein Herz saß.
»Und was ist, wenn ich an gar nichts glaube?«, fragte ich, als plötzlich das Rollo an der Eingangstür hinter Dad hochschnellte und Mr. Wangs Gesicht auftauchte.
»Die Bentleys«, bemerkte Mr. Wang säuerlich, während er die Tür öffnete.
Dad nickte ihm höflich zu. »Guten Morgen, Mr. Wang.«
»Näh«, war das Einzige, das Mr. Wang von sich gab, ehe er sich umdrehte und in seinem Laden verschwand.
Dad bedeutete Mom vorzugehen, bevor er mich durch die Tür hinterherschob, das Rollo an der Eingangstür wieder herunterzog und diese schloss.
Im Laden war es schummrig, nur wenig Tageslicht fiel durch die Lamellen der heruntergelassenen Jalousien an den Schaufenstern. Das einzige Licht spendete die Hängelampe über dem Tresen, unter deren Lichtkegel Mr. Wang nun stand und uns skeptisch musterte. Dabei fiel mir einmal mehr sein hängendes Auge auf, mit dem er uns abfällig musterte.
Konnte dieser Mann denn nicht einmal ein freundliches Gesicht machen? Ich meine, das war doch echt nicht zu viel verlangt! Immerhin hatte er einen Laden und sollte wissen, wie man Kunden behandelt.
Dad kam gemeinsam mit Mom beim Tresen zum Stehen.
»Mr. Wang, es tut uns leid, dass wir Sie so früh stören«, begann Mom, »aber wir haben ein sehr wichtiges und vor allem dringendes Anliegen, bei dem wir so rasch wie möglich Ihre Hilfe benötigen.«
Wieso um Himmels willen war sie so nett zu ihm? Was sollte er schon machen – das Problem würde sich bestimmt nicht mit dem Glas getrockneter Seegurken beheben lassen, das hinter ihm im Regal stand!
»Worum geht es denn?«, erkundigte sich Mr. Wang, wobei ich mir einbildete, dass er mich nach wie vor mit seinem hängenden Auge beobachtete, obwohl er eigentlich zu Mom und Dad sah. Ich war froh, dass ich etwas weiter hinter Mom stehen geblieben war.
»Es ist sehr heikel«, begann Dad zögerlich, wobei er einen Zettel aus seiner Jackentasche holte und ihn vorsichtig auf den Tresen legte. »Wäre es denn möglich, dass Sie das hier dem Orakel übergeben? Ich habe mich zum Schweigen in dieser Angelegenheit verpflichtet, daher darf und kann ich niemandem sonst verraten, worum es bei der Sache geht – nur dem Orakel.« Dad schob das zusammengefaltete Stück Papier in Mr. Wangs Richtung.
Mr. Wang richtete den Blick darauf und verzog seinen Mund, bevor er skeptisch zu Dad aufsah. »Na gut – warten Sie einen Moment.« Er schnappte sich den Zettel und verschwand durch den Holzperlenvorhang, der die Tür hinter dem Tresen verdeckte.
»Was macht er jetzt?«, flüsterte ich.
Mom drehte sich um und winkte mich näher zu sich. »Er befragt das Orakel«, entgegnete sie leise.
»Welches Orakel?«, fragte ich verwirrt.
»Mr. Wangs Familie ist seit langem der Wächter des Long-Orakels«, erklärte Dad.
»Mhm, toll – und was genau ist ein Long?« Doch schneller als mir lieb war wurde meine Frage beantwortet – zu Beginn mit einem lauten Zischen. Dem folgte ein buckelnder, rückwärtsschleichender Mr. Wang, dessen Hintern sich gerade durch den Perlenvorhang schob, während der Boden unter unseren Füßen bebte. An der Wand hinter dem Perlenvorhang zeichnete sich ein Schatten ab. Etwas Riesiges bewegte sich auf uns zu.
»Mom, was ist das?« Ich griff nach ihrer Hand, denn ich hatte die Hosen gestrichen voll – zugleich erinnerte ich mich aber daran, dass Dad mir zu Hause noch das Versprechen abgenommen hatte, keinesfalls wieder so laut zu brüllen wie in der Nacht zuvor – egal, was geschehen würde! Er hatte damit gedroht, mich ansonsten wieder von Mrs. Norris beaufsichtigen zu lassen, und das wollte ich auf keinen Fall! (Wobei Stillsein gar nicht so einfach war – glaubt mir – als ich erkannte, dass der Schatten aussah wie ein riesiger Drache!)
»Oh, heiliges Orakel«, versuchte Mr. Wang die zischende Kreatur zu beruhigen, zugleich gab er uns mit einer Geste zu verstehen, dass wir uns ebenso verbeugen sollten. »Eure Anwesenheit – welch außergewöhnliche Ehre!«
Aus dem Augenwinkel erkannte ich, wie Mr. Wangs hängendes Auge nervös zuckte, als er zum Perlenvorhang hochschielte. Ich folgte seinem Blick. Zu meiner Überraschung schoben zwei menschliche Hände den Vorhang auseinander und eine ältere Frau schwebte hindurch – ja, schwebte!
Sie bedeutete uns, uns aufzurichten.
»George Bentley«, bemerkte sie beiläufig, als Dad aus der Verbeugung hochkam.
Er nickte ihr höflich zu. »Heiliges Orakel.«
Das Orakel ließ seine Augen weiter zu Mom wandern. »Und Henrietta Bentley«, fügte sie etwas leiser hinzu.
Ich sah suchend an der Frau vorbei – wo zum Teufel war der riesige Drache geblieben?!
»Und du bist?«
Als ich bemerkte, dass sie mich meinte, antwortete ich wie aus der Pistole geschossen: »Charlotte!«
»Du suchst etwas?«, fragte mich das Orakel.
Ich nickte. Erst jetzt fielen mir die zwei langen Drachenbarthaare an ihrer Oberlippe auf.
»Und was suchst du?«, erkundigte sie sich.
»Den Drachen«, stammelte ich zaghaft.
»Den Drachen«, wiederholte das Orakel und winkte mich näher. Zögerlich machte ich einen Schritt vor in Richtung des Tresens. Das Orakel hielt seine Hand unter den Lichtkegel der Hängelampe. Als ich auf den Tresen blickte, fiel mir auf, dass der Schatten ihrer Hand die Form einer Klaue hatte.
»Der Drache wohnt in mir«, sagte das Orakel. »Ich hüte sein Feuer und er begleitet mich auf Schritt und Tritt – er ist meine dunkle Seite.« Die Gegenstände im Raum vibrierten für einen kurzen Moment, das Orakel zog rasch seine Hand aus dem Lichtkegel.
Ich blickte vom Tresen zum Orakel auf und nickte, indes spürte ich Moms Hand auf meiner Schulter, die mich an sich zog.
Das Orakel wandte sich an Dad. »Also in deiner Nachricht an mich stand, dass du hier bist, weil du etwas sehr Wichtiges verloren hast?«
»Ja, das ist richtig – aber nicht direkt ich habe es verloren«, gab Dad vorsichtig von sich.
»Sondern?«, erkundigte sich das Orakel.
»Diesbezüglich habe ich mich zum Schweigen verpflichtet, heiliges Orakel«, erwiderte Dad.
»Wenn du mir nicht traust, George Bentley, wieso bittest du dann um meine Hilfe?«, fragte das Orakel. Der Boden unter unseren Füßen vibrierte erneut.
Mom versuchte, Dad zu Hilfe zu kommen. »Wir brauchen nur einen winzigen Hinweis, heiliges Orakel. Einen kleinen Anhaltspunkt, wo wir anfangen sollen zu suchen – nicht mehr«, ergänzte sie vorsichtig.
»Dann müsst ihr mir die ganze Wahrheit anvertrauen«, zischte das Orakel. Die Regale an den Wänden fingen an zu wackeln. Als die erste Reihe Gläser zu Boden ging, fiel Mr. Wang auf die Knie.
»Oh heiliges Orakel, bitte nicht die Seegurken«, bettelte er.
Nun fingen auch die Gläser vor uns auf dem Tresen zu hüpfen an.
»Ist ja gut«, platzte es aus mir heraus. »Bastet hat´s vermasselt!«. Dann sah ich zu Mom und Dad. »Und wieso deckt ihr ihr den Rücken?! Wenn ich in der Schule Mist baue, dann heißt es doch immer, dass ich dafür geradestehen muss. Und wer bewahrt denn bitte einen so wichtigen Gegenstand unter seinem Bett in einem Schuhkarton auf!«, schnaubte ich.
»Wissen die anderen ägyptischen Götter davon?«, erkundigte sich das Orakel, zugleich spürte ich, wie die Vibration des Bodens nachließ.
»Nein«, antwortete Dad. »Wir möchten das Problem ohne großes Aufsehen lösen.«
»Na gut«, erwiderte das Orakel, während sich die Spitzen seiner Drachenbarthaare mit einem sanften Schwung nach oben wanden. »Aber das Schicksal hat eine Bedingung an euer Anliegen geknüpft.«
»Und die wäre?«, erkundigte sich Dad.
»Ihr müsst euch dieser Aufgabe gemeinsam als Familie stellen«, antwortete das Orakel. »Erfüllt ihr diese Bedingung nicht, wird sich bei eurer Suche das Schicksal gegen euch wenden.«
»George, ich bin mir nicht sicher, ob das klug ist – wir wissen nicht, was uns erwartet«, flüsterte Mom in Dads Richtung.
»Ihr seid als Familie gekommen und habt meine Hilfe erbeten. Jetzt müsst ihr euch dieser Aufgabe auch als Familie stellen. Wenn ihr nicht gewillt seid, dieses Zugeständnis an das Schicksal zu machen, kann ich euch leider nicht weiterhelfen«, entgegnete das Orakel und wandte sich mit einem lauten Zischen von uns ab.
»Warten Sie!«, rief ich. Und zu meiner Überraschung verharrte das Orakel tatsächlich an Ort und Stelle.
»Mom, was soll denn schon großartig passieren – wir suchen doch nur nach einem Buch. Und wenn es deiner Meinung nach zu gefährlich wird, beenden wir die Suche einfach und überlassen die Angelegenheit dann von mir aus den Göttern.«
»Das scheint mir durchaus eine vernünftige Vorgehensweise zu sein«, pflichtete mir Dad mit einem Nicken bei, während Mom angesichts meines Vorschlags ihren Mund nur zu einer schiefen Linie verzog.
»Du hast doch selbst gesagt, dass euer Schicksal an das der Götter gebunden ist, und immerhin war es eine Göttin, die dieses unheimlich wichtige Buch verloren hat. Auf mich wirkt das nicht unbedingt vertrauenswürdig. Außerdem bist doch du immer diejenige, die predigt: Man kann erst wissen, ob etwas klappt, wenn man es versucht hat – nicht wahr?«, setzte ich nach.
»Na gut«, schnaubte Mom einen Moment später. »Dann lasst es uns versuchen – als Familie.«
»So soll es sein«, verkündete das Orakel und klatschte in die Hände. »Wang, es werde dunkel!«
»Oh heiliges Orakel, ich fühle mich geehrt, dass Ihr bei so einer wichtigen Aufgabe an meine Wenigkeit denkt«, säuselte Mr. Wang aus dem Abseits.
»Das Licht!«, herrschte ihn das Orakel an.
»Ja, natürlich, natürlich, Euer heiliges Orakel … Es ist mir eine Ehre!« Mehrmals buckelnd schlich Mr. Wang auf Zehenspitzen an uns vorbei zum Lichtschalter und mit einem Klick erlosch das Licht der Hängelampe. Nur das schummrige Tageslicht, das durch die Lamellen der Rollos drang, erfüllte noch den Raum. Bedächtig wandte sich das Orakel um und musterte jeden von uns eingehend. Unterdessen begannen seine Drachenbarthaare golden zu glühen, wobei sie sich wie kleine Schlangen rhythmisch auf und ab bewegten und winzige Funken versprühten. Irgendwie erinnerte mich das Ganze ein bisschen an die Wunderkerzen zu Weihnachten, aber ich drängte den Gedanken rasch beiseite und versuchte mich auf die Worte des Orakels zu konzentrieren.
»Ihr braucht einen der Isisknoten aus Königin Nefertaris Grab. Sobald der Knoten gelöst ist, solltet ihr mehr über den aktuellen Standpunkt des Buches erfahren. Damit er euch dieses Geheimnis verrät, dürft ihr ihn allerdings nur vor Isis’ Ka-Statue in eurem Hauptzirkel in London lösen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt werdet ihr Gefahr laufen, dass die Verfehlung Bastets kein Geheimnis mehr bleibt. Denn die freigesetzte Energie, die durch das Lösen des Knotens entsteht, bleibt unter Umständen nicht unbemerkt. Denkt daher bereits jetzt über die Konsequenz eures Handelns nach, Bentleys, und ob ihr diese auch wirklich tragen wollt. Wenn ihr den Pfad einmal betreten habt, gibt es keine Rückkehr mehr, denn bringt ihr eure Aufgabe nicht zu Ende, so wird eurer Familie großes Unheil drohen.« Die letzten Worte des Orakels hallten gespenstisch im Laden wider, ehe das Licht über dem Tresen plötzlich wie von Geisterhand anging und gleißend hell wurde, bis die Glühbirne mit einem lauten Knall zerbarst. Als ich meine Hand wieder von meinen Augen senkte, war das Letzte, was ich vom Orakel von Long sah, der schemenhafte Schatten eines riesigen Drachen, der mit einem letzten lauten Zischen um die Ecke schlängelte.
»Den Schaden werden Sie bezahlen, Bentley!«, keifte Mr. Wang, dessen Gesichtsausdruck sich mit dem Wort sauer eigentlich nicht ausreichend beschreiben ließ. »Und nun verschwinden Sie!« Mit wilden Gesten scheuchte er uns aus seinem Laden und knallte die Tür hinter uns zu.
Da standen wir nun auf der Schwelle zu Mr. Wangs Spezialitäten und blickten uns ein wenig verdutzt an. Mr. Wang war zwar das eine oder andere Mal bereits mehr als unhöflich gewesen, aber so aufgebracht hatten wir ihn noch nie erlebt.
»Kann ich euch was fragen?«
Mom und Dad nickten mir zu.
»Wieso sind wir zu einem chinesischen Orakel gegangen und nicht zu einem ägyptischen – wäre das nicht hilfreicher gewesen und vielleicht auch ein klein bisschen weniger gefährlich?«, erkundigte ich mich, denn die Nummer mit der Glühbirne hatte mir dann doch ein wenig Angst eingejagt.
»Wir sind hier, weil das Long-Orakel das einzig zuverlässige Orakel in Manhattan ist, und weil es, selbst wenn es ein ägyptisches gäbe, nicht besonders klug wäre, das Verschwinden des Buches genau dort bekannt zu machen – vor allem da wir Bastet unser Versprechen gegeben haben«, erwiderte Dad.
»Aber wieso wissen chinesische Drachen über Dinge Bescheid, die eigentlich die ägyptischen Götter betreffen?«, entgegnete ich.
»Ich habe dir doch heute Morgen erklärt, dass die ganzen Götter – nennen wir sie einfachheitshalber mythologische Figuren – aufgrund des Glaubens der Menschen existieren, richtig?«, fragte mich Dad.
Ich nickte.
»Und ich hatte erläutert, dass ich den Glauben als Weg zur eigenen inneren Erkenntnis verstehe – richtig?« Dad sah abwartend in meine Richtung.
Ich nickte erneut.
»Somit haben die verschiedenen Pfade im Grunde genommen alle dasselbe Ziel.« Dad pausierte und rieb sich für einen Moment den Unterarm. »Stell dir das am besten wie ein großes Straßennetz vor, das zu einem zentralen Punkt führt. Du hast so etwas wie ein riesiges Flechtwerk, das an allen Stellen von der gleichen Energie durchdrungen wird. Und genau auf diese Art und Weise sind alle Götter miteinander verbunden. Wird eine Stelle in diesem Netz empfindlich gestört, so leiden im Grunde genommen alle darunter. Ich denke, deshalb war das Orakel von Long überhaupt bereit, uns zu helfen. Es versteht, dass die Konsequenz, die möglicherweise aus dem Verlust des Buches resultiert, auch Auswirkungen auf seine eigene Existenz haben kann. Und die Orakel sind eben die einzigen, denen der Überblick über das gesamte Netz gewährt ist.«
»Ja und angesichts dessen sollte man es nicht für möglich halten, dass sich eine Stadt wie New York nicht ein paar zuverlässige Orakel mehr leisten will«, ergänzte Mom und rang sich ein eher kümmerliches Lächeln für mich ab, bevor sie zu Dad sah. »Was machen wir jetzt, George?«
»Lasst uns erst mal nach Hause fahren«, schlug Dad vor und brachte ein wesentlich gelungeneres Lächeln zustande als Mom.
»Ich hätte da noch eine letzte Frage, Dad. Wieso wohnt bitte ein chinesischer Drache in einer Frau? Wie kann sowas nur passieren?« Das ging mir nicht in den Kopf. »Das ist doch schrecklich! Und weshalb wohnt das Orakel ausgerechnet bei Mr. Wang?« Ich schüttelte verständnislos meinen Kopf, denn niemand, den ich kannte, würde freiwillig bei Mr. Wang wohnen wollen.
Auf dem Weg nach Hause erzählte mir Dad, dass die Familie Wang seit Langem mit einem Fluch belegt war, da Mr. Wangs Ur-ur-urgroßmutter die schwarze Perle eines Long-Drachen gestohlen hatte. Eine solche Perle konnte nur im Gehirn eines Long-Drachen entstehen. Sie war der Schlüssel zu Weisheit und Wahrheit und verlieh dem Drachen die Macht eines Orakels. Als der bestohlene Drache damals die Diebin ausfindig gemacht und seine Perle zurückgefordert hatte, belog Wangs Ur-ur-urgroßmutter ihn und lockte ihn in eine tödliche Falle. Zur Strafe fuhr der Geist des toten Long-Drachen in die Frau und bemächtigte sich ihrer. Von diesem Zeitpunkt an lebte der Drache in den Frauen der Wang Familie weiter, die von da an ausnahmslos im Dienste des Long-Orakels standen. Damit die Existenz des Drachen auf ewig gesichert war, kamen in der Familie Wang seit Anbeginn des Fluchs immer ein Mädchen und ein Junge zur Welt. Mr. Wang kam als männlichem Nachfahren der Diebin die Pflicht zu, dem Long-Orakel ein Zuhause zu geben und sich um dessen Bedürfnisse zu kümmern. Das war Dads Kurzversion der Geschichte des Long-Orakels von Manhattan.
Zu Hause angekommen setzte sich Mom mit Dad an den Küchentisch. Ich verkrümelte mich auf das gegenüberliegende Sofa, denn ich war nach der ganzen Aufregung in Mr. Wangs Laden noch müder als am Morgen.
»George, wir können unmöglich Nefertaris Isisknoten aus dem Museum entwenden«, bemerkte Mom vorsichtig.
»Können wir nicht?«, fragte Dad.
»Nein, George – um Himmels willen, das können wir nicht! Das geht zu weit! Wir haben Bastet versprochen, ihr zu helfen, und ich denke, wir haben unser Versprechen eingelöst, indem wir das Orakel aufgesucht haben. Aber ich werde auf keinen Fall den Isisknoten aus dem Museum stehlen! Was ist, wenn der Knoten beim Lösen beschädigt wird?!«, regte sich Mom auf und stürmte in Richtung Herd, um Kaffee aufzusetzen.
»Aber wir borgen ihn uns doch nur kurz aus und werden ihn auch nicht beschädigen. Wie lang kann es dauern – drei, vier Tage und dann ist er wieder dort, wo er hingehört. Wir sagen einfach, dass er einen kleinen Sprung hat, den wir schließen müssen, damit der Schaden nicht größer wird.« Um seinem Plan etwas mehr Überzeugungskraft zu verleihen, setzte Dad seinen Hundeblick auf, der Mom in den meisten Fällen dazu brachte, Ja zu sagen – zu was auch immer.
»George Bentley, ich habe den Eindruck, dass du dir all das bereits in der U-Bahn zurechtgelegt hast!«, empörte sich Mom und schnappte sich zwei Kaffeebecher vom Regal. Mom sprach Dad übrigens nur mit seinem vollen Namen an, wenn sie wirklich sauer war – so richtig sauer.
Dad stand vom Küchentisch auf, ging in Richtung Herd und umfing Moms Hüfte mit seinen Händen.
»Henrietta, ich würde das niemals vorschlagen, wenn nicht wirklich viel auf dem Spiel stünde. Immerhin geht es um den Fortbestand der ägyptischen Götter – und im schlimmsten Fall aller Gottheiten.«
Mom schnaubte. »Und genau deshalb finde ich noch immer, dass es klüger wäre, die anderen darüber zu informieren.«
Dad legte seinen Kopf schief und musterte Mom eindringlich. »Wollten wir es nicht zumindest versuchen?«
Mom verdrehte mit einem Schnauben die Augen, ehe sie sich zu einem langgezogenen »Na gut« hinreißen ließ. »Aber wir einigen uns auf maximal vier Tage«, fügte sie rasch hinzu. »Und dann bringen wir den Knoten dorthin zurück, wo er hingehört – Götter hin oder her. Danach müssen sie sich selbst um die Angelegenheit kümmern.«
Moms „na gut“ leitete übrigens die nächste Phase unserer Unternehmung ein: Die Planung des Met Coups, bei dem ich einiges über meine Eltern lernen sollte.
Der Met Coup
Ich muss echt sagen, Dad überraschte mich am meisten, denn in ihm schlummerte definitiv verbrecherisches Potenzial. Wahrscheinlich hatte ihn nur seine Tollpatschigkeit von einer bahnbrechenden Karriere in einem Syndikat abgehalten.
Ich war baff, wie genau und präzise Dad alles durchdachte und plante. Der Becher Kaffee, den er bei diesem Unterfangen am Küchentisch verschüttete, überraschte mich allerdings weniger.
Kurzgefasst war Dads Plan, dass wir am nächsten Morgen ins Museum marschierten und uns schlicht und ergreifend diesen Isisknoten schnappten. Für die anschließende Flucht zum Flughafen hatte er bereits das Taxi bestellt und die Flugtickets nach London gebucht. Er sah bei der Realisierung seines Plans im Gegensatz zu Mom keinerlei Probleme. Erstens befand sich der Knoten momentan nicht in der Ausstellung und zweitens war Mr. Crowley, der Leiter der Ägyptologischen Abteilung, im Urlaub. Nichtsdestotrotz hatte sich Dad für den Ernstfall eine Ausrede zurechtgelegt. Mom und er würden behaupten, dass sie auf alle Fälle für die nächsten vier bis fünf Tage zu Hause arbeiten mussten, da ich an einer ansteckenden Krankheit litt und sie trotz größter Anstrengungen keinen Babysitter gefunden hatten. Außerdem war noch die Ansteckungsgefahr zu bedenken und wer weiß was sonst noch. Dad schien auf alle Fälle gewappnet. Und als er mir die kaffeegetränkten Flugtickets in die Hand drückte, damit ich sie in die Reisetasche packen konnte, hatte ich das Gefühl, dass sich die Ferien endlich nach meinem Geschmack entwickeln würden!
Ich wartete also, so wie ich es mit Mom und Dad vereinbart hatte, am Eingang des Museums. Auf unseren Reisetaschen sitzend beobachtete ich die Touristenhorden, die an mir vorbeizogen. Heute würde im Met wieder die Hölle los sein. Als ich in der Menschenmenge Mr. Crowley entdeckte, versuchte ich noch, meine Baseballkappe tiefer ins Gesicht zu ziehen, aber es war zu spät. Er winkte mir zu und kam direkt auf mich zu gehopst. Haltet mich jetzt bitte nicht für kleinlich, aber Mr. Crowley war so ein Fall für sich. Er war Ende Fünfzig und seit letztem Frühjahr der neue Leiter der Abteilung für Ägyptologie. Er versuchte es jedem recht zu machen – vor allem seinen Vorgesetzten – dabei war seine Freundlichkeit aber alles andere als glaubwürdig.
»Ja – Hallöchen, wen haben wir denn da?«, zwitscherte Mr. Crowley, als er mit einem breiten Grinsen vor mir zum Stehen kam.
»Guten Tag, Mr. Crowley«, antwortete ich höflich und hoffte, dass er auf keinen Fall Mom und Dad treffen würde. Er sollte doch eigentlich im Urlaub sein!
»Na, was machen wir denn hier draußen?«, erkundigte sich Mr. Crowley, als wäre ich eine Dreijährige.
»Warten«, gab ich wie eine Dreizehneinhalbjährige knapp zurück.
»Ich denke, wir sollten dich zu deinen Eltern bringen. Ich habe ohnehin etwas Wichtiges mit ihnen zu besprechen. Außerdem finden unsere Besucher das bestimmt nicht so hübsch, wenn du hier einfach so rumlümmelst.«
»Ich lümmele nicht, ich sitz hier nur – wirklich«, erwiderte ich, aber Mr. Crowley ließ sich von seinem Vorhaben nicht abbringen.
»Na, na. Wer wird denn«, gab er zurück. »Wenn ich bitten darf – hopp, hopp!« Dabei wedelte er mit seinen Händen, als wollte er eine Taube verscheuchen. Widerwillig schnappte ich unsere Taschen. Mr. Crowley war zumindest so nett und nahm mir die große Reisetasche ab, bevor er mich vor sich herschob. Er klopfte nicht mal, als er die Tür zu Moms und Dads Büro aufstieß. Dad schnellte überrascht herum.
»Oh, Mr. Crowley!«, rief er übertrieben freundlich, während Mom so weiß wie die Wand hinter ihr wurde.
»Mr. Crowley«, stieß sie leise hervor.
Mr. Crowley bedeutete mir, ins Büro zu kommen.
»Hi Mom, hi Dad.« Ich winkte den beiden unbeholfen zu, denn unser Plan war an dieser Stelle scheinbar zunichtegemacht.
Mr. Crowley schielte neugierig an meinem Vater vorbei, hinter dem eine kleine Schachtel stand. »Was machen Sie denn da?«, erkundigte er sich beinahe begierig. »Sind etwa neue Objekte eingetroffen, von denen ich noch nichts weiß?«
»Oh, nein, nein«, entgegnete Dad kopfschüttelnd. »Wir haben nur einige Restaurationen vorzunehmen und dafür packe ich ein, zwei Stücke ein.« Dad versuchte, das Ganze so beiläufig und unwichtig wie möglich klingen zu lassen.
»Aha und warum wollen Sie ihre Arbeit nicht hier machen?«, hakte Mr. Crowley bemüht freundlich nach. »Soweit ich weiß, beginnt Ihr Urlaub erst in vier Wochen.«
»Na ja«, Dad sah zu mir und rieb seinen Unterarm, »Charlotte ist krank und da wir keinen Babysitter finden konnten, müssen wir die Reparaturen zu Hause vornehmen.«
Mr. Crowley sah mich prüfend an. »Sehr krank sieht das Mädchen aber nicht aus, wenn Sie mich fragen.«
Mom räusperte sich und wischte sich nervös ihren Pony aus dem Gesicht. »Ja, also – wissen Sie, das ist …« Sie stockte.
»Ja, was denn nun?!«, stieß Mr. Crowley ungeduldig hervor.
Mom sah hilflos zu Dad – sie war wirklich eine verdammt schlechte Lügnerin – und nachdem Dad noch immer seinen Unterarm rieb, war klar, dass auch er keine Lösung parat hatte.
»Ich habe einen ansteckenden Pilz«, warf ich ein.
Mr. Crowley sah überrascht zu mir.
»Ja genau – hochinfektiös«, mischte sich Dad ein. »Hochinfektiös«, wiederholte er. »Und deshalb konnten wir auch keinen Babysitter finden.«
Mr. Crowley wich entsetzt einen Schritt von mir zurück.
»Und was sollen die Reistaschen?«, erkundigte er sich skeptisch.
»Mom und Dad müssen wegen der Ansteckungsgefahr meine gesamte Wäsche desinfizieren lassen – da drinnen ist meine Schmutzwäsche der letzten zwei Tage«, fügte ich unschuldig hinzu.
Mr. Crowley ließ entsetzt die Reisetasche fallen und wischte sich die Hände an seinem Anzug ab.
»Schaffen Sie das Kind sofort aus meinem Museum!« Empört blickte Mr. Crowley zu meinen Eltern. »Was haben Sie sich bloß dabei gedacht, sie hierher zu bringen!«
»Ja, deshalb hatten wir Charlotte auch gebeten, vor dem Museum zu warten«, konterte Dad.
»Wie auch immer«, erwiderte Mr. Crowley und streifte sein Jackett glatt. »Der Grund, weshalb ich in meinem wohlverdienten Urlaub überhaupt hier bin, ist ein anderer. In zwei Tagen schickt das ägyptische Kulturkonsulat einen Historiker des Luxor Museums. Das Museum bereitet im Rahmen seines Jubiläums gerade eine Ausstellung rund um Königin Nefertari vor, und daher werden wir der Einrichtung einige Exponate leihen, die im Zusammenhang mit der Königin stehen – besonderes Interesse gilt Nefertaris Isisknoten. Wenn wir ihn bereitstellen, wird es das erste Mal sein, dass alle sieben Knoten, die in der Grabkammer gefunden wurden, wieder vereint sind.« Mr. Crowley klatschte wie ein kleines Kind in die Hände. » Ist das nicht wundervoll? Daher bereiten Sie das bitte vor – und zwar ohne Pilz«, ergänzte er und begutachtete mich skeptisch.
»Sir, das wird unmöglich sein – wir brauchen mindestens fünf Tage für die Reparatur des Isisknotens«, warf Dad ein.
»Papperlapapp.« Mr. Crowley winkte ab. »Sie schaffen das schon.«
»Wäre es denn nicht denkbar, dass wir den Knoten einige Tage später aushändigen?«, erkundigte sich Dad vorsichtig.
Mr. Crowleys Gesicht verfinsterte sich. »Mr. Bentley, wie Ihnen bestimmt aufgefallen sein wird, erhalten sie monatlich einen Gehaltsscheck vom Met. Daher dürfen wir auch erwarten, dass Sie Ihre Arbeit in angemessener Zeit, Art und Weise tun. Wie bereits erwähnt wird der Vertreter des Museums in zwei Tagen den Isisknoten abholen. Sie werden bestimmt nicht erwarten, dass ich mich wegen Ihrer Unzulänglichkeiten vor meinen Kollegen in Luxor lächerlich mache. Sie haben genau 48 Stunden Zeit und keine Minute mehr – ich hoffe, ich habe mich unmissverständlich ausgedrückt!« Mr. Crowley machte auf dem Absatz kehrt und verließ das Büro.
Mom starrte ihm noch hinterher, während Dad sich umdrehte, die Schachtel mit dem Knoten verschloss und mit einem Überführungsformular des Museums in seinen Rucksack steckte.
»Lasst uns gehen«, verlautbarte Dad und schnappte sich die Reisetaschen.
Wenige Minuten später hatten wir das Gebäude verlassen. Mom atmete erleichtert auf.
»Das hast du gut gemacht«, sagte Dad lächelnd, während wir die Treppen des Museums hinunterliefen.
»Anscheinend habe ich etwas von deinem verbrecherischen Potential geerbt«, stellte ich grinsend fest.
»George, jetzt bestärk unser Küchlein nicht noch darin, unehrlich zu sein«, funkte Mom dazwischen.
Doch Dad zwinkerte mir zu, als er die Tür des Taxis öffnete.
Die Fahrt zum Flughafen verlief reibungslos – was angesichts Moms Verfassung hilfreich war. Sie hatte ein furchtbar schlechtes Gewissen wegen all der Lügen und fand Dads Plan von Minute zu Minute weniger überzeugend. Das von Mr. Crowley vorgegebene Zeitfenster von 48 Stunden machte das Ganze nicht besser.
»Das schaffen wir nie, George«, sagte Mom, als sie den Gurt im Flugzeug anlegte. »Allein der Flug dauert bereits sechs Stunden und 45 Minuten.« (Mom würde bei unserer Unternehmung übrigens von nun an unser persönlicher Countdown sein.)
»Wir schaffen das – versprochen«, entgegnete Dad und drückte Moms Hand.
Ich hatte übrigens auf den Platz am Gang bestanden. Das Letzte, was ich in den kommenden sechs Stunden und 45 Minuten wollte, war zwischen dem Fenster, einem zurückgeklappten Sessel und meiner nervösen Mom eingequetscht zu sein – das überließ ich liebend gerne Dad.
Da Mom anfing viertelstündlich auf die Uhr zu sehen und ich so gut wie nichts über die Arbeit meiner Eltern oder über diesen ganzen ägyptischen Götterkram wusste, entschied ich mich dazu, sie ein wenig abzulenken. Es konnte definitiv nicht schaden, darüber informiert zu sein, was da so auf mich zukam.
»Mom, kann ich dich was fragen?«
Sie sah von der Uhr auf und nickte mir zu. »Nur zu, Küchlein.«
»Wer genau ist eigentlich diese Isis und was steht denn in ihrem Buch, das so unheimlich wichtig ist?«, flüsterte ich – ich konnte ja nicht wissen, ob uns jemand belauschte.
»Also, Isis ist die Göttin der Geburt, des Todes und der Wiedergeburt – aber auch Göttin der Magie«, entgegnete Mom. »Sie ist die Schutzherrin aller Wesen, die leiden oder in Sorge sind, und trägt zu deren Genesung bei. Aber nimm dich in Acht, Isis hat auch ihre dunkle Seite – so wie jeder Gott – und die kann sie dazu bringen, sich gegen dich zu wenden.«
»Das heißt, man kann den Göttern nicht trauen?«, erkundigte ich mich. Insgeheim hatte ich mich nämlich schon gefragt, ob jemand wie Bastet wirklich vertrauenswürdig war.
Mom machte eine abschätzende Handbewegung. »Na ja, nicht so direkt. Es heißt einfach nur, dass man im Umgang mit ihnen achtsam sein und nicht vergessen sollte, dass die Götter ebenso ihre Schwächen und Stärken haben wie wir Menschen. Letztendlich sind sie eine Art Abbild des menschlichen Geistes – von uns durch den Glauben geschaffen.«
»Und das Buch?«, fragte ich.
»Wo beginne ich am besten?« Mom überlegte für einen Augenblick. »Lass uns mit Re anfangen – ich denke, das ist ein guter Einstieg in die Geschichte. Re ist einer der ersten Götter, der altägyptische Sonnengott. Aber er ist in der ägyptischen Mythologie nicht der Schöpfer der Sonne, sondern im Grunde genommen die Sonne selbst. Re reist von Sonnenaufgang bis Untergang mit der Sonnenbarke über den Himmel. Eine Barke ist übrigens ein Schiff. Abends steigt Re dann in seine Nachtbarke und fährt durch das Totenreich, wo er gemeinsam mit seinem Sohn Seth, dem Wüstengott, Apophis bekämpft. Apophis ist eine Riesenschlange. Sie steht für die Auflösung, Finsternis und Chaos. Konntest du mir folgen?«, fragte mich Mom.
»Ich denke schon«, entgegnete ich, fasste es aber sicherheitshalber nochmals zusammen. »Also, es gibt so einen alten Sonnentyp, der mit einem Schiffchen rumschippert und gegen das Chaos kämpft – richtig?«
Mom hob ihre Augenbrauen. »Ja, so in etwa.«
»Aber was hat Re jetzt mit Isis zu tun?«, erkundigte ich mich.
»Nun, die Göttin Isis wusste so ziemlich alles über Himmel und Erde – allerdings kannte sie Res wahren Namen nicht, der ihr uneingeschränkte Macht verliehen hätte. Um diesen zu erfahren, bediente sich Isis einer List. Sie sammelte ein paar Tropfen von Res Speichel, der dem alternden Gott aus dem Mund getropft war, mischte ihn mit Lehm und formte daraus eine Schlange. Nachdem sie dieser Leben eingehaucht hatte, sandte sie das Tier zu Re, mit dem Auftrag ihn zu beißen. Re wurde aufgrund des Bisses der Schlange schwach und hatte große Schmerzen. Nachdem Isis dafür bekannt war, den Leidenden zu helfen, rief Re sie zu sich. Isis forderte als Gegenleistung für ihre Hilfe seinen wahren Namen, doch Re weigerte sich zunächst. Eines Tages aber waren seine Schmerzen so groß, dass Re sich dem Willen Isis’ beugte und ihr seinen wahren Namen nannte. Von da an offenbarten sich ihr alle Geheimnisse dieser Welt, die sie im Buch der Isis niederschrieb. Es gilt als eines der mächtigsten Bücher der ägyptischen Mysterien. Und sein Inhalt ist so tiefgreifend, dass es in den falschen Händen die ganze Welt in ihren Grundfesten erschüttern könnte. Ich hatte es so wie die meisten meiner Kollegen für einen Mythos gehalten – so wie zum Beispiel die Bundeslade oder den heiligen Gral – bis ich deinen Dad traf.«
Mom lächelte und schielte zu Dad, der bequem in seinem Sessel nach hinten gelehnt war und etwas vor sich hinmurmelte.
»Was macht Dad da?«, fragte ich. »Führt er Selbstgespräche?«
Mom lachte laut auf. »Oh, nein! Er betet Bastet an«, fügte sie etwas leiser hinzu. »So weiß sie, wo sie uns findet.«
Stimmt – ich hatte ganz vergessen, dass Dad sich bei dem Katzenmonster hatte melden wollen, sobald wir eine Spur hatten.
»Und lebt Isis noch?«, erkundigte ich mich.
»Ja, natürlich«, entgegnete Mom.
»Und wie sieht sie aus?«, fragte ich. »Re ist ja leicht an den Sabberflecken zu erkennen.«
Mom nahm eine Serviette, breitete diese vor sich auf dem Tisch aus und begann zu zeichnen. »Also, Isis erscheint in menschlicher Gestalt. Früher trug sie einen Thronsitz auf ihrem Kopf. Später wurden daraus zwei Kuhhörner, zwischen denen sich eine Sonnenscheibe befindet. Sie kann aber auch die Form eines Schwarzmilans, das ist ein Greifvogel, annehmen. Deshalb trägt sie in ihrer menschlichen Form manchmal auch Schwingen – siehst du?« Mom drehte die Serviette, auf die sie Isis gemalt hatte, zu mir. »Re hat einen menschlichen Körper und einen Falkenkopf, auf dem er die Sonne trägt.« Sie zeichnete den alten Sabbergott nicht unweit von Isis. »Damit kannst du ihn leicht von Horus unterscheiden, der nur einen Falkenkopf besitzt. Horus ist übrigens der Sohn der Isis.« Mom zeichnete einen Gott mit Falkenkopf und zog zwischen ihm und Isis eine Verbindungslinie. »Seth ist der Bruder von Isis und ich würde mal sagen, die beiden verstehen sich nicht so gut, da Seth Osiris getötet hat. Osiris ist der Mann von Isis und Gott der Unterwelt.«
»Ist ja krass!« Ich traute meinen Ohren nicht. Denn im Grunde genommen klang die Geschichte, die mir Mom gerade erzählt hatte, spannender als jeder Film, den ich bisher gesehen hatte. Ich ärgerte mich ein wenig darüber, dass ich mir das alles bis dato hatte entgehen lassen.
»Du solltest dieses Thema bei einem Aufeinandertreffen allerdings besser meiden«, schlug Mom vor und zeichnete unterdessen einen etwas deformierten Eselskopf auf einen menschlichen Körper. »Das ist Seth.« Sie deutete mit ihrem Stift auf die letzte Zeichnung.
»Und was für ein Tier soll das sein?«, fragte ich.
»Das ist nicht so einfach – Seth kann nicht eindeutig einer Spezies zugeordnet werden. Er besitzt einen deformierten Kopf, der einen am ehesten noch an einen Esel erinnert.«
Ich nahm die Serviette und sah mir diese ganzen Götter nochmals genauer an. »Werden wir die alle treffen?«, erkundigte ich mich.
»Keine Ahnung, Küchlein. Es kann sein, dass einige von ihnen im Zirkel von London sind, es kann aber auch sein, dass kein einziger Gott anwesend ist – wir werden sehen.«
Das war echt der absolute Wahnsinn! Ich spürte vor Aufregung ein leichtes Kribbeln im Bauch.