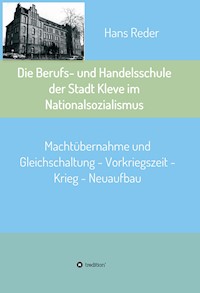
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Im Buch wird die Berufs- und Handelsschule der Stadt Kleve als Vorläufer des heutigen Berufskollegs Kleve des Kreises Kleve, der größten Schule des Landes NRW, 1837 als Handwerker-Fortbildungsschule errichtet, während der Zeit des Nationalsozialismus 1933 - 1945 geschildert. Nach einer Kurzvorstellung der Geschichte der Schule werden die Verhältnisse in Kleve während des Machtwechsels sowie das wirtschaftliche, gesellschaftliche, politische und allgemein-rechtliche Umfeld behandelt, in dem sich die Schule bewegte. Ausführlich wird der Kontext von Berufsschulen allgemein dargestellt, der aufzeigt, wie sich die berufliche Bildungslandschaft 1933 - 1945 in Deutschland veränderte durch Entscheidungen, die teilweise heute noch von Bedeutung sind. Die Chronik des Berufskollegs Kleve wird danach ergänzt um die Zeit des Nationalsozialismus, gegliedert in die Phasen Machtübernahme und Gleichschaltung, Vorkriegszeit, Krieg und Neuaufbau.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 767
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Hans Reder
Die Berufs- und Handelsschule der Stadt Kleve im Nationalsozialismus
Machtübernahme und Gleichschaltung - Vorkriegszeit - Krieg - Neuaufbau
Ein Beitrag zur Chronik des Berufskollegs Kleve des Kreises Kleve
Mit freundlicher Förderung durch
Verein zur Förderung der Beruflichen Bildung
Titelbild: Das Schulgebäude Brabanter Straße in Kleve
Aufnahme: Annegret Gossens
Copyright Stadt Kleve, Stadtarchiv Kleve EB-2962
© 2021 Hans Reder
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-21682-2
Hardcover:
978-3-347-21683-9
e-Book:
978-3-347-21684-6
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Hans Reder
Die Berufs- und Handelsschule der Stadt Kleve im Nationalsozialismus
Machtübernahme und Gleichschaltung – Vorkriegszeit - Krieg - Neuaufbau.
Ein Beitrag zur Chronik des Berufskollegs Kleve des Kreises Kleve
„Von der gesamten Berufsschullehrerschaft wird erwartet,
daß sie sich, wie stets, in freudiger Erfüllung ihrer Pflichten
der großen Aufgaben würdig erweist.
Wie der Soldat an der Front, der Arbeiter an der Werkbank
und die deutsche Frau und Mutter in der Familie,
so wird der Berufsschullehrer an seinem Platze
sein Bestes geben
und sich als wertvolles Glied
der deutschen Volksgemeinschaft
im Kampfe um die deutsche Zukunft erweisen.“ (Gentz, S. 166)
(Gentz, Erwin: Reichsberufsschulrecht. Handbuch für Schule und Verwaltung, Eberswal-de-Berlin-Leipzig 1943, Seite 166.)
Erwin Gentz war Ministerialrat im Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung in Berlin
INHALT
VORWORT
1DIE GESCHICHTE DER SCHULE BIS ZUR NS-ZEIT
2DIE „MACHTÜBERNAHME“ IN KLEVE – EIN BILD DER ZEIT
3DER RAHMEN VON SCHULEN UND SEINE VERÄNDERUNGEN IN DER NSZEIT IN KLEVE
3.1 Der wirtschaftliche Rahmen
3.2 Der gesellschaftliche Rahmen
3.3 Der politische Rahmen
3.4 Der allgemeine rechtliche Rahmen von Schulen
4DER KONTEXT VON BERUFLICHEN SCHULEN
4.1 Ministerium und Wissenschaft als Entscheidungsträger
4.2 Schulträger
4.3 Schulformen
4.4 Unterrichtsbedingungen
4.5 Ziele, Intentionen, Lehrpläne und Bücher
4.6 Schulleitung
4.7 Kooperation, Koordination und Prüfungen
4.8 Personalpolitik und –entwicklung
4.9 Lehrpersonal und Unterricht
4.10 Schülerinnen und Schüler
4.11 Jüdische Berufsschüler und Ausbildung in jüdischen Betrieben
4.12 Berufsschulpflicht
4.13 Der Einfluss der Hitler-Jugend und der DAF
4.14 Zusammenarbeit der Berufsschule mit den Betrieben
4.15 Output – die Leistungen des Systems- Reichsberufswettkämpfe
4.16 Schulaufsicht
4.17 Dienstanweisung und Schulordnung für Berufsschulen im Jahre 1942
4.18 Zusammenfassung
5DIE BERUFLICHEN SCHULEN KLEVE IN DER ZEIT DER MACHTÜBERNAHME 1933 UND 1934
5.1 Der rechtliche Rahmen der personellen Gleichschaltungsmaßnahmen
5.2 Der Stand der Schule zu Beginn der NS-Zeit 1933
5.3 Der neue Bildungsauftrag im Nationalsozialismus
5.4 Schlageter-Gedächtnisfeier im Mai 1933 in Kleve
5.5 Einschüchterung der Lehrer
5.6 Der Stand der Schule im April 1934
5.7 Schulleiter-Wechsel im Jahre 1935
5.8 Zusammenarbeit mit Betrieben
5.9 Jüdische Schüler
5.10 Beispiele aus dem Schulleben
5.11 Die Berufsschule in Elten
6DIE BERUFLICHEN SCHULEN KLEVE BIS ZUM BEGINN DES 2. WELTKRIEGS (1935 – 1939)
6.1 Technik
6.2 Wirtschaft und Verwaltung
6.3 Hauswirtschaft / Gastgewerbe
6.4 Landwirtschaft und Gartenbau
6.5 Eingliederung der Berufsschulen Calcar und Uedem 1937
6.6 Reichsberufswettkämpfe
6.7 SA-Sportabzeichen-Gemeinschaft Stadtverwaltung
6.8 Werbung für die HJ in allen Klassenräumen
6.9 Umschulung für wehrwirtschaftlich wichtige Betriebe
6.10 Mobilmachungsdienstanweisung für Schulen
7DIE BERUFLICHEN SCHULEN KLEVE IM 2. WELTKRIEG (1939 – 1945)
7.1 Technik
7.2 Wirtschaft und Verwaltung
7.3 Hauswirtschaft
7.4 Sozialwesen
7.5 Landwirtschaft und Gartenbau
7.6 Errichtung einer Molkereifachklasse
7.7 Lehrer
7.8 NS-Fliegerkorps in der Berufsschule
7.9 Abschlussprüfungen
7.10 Reichsberufswettkampf - Kriegsberufswettkampf
7.11 Berufsschulpflicht
7.12 Zwei Berufsschulen in Trägerschaft des Kreises Kleve?
7.13 Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 1943
7.14 Statistik der Berufsschulen Kleve und Goch 1944
7.15 Schließung der Schule
7.16 Sonstiges
8DIE BERUFLICHEN SCHULEN KLEVE NACH DER NS-ZEIT – NEUANFANG
8.1 Zerstörungsgrad der Schule
8.2 Wiederaufnahme des Unterrichts
8.3 Patenschaften für den Wiederaufbau
8.4 Zusammenarbeit Kleve und Goch
8.5 Stand der Schule im Herbst 1947
8.6 Kostenbeteiligung des Kreises und der Kommunen
8.7 Entnazifizierung
8.8 Neue Schulleitung
8.9 Sonstiges
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
LITERATURVERZEICHNIS
DER AUTOR:
VORWORT
Im Juli 2001 erschien erstmals eine sehr umfangreiche Chronik der Berufsbildenden Schulen des Kreises Kleve in Kleve, die von Hans-Ernst STRÄHNZ zusammengetragen und verfasst wurde. Der zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand verabschiedete Schulleiter Heinz WELBERS erhielt anlässlich seiner Verabschiedung das erste Exemplar.
Seit 1998 firmieren Berufliche Schulen in Nordrhein-Westfalen unter dem Namen „Berufskolleg“. Aus der ehemaligen „Handwerker-Fortbildungsschule Cleve“ (1837) und der Fortbildungsschule des katholischen Lehrlingsvereins (1884) ist eine große Organisation mit heute um die 5.000 Schülerinnen und Schülern und ca. 200 Lehrerinnen und Lehrern geworden, die unter dem Namen „Berufskolleg Kleve des Kreises Kleve“ firmiert und in den 1980er Jahren mehr als 6.600 Schülerinnen und Schüler aufwies.
Die von Hans-Ernst STRÄHNZ verfasste Chronik umfasst den Zeitraum von der Gründung (1837) bis Juli 2001.
In seinem Vorwort bedauert Hans-Ernst STRÄHNZ, dass die Geschichte des beruflichen Schulwesens in der Region Kleve nur unvollständig dargestellt werden kann, „da alle Unterlagen und Dokumente aus der nationalsozialistischen Zeit fehlen. Sie gingen im 2. Weltkrieg verloren.“ (Strähnz, S. 1)
Auch Urban GERSTNER hat in seiner freien wissenschaftlichen Arbeit „Die Entwicklung der Berufsschule der Stadt Kleve“, vorgelegt für die Wissenschaftliche Prüfung für das Gewerbelehramt im Fach Pädagogik an der Universität zu Köln, im Sommer 1958 die Zeit des Nationalsozialismus ausgespart, da „die Berufsschule und die Stadtverwaltung durch den Krieg sämtliche Akten und Unterlagen dieser Schule aus den Jahren 1913 – 1945 verloren haben.“ (Gerstner, S. 1)
In der vorliegenden Schrift wird der Versuch unternommen, diese Lücke zu schließen.
Gründe für die Schilderung der NS-Zeit
Der Verfasser hat mit sich gerungen, die NS-Zeit geschichtlich zu erforschen, sprechen doch auch Gründe dafür, das Vergangene vergessen zu machen. Den Ausschlag für die Untersuchung der Jahre 1933 – 1945 und dem Aufbau danach gab aber die Überzeugung, dass die Geschichte beschrieben werden muss, damit nachfolgende Generationen Wissen darüber erlangen und ihre Schlüsse daraus ziehen können. Schlussstriche zu ziehen ist in der Geschichte unmöglich. Nur wenn wir offensiv in der Vergangenheit forschen, können wir eine versöhnliche, vom christlichen Menschenbild her bestimmte Zukunft gestalten.
Als ich geboren wurde (Jahrgang 1950) gab es – heute für viele junge Leute nicht vorstellbar – in den deutschen Städten Trümmergrundstücke, Luftschutzbunker und Bombentrichter und auf den Straßen waren Kriegsversehrte mit Schussverletzungen, Amputationen usw. normal, Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten fanden in unserem Umfeld langsam Unterkunft. Deutschland war in die „Ostzone“ und „Bundesrepublik Deutschland“ ge teilt. Heute leben wir in einem wiedervereinigten Deutschland. Im Gegensatz zur Nazizeit herrschen wieder Freiheit und Demokratie, die Frau ist dem Mann gleichgestellt, neue Familienmodelle, religiöse Toleranz, sexuelle Vielfalt und Rechtsstaatlichkeit werden als normal und selbstverständlich angesehen. Insofern soll diese Schrift auch daran erinnern, dass es dies vor allem in der Zeit des Nationalsozialismus nicht gab bzw. dass dies von den Nazis bekämpft wurde.
Das sog. „Dritte Reich“ der Nazis endete mit folgender „Bilanz“:
1.
Tote insgesamt
54.800.000
davon Tote an den Fronten
27.000.000
getötete Zivilpersonen
24.500.000
2.
Verwundete
90.000.000
3.
Ermordete Juden
6.000.000
4.
Kriegsgefangene Deutsche
11.000.000
5.
Deutsche Flüchtlinge
12.000.000
6.
Tote nach Ländern
Sowjetunion
20.300.000
Asiatische Staaten
13.600.000
Polen und Balkanländer
9.010.000
Deutschland
6.600.000
Westliche Länder
1.300.000
Italien und Österreich
750.000
USA
229.000
Vermisste
3.000.000
Menschenverluste insgesamt
54.789.000
7.
Kriegsausgaben und Kriegsschäden
1.350.000.000.000 Dollar
8.
Verlust von Haus und Gut
21.000.000 Menschen
9.
Zerstörte und beschädigte dt. Gebäude
5.000.000 Gebäude
10.
Evakuiert, eingesperrt, deportiert, vertrieben
45.000.000 Menschen
11.
Bomben auf Europa abgeworfen
2.429.475 t
12.
Gebietsverluste Deutschlands
ein Viertel seines Gebietes
(Pommern, Schlesien, Ostpreußen, Ostbrandenburg)
13.
Deutschland wurde in 2 Staaten geteilt (BRD und DDR).
(Frey, S. 241 sowie www.bpb.de, Aufruf 12.12.2019 sowie zeit.de, Aufruf 12.12.2019)
Nicht nur diese „Ergebnisse“ beschreiben die schreckliche Zeit, sondern die Bürger unseres Landes und anderer Länder erlebten auch folgendes:
Im Sommer 1941 befahl HITLER der Wehrmacht bei klarem Verstoß gegen das Kriegsund Völkerrecht ohne Rücksicht gegen die Feinde vorzugehen. Damit wurde Mord zum legitimen Mittel für die Wehrmacht erklärt. Gefangene wurden versklavt und man ließ sie verhungern. Sie wurden erschossen und in Massengräbern verscharrt. Zwangsarbeiter mussten unbezahlte bzw. unterbezahlte Arbeit in deutschen Betrieben, bei Kirchen und in der Landwirtschaft verrichten und sie wurden zum Teil wehrlos ihrem Schicksal bei Bombenangriffen überlassen. In Deutschland wurden Lebensmittel rationiert und mit zunehmender Kriegsdauer herrschte Hunger, vor allem in der Zeit des Zusammenbruchs und nach dem Kriege. Mangels Hilfsmöglichkeiten starben Kranke und Alte wegen des Gesundheitssystems oder aus Hunger. Behinderte Menschen mussten in ihren Heil- und Pflegeanstalten Platz machen für verwundete Soldaten und Bürger, sie wurden verschleppt und ermordet (Euthanasie). Zunehmend etablierte sich ein Überwachungsstaat, bei dem einzelne Bürger andere bespitzelten und manchmal auch Eigentum erwarben, weil sie bewusst anderen schadeten. Familien, Partner und Geschwister wurden getrennt und viele überlebten die Vertreibung aus dem Osten nicht. Überlebende Soldaten litten noch Jahrzehnte unter ihren Kriegseindrücken und dies hatte Einfluss auf das Leben ihrer Familienangehörigen.
Hingewiesen sei hier auch an die damaligen Kinder, die die Hitler-Zeit überlebten und denen ihre Kindheit und Jugend in Freiheit durch die Nationalsozialisten geraubt wurde: Sie wurden in staatlichen Schulen erzogen, manche auch in speziellen NS-Schulen (Napola, Adolf-Hitler-Schulen usw.). Es handelt sich um die Kinder derjenigen, die Hitler nicht verhinderten und die in der Hitlerjugend, dem Bund deutscher Mädel usw. vom Nazi-Regime erzogen und missbraucht wurden. Sie wurden zu willigen Gefolgsleuten gemacht, Pflicht und Ehre waren ihre Werte, sie sollten als Soldaten oder Gebärmaschinen dem Staate dienen und ihre Werte waren 1945 nichts mehr wert, lebten aber noch Jahrzehnte in ihnen weiter.
Ursache des deutschen Eroberungskrieges waren Neid und Hass, fremde Völker und Religionen sollten unterdrückt, entrechtet, versklavt, verschleppt, ausgehungert, gebombt usw. werden.
Derzeit kommt überall in Deutschland und Europa der Nationalismus wieder auf. Die Nazi-Zeit wurde als „Vogelschiss“ in der Geschichte Deutschlands bezeichnet und die Hetze, die im Internet auf staatliche Repräsentanten (Bürgermeister, Landräte usw.), Stadtverordnete und Politiker, Demonstranten und Ehrenamtler sowie die freie Presse und den öffentlichrechtlichen Rundfunk und das Fernsehen gemacht wird, erinnert doch sehr an die Praktiken der Nationalsozialisten, die seinerzeit erfolgreich die freie Presse und staatliche Repräsentanten angriffen und Bürgermeister, Landräte, Parteimitglieder, Leiter öffentlicher Einrichtungen und Stadtverordnete aus den Ämtern und Parlamenten drängten.
Gründe für die Schilderung des Kontextes von Beruflichen Schulen
Schule ist immer eingebettet in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Recht. Dies trifft in besonderer Weise auf die Berufskollegs zu. Die damalige Schule war fast ausschließlich eine „Berufsschule“, d. h. ihre Schüler rekrutierten sich entweder aufgrund eines Lehrverhältnis-ses zu einem Ausbildungsbetrieb oder waren ungelernte junge Arbeite r. Als sog. „Vollzeitschule“ gab es in Kleve nur die 1 Unterstufe und 1 Oberstufe der Handelsschule. Im Rahmen der Erwachsenenbildung (Fortbildung) wurden im Auftrage der Handwerkskammer Düsseldorf Kurse zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung im Handwerk in Abendform durchgeführt. Daneben gab es noch diverse Abendkurse für Erwachsene (z. B. Technisches Zeichnen, Buchführung, Fremdsprachen). Aufgrund der daraus resultierenden engen Verzahnung der Berufsschule mit den „dualen Partnern“ und der Region soll in dieser Schrift auch der Kontext aufgezeigt werden, in dem die Schule agierte, denn wohl keine Schule interagiert mehr mit anderen Organisationen (Schulen, Ausbildungsbetrieben, Innungen, Kammern, Parteien, Verwaltungen, Religionen, Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften usw.) als die Berufsschule. Der Nationalsozialismus in diesen Organisationen und der Region und das von den Nationalsozialisten geschaffene neue Recht hatten sicher auch Auswirkungen auf die Situation der Schüler und Lehrer in der Berufsschule.
Zur Vorgehensweise bei der Quellensuche
Das Stadtarchiv der Stadt Kleve war die erste Station der Quellensuche. Die Akten der Stadt Kleve sind bei drei Bombenangriffen vernichtet worden. Die Suche in den Heimatkalendern des Kreises Kleve war wenig erfolgreich. Aufschlussreicher war die Durchsicht aller verfügbaren Ausgaben der damaligen Tageszeitung im Klever Land „Der Volksfreund“. Leider sind die vorhandenen und im Krieg nicht vernichteten Ausgaben dieser Zeitung ab 1939 immer lückenhafter, weshalb auch die Darstellung der Schule in dieser Schrift in dieser Zeit weniger umfangreich ist. Auch das Clever/Klever Kreisblatt, das bis Ende 1933 erschien, gab einige Hinweise, was damals in Kleve geschah.
Im Kreisarchiv des Kreises Kleve in Geldern konnte ich Einsicht nehmen in Akten der Vor- und Nachkriegszeit, insbesondere über die Frage des Zusammenschlusses der Schulen Kleve mit Kalkar und Goch mit Uedem 1937 und angeregte Zusammenschlüsse Kleve und Goch nach 1945.
Im Landesarchiv NRW in Duisburg sind Akten des damaligen Regierungspräsidenten Düsseldorf allgemeiner Art, soweit sie die Schulaufsicht über Kleve betreffen, teilweise vorhanden. Aufschlussreich waren auch die Entnazifizierungsakten, die dort eingesehen werden konnten.
Die Schule verfügt über keine Akten aus dem untersuchten Zeitraum, da das Gebäude ab Herbst 1944 für militärische Zwecke zur Unterbringung von Soldaten benötigt sowie durch Luftangriffe zum Teil zerstört wurde. Die Schülerkartei enthält keine Schülerstammdaten aus der Zeit vor dem Neuanfang.
Hinweise zum Lesen – Besprechung einzelner Kapitel
Dem interessierten Leser, der seinen Focus nur auf bestimmte Kapitel richten will, soll hier kurz geschildert werden, welche Inhalte die einzelnen Kapitel haben. Es ist ohne weiteres möglich, einzelne Kapitel zu überspringen:
Im 1. Kapitel wird die Geschichte der Schule dem interessierten Leser in Kurzform veranschaulicht, und zwar erstmals gegliedert nach den Abteilungen der Schule.
Das 2. Kapitel schildert den Übergang in die NS-Zeit in Kleve.
Um dem Leser einen Eindruck der NS-Zeit in Kleve zu vermitteln, schildert das 3. Kapitel den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, politischen und allgemein-rechtlichen Rahmen, in dem sich die Schule während der NS-Zeit in Kleve und Umgebung befand. Dieser Rahmen hatte Auswirkungen auf das Leben in der Schule.
Kapitel 4 beschreibt den allgemeinen rechtlichen Rahmen speziell von Beruflichen Schulen in der NS-Zeit.
Die Chronik des Berufskollegs Kleve wird ergänzt um die folgenden Kapitel:
Kapitel 5 beschreibt die Schule zur Zeit der Machtergreifung und Gleichschaltung.
Kapitel 6 beschreibt die Schule in der Zeit zwischen Machtergreifung und Gleichschaltung und 2. Weltkrieg.
Kapitel 7 schildert die Schule während des 2. Weltkriegs (1939 – 1945).
Das Kapitel 8 beschreibt den Stand der Schule nach dem Kriege und am Ende der NS-Zeit. Es ergänzt die Ausführungen in der Chronik, in dem es den Zerstörungsgrad, Wiederaufbau, Fragen der Zusammenlegung mit der Berufsschule Goch, Entnazifizierung der Lehrerschaft sowie die mit der Schulleitung beauftragten Personen in der Nachkriegszeit schildert.
Wer sich also nur über den Nationalsozialismus in der Berufs- und Handelsschule der Stadt Kleve informieren will, kann direkt mit Kapitel 5 beginnen, da Kapitel 1 die Geschichte der Abteilungen zeigt und die Kapitel 2 – 4 den Kontext beschreiben, in dem sich die Schule seinerzeit bewegte.
Die Berufs- und Handelsschule der Stadt Kleve wurde am 1. April 1960 überführt in die Berufsbildenden Schulen des Kreises Kleve in Kle ve und firmiert heute als „Berufskolleg Kleve des Kreises Kleve“. Dabei handelt es sich heute um ein Gebiet, das die Städte Emmerich und Rees rechtsrheinisch sowie die Gemeinden Kranenburg, Bedburg-Hau und Uedem und die Städte Goch, Kalkar und Kleve linksrheinisch umfasst und in die Abteilungen Technik, Wirtschaft und Verwaltung, Gesundheit und Ernährung, Sozialwesen und Agrarwirtschaft gegliedert ist. Aus diesem Grunde habe ich diese Bereiche an wenigen Stellen aufgenommen, obwohl sie seinerzeit nicht zum Tätigkeitsgebiet der Berufs- und Handelsschule der Stadt Kleve gehörten.
Zum besseren Verständnis habe ich die alten Schreibweisen einiger Städte in der neuen Schreibweise geschrieben, außer in Zitaten (z. B. Cleve – Kleve, Cranenburg – Kranenburg).
Dank
Ich danke allen Mitarbeitern der Archive in Kleve, Geldern und Duisburg, die mir aus ihren Beständen Akten zur Verfügung stellten sowie den Mitarbeitern der Stadtbibliothek Kleve, die manches Buch für mich über die Fernleihe beschafften. Meiner Ehefrau danke ich für die Zeit, die sie mir überließ und für so manche Hinweise und Unterstützung. Meinem Schwager Anton Uthemann danke ich für die Durchsicht des Manuskripts und seine wertvollen Anregungen. Schließlich danke ich dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (Programm „Heimat-Scheck“) und dem Förderverein des Berufskollegs Kleve des Kreises Kleve (FBB), die den Druck dieses Buches finanziell unterstützten.
Kleve, im Februar 2021
Hans Reder
1 DIE GESCHICHTE DER SCHULE BIS ZUR NS-ZEIT
Das heutige Berufskolleg Kleve, eine Schule in Trägerschaft des Kreises Kleve, hat viele Schulen als Vorgänger. Zunächst blieb die Schule auf die Stadt Cleve und ihre unmittelbare Umgebung begrenzt. Nach und nach weitete sich der Schulbezirk aus und besteht heute aus dem Gebiet der Stadt Kleve sowie der Gemeinden Kranenburg und Bedburg-Hau, der Städte Kalkar, Emmerich und Rees, der Gemeinde Uedem sowie der Stadt Goch. Schulbezirke im engeren Sinne gibt es aber heute nicht mehr, die Schule kann Schüler aus benachbarten Kommunen aufnehmen und Schüler aus dem Bereich Kleve können auch Berufskollegs benachbarter Kommunen besuchen.
Aus heutiger Sicht besteht das Berufskolleg im Wesentlichen aus den Vorläufern der Berufsschulen in Cleve, Kalkar, Uedem, Goch, Emmerich und Rees. Es hat fünf Berufsfelder: Wirtschaft und Verwaltung (früher „kaufmännisch“, Technik (früher „gewerblich“), Gesundheit und Ernährung (früher „hauswirtschaftlich“), Sozialwesen (früher z. T. „hauswirtschaftlich“) und Agrarwirtschaft (früher „Landwirtschaft“ und „Gartenbau“)
Die Anfänge der Schule gehen auf die Errichtung einer Handwerker-Fortbildungsschule in Cleve durch den Gewerbeverein im Jahre 1837 zurück. Die gleiche Aufgabe stellten sich der katholische Gesellen- und Katholische Lehrlingsverein in Cleve, die seit 1863 bzw. 1881 Fortbildungseinrichtungen unterhielten.
Erster Schulleiter war Gymnasiallehrer Konrektor Vierhaus, 1860 übernahm der Advokatsanwalt Junck die Leitung. Die Bemühungen des Vorstandes, der Schule Körperschaftsrechte zu verleihen, wurde durch die Stadt Cleve zunächst abgelehnt. Erst am 25.09.1886 wurde die Satzung hierzu genehmigt. Dem Kuratorium gehörten nun der jeweilige Landrat, der Bürgermeister, der Leiter der Schule und 2 Handwerksmeister an. (Schwartmann, S. 5 f.) Es handelte sich also noch nicht um eine Schule der Stadt Kleve.
Um die Handwerker-Fortbildungsschule entstand in Kleve um 1873 ein erbitterter Streit im Klever Stadtrat, der seinen Ursprung sicher im Konfessionshader des Kulturkampfes hatte. Obwohl der Bürgermeister der Stadt Cleve im Vorstand der Schule war, beteiligte sich die Stadt nicht oder unwesentlich an den Kosten der Schule. Die Lehrer der Schule, die auf eine Beteiligung im Vorstand drängten, wollten den Kreis als Schulträger, „da dieser die Schule im Gegensatz zur Stadt finanziell unterstütze.“ (Gorissen, S. 321) Es dauerte bis 1880, bis ein Statut (u.a. sollte die Schule eine „freie“ Schule sein, frei ohne Erteilung von Religionsunterricht) von der Stadtverordneten-Versammlung angenommen wurde. (Gorissen, S. 322) Nachdem zwei katholische Lehrer entlassen wurden (Mönnichs I und II), fühlte sich die kath. Mehrheit der Bevölkerung brüskiert und boykottierte die Schule. Bis April 1882 sank die Schülerzahl der Handwerker-Fortbildungsschule auf 10 – 12 Schüler. (Gorissen, S. 322)
Die Handwerker bevorzugten die Schule des katholischen Gesellen- und Lehrlingsvereins, da sie der Überzeugung waren, dass das Prinzip der konfessionell getrennten Schule das allein richtige sei. (Gorissen, S. 325) Auch nach dem Tode des ev. Schulleiters Junck im Jahre 1888 konnte der Konflikt nicht beigelegt werden, da die Katholiken eine Förderung des Religiösen zum Ziel hatten und die Schule des katholischen Gesellen- und Lehrlingsvereins favorisierten, die etwa dreimal so viele Schüler besuchten (1891/92 ca. 150 freiwillige Schüler). (Gorissen, S. 325 f.) „Die Regierung kam den Wünschen der Katholiken nach und erteilte dem Kaplan Johann Verheyen am 18. und dem Pfarrer Dr. Driessen am 22. August 1894 auch die Erlaubnis zur Errichtung einer Fortbildungsschule für die Mitglieder des katholischen Gesellenvereins zu Cleve. Der Lehrstoff wurde so aufgeteilt, daß die Lehrlinge nur inden allgemeinen Fächern (Religion, Deutsch, Rechnen, Buchführung, Zeichnen), die Gesellen darüber hinaus in ihrem Fachgebiet unterwiesen wurden. “ (Gorissen, S. 326)
In der Folge wurden beide Schulen von der Stadt unterstützt, noch im Jahr 1900 lehnte die Stadt die Übernahme der Trägerschaft einer Handwerker-Fortbildungsschule ab, da für den Fortbildungsunterricht hinreichend durch die Handwerker-Fortbildungsschule und die Schule des Kath. Gesellen- und Lehrlingsvereins gesorgt sei. Allerdings trat am 1. April 1913 endlich das Ortsstatut in Kraft, das aufgrund des Gesetzes über die Pflicht-Fortbildungsschulen 1909 erlassen worden war. „Das Schullokal war das von der Landwirtschaftsschule nach Fertigstellung ihres Neubaus aufgegebene Gebäude an der Ecke der Hagsche Straße und Lindenallee.“ (Gorissen, S. 326) Leiter der nun städtischen Schule wurde Joseph SCHWARTMANN aus Gelsenkirchen. Damit trat anstelle der bisherigen beiden gewerblichen Fortbildungsschulen mit freiwilligem Besuch die städtische Fortbildungsschule mit Pflichtbesuch, seit 01.04.1921 durfte sie sich „Berufsschule“ nennen. (Schwartmann, S. 6)
Mit dem Aufblühen der Stadt Kleve als Industrie- und Handelsstadt wuchs auch das Bedürfnis für eine berufliche Ausbildungsgelegenheit der Kaufmannslehrlinge, so dass die Vereine der Handlungsgehilfen im Jahre 1904 bei der Stadt die Errichtung einer städtischen kaufmännischen Fortbildungsschule beantragten, die 1908 als Schule mit freiwilligem Besuch eingerichtet wurde.
Aus diesen beiden Schulen wurde am 01.10.1924 dann die neue Berufsschule gebildet.
Der Unterricht sowohl der gewerblichen Berufsschule als auch der kfm. Berufsschule wurde mit Ausnahme des Schulleiters Josef SCHWARTMANN nur von nebenamtlichen Lehrkräften erteilt. Nachdem das Preußische Ministerium für Handel und Gewerbe, dem die Berufsschulen seit 1885 unterstanden, eine besondere Lehrerausbildung für Berufsschulen an den Universitäten startete, trat am 1. April 1919 der erste hauptamtliche Gewerbeoberlehrer Josef GOERTZ aus Erkelenz seinen Dienst an der Schule in Kleve an. Ein Verzeichnis aller Lehrkräfte Ende des Schuljahres 1932/33 enthält die Namen von 14 hauptamtlichen Lehrerinnen und Lehrern und 5 nebenberuflichen und nebenamtlichen Lehrern (Pfarrer, Schneidermeister, 2 Friseurmeister, Kreislehrgärtner). (Schwartmann, S. 13 f.)
Bis 1931 war die Berufs- und Handelsschule in dem alten Landwirtschaftsschulgebäude an der Lindenallee untergebracht. Seit 1930 stand der Schule das ganze Gebäude zur Verfügung, zur Unterbringung der damals 50 Berufsschul- und 2 Handelsschulklassen mussten noch andere Räume angemietet werden. Im Jahre 1928 beschloss die Stadtverordneten-Versammlung, die sog. „neue Kaserne“ an der Brabanter Straße zur Berufsschule umzubauen. Am 18.04.1931 fand die Eröffnungsfeier statt.
Im Folgenden soll die Geschichte jeder der fünf Abteilungen dargestellt werden, um dem Bedürfnis nach der Geschichte der einzelnen Abteilungen der Schule Rechnung zu tragen.
Seit dem Schuljahr 2016/17 hat die Schule als sechste Abteilung die Abteilung „Basis- und Ausbildungsvorbereitung“. Sie besteht im Wesentlichen aus internationalen Förderklassen für zugewanderte Jugendliche, Klassen für Jugendliche ohne Schulabschluss und Klassen für junge Menschen, die durch Maßnahmen der Agentur für Arbeit besonders gefördert werden. Solche Klassen gab es bis auf die internationalen Förderklassen, in denen in den letzten Jahren asylsuchende Jugendliche beschult werden, selbstverständlich schon seit Jahrzehnten, nur nicht als selbstständige Abteilung. Die Beschulung dieser Jugendlichen erfolgte bis zu diesem Zeitpunkt vor allem innerhalb der Abteilung Technik, aber auch in anderen Abteilungen.
Da diese Abteilung erst im Schuljahr 2016/17 gebildet wurde, erübrigt sich in dieser Schrift eine Darstellung ihrer Geschichte, obwohl es sicher lohnend wäre, die Geschichte ihrer Schülerschaft, z. B. Jugendliche ohne Schulabschluss, Ungelernte, Jugendliche ohne Ausbildung („Jungarbeiter“) sowie Berufsvorbereitung zu untersuchen.
Abteilung Technik
In der 1837 errichteten Handwerker-Fortbildungsschule erhielten die Schüler wöchentlich 6 Stunden Unterricht in Zeichnen, Rechnen und Raumlehre sowie in Deutsch und Buchführung. Der Unterricht wurde von Zeichenlehrern, Volksschullehrern und Handwerksmeistern bzw. Bautechnikern erteilt. Der erste Leiter der Schule war der Gymnasiallehrer Konrektor VIERHAUS. Im Jahre 1860 übernahm der Advokatsanwalt JUNCK die Schule. Eine gleiche Aufgabe wie die Handwerker-Fortbildungsschule hatten sich der katholische Gesellen- und katholische Lehrlingsverein Cleve gestellt, die seit 1863 bzw. 1881 Fortbildungs-Einrichtungen unterhielten.
Durch die fehlende Schulpflicht konnte der Zweck der Schulen nicht erreicht werden, da zu viele Schüler unregelmäßig und auch unpünktlich die Schule besuchten.
Am 01.04.1913 trat eine Ortssatzung der Stadt Cleve nach Genehmigung durch den Bezirksausschuss in Düsseldorf in Kraft. Die Leitung der gewerblichen Berufsschule wurde dem hauptamtlichen Gewerbelehrer Joseph SCHWARTMANN aus Gelsenkirchen übertragen, der zum gleichen Zeitpunkt sein Amt antrat. Der Besuch der Schule wurde ab diesem Zeitpunkt zum Pflichtbesuch, allerdings nicht für alle Schülerinnen und Schüler. Der 1. Weltkrieg sollte schon im darauf folgenden Jahr die Schule auf eine harte Bewährungsprobe stellen.
Der Vollständigkeit halber soll erwähnt werden, dass eine Handfertigkeitsschule, die im Jahre 1892 von Schulrat Dr. WESSIG gegründet wurde, infolge des Krieges 1914/15 einging. Diese Schule verfolgte das Ziel, „bei den Knaben der Volksschule und der höheren Lehranstalten die Anlagen zur Werktätigkeit für das praktische Leben zu entwickeln, die Sinne, besonders Auge und Hand, zu üben, die geistige Schultätigkeit durch körperliche Arbeit zu ergänzen, um dadurch zu einer harmonischen Ausbildung von Körper und Geist beizutragen.“ Im letzten Jahre ihres Bestehens 1914/15 wurde die Schule noch von 16 Gymnasiasten, 7 Landwirtschafts- und 72 Volksschülern besucht. (Stadt Kleve 1926, S. 339)
Als sich am 1. Oktober 1924 der Leiter der kaufmännischen Fortbildungsschule, Landwirtschaftsschullehrer HEUCKMANN, zur Ruhe setzte, wurden die kaufmännische und gewerbliche Fortbildungsschule (seit 01.04.1921 Berufsschule genannt) aus „schultechnischen Gründen“ zusammengelegt und unter die einheitliche Leitung des hauptamtlichen Berufsschuldirektors SCHWARTMANN, der schon seit 1913 die gewerbliche Berufsschule leitete, gestellt. Nach Ablauf des Schuljahres 1924/25 wurden dann auch die nebenamtlichen Lehrkräfte durch hauptamtliche abgelöst. (Schwartmann, S. 6 f.)
Bis zum Ende des 2. Weltkriegs bestand die gewerbliche Abteilung nur aus Berufsschülern, die in Teilzeit unterrichtet wurden. Es gab also nur den Teilzeitunterricht (Berufsausbildung im Betrieb und Besuch der Berufsschule), keine Vollzeitklassen mit täglichem Besuch.
Abteilung Wirtschaft und Verwaltung
Die Vereine der Handlungsgehilfen beantragten im Jahre 1904 bei der Stadt Cleve die Errichtung einer städtischen kaufmännischen Fortbildungsschule. Da sich die Stadtverwaltung nicht zur Schaffung einer Schule mit Besuchszwang entschließen konnte, wurde zu Ostern 1908 zunächst eine Schule mit freiwilligem Besuch eingerichtet.
„Die Schule wurde am 5.5.1908 mit 65 Schülern, die in 3 aufsteigenden Klassen unterrichtet wurden, mit einer schlichten Feier eröffnet. Der Unterricht wurde an 3 Wochentagen morgens von 7 – 9 Uhr, in den Wintermonaten von 7:30 – 9: 30 Uhr, in folgenden Fächern erteilt: Handelskunde und Schriftverkehr, Deutsch, Rechnen, Buchführung und Wirtschaftskunde. Das Schulgeld betrug jährlich 36 RM. Die durch das Schulgeld nicht gedeckten Kosten wurden von der Stadt getragen. Der Kreis Cleve bewilligte einen jährlichen Zuschuss von 250 M. “ (Schwartmann, S. 6)
Der Schulvorstand beantragte die Einführung eines Besuchszwangs, der durch die Stadt und den Bezirksausschuss Düsseldorf im März bzw. Juni 1910 genehmigt wurde. Die Schulpflicht erstreckte sich zunächst nur auf alle im Bezirk der Stadt Cleve beschäftigten männlichen Lehrlinge im Handelsgewerbe, d. h. dass männliche Lehrlinge, die in Cleve wohnten, aber auswärtig beschäftigt waren, nicht der Schulpflicht unterlagen und weibliche Lehrlinge überhaupt noch nicht.
Die Leitung lag von der Gründung 1908 bis zum 1. Oktober 1924 bei Landwirtschaftsschullehrer HEUCKMANN. Der Unterricht wurde von Lehrern, die durch besondere Lehrgänge der Regierung für den kaufmännischen Unterricht vorbereitet worden waren, nebenamtlich erteilt.
Als sich am 1. Oktober 1924 Landwirtschaftsschullehrer HEUCKMANN zur Ruhe setzte, wurden die kaufmännische und gewerbliche Fortbildungsschule (seit 01.04.1921 Berufsschule genannt) „aus schultechnischen Gründen“ zusammengelegt und unter die einheitliche Leitung des hauptamtlichen Berufsschuldirektors SCHWARTMANN, der schon seit 1913 die gewerbliche Berufsschule leitete, gestellt. Nach Ablauf des Schuljahres 1924/25 wurden dann auch die nebenamtlichen Lehrkräfte durch hauptamtliche abgelöst. Als erste hauptamtliche Lehrkraft an der kaufmännischen Berufsschule trat Diplom-Handelslehrer Josef ANGEN-ENDT aus Cleve ein. (Schwartmann, S. 6 f.)
Am 01.04.1925 errichtete die Stadt Cleve eine öffentliche Handelsschule für Knaben und Mädchen mit zweijährigem Lehrgang. Nach einer Aufnahmeprüfung (75 Anmeldungen) wurden 42 Schüler und Schülerinnen ausgewählt und zur Handelsunterstufe zusammengefasst. Durch den etwa gleich großen Andrang im kommenden Jahr wurden 2 Klassen beantragt und genehmigt. Am 01.04.1931 wurde eine zusätzliche Klasse für Schüler mit O II. Reife, die sich nur für die Oberstufe anmeldeten, dort aber aufgrund fehlender Kenntnisse in den beruflichen Fächern nicht sinnvoll zusammen mit den Handelsschülern beschult werden konnten, gebildet. Sie erhielten den Unterricht in den allgemein-bildenden Fächern zugunsten der kaufmännischen gekürzt. Die Stundentafel enthielt wöchentlich 32 Stunden in den Fächern Handelskunde und Schriftverkehr, Kaufmännisches Rechnen, Buchführung, Deutsch, Wirtschaftskunde, Staats- und Volksbürgerkunde, Kurzschrift, Maschinenschreiben, Plakatschrift, Englisch, Turnen sowie Nadelarbeit und Hauswirtschaft (Mädchen). Die katholischen und evangelischen Schüler erhielten wöchentlich 1 Stunde Religionsunterricht. Befähigte Schüler konnten außerdem an freiwilligen Lehrgängen in Holländisch und Spanisch sowie Französisch teilnehmen.
Die Abschlussprüfung der Handelsschüler wurde vor einem Prüfungsausschuss abgelegt, dem Vertreter der Stadtverwaltung, der Industrie - und Handelskammer, der Handlungsgehilfenverbände und der Schule angehörten, und dessen Vorsitzender ein Beauftragter des Regierungspräsidenten war. Nach den Bestimmungen des Preußischen Ministers für Wirtschaft und Arbeit vom 03.02.1933 erhielten die Schüler die Mittlere Reife und waren vom Besuch der kaufmännischen Berufsschule befreit. Sie wurden bei Einstellungen bevorzugt und ihre Lehrzeit wurde oft verkürzt.
Es wurde ein Schulgeld von 200 RM erhoben plus 20 RM für Schreibmaschinenabnutzung. (Schwartmann, S. 7 f.)
Bis nach dem 2. Weltkrieg bestand die kfm. Abteilung nur aus Berufsschülern (Teilzeitschülern) und Handelsschülern (Vollzeitschülern)
Abteilung Gesundheit / Ernährung / Hauswirtschaft
Erst mit der Einführung einer Berufsschulpflicht für das weibliche Geschlecht kam es zu hauswirtschaftlichen Klassen an der Klever Berufsschule.
Während die Berufsschulpflicht für kaufmännische Lehrlinge 1910, für gewerbliche 1913 und für weibliche Lehrlinge im Handelsgewerbe 1925 eingeführt wurde, gab es eine solche noch im Jahre 1934 immer noch nicht für gewerbliche Arbeiterinnen, Haustöchter und Hausangestellte. Erst das „Gesetz über die Schulpflicht im Deutschen Reich (Reichsschulpflichtgesetz), das am 01.11.1938 in Kraft trat, regelte eine allgemeine 3-jährige Berufsschulpflicht (2-jährig für landwirtschaftliche Berufe). Sie dauerte bis zum Ende der Lehrzeit bzw. bei Ungelernten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres oder bis zur Heirat des Berufsschulpflichtigen. Die Berufsschulpflicht erstreckte sich nicht auf diejenigen, die im Arbeitsdienst oder Wehrdienst standen. (Berufskolleg, Chronik, S. 93)
Damit waren ab November 1938 die weiblichen Jugendlichen berufsschulpflichtig. Im Folgenden werden die Vorläuferschulen der hauswirtschaftlichen Abteilung der Klever Berufsschule beschrieben.
Jungmädchenheim in der Schlossstraße
Der Präses des katholischen Arbeitervereins, Kaplan WINKELMANN, kaufte 1919 mit finanzieller Unterstützung der Industrie und Bürgerschaft den zum Verkauf anstehenden Gasthof Holzem in der Schloßstraße, um ein Heim für junge Mädchen, in erster Linie für Arbeiterinnen, einzurichten. Träger des Heimes wurde der neu gegründete „Verein Arbeiterinnenheim Cleve e.V.“, in dessen Kuratorium der Präses des katholischen Arbeiterinnenvereins als Vorsitzender fungierte. Ferner waren im Kuratorium die beiden kath. Pfarrer, die jeweilige Oberin der Vorsehungsschwestern und mehrere Bürger der Stadt.
Das Heim wurde geleitet von den Vorsehungsschwestern aus dem Mutterhause Friedrichsburg-Münster i. W. (in Westfalen). Etwa zur gleichen Zeit wurde die „Fabrikanten-Vereinigung für Arbeiterinnenfürsorge“ gegründet, der alle namhaften großen und kleinen Fabriken Kleves angehörten. Ziel beider war die Vorbereitung der jugendlichen Arbeiterinnen für ihren künftigen Lebensberuf als Hausfrau und Mutter, namentlich durch die Einrichtung von hauswirtschaftlichen Abendkursen. Inhalte waren: Kochen, Nähen, Bügeln, auch theoretischer Unterricht in Lebenskunde, Ernährungslehre, Kleinkinder- und Säuglingspflege. Im Jahre 1924 nahmen 315, 1925 336 Arbeiterinnen an den Unterrichtsstunden teil. Die Kosten der Kurse trug die Fabrikanten-Vereinigung, die auch eine besondere Fabrikschwester angestellt hatte, die das Heim bei der Betreuung der jugendlichen Arbeiterinnen unterstützte.
Im Heim wohnte eine Anzahl erwerbstätiger junger Mädchen, die in Kleve sonst keine Wohnung gehabt hätten. 1926 hatte das Heim 53 Betten. Da der Unterricht in den Abendstunden stattfand, konnte in der übrigen Zeit eine landwirtschaftliche Haushaltungsschule für Bürger- und Landwirtstöchter eingerichtet werden, wodurch die Räumlichkeiten auch tagsüber genutzt wurden. (Stadt Kleve 1926, S. 416 f.)
Die landwirtschaftliche Haushaltungsschule für Bürger- und Landwirtstöchter im Jungmädchenheim
Der Unterricht wurde von staatlich geprüften Schwestern erteilt. Die Schule wurde im Jahre 1925 staatlich anerkannt. Sie wurde durchschnittlich von 50 bis 60 Schülerinnen besucht. „Unterrichtet wurde im Kochen, in Hausarbeit und Wäsche, in Nadelarbeit, im Gartenbau, in Milchwirtschaft, in Kleintierzucht, in der Nahrungsmittellehre, der Gesundheitslehre, der Säuglingspflege, der Wohlfahrtspflege, der Bürgerkunde, im Rechnen und in derBuchführung, im Deutschen, in der Erziehungslehre und in Lebenskunde“. (Stadt Kleve 1926, S. 345)
SCHWARTMANN berichtet im Jahre 1934 davon, dass für die gewerblichen Arbeiterinnen auf Kosten der Arbeitgeber-Vereinigung im Jungmädchenheim hauswirtschaftliche Lehrgänge eingerichtet worden seien. Da der Besuch jedoch freiwillig war, und infolgedessen nur ein Teil der Fabrikarbeiterinnen die Lehrgänge besuchte, haben die Frauenverbände sowohl wie die Schulleitung wiederholt die Ausdehnung der Schulpflicht auch auf Arbeiterinnen, Hausangestellte und Haustöchter beantragt. „Es ist zu erwarten, daß die Stadtverwaltung, nachdem nun in dem neuen Schulgebäude die bisher fehlenden Unterrichtsräume und – einrichtungen geschaffen worden sind, und die Bedeutung der hauswirtschaftlichen Ausbildung für Mädchen heute von keiner Seite mehr geleugnet wird, dem Antrage bald entsprechen wird. “ (Schwartmann, S. 10)
Hauswirtschaftsschule an der Mühlenstraße
In Kleve gab es in der Mühlenstraße seit dem Jahre 1906 eine Hauswirtschaftsschule, die sich nach dem Bericht der Stadtverwaltung gut bewährte. Aus dem letzten Schuljahr der Volksschulen gab es für ca. 24 Schülerinnen Platz. Diese wurden täglich von 10 bis 13:30 Uhr beschult. Der Unterricht umfasste alle häuslichen Arbeiten, wie Kochen, Einmachen, Waschen, Bügeln und Putzen. Daneben fanden noch Sonderkurse statt: 1912 ein Fischkochkurs, 1915 zwei Kriegskochkurse mit 47 Frauen, 1920 drei Abendkochkurse für schulentlassene Mädchen. Von 1922 an fanden regelmäßig Kinderspeisungen auf Kosten des Quäkervereins statt. Die Schülerinnen nahmen an der Zubereitung dieser Speisen täglich teil. Lehrerin war die Hauswirtschaftslehrerin Karoline CLAEßEN. (Stadt Kleve 1926, S. 338 f.)
Diese Schule, die von 1906 bis 1933 bestand, diente vor allem der Ausbildung von Schülerinnen der Volksschulen, so dass sie nicht zu den Vorläufern der Klever Berufsschule gezählt werden kann. Nähere Ausführungen zu dieser Schule in der Chronik (Berufskolleg, Chronik, S. 42 f.)
Wanderhaushaltungsschule
Für die ländlichen Bereiche gab es im Kreis Kleve in den 30er Jahren eine Wanderhaushaltungsschule, die sich für die Dauer des achtwöchigen Lehrgangs in einer Gemeinde aufhielt und vom Gemeinderat angefordert wurde. Inhalte des Lehrgangs dieser Schule waren Lebensmittellehre, Säuglings-, Kranken-, Gesundheits- und Gartenpflege. So fand z. B. am 20.12.1933 in Pfalzdorf im Lokal Auler eine Abschlussfeier statt, zu der außer dem Bürgermeister von Pfalzdorf, HETZEL, auch Landrat EICH, Landwirtschaftsrat RECH, Förster DEUTSCH, die Gemeindevertretung, die Geistlichkeit, die Vertreter der Schulen und der NS-Frauenschaft und der Landfrauenvereinigung und natürlich die Eltern der Schülerinnen teilnahmen. Die Schulleiterin, Frl. MÜLLER, bat den Gemeinderat, „auch in Zukunft der Wanderhaushaltungsschule Interesse entgegen zu bringen, denn in Verbindung mit der Landfrauenvereinigung werde die Wanderhaushaltungsschule den jungen Mädchen das beibringen, was das Dritte Reich von ihnen verlangte.“ (Klever Kreisblatt, 23.12.1933)
Hauswirtschaft an der Berufsschule
Die Anfänge der Hauswirtschaft an der Berufs - und Handelsschule der Stadt Kleve dürften um 1930 liegen. Josef SCHWARTMANN erwähnt in seiner Schrift von 1934 als Lehrkraft Frl. Th. MÜTTER als Gewerbelehrerin für Hauswirtschaft seit 01.09.1932, und im 2. Obergeschoss befanden sich ein Vorratsraum, ein Esszimmer, das auch als Säuglingspflegeraum genutzt wurde und eine Schulküche mit 6 Gasherden und 1 elektrischen Kochherd. (Schwartmann, S. 17)
Zunächst dürfte es sich um freiwillige „Lehrgänge“ gehandelt haben, noch nicht um Berufsschüler, denn einer Aufstellung dieser Lehrgänge kann entnommen werden, dass es im Jahre 1932 bereits folgende Lehrgänge gab:
Kochen und Nahrungsmittel-Lehre: 2 Lehrgänge mit 39 Teilnehmern und 96 Unterrichtsstunden Nähen und Flicken: 1 Lehrgang mit 16 Teilnehmern und 48 Unterrichtsstunden Schneidern und Umändern: 1 Lehrgang mit 16 Teilnehmern und 48 Unterrichtsstunden Kranken- und Säuglingspflege: 1 Lehrgang mit 20 Teilnehmern und 72 Unterrichtsstunden.
Außerdem gab es im Jahre 1932 bereits 2 Hauswirtschaftslehrgänge für Erwerbslose mit 38 Teilnehmern und 432 Unterrichtsstunden.
Laut Organisationsplan gab es aber im Jahre 1934 noch keine hauswirtschaftliche Berufsschulklasse und keine Vollzeitklasse als Berufsfachschule. SCHWARTMANN gibt in seiner Schrift aus dem Jahre 1934 der Hoffnung Ausdruck, bald eine Berufsschule für Hauswirtschaft gründen zu können: „Mit Beginn des Schuljahres 1927 waren somit alle Jugendlichen, bis auf die gewerblichen Arbeiterinnen, die Haustöchter und weiblichen Hausangestellten, von der Berufsschulpflicht erfaßt. Für die gewerblichen Arbeiterinnen sind auf Kosten der Arbeitgeber-Vereinigung im Jungmädchenheim hauswirtschaftliche Lehrgänge eingerichtet worden. Da der Besuch hier jedoch freiwillig ist, und infolgedessen nur ein Teil der Fabrikarbeiterinnen die Lehrgänge besucht, haben die Frauenverbände sowohl wie die Schulleitung wiederholt die Ausdehnung der Schulpflicht auch auf Arbeiterinnen, Hausangestellte und Haustöchter beantragt. Es ist zu erwarten, daß die Stadtverwaltung, nachdem nun in dem neuen Schulgebäude die bisher fehlenden Unterrichtsräume und –einrichtungen geschaffen sind, und die Bedeutung der hauswirtschaftlichen Ausbildung für Mädchen heute von keiner Seite mehr geleugnet wird, dem Antrage bald entsprechen wird. “ (Schwartmann, S. 10)
Im Schuljahr 1936/37, also noch vor der Ausdehnung der Berufsschulpflicht im Reich auf die weiblichen Hausangestellten, gab es an der Klever Berufsschule eine Beschulung von Hausgehilfinnen: Am 22. März 1937 berichtete der Volksfreund kurz: „An unsere Hausfrauen! Am Dienstag, dem 28. März 1937, abends 18 Uhr, findet in der Aula der Berufsschule ein Heimabend der Hausgehilfinnen statt. Hausfrauen! Sorgt bitte dafür, daß Eure Hausgehilfinnen an diesem Heimabend teilnehmen können.“ (Der Volksfreund, 22.03.1937)
Im Jahre 1938 hatte sich die Hauswirtschaft an der Berufsschule bereits voll etabliert. Der Volksfreund berichtete am 07.11.1938 über eine Veranstaltung, an der über hundert Frauen und Mädel teilnahmen. Auf der Veranstaltung sprachen Vertreter von Arbeitsamt (Pgn. STEGERT), Landwirtschaft (Frl. WAGNER) und Berufsschule (Frl. MÜTTER). Versammelt waren die Hausjahrmütter, die weibliche Jugendliche während des neu geschaffenen Hausjahrs anlernten, und die Lehrfrauen, die weibliche Jugendliche während der zweijährigen Lehre ausbildeten und die Jugendlichen. Frl. MÜTTER informierte die Teilnehmer über die Berufsschulpflicht, über Ziele und Inhalte des Unterrichts und bemerkte, dass alle gerne zum Unterricht kommen und rege teilnehmen. Aus den Inhalten, die Frl. MÜTTER in der Versammlung erwähnte, kann geschlossen werden, dass man seinerzeit bereits neben der Haushaltsführung auch die Kinderpflege im Focus der Ausbildung hatte. (Der Volksfreund, 07.11.1938)
Im Jahre 1939 wurde eine ähnliche Veranstaltung wiederum durchgeführt, was darauf schließen lässt, das sowohl von Seiten der Berufsschule als auch der Berufspraxis und dem Deutschen Frauenwerk ein hohes Interesse bestand. (Der Volksfreund, 15.02.1939)
Nach der Neuregelung der Berufsschulpflicht für Mädchen (06.07.1938) und der Verabschiedung des Vierjahresplanes vom 15.02.1938 wies der Regierungspräsident Düsseldorf alle Landräte und Oberbürgermeister am 21.01.1939 an, alle berufsschulpflichtigen Mädchen mit Beginn des neuen Schuljahres in die hauswirtschaftlichen Abteilungen der Berufsschulen einzuschulen. Mädchen im Pflichtschuljahr sollten in den Bereich Hauswirtschaft, auch wenn sie nach dem Pflichtjahr eine andere Ausbildung beginnen wollen. (LAV NRW R, BR 1004 Nr. 1156, S. 40, 129, 130 und 135) Spätestens dadurch erhielt die Ausbildung in der Hauswirtschaft einen neuen Stellenwert, galt sie dadurch nicht mehr als geringer eingeschätzt als die Ausbildung in anderen Berufen.
Ähnlich wie in den Jahren 1938 und 1939 wurde auch im Kriegsjahr 1943 eine Veranstaltung mit den Lehrfrauen und Lehrlingen, diesmal jedoch in der Berufsschule durchgeführt. Frl. MÜTTER gab die Inhalte der Ausbildung bekannt und betonte, dass für das Bestehen der Prüfung eine Beschulung von 10 Schulstunden erforderlich sei. „Eine kleine Ausstellung von theoretischen und praktischen Arbeiten der Schülerinnen erregte lebhaftes Interesse unter den Lehrfrauen, ebenso ein Gang durch die mustergültigen Räume wie: Küche, Waschküche, Näh- und Eßraum, in denen ihre Lehrlinge die praktischen Kenntnisse noch vertiefen. “ (Der Volksfreund, 05.11.1943) Ob die Teilnehmer ahnten, dass die „mustergültigen Räume“ 1 Jahr später durch Luftangriffe oder Einquartierung von Soldaten zerstört werden würden?
Eine Aufstellung der Schulleiter der Berufsschulen Kleve und Goch kann entnommen werden, dass die Hauswirtschaft im Januar 1943 einen erheblichen Anteil an der Gesamtschülerschaft hatte:
Gewerblich
560
Angelernte und Ungelernte
194
Hauswirtschaftlich
267
Kaufleute
307
Verkäuferinnen
146
(LAV NRW R, BR 1004 Nr. 215, Bl. 23 ff.)
Am 1. Juni 1944 gab es im hauswirtschaftlichen Bereich der Schule 40 ungelernte Schülerinnen und 260 Hausangestellte und Haustöchter, die ausgebildet wurden. (LAV NRW R, BR 1004 Nr. 215, S. 88 f.)
Ostern 1947 wurde der Berufsschule eine Haushaltungsschule als Berufsfachschule (24 Schülerinnen im Oktober 1947) angegliedert, die mit der ersten Abschlussprüfung Ostern 1948 die Anerkennung der Regierung erhielt und im 2. Jahr mit 36 Schülerinnen in 2 Parallel-Klassen durchgeführt wurde. (Kreisarchiv Kleve, O10, 150)
Zum Stichtag 01.12.1948 waren es in der Haushaltungsschule I: 18 Schülerinnen und in der Haushaltungsschule II: 27 Schülerinnen.
Ostern 1948 wurde die Errichtung einer Schule für Kinderpflege- und Haushaltsgehilfinnen als weitere Berufsfachschule genehmigt. Dieser Bildungsgang startete mit 12 Schülerinnen. (Kreisarchiv Kleve, O10, 150)
Abteilung Sozialwesen
Im Jahre 1983 wurde der sozialpädagogische Fachbereich aus der Abteilung Hauswirtschaft ausgegliedert (Chronik, S. 198), weil die Schulformen und Unterrichtsinhalte sich von denen des Fachbereichs Ernährung und Hauswirtschaft immer mehr unterschieden.
Die Kindergärten im Kreis Kleve haben sicher eine längere Tradition. Im Jahre 1843 trat in Kleve an die Stelle der überkonfessionellen Warteschule des patriotischen Frauenvereins die Katholische Kleinkinderbewahrschule, die von mehr als 200 Kindern besucht wurde. (Ullrich-Scheyda, 2004, S. 97 ff.) Wo es die ersten Einrichtungen gab, wer die ersten Träger waren und wie die Ausbildung der „Kindergärtnerinnen“ geschah, lohnte sich künftig zu ergründen. Dies würde aber den Umfang dieser Arbeit sprengen, so dass es wünschenswert ist, dass vielleicht jemand anders als der Autor sich dieses Themas eines Tages annimmt.
Kleinkinder-Verwahranstalten
Unter dieser Überschrift berichtete die Stadt Cleve in ihrem Verwaltungsbericht aus dem Jahre 1926:
„ Von den katholischen Verwahrschulen befindet sich die eine nach wie vor im Schwesternhause an der Stechbahn. Die andere, früher in der Münze untergebracht, befindet sich in dem 1910/11 erbauten neuen Heime an der Kermisdahlstraße. Die Anstalten wurden durchschnittlich von 230 Kindern im Alter von 3 – 6 Jahren besucht. Die Leitung hatten staatlich geprüfte Schwestern aus der Genossenschaft der göttlichen Vorsehung (Mutterhaus Friedrichsburg-Münster). Die Anstalten erhoben ein Schulgeld. Dieses betrug im letzten Berichtsjahre 5 M für das erste Kind und 3 M für jedes weitere. Unbemittelten Eltern wurde das Schulgeld erlassen. … In beiden katholischen Verwahrschulen wurde nach dem Fröbelsystem gearbeitet. Die Kinder versammelten sich des Morgens im Spielsaale und wurden dann gegen 9 ¼ Uhr dem Alter nach getrennt in den Kindergarten geführt. Dort wurde dem Streben der Kinder nach Betätigung aller Art Rechnung getragen, und es durch geeignete Beschäftigungen in die richtigen Bahnen gelenkt; so z. B. durch Bauen, Zeichnen, Modellieren, Kleben, Sand-, Bewegungs-, Hand- und Fingerspiele. “ Die Stadt beteiligte sich durch Zuschüsse (Stadt Kleve, 1926, S. 418)
„Die evangelische Kleinkinderschule in der alten Pastorat Stechbahn 35, eine der ältesten Verwahrschulen in Preußen, von der Ortsschulbehörde genehmigt schon am 25. Januar 1842, wurde durchschnittlich von 40 Kindern besucht. Bis 1924 wurde die Kleinkinderschule von evangelischen Schwestern geleitet, seit 1924 von einer staatlich geprüften Kindergärtnerin, der eine Gehilfin zur Seite stand. Zum Aufenthalte für die Kinder stand ein großer Raum zur Verfügung, außerdem ein großer schattiger Spielplatz. … Die Anstalt wurde unterhalten aus dem Schulgeld, das für die Kinder gezahlt wurde, und aus Mitteln der Diakonie. … Die Verwaltung der Anstalt lag in den Händen des Presbyteriums der evangelischen Gemeinde. “ Auch die evangelische Kinderverwahrschule erhielt ähnliche Zuschüsse wie die katholische von der Stadt. (Stadt Kleve, 1926, S. 418)
Die beiden „Kindergärten“ der kath. Kirche und der „Kindergarten“ der evangelischen Kirche wurden von „Schwestern“ geleitet. Vermutlich ist dies der Grund dafür, dass es im Jahre 1926 noch keine Ausbildung von Erzieherinnen oder Kinderpflegerinnen an der Berufsschule in Kleve gab, es war noch kein Bedarf vorhanden.
Anzahl der Kindergärten im 2. Weltkrieg
Im Jahre 1943 befanden sich im Altkreis Kleve 6 Kindergärten, „und zwar in Kleve-Mittelstadt, Kleve-Oberstadt, Kellen, Kranenburg, Griethausen und Düffelward. Weitere zwei Kindergartenneubauten in Kleve-Mittelstadt und Uedem sowie zwei Kindergartenumbauten in Keeken und Warbeyen stehen vor der Eröffnung. Außerdem werden dem Kreise Kleve sechs Kindergartenbaracken zur Verfügung gestellt, die in Goch, Kalkar, Hau, Materborn, Nütterden und Rindern Aufstellung finden sollen. Weitere Einrichtungen sind noch in der Planung. Zur Betreuung all dieser Kinder stehen im Augenblick 33 Kräfte zur Verfügung. “ (Janssen, 1943, S. 258 f.)
KERST berichtet über die Kindergärten in Kellen (heute Kleve-Kellen): Er und sein Bruder gingen in den Kindergarten im „Wohlfahrtshaus“ an der neuen St. Willibrord-Pfarrkirche, das neben Lehrküche und Nähschule auch eine Krankenstation hatte und von Clemensschwestern betrieben wurde. Der Kindergarten bestand aus zwei Räumen. Drei Ordensschwestern und zwei bis drei Helferinnen waren dort tätig. Am 1. November 1941 wurde ein neuer, moderner und öffentlicher Kindergarten in Sichtweite an der Overbergstraße eröffnet, der von der Partei „beaufsichtigt“ und nicht-konfessionell betrieben wurde. (Kerst, S. 15)
Kinderpflege
In der Statistik der Berufs - und Berufsfachschulen der Stadt Kleve von Oktober 1947 sind zum ersten Male „Kindergartenhelferinnen“ erwähnt, allerdings nur 3 weibliche Schülerinnen im 2. Lehrjahr. Sie wurden vermutlich zusammen mit den 21 Hausgehilfinnen beschult, da es 2 Klassen gab, und in der anderen Klasse wurden vermutlich die 28 Haustöchter des 2. Ausbildungsjahres beschult. (LAV NRW R, BR 1004 Nr. 215, S. 122)
Ostern 1948 wurde die Errichtung einer Schule für Kinderpflege- und Haushaltsgehilfinnen genehmigt. (Kreisarchiv Kleve, O10, 150)
Die Statistik vom 01.12.1948 weist 12 Kinderpflegerinnen aus. (Kreisarchiv Kleve, O10, 150)
Am 28.02.1957 lehnte der Rat der Stadt Kleve anlässlich der Etatberatungen der Haushaltssatzung für 1957 die Erhöhung auf 2 Klassen der Kinderpflegerinnen - und Hausgehilfinnenschule ab mit der Begründung, es solle die Entwicklung der Nachfrage der Schülerinnen in den nächsten Jahren abgewartet werden. „Der Rat stützt sich bei der Ablehnung auf das hohe Defizit sowie auf die Tatsache, daß diese Schule mit rd. 90 % von auswärtigen Schülerinnen besucht wird. “ (Stadtarchiv, SKS 333)
Einem Artikel der Rheinischen Post vom 9. März 1957 mit der Überschrift „Nicht nur das Geld … Kinderpflegeschule Kleve kann nicht alle Anwärterinnen aufnehmen“ kann folgendes entnommen werden: Vierzig junge Mädchen baten nach bestandener Haushaltsprüfung um die Aufnahme in die Kinderpflegeschule Kleve. Die Schule wurde 1948 eingerichtet und hatte schwankende Schülerzahlen. Die Stadt Kleve ließ die Schule aber auch dann bestehen, wenn die Schülerzahl zur Klassenbildung nicht ausreichte. Vorstufe zur Kinderpflegeschule war eine ein- oder zweijährige Haushaltsschule mit Abschlussprüfung. Es folgte der einjährige Besuch der Kinderpflegeschule. „Als drittes bzw. viertes Ausbildungsjahr leisten dann die Mädchen ihr Praktikum meistens in einem Kindergarten oder in einer hierzu besonders geeigneten kinderreichen Familie ab.“ (Stadtarchiv, SKS 333)
Fachschule für Sozialpädagogik (Erzieherinnen und Erzieher)
„Ende 1965 wurde mit der Planung der Einrichtung einer Fachschule für Sozialpädagogik begonnen und gleichzeitig einer einjährigen Berufsfachschule für Ernährung- und Hauswirtschaft, um Schülerinnen, die von den allgemeinbildenden Schulen mit mittlerem Bildungsabschluss kommen, den Zugang zur Fachschule für Sozialpädagogik zu ermöglichen. Die einjährige Berufsfachschule begann 1969, die Fachschule 1970. “ (Chronik, S. 105)
„Gleichzeitig liefen die Vorplanungen für eine neue Schulform, die Fachoberschule, in unserem Bereich für die Klasse 11 und Klasse 12 Sozialpädagogik. Die FOS startete 1971. “ (Chronik, S. 105)
Abteilung Agrarwirtschaft
Zur Agrarwirtschaft gehören die Bereiche Landwirtschaft und Gartenbau.
Gartenbau
Mit Errichtung der Gewerblichen Berufsschule im Jahre 1913 wurde auch die Berufsschulpflicht für die Gärtnerlehrlinge ausgesprochen, nicht jedoch für Jugendliche im Bereich Landwirtschaft. Seit 1913 gibt es daher an der Berufsschule der Stadt Kleve Gärtnerlehrlinge, die mit Erreichen einer entsprechenden Schülerzahl ab 1920 in einer eigenen Klasse beschult wurden, und zwar mit Rücksicht auf die Arbeiten im Betrieb in der Zeit zwischen dem 01.06. und 01.03. jeden Jahres mit 8 Wochenstunden.
Von Anfang an war die Zusammenarbeit zwischen Berufsschule und den Gärtnereien sehr gut, da die Gärtnereien erkannten, dass ein gründliches theoretisches Wissen mit einem praktischen Können verbunden sein muss, damit die Lehrlinge durch den Unterricht gefördert werden. Ein Beweis für die Anerkennung der theoretischen Ausbildung in der Berufsschule ist auch die Förderung der 4 besten Schüler der Gehilfenprüfung durch den Gärtnerausschuss, der Stipendien vergab für ein Freistudium auf einer Gärtner-Fachschule. Bis zum Jahre 1934 wurde ein solches Stipendium bereits 5 Schülern der Klever Gärtner-Berufsschule zugesprochen. (Schwartmann, S. 8 f.)
Landwirtschaft
Die Ausbildung von Berufsschülern der Landwirtschaft geschah zunächst noch im Bereich der Landwirtschaft, nicht des Erziehungsministeriums. Nach dem Besuch der Volksschule wurden die in der Landwirtschaft beschäftigten Jugendlichen meist in Ländlichen Fortbildungsschulen beschult, bei denen der Unterricht nachmittags durch Volksschullehrer und Praktiker erfolgte. Söhne von Landwirten mit größeren Betrieben und höheren Bildungsabsichten besuchten in Kleve die Landwirtschaftsschule, die zu den höheren Lehranstalten gehörte.
Von der Ackerbauschule zur Landwirtschaftsschule
Im Jahre 1868 wurde in Kleve eine Ackerbauschule eröffnet. Kleve erhielt als einzige im Rheinland den Zuschlag aufgrund der hochentwickelten Viehzucht und Molkereiwirtschaft. Vorläufer war eine aus Privatinitiative entstandene Ackerbauschule, die mehrere Jahre bestanden hatte, aber 1862 wegen mangelnder Unterstützung schließen musste. Kleve hatte sich in den Jahren zuvor aufgrund mehrerer ausgerichteter Versammlungen (1846 und 1851 Generalversammlung des Landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen zu Düsseldorf und 1855 Versammlung der deutschen Land- und Forstwirte) einen Namen gemacht.
Das Programm der Ackerbauschule Kleve war in nahezu allen landwirtschaftlichen Fachzeitschriften, sogar französischen, publik gemacht worden und zog daher das Interesse des In- und Auslandes auf sich. In Westfalen entstand eine solche Schule in Herford und Lüdinghausen, in der Eifel in Bitburg.
Das Schulgebäude befand sich von 1868 bis 1905 dort, wo sich heute der Marktplatz an der Linde befindet.
Der Unterricht begann am 12. Mai 1868 als Landwirtschaftliche Realschule. Im Sommer 1870 hatte die Schule 59 Schüler. Bereits im Jahre 1875 wurde die Ackerbauschule aufgrund des neuen Lehrplanes des Reiches in eine Landwirtschaftsschule umgewandelt. Nach Ende des dreijährigen Kurses erhielten die Schüler nach bestandener Prüfung die Berechtigung zum Einjährig-Freiwilligen-Militärdienst. Nicht entsprechend vorgebildete Schüler konnten eine Vorschule besuchen, um die Berechtigung zum Besuch der Landwirtschaftsschule zu erhalten. Damit war der jahrelange Kampf aller Realschulen gegen das traditionelle Bildungsprivileg der Gymnasien zu Ende gegangen. Das Neue an dieser Art von Schule war, dass sie nicht praktisch-theoretischen Unterricht erteilte, sondern theoretischen.
Mitte der siebziger Jahre des gleichen Jahrhunderts entbrannte ein Krieg um den Fortbestand der Schule, da einige Ratsherren, vornehmlich die katholische Zentrumsfraktion, die Pensionsverpflichtungen der Stadt Kleve zum Anlass nahmen, die Finanzierung durch die Stadt in Frage zu stellen. Nachdem der Regierungspräsident mit einer Verlegung der Schule nach Hilden drohte, einigten sich schließlich Stadt und Regierungspräsident auf einen Verbleib der Schule in Kleve und beiderseitiger Finanzierung. (Gorissen, S. 316 ff.) Damit war die Finanzierung der Schule gesichert und die Schülerzahl stieg von 39 im Jahre 1877 auf 85 (1880), 106 (1881), 152 (1898), 207 (1902), 250 (1905). „Die alte Schule an der Linde war längst zu klein, ein Neubau an der Materborner Allee nötig geworden.“ (Gorissen, S. 320)
Die Landwirtschaftsschule gehörte zu den höheren Lehranstalten. „Sie hat den Zweck, ihren Zöglingen eine für den zukünftigen praktischen Lebensberuf ausreichende allgemeine Bildung mit dem Ziele der mittleren Reife und eine sorgfältige fachwissenschaftliche Vorbildung für den landwirtschaftlichen Beruf zu geben. Sie gleicht in mancher Beziehung den sechsklassigen Realschulen, unterscheidet sich aber von diesen dadurch, daß sie von Sexta an als Pflichtfremdsprache durch alle Klassen Französisch betreibt, den naturwissenschaftlichen Unterricht stärker betont und außerdem Landwirtschaftslehre in den Unterrichtsplan aufgenommen hat als Ersatz für die zweite Fremdsprache. “ (Stadt Kleve 1926, S. 322)
Nachdem in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts die Landwirtschaft zum Studienfach an Universitäten wurde, die Zahl der Studierenden jedoch gering blieb, erkannte man, dass der Mittelbau eines landwirtschaftlichen Schulwesens fehlte. Diese Lücke wurde im Kreis Kleve durch die Ackerbauschule bzw. Landwirtschaftsschule geschlossen. „Ihr erster Direktor Dr. Fürstenberg (Leiter bis 1898) führt die Schule zu bestem Ansehen in der ganzen Provinz. Auch unter seinem Nachfolger Dr. Pick (Leiter bis 1927) ist die Schule zunächst in der Hauptsache von Landwirtssöhnen, darunter vielen auswärtigen besucht und bleibt eine Zentrale für die landwirtschaftliche Unterweisung am ganzen Niederrhein. In den 30er Jahren wird dann immer mehr eine Mittelschule mit besonderer Betonung der Naturwissenschaften daraus. 1943 wird sie aufgehoben. Ihr letzter Leiter war Direktor Dr. Borchert.“ (Kreis Kleve, S. 95)
Im Jahre 1918 hatte die Landwirtschaftsschule 398 Schüler. Bis zum Jahr 1926 verließen 1.661 Schüler die Schule mit dem Reifezeugnis. Mit Beginn des Schuljahres 1925 wurde die Schule gleichzeitig eine der wenigen Pädagogischen Seminare in Deutschland mit dem Zweck, Kandidaten des landwirtschaftlichen Lehramtes nach dem Studium in den praktischen Schuldienst an landwirtschaftlichen Lehranstalten sowie in die Tätigkeit des Wirtschaftsberaters einzuführen.
Winterschule
Für die kleinen und mittleren Bauern gab es seit den 1860er Jahren eine Winterschule, die sich an Bauernsöhne richtete, die in der Praxis standen und nur für die Praxis lernen wollten. Diese Form kam schon einer Berufsschule nahe. Die Lehrer, die dort unterrichteten, übernahmen auch die individuelle Hofberatung der Landwirte. (Kreis Kleve, S. 95) Mit den Winterschulen erreichte man zwar die Bauernsöhne, aber nicht die der Kleinbauern und auch nicht die Landarbeiter.
Bis zum Jahre 1898 blieb die Ackerbauschule neben der Landwirtschaftsschule bestehen. „Dann trat an Stelle der letzteren für einige Jahre eine Obst-, Gemüse- und Gartenbauschule, bis im Jahre 1902 an deren Stelle eine Winterschule eröffnet wurde. Diese, jetzt Landwirtschaftliche Schule genannt, unterstand bis zum Jahre 1923 ebenfalls dem Leiter der Landwirtschaftsschule. Es erfolgte dann eine Trennung der Leitung: jedoch ist die Winterschule auch heute noch im Gebäude der Landwirtschaftsschule untergebracht. Infolge des Anwachsens der Schülerzahl wurde in den Jahren 1903 bis 1905 an der Materborner Allee für die Landwirtschaftsschule ein Neubau errichtet und am 24. Juni 1905 bezogen.“ (Stadt Kleve, 1926, S. 321 f.)
Ländliche Fortbildungsschulen als Berufsschulen
Um möglichst alle Landarbeiter und Söhne von Bauern nach der Volksschule beruflich zu bilden, wurden in Preußen Ländliche Berufsschulen eingerichtet, in denen der Unterricht nachmittags von eigens dafür fortgebildeten Volksschullehrern erteilt wurde.
Schon nach 1870 bereiste ein Wanderlehrer, Dr. BÜRSTENBINDER, den Kreis Kleve und sprach in einer Vortragsreihe über den Ackerboden und seine Bearbeitung, über Stallmist, Gründüngung und Hilfsdüngemittel (Kunstdünger). Er leitete auch einen Fortbildungskurs für rund 40 Volksschullehrer, um diese für den Unterricht in den ländlichen Fortbildungsschulen zu befähigen. (Kreis Kleve, S. 95 f.)
„Am 9. Juli 1871 wird eine solche für Calcar-Uedem eröffnet. Sie wird im Winter am Mittwoch und Samstag je 2 bis drei Stunden und im Sommer sonntags 2 bis 3 Stunden besucht. Der Unterricht erstreckt sich über 3 Fächerkombinationen:
1. Fortbildung in den Elementarfächern Lesen, Schreiben, Rechnen,
2. Landwirtschaftliche Hilfswissenschaften Chemie, Physik, Botanik, Zoologie,
3. Landwirtschaftliche Kernfächer: Tierzucht, Acker- und Pflanzenbau, Düngelehre, Betriebslehre, landwirtschaftliche Buchführung, Bienenzucht, Obstbau“, schreibt der Clevische Volksfreund am 13. Juli 1871 (zitiert nach Kreis Kleve, S. 96)
Der Kreis Kleve erließ eine „Kreissatzung für die ländlichen Fortbildungsschulen des Kreises Cleve“, die am 1. April 1927 in Kraft trat. Nach dieser Satzung wurden alle im Kreis Cleve nicht vorübergehend beschäftigten unverheirateten Jugendlichen beiderlei Geschlechts unter 18 Jahren verpflichtet, die für ihren Wohn- oder Beschäftigungsort errichtete öffentliche Fortbildungsschule zu besuchen. Die Schule dauerte vom 15. Nov. bis in die 2. Märzhälfte für die Dauer von drei Jahren. Die Pflicht zum Besuch der Fortbildungsschule ruhte bei Besuch einer Berufsschule oder Fachsc hule. Auf Kreisebene wurde ein „Kreisfortbildungs-schul-Kuratorium“ gebildet, die Geschäftsführung wurde durch das Kreisjugendamt durchgeführt. Die Verwaltung der örtlichen Fortbildungsschule erfolgte durch den Schulvorstand, der unter dem Vorsitz des Bürgermeisters tagte und gebildet wurde aus zu gleichen Teilen Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie dem Leiter und einem Vertreter des Ortsgeistlichen. Leichtere Zuwiderhandlungen wurden durch Schulstrafen geahndet. Solche waren Verweise, besondere Schulaufgaben und „Schulhaft während der schulfreien Zeit“. Außerdem konnten Geldstrafen bis zu 30 RM, im Unvermögensfalle Haftstrafen verhängt werden.
Die Ländlichen Fortbildungsschulen bestanden noch bis nach 1945 im Kreis Kleve fort. (Kreis Kleve, S. 96) Sie wurden abgelöst durch die Neugründung einer landwirtschaftlichen Kreisberufsschule, deren Satzung am 01.09.1958 in Kraft trat und die die Kreissatzung für die ländlichen Fortbildungsschulen des Kreises Kleve vom 05.01.1927 außer Kraft setzte. (Chronik, S. 110) Diese erste Kreisberufsschule des Kreises Kleve wurde dann durch Kreistagsbeschluss im Jahre 1961 eine Sparte der neu gegründeten Kreisberufsschule (neben den Sparten Gewerblich, Kaufmännisch, Hauswirtschaftlich).
Landwirtschaftsschulen
In der Vorlage zur Kreistagssitzung vom 27. Juni 1956 wurde dem Kreistag empfohlen, für die Landwirtschaftsschule Goch einen Vertrag über die Regelung der Rechtsverhältnisse abzuschließen. Einen solchen Vertrag gab es bereits für die Landwirtschaftsschule in Kellen.
Der Kreisausschuss hatte sich bereits in seiner Sitzung vom 24.11.1955 grundsätzlich mit dem Neubau der Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle mit Mädchenabteilung in Kleve einverstanden erklärt und die Verwaltung beauftragt, den Raumbedarf festzustellen. Das Baugrundstück sollte in Kleve, An den Bleichen, liegen.
Landwirtschaftliche Kreisberufsschule
Am 1. Oktober 1958 begann der Unterricht einer eigenen Berufsschule für die Landwirtschaft in Trägerschaft des Kreises Kleve. Die Schule hatte verschiedene Standorte, vor allem in der Gocher Berufsschule, aber auch in Kleve im Jugendheim an der Stechbahn, in der Spyckschule und in der Landwirtschaftsschule Schmitthausen. Erster Leiter war Landwirtschaftsoberlehrer Wolfgang BRAUN. Diese Berufsschule bestand nur 2 ½ Jahre. Sie wurde am 1. April 1961, nachdem der Kreis Kleve von der Stadt Kleve die Berufs - und Handelsschule der Stadt Kleve am 1. April 1960 übernommen hatte, also ein Jahr später, in die Schule als Abteilung eingegliedert, nachdem der Kreis Kleve als neuer Schulträger auch die Berufs- und Handelsschule der Stadt Goch zum 1. April 1961 übernommen hatte.
Eingliederung der Landwirtschaftlichen Kreisberufsschule in die allgemeine Kreisberufsschule
„Die Landwirtschaftliche Kreisberufsschule wird mit der von der Stadt Kleve übernommenen Berufsschule zu einer einheitlichen Kreisberufsschule, bestehend aus einer gewerblichen kaufmännischen, hauswirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Abteilung, unter einer Leitung vereinigt.
Die Schulorte Kleve und Goch bleiben für die landwirtschaftliche Abteilung der Kreisberufsschule bestehen.
Der Erlaß einer neuen Satzung wird zurückgestellt, bis eine Entscheidung über die Berufsschule der Stadt Goch getroffen ist. “ (Kreisarchiv Kleve, O Nr. 407, Vorlage zur Kreistagssitzung 22.10.1960)
In der gleichen Sitzung soll der Beschluss gefasst werden, die Berufs- und Berufsfachschulen der Stadt Goch zu übernehmen.
Zum 1. April 1961 wurde die Landwirtschaftliche Kreisberufsschule in die neue Kreisberufsschule als Abteilung eingegliedert. Die neue Schule hatte damit eine gewerbliche, kaufmännische, hauswirtschaftliche und landwirtschaftliche Abteilung, umfasste als Schulgebiet den Kreis Kleve (Altkreis) und hatte die beiden bisherigen selbstständigen Berufsschulen in Trägerschaft der Städte Kleve und Goch mit den beiden Schulgebäuden übernommen.
2 DIE „MACHTÜBERNAHME“ IN KLEVE – EIN BILD DER ZEIT
In diesem Kapitel soll dem Leser ein kurzer Eindruck des Übergangs in die NS -Zeit in Kleve vermittelt werden, denn die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse und ihre Änderungen dürften Einfluss auf das Denken und Handeln der Lehrerschaft der Berufs- und Handelsschule der Stadt Kleve gehabt haben. Es wird hier der Versuch unternommen darzustellen, wie die Nationalsozialisten Parteimitglieder, Verwaltungen, Bürgermeister, Juden, Kirchen, Beamte und Lehrer sowie die örtliche Wirtschaft beeinflussten und Stimmung gegen Andersdenkende machten.
Nach dem Sieg der NSDAP am 30. Januar 1933 in Berlin setzten Terror und Propaganda zunächst der KPD, dann der SPD und nach der Reichstagswahl am 5. März 1933 und den Kommunalwahlen am 12. März 1933 dem Zentrum erheblich zu. Bei der Reichstagswahl behauptete das Zentrum in Kleve trotz Terror und Propaganda mit 50,6 % der Stimmen (7.371 Wähler) die absolute Mehrheit, jedoch war dies auch auf die Stimmen von 2.615 Wählern aus den Niederlanden zurückzuführen, die in Kleve wählen konnten (14.560 Stimmen wurden abgegeben). Die NSDAP erreichte in Kleve 27,5 % der Stimmen (4.009 Wähler), die SPD 6,6 % und die KPD 8,6 %. (Rolf Eilers, 1991, S. 58)
Bei der Kommunalwahl am 12. März 1933 erreichte die NSDAP einen Stimmenanteil von nur 29,9 % (9 Sitze), das Zentrum behauptete die absolute Mehrheit mit 50,8 % der Stimmen (16 von 29 Sitzen). Die NSDAP konnte aber mit der Unterstützung des Kampfbundes Schwarz-Weiß-Rot rechnen, der 4,1 % der Stimmen erhalten hatte, was einen Sitz in der Stadtverordnetenversammlung ausmachte. Die SPD erhielt 6 % Stimmenanteil (1 Sitz), die KPD fast 7 % der Stimmen, die damit verbundenen 2 Sitze wurden aber sofort eingezogen (Rolf Eilers, 1991, S. 58 f.)
„Bei diesen Mehrheitsverhältnissen im Rat erwies sich die eigentliche Machtergreifung auf legalem Wege als unmöglich … Die NSDAP konzentrierte sich daher auf drei andere Wege, um die Entscheidungsgewalt in der Stadt in die Hand zu bekommen: auf die Auswechslung der Verwaltungsspitzen, die nachträgliche Beschaffung der Mehrheit im Rat und die Zerstörung der noch bestehenden Loyalität der Bürger durch eine moralisch-politische Diffamierungskampagne gegen die Stadtverwaltung und die Mehrheitsfraktion.“ (Rolf Eilers, 1991, S. 59)
Parteien
KPD und SPD
„Terror und Propaganda werden häufig als die Mittel bezeichnet, mit denen die Nationalsozialisten die Macht errungen hätten. Auch in Kleve stand am Anfang der Machtergreifung der Terror.“ (Rolf Eilers, 1991, S. 51) Die nationalsozialistischen Gruppierungen (SA, SS, Grenzkommissariat „Greko“) sowie Parteigrößen wie z. B. der Kreisleiter der NSDAP, Alwin GÖRLICH, der später Bürgermeister der Stadt Kleve wurde, nahmen sich zunächst die linken politischen Parteien KPD und SPD vor. Demonstrationen und Gegendemonstrationen führten am 31. Januar 1933, nach dem Sieg der NSDAP am 30. Januar in Berlin, zu einer Schlägerei, die die Polizei trennte (Rolf Eilers, 1991, S. 52). Görlich versuchte als Kreisleiter der NSDAP, Demonstrationen der Linken durch die Polizei verbieten zu lassen. Er drohte dem Polizeioberinspektor SÜRTH, der dies ablehnte, mit der Entlassung, die er einige Zeit später auch durchsetzte. (Rolf Eilers, 1991, S. 52) Die NSDAP versuchte vor der Kommunalwahl am 12. März 1933 mit aller Gewalt, die Linken von der Straße und aus der Öffentlichkeit zu verbannen. So zwang GÖRLICH den damaligen Bürgermeister, der KPD die bereits zugesagte Vermietung des Schwanensaals wieder rückgängig zu machen (Rolf Eilers, 1991, S. 52). Als die SPD am 23. Februar 1933 den ehemaligen Minister Hilferding als Redner für eine Versammlung vorgesehen hatte, wurde dieser in einem Flugblatt der NSDAP als „negroiden Juden“ betitelt, den man in Kleve nicht dulden werde. Nach einem Umzug durch die Stadt marschierten SA und SS in geschlossenen Formationen in den Versammlungssaal und inszenierten eine wilde Prügelei. (Rolf Eilers, 1991, S. 52)
Durch die Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 wurde die Hatz auf Kommunisten und Sozialdemokraten erleichtert. In Kleve waren es zwar kleine Gruppen (KPD drei Stadtverordnete, SPD ein Stadtverordneter). „Insgesamt 38 Mitglieder der KPD wurden vom 28. Februar bis Anfang April 1933 in der Stadt Kleve in „Schutzhaft“ genommen“ (Rolf Eilers, 1991, S. 53). Am 31. März zogen SA -Trupps durch die Stadt, durchsuchten Wohnungen von 4 SPD-Mitgliedern, verhafteten und misshandelten sie schwer. Am 4. April folgte eine weitere Reihe von Festnahmen von SPD-Mitgliedern, die anschließend fürchterlich gefoltert und zugerichtet wurden, so dass sie noch lange danach arbeitsunfähig waren (Rolf Eilers, 1991, S. 53). Auch noch im Gefängnis sollen die politischen Gefangenen gefoltert und misshandelt worden sein (S. 53) Die Zahl der verhafteten KPD- und SPD-Mitglieder stieg insgesamt auf sechzig (Rolf Eilers, 1991, S. 53).
Über die Schutzhaft berichtete das Clever Kreisblatt: „





























