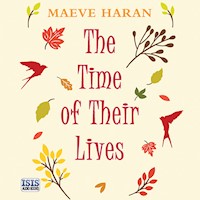4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die wunderbare Geschichte von vier Freundinnen, die vom Leben noch lange nicht genug haben!
Seit 45 Jahren gehen die vier Freundinnen Claudia, Sal, Ella und Laura zusammen durch dick und dünn. Sie treffen sich einmal im Monat in London auf ein paar Drinks, um gemeinsam zu lachen, zu feiern und manchmal auch zu weinen. Denn das Leben hält nicht immer das bereit, was man sich erträumt hat. So steht Laura plötzlich vor den Trümmern ihrer Ehe, nachdem sie erfahren hat, dass ihr Mann sie betrügt, während Sal akzeptieren muss, dass sie ihren Job an eine jüngere Kollegin verliert. Doch die vier lassen sich nicht einschüchtern, denn sie wissen, dass sie – was immer auch passiert – auf ihre Freundschaft setzen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 805
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Buch
Seit 45 Jahren gehen die vier Freundinnen Claudia, Sal, Ella und Laura zusammen durch dick und dünn. Sie kennen sich noch von der Uni und haben bisher alles – Liebe, Ehe, Scheidung, Kinder, Älterwerden und eben alles dazwischen – miteinander geteilt. Einmal im Monat treffen sie sich in London auf ein paar Drinks, um gemeinsam zu lachen, zu feiern und manchmal auch zu weinen. Denn das Leben hält nicht immer das bereit, was man sich erträumt hat, das müssen sie jetzt in ihren 60ern immer wieder erkennen. So steht Laura plötzlich vor den Trümmern ihrer Ehe, nachdem sie erfahren hat, dass ihr Mann sie betrügt, während Sal akzeptieren muss, dass sie ihren Job an eine jüngere Kollegin verliert. Ella hat vor Kurzem ihren Mann verloren, und Claudia steht vor der Entscheidung, die Stadt zu verlassen, um aufs Land zu ziehen, ein Wunsch, der nicht ihr eigener, sondern der ihres Mannes ist. Doch die vier lassen sich nicht einschüchtern, denn sie wissen, dass sie – was immer auch passiert – auf ihre Freundschaft setzen können.
Autorin
Maeve Haran hat in Oxford Jura studiert, arbeitete als Journalistin und in der Fernsehbranche, bevor sie ihren ersten Roman veröffentlichte. Alles ist nicht genug wurde zu einem weltweiten Bestseller, der in 26 Sprachen übersetzt wurde. Maeve Haran hat drei Kinder und lebt mit ihrem Mann im Norden Londons.
Von Maeve Haran bei Blanvalet lieferbar:
Die beste Zeit unseres Lebens Das größte Glück meines Lebens Der schönste Sommer unseres Lebens Das Beste, das uns je passiert ist Unser griechischer Sommer
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
MAEVE HARAN
ROMAN
Aus dem Englischen von Karin Dufner
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »The Time of Their Lives« bei Pan Books, an imprint of Pan Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited, London.
Copyright © 2014 by Maeve Haran
Copyright © 2015 für die deutsche Ausgabe
by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign,
unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
Redaktion: Ulrike Nikel
LH ∙ Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-15908-5V004
www.blanvalet.de
Für meine wundervollen Freundinnen Alex, Claire, Harriet und Presiley, die ich an meinem ersten Tag an der Uni kennengelernt habe. Seitdem treffe ich sie jeden Monat, um unsere Freundschaft zu pflegen und ein Gläschen Schampus mit ihnen zu trinken.
Kapitel 1
»Okay, Mädels.« Claudia sah ihre drei besten Freundinnen an, die sich zu ihrem üblichen Treffen im Grecian Grove versammelt hatten. Es war ein Kellerlokal, das sich hauptsächlich durch miserable Wandgemälde auszeichnete. Die darauf abgebildeten, von lüsternen Schäfern gejagten Nymphen machten nicht den Eindruck, als gäben sie sich große Mühe, den Verfolgern zu entkommen. »Kann mir eine von euch sagen, welches Datum wir heute haben?«
Claudia wusste, dass die Anrede »Mädels« ein wenig übertrieben war. Schließlich waren sie keine Mädchen mehr, sondern Frauen. Im vorgerückten mittleren Alter, um genau zu sein. Noch vor ein paar Jahrzehnten hätte man sie sogar als alt bezeichnet, doch seit sechzig die neue vierzig war, hatte sich das geändert.
Sal, Ella und Laura zuckten die Achseln und wechselten fragende Blicke.
»Geburtstag hast du nicht, richtig? Nein, der ist erst im Februar, und dann wirst du …«, begann Ella.
»Sprich es nicht aus«, unterbrach Sal, der ihr Alter am meisten zu schaffen machte, die Freundin. »Jemand könnte dich hören.«
»Wer denn? Irgendein zukünftiger junger Liebhaber mit wiegenden Hüften?«, frotzelte Laura. »Ich würde mich verpflichtet fühlen, ihm die Wahrheit zu sagen.«
»Es ist der 30. September«, verkündete Claudia, als zöge sie ein Kaninchen aus dem Hut.
»Na und?« Die anderen musterten sie verdattert.
»An einem 30. September haben wir uns kennengelernt.« Aus ihrer Handtasche förderte Claudia ein ausgeblichenes Foto zutage. »Im ersten Semester. Vor über vierzig Jahren.«
Sal machte ein Gesicht, als würde sie gleich in Ohnmacht fallen, während die anderen sich sofort neugierig über den Schnappschuss beugten. Und da waren sie. Vier vor Optimismus sprühende Achtzehnjährige mit langen Ponyfransen, kurzen Röcken und kniehohen Stiefeln. Ihre frischen, jungen Gesichter strahlten vor Zuversicht und Hoffnung.
»Ich muss zugeben«, stellte Ella stolz fest, »dass wir nicht schlecht ausgesehen haben. Warum glauben junge Leute einfach nie, wie schön sie sind? Ich erinnere mich eher daran, dass ich unter meiner miesen Haut gelitten habe und unbedingt fünf Kilo abnehmen wollte.«
Claudia schaute zwischen ihren Freundinnen und dem Foto hin und her.
Auf den ersten Blick schien sich Sal mit ihren schicken Klamotten und der modischen Frisur am besten gehalten zu haben. Allerdings hatte sie auch nie einen Mann und Kinder gehabt, die an ihren Nerven gezerrt hätten. Zudem kam Sals Optik ein wenig übertrieben daher, als würde sie sich allzu sehr ins Zeug legen.
Laura hingegen war zwar hübsch, aber konservativer als sie alle mit ihrem Faible für pastellfarbene Pullis und Perlenketten. Zweifellos hatte sie als Kind eines dieser Schmuckkästchen besessen, auf deren Deckel sich, begleitet von Musik, eine Ballerina drehte. Und diese anmutige Figur war offenbar für immer Lauras modisches Vorbild geblieben.
Ella nahm früher die Rolle eines Kobolds ein. Zumindest bis vor drei Jahren, als aus heiterem Himmel ein schwerer Schicksalsschlag sie getroffen und seinen Tribut gefordert hatte. Inzwischen war sie zum Glück fast wieder die Alte, und weil sie nicht krampfhaft versuchte, so zu tun als ob, sah sie sogar eher etwas jünger aus.
Und last not least Claudia selbst mit ihrem sorgfältig kolorierten Haar. Seit Jahren wählte sie immer denselben Ton. Nicht etwa weil das ihre echte Haarfarbe gewesen wäre – an die konnte sie sich gar nicht mehr erinnern –, sondern weil sie fand, dass Dunkelbraun natürlich aussah. Ansonsten trug sie stets ihre üblichen Schlabberpullis mit einem Shirt darunter, Jeans und Stiefel.
»So lange kann es doch noch nicht her sein«, jammerte Sal und machte ein Gesicht, als würde sie wie gelähmt darauf warten, von einem herannahenden Bus überrollt zu werden.
»Eine schöne Zeit, oder?«, seufzte Ella.
Sie wusste, dass ihre beiden Töchter die Dinge anders betrachteten. In ihren Augen war die Generation der Eltern egoistisch, promisk und, nicht zu vergessen, vermutlich drogenabhängig gewesen. Die frühen Babyboomer hätten Glück gehabt, klagten sie. Ihnen seien Vollbeschäftigung, dicke Renten und günstige Immobilienpreise noch in den Schoß gefallen, während ihre Kinder sich mit befristeten Jobs und Wuchermieten herumschlagen müssten und vielleicht erst mit siebzig in Rente dürften.
Ella überlegte. Was das Promiske anging, hatten sie gar nicht so unrecht. Niemals würde sie ihren Töchtern beichten, dass sie mit zwanzig einen Mann daran gehindert hatte, ihr im Bett seinen Namen zu nennen. Anonymer Sex war schließlich viel prickelnder gewesen. Wie entsetzlich. Hatte sie wirklich je so etwas getan? Ganz zu schweigen davon, dass es sowieso viel zu viele Männer gewesen waren, um sich ihre Namen überhaupt zu merken.
Ach, die rauschhaften Tage nach Erfindung der Pille und vor der Entdeckung von Aids!
Ella ertappte sich dabei, dass sie schmunzelte. Es war eine unbeschreibliche Zeit gewesen. Die Musik. Die Festivals. Das Gefühl, dass die Jugend plötzlich an der Macht war und dass sich die Gesellschaft wirklich änderte. Doch seitdem waren viele Jahre vergangen.
Claudia steckte das Foto wieder weg. »Ich hätte mal eine Frage.« Sie schenkte allen Wein nach. »Und zwar, was zum Teufel wir mit dem Rest unseres Lebens anfangen sollen. Schließlich haben wir schätzungsweise noch etwa dreißig Jahre vor uns.«
»Möchtest du nicht weiter an der Schule arbeiten?«, erkundigte sich Ella überrascht. Claudia liebte ihren Beruf als Französischlehrerin. »Ich dachte, heutzutage würde man nicht mehr zwangsweise in Rente geschickt.«
»Ich bin nicht sicher, ob ich das weiterhin will«, erwiderte Claudia zögernd.
Die anderen starrten sie erschrocken an.
»Aber du unterrichtest doch so gerne«, wandte Laura ein. »Hast du zumindest immer behauptet. Weil du auf diese Weise den Kontakt zur Jugend hältst.«
»Offenbar nicht genug …« Claudia gab sich Mühe, nicht sarkastisch zu klingen. »Anscheinend findet man, dass meine Unterrichtsmethoden nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind. Meine Lieblingsklasse wurde gerade einem jungen Lehrer zugeteilt, damit er mit den Schülern Slang auf YouTube übt. Laut Aussage der Schulleitung reißt man so die schwächeren Schüler besser mit.«
Claudia versuchte, nicht an den gönnerhaften Vortrag der Stellvertreterin des Direktors zu denken. Diese hatte ihr gestern in einem Ton, als spräche sie mit einer Altenheimbewohnerin, diese Änderung mitgeteilt. Peter Dooley, dieses dreißigjährige Bürschchen, das unter den Kollegen den Spitznamen Sabber-Dooley trug wegen seiner üblen Angewohnheit, seine Gesprächspartner mit Speichel zu besprühen.
»Peter«, hatte Claudia empört ausgerufen. »Der war nie in seinem Leben in Frankreich und bezieht sein Wissen allein aus dem Internet.«
Zu spät wurde ihr klar, dass das ein Fehler gewesen war.
»Genau.«
Offenbar tat das die Stellvertretende ebenfalls. Sie war erst dreißig und konnte nicht einmal ein richtiges Lehramtsstudium vorweisen, sondern bloß den MBA-Abschluss von einer Uni im Nordosten. Einer ehemaligen Fachhochschule, wie Claudia in Gedanken hämisch hinzufügte.
»Aber du hast immer Wunder bei deinen Schülern bewirkt«, ergriff Sal entrüstet für sie Partei. »Ich denke nur daran, wie du vor Einführung des Internets Videos von dir und Gaby aufgenommen hast, auf denen ihr euch auf Französisch unterhaltet. Die Schüler waren begeistert.«
Claudia wurde blass. Ausgerechnet eine dieser zwanzig Jahre alten Jugendsünden war nämlich Gegenstand der Vorwürfe, sie sei nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Während der Unterredung hatte ihre junge Vorgesetzte plötzlich eine Kassette hervorgezogen, sie vor ihrer Nase herumgeschwenkt und in zuckersüßem Ton anzüglich gefragt: »Sicher halten Sie die altbewährten Methoden nach wie vor für die besten, oder, Claudia?«
Am liebsten hätte sie Sonia an den Kopf geworfen, dass sie in Sachen moderne Lehrmethoden sehr wohl auf dem neuesten Stand sei, doch sie brachte nicht die Kraft auf. Fühlte sich zermürbt und irgendwie alt. Zum ersten Mal seit jenen glückseligen Tagen, in denen das Foto entstanden war. Und das lag nicht etwa an Gedächtnisschwäche oder am Kampf gegen graue Haare.
Nein, lediglich die verdammten Computer waren schuld.
Sartre mochte ja recht haben mit seiner Erkenntnis, dass die Hölle die anderen seien. Allerdings galt das bloß für seine Zeit, denn er war nie an einem Samstag in einem überfüllten Apple Store gewesen und musste sich nie sagen lassen, dass man einen Termin brauche, um mit einem »Genie« zu sprechen. Also mit einem dieser Jungmänner, die zu Tausenden herumliefen und alle aussahen, als wären sie in einer Fabrik für Streber vom Fließband gelaufen.
Und diese Auskunft erhielt man, bevor man nur eine einzige einfache Frage loswurde.
Desgleichen musste Sartre sich nicht mit einem »gesteuerten Lernumfeld« herumschlagen, in dem Schüler und sogar ihre Eltern von zu Hause aus online auf ihre Schularbeiten Zugriff nehmen konnten. Selbst die Technikfreaks unter den Kollegen bezeichneten dieses Programm als feindlichen Albtraum. Und als ob das nicht genug wäre, erwartete man zusätzlich von den Lehrern, die Schwächen ihrer Schüler anhand einer schauderhaften Software zu bewerten, die offenbar von einem Zehnjährigen entwickelt worden war.
»Arrogante Tussi«, rief Ella zornig aus und gab sich keinerlei Mühe, ihre Stimme zu dämpfen. »Du kennst dich mit diesem ganzen Computerkram doch ganz gut aus. Jedenfalls viel besser als ich. Für mich klingt iPad noch immer wie eine Kompresse gegen gerötete Augen.« Sie hielt inne und sah die Freundin nachdenklich an. »Und was willst du jetzt tun?«
»Offen gestanden«, begann Claudia und machte sich zum ersten Mal wirklich die Konsequenzen bewusst, »überlege ich, ob ich nicht kündigen sollte.«
»Claudia, nein.« Laura war sichtlich schockiert. »Du liebst deinen Job und bist eine wirklich gute Lehrerin.«
»Tatsächlich? Bin ich das? Mal im Ernst, Mädels, diese Schwachköpfe glauben, dass wir das Verfallsdatum überschritten haben. Soll ich euch verraten, was Sabber-Dooley gesagt hat? ›Machen Sie sich nichts draus, Claudia. Viele ältere Lehrkräfte kommen mit dem System nicht zurecht.‹«
»So ein Blödsinn«, schimpfte Sal und leerte ihr Glas.
»Außerdem würde dich jede andere Schule mit Handkuss nehmen.« Laura, seit fünfundzwanzig Jahren glücklich verheiratet und eine glühende Befürworterin der Ehe, hatte nach dem ersten Schreck schnell zu ihrem unverwüstlichen Optimismus zurückgefunden und verdrängte das Problem. »Schließlich bist du eine wundervolle Lehrerin. Und wenn nicht an einer Schule, wirst du anderweitig eine sinnvolle Beschäftigung finden. Wir sollten einfach die Ruhe bewahren und weitermachen wie gehabt. Und ehe wir uns versehen, sind wir neunzig – die Zeit verfliegt so schnell.«
»Nur dass sie künftig im Gegensatz zu früher von Arthritis, Gedächtnislücken und Blasenschwäche geprägt sein wird«, ergänzte Sal trocken. »Trotzdem finde ich, dass du dich wehren solltest. Diskriminierung aufgrund des Alters darf man nicht einfach hinnehmen, und im Übrigen sind wir nicht alt, sondern gerade mal im mittleren Alter.«
Vielleicht stemmte Sal sich am meisten gegen die Erkenntnis, langsam alt zu werden, weil sie als Einzige von ihnen ihren Lebensunterhalt ganz allein verdienen musste. Jedenfalls hatte sie allen Zeichen des Alterns den Kampf angesagt. Dem zunehmenden Körperfett und den Lachfalten ebenso wie sämtlichen geräumigen, nicht figurbetonten Kleidungsstücken. Das war etwas für Großmütter, nicht für sie! Heute trug sie ein schwarzes Etuikleid, dessen modisch-jugendliche Signalwirkung abgerundet wurde durch hochhackige Schuhe.
Letzteres tat Ella sich bereits seit Jahren nicht mehr an, und Claudia gab sowieso sportlichen Sneakers den Vorzug. Was nicht zuletzt daran lag, dass sie gerne zu Fuß ging. Auch zur Schule. Bloß würde sie noch lange eine Schule haben, zu der sie gehen konnte?, fragte sie sich bedrückt, während sie den Rest des Weins auf die Gläser verteilte.
»Du findest ganz sicher eine andere Stelle als Lehrerin«, munterte Laura sie erneut auf und verbreitete die Zuversicht eines Menschen, der es nicht wirklich nötig hatte, einen Beruf auszuüben.
»Glaubst du?« Trotz ihres studentischen Outfits mit Jeans und Schlabberpulli fühlte Claudia sich plötzlich aufs Altenteil geschoben. Wer würde schon eine Lehrerin in einer tariflich hohen Gehaltsstufe einstellen, die bereits jenseits der sechzig war?
»Kopf hoch, Claudia«, versuchte Ella sie zu trösten. »Du bist schließlich unsere Revoluzzerin. Eine kampferprobte Achtundsechzigerin. Hast damals in Paris sogar Pflastersteine geschmissen. Da willst du jetzt wohl nicht einfach aufgeben, weil irgendein größenwahnsinniger Jungspund dich auszubooten versucht.«
Claudia trank einen Schluck Wein und verzog das Gesicht. Ihr Problem bestand im Grunde darin, dass sie nicht wirklich wusste, ob sie sich überhaupt wehren sollte. Ob sie Lust dazu hatte. Eigentlich war sie das Ganze leid.
Sie sah ihre Freundinnen an und hob ihr Glas. »Auf uns. Es war eine supertolle Zeit.«
»Darauf trinke ich auch«, erwiderte Sal. »Und darauf, dass es noch lange nicht vorbei ist.«
»Ach, Sal, gib’s endlich zu.« Ella schüttelte den Kopf. »Wir sind keine Middle-Ager mehr. Davon sind wir so weit entfernt wie am anderen Ende des Spektrums vom Greisenalter.«
»Nein, sind wir nicht. Heutzutage gibt es kein festgelegtes Alter mehr. Wir sind IHJs: im Herzen Junggebliebene. Oder vielleicht SWATs.«
»Ich dachte, das ist ein Tal in Pakistan«, witzelte Claudia.
»Oder irgendeine Abteilung bei der Polizei. Special Weapons and Tactics«, fügte Ella hinzu.
Sal ging nicht darauf ein. »Unsinn. SWAT bedeutet ›Still Working at Sixty‹ – und genau das tun wir schließlich.«
»Sofern wir weiter einen Job haben.« Claudia seufzte. »Vielleicht, Sal, würde bei dir ja auch MSAR zutreffen – mit sechzig auf der Rolle.«
»Das klingt nach einer Lustgreisin mit Alkoholproblemen.«
»Und dem willst du widersprechen?«, zog Ella sie auf.
»Aber, aber«, mahnte Laura. »Verbündet euch nicht gegen Sal.«
»Tatsache ist und bleibt, dass wir anders altern als die Leute früher.« Sal ließ sich nicht von ihrer Meinung abbringen. »Meine Mutter sah in meinem Alter aus wie die Queen. Während sie Dauerwelle und Twinsets bevorzugte, trage ich Jeans und flippige Klamotten.«
»Stimmt, wir sehen überhaupt nicht aus wie unsere Mütter damals«, räumte Laura ein. »Inzwischen lässt sich das Alter einer Frau lediglich einschätzen, indem man einen Blick auf ihren Mann wirft.«
»Eigentlich läuft es eher darauf hinaus, dass wir vielleicht so alt sind, wie in unseren Papieren steht, uns jedoch nicht so fühlen«, sagte Sal. »Das unterscheidet uns. Und dass wir zur Generation Ich gehören. Wir haben den Altvorderen seit jeher ihre Regeln vor die Füße geworfen und getan, was uns gefällt. Altern ist heutzutage kein Schicksal mehr, sondern eine freie Entscheidung! Und ich für meinen Teil entscheide mich dagegen.«
»Ich weiß nicht recht.« Ella streckte den Arm aus, in dem sie hin und wieder ein rheumatisches Zwacken verspürte. »Manchmal fühle ich mich schon alt.«
»Unsinn.« Sal bestellte sich ein weiteres Glas Wein. »Wir werden niemals alt sein. Nicht die Woodstock-Generation. Denkt dran: We are stardust. We are golden … Hat Joni Mitchell gesungen. Die Hymne auf das Festival und auf unsere Generation.«
Ella war nicht überzeugt. »Mag ja alles sein. Nur würden wir inzwischen Eintrittskarten mit Seniorenrabatt bekommen.«
Auf der Heimfahrt mit der U-Bahn holte Claudia ihr Mobiltelefon heraus und stellte die Taschenrechnerfunktion ein. Dazu reichte ihre technische Begabung gerade noch – den gemeinen Behauptungen ihrer Tochter Gaby zum Trotz, sie würde das Handy lediglich benutzen, um Nörgel-SMS zu verschicken. Sie überschlug grob ihre Festkosten. Musste sie, denn falls sie jetzt kündigte, würde sie weniger Rente bekommen. Rente!
War es wirklich bereits so lange her, dass sie in Paris auf den Barrikaden gestanden und die Polizei mit Steinen beworfen hatte? Durch Ellas Bemerkung war ihr das wieder in den Sinn gekommen. Und jetzt saß sie da und grübelte über die Höhe ihrer Rente nach. Was hätte wohl die junge Claudia dazu gesagt?
Eigentlich war sie bloß aus Versehen Anarchistin geworden. Nach der Schule hatte es sie als Au-pair nach Frankreich verschlagen, um vor dem Studium ihr Französisch zu verbessern. Die Gastfamilie war wohlhabend und lebte im schicken 16. Arrondissement. Und dort lernte sie den besten Freund des Sohnes kennen. Thierry, grüblerisch, attraktiv, mit schwarzer Hornbrille und der Aura eines Intellektuellen, war es dann auch, der sie an einem ihrer seltenen freien Tage überredete, ihn ins Univiertel zu begleiten und zu schauen, was bei den Studenten so lief.
Claudia, aus einem verschlafenen Dorf in Surrey stammend, ließ sich von der berauschenden Stimmung der Revolution anstecken. An den ehrwürdigen Mauern der Sorbonne prangten geistreiche Graffiti: Sei realistisch, verlange das Unmögliche.Ich bin Marxist– und verehre Groucho. Und vieles andere mehr, erdacht vom ebenso verführerischen wie anarchistischen Thierry.
Alles schien gefährlich und aufregend damals. Sie bildete mit ihm und seinen korrekt wirkenden Freunden, die mit ihren Cordjacken und ordentlichen Kurzhaarfrisuren so gar nicht in das Klischee vom studentischen Revoluzzer und Bürgerschreck passten, Menschenketten quer über die Straßen von Paris, um den verhassten fliques den Weg zu versperren. Sie saß auf seinen Schultern wie später die Groupies auf den Musikfestivals und forderte mit zigtausend anderen lautstark im Quartier Latin die sexuelle Befreiung und das Ende des Patriarchats. Das alles war schrecklich lange her – fast wie in einem anderen Leben. Doch eine rebellische Ader hatte sie nach wie vor, wenngleich mit veränderter Zielrichtung. Heute machte es sie wütend, wenn Schüler mit reichen Eltern Privilegien genossen.
Seufzend wandte sie sich wieder ihren Berechnungen zu. Wie würden sie ohne ihr Gehalt über die Runden kommen? Miserabel. Vermutlich würde sie wie andere Rentnerinnen im Baumarkt jobben müssen. Und das, obwohl sie gut in ihrem Beruf war. Über diese Ungerechtigkeit ärgerte Claudia sich am meisten. Sie konnte die Schüler begeistern und sie mit der fremden Sprache so weit vertraut machen, dass sie ordentliche Noten schrieben. Ohne allerdings neue Technologien einzusetzen wie Peter Dooley etwa.
War sie deshalb wirklich hoffnungslos veraltet?
Nein, verdammt noch mal. Eine Lehrerin wie sie musste man suchen. Wenn man ihre Fähigkeiten allerdings nicht mehr zu schätzen wusste, würde sie eben kündigen und sich einen Job bei einem Nachhilfeinstitut suchen. Kein Problem. Oder doch? Obwohl sie sich einredete, sie werde locker etwas Neues finden, wusste sie zugleich tief in ihrem Herzen, dass es nicht stimmte. Sie konnte so gut sein, wie sie wollte – ihr Alter würde gegen sie arbeiten.
Als sie nach Hause kam, war die durch den Wein und die aufmunternden Worte der Freundinnen erzeugte Euphorie verschwunden. Vom Vorgarten aus sah sie, dass im Wohnzimmer Licht brannte. Ihr Mann Don, Lehrer wie sie, saß an seinem Computer, was eher selten vorkam. Über ihm wucherte in einem Topf eine Pflanze mit dem merkwürdigen Namen Köstliches Fensterblatt. Wie Claudia selbst ein zäher Überlebender aus den späten Sechzigern. Damals der letzte Schrei, war es inzwischen genauso veraltet wie Schusterpalmen. Doch Claudia fühlte sich der Pflanze aus unerklärlichen Gründen verbunden und brachte es nicht über sich, sie wegzuwerfen.
Den Großteil des gestrigen Abends hatte sie damit verbracht, über die dämliche stellvertretende Direktorin zu jammern, ohne bei ihrem Mann auf Gegenliebe zu stoßen. Dabei war er mit seiner Stelle in letzter Zeit desgleichen denkbar unzufrieden gewesen. Plötzlich hingegen wirkte er wie ausgewechselt.
»Hallo, Liebling.« Sein Lächeln wurde plötzlich jungenhaft. »Könnte sein, dass ich eine Lösung für unsere Probleme gefunden habe.«
Tief in ihrem Innern schrillten sämtliche Alarmglocken. Das passte so gar nicht zu Don. Schließlich war sie diejenige, die alles organisierte, die Entscheidungen traf und Veränderungen in die Wege leitete. Er war seit jeher unpraktisch und chaotisch und zeigte nicht einmal den Hauch eines Interesses an alltäglichen Dingen. Ihm war es viel wichtiger, für gelangweilte, auf ihre Smartphones stierende Jugendliche das englische Wahlsystem oder die glorreichen Zeiten des Empire lebendig werden zu lassen. Wen kümmerte es da schon, ob das Dach undicht war oder ob sie irgendwo für ihre jämmerlichen Ersparnisse höhere Zinsen bekommen konnten? Einzelheiten wie diese übertrug er ihr, seiner »Managerin«, wie er sie zu nennen pflegte.
Ihre gemeinsame Tochter Gaby hatte sich ihn zum Beispiel genommen und wandte sich stets an ihre Mutter, nicht an ihren Vater, wenn sie eine Finanzspritze, einen guten Rat oder eine nächtliche Fahrgelegenheit brauchte.
»Okay.« Claudia zog den Mantel aus und hängte ihn in der Flurgarderobe auf. »Und wie sieht diese Lösung unserer Probleme aus?«
»Wir sollten darüber nachdenken, uns zur Ruhe zu setzen. Es wären ja nur ein paar Jahre früher als üblich. Die fragen schließlich ständig, wer von den älteren Lehrern freiwillig gehen möchte. Wir sind denen zu teuer, deshalb sind ihnen Lehramtsanwärter frisch von der Uni am liebsten. Und was uns betrifft: Wir verkaufen das Haus hier und suchen uns etwas Kleineres, Preiswerteres in Surrey, in der Nähe deiner Eltern. Dann bleibt uns noch Geld zum Anlegen, das Zinsen bringt. Zusammen mit unseren Renten müssten wir dann klarkommen.« Seine Augen leuchteten wie die eines Erweckungspredigers, der eine neue Erlösungsformel entdeckt hat. »Außerdem könntest du Hühner züchten.«
Claudia schauderte es. Für sie war »sich zur Ruhe setzen« gleichbedeutend mit »Lebensabend«, also nichts, womit man den Rest seines irdischen Daseins ausfüllen konnte. Andererseits stellte sich natürlich die Frage, ob sie Sabber-Dooley ernstlich etwas entgegenzusetzen vermochte, wenn der sie aus ihrem Job zu drängen versuchte.
Ihr lagen einige ziemlich saftige französische Kraftausdrücke auf der Zunge, um den kleinen Stinker zu beschreiben. Und zwar solche, die bei Weitem über das hinausgingen, was dieser Schleimer vermutlich aus dem Internet kannte, und die ihm die Schamesröte ins Gesicht treiben würden. Vielleicht sollte sie sich bei Stephen, dem Direktor, beschweren. Er war immerhin fast so alt wie sie – was natürlich nicht zwangsläufig hieß, dass er sie unterstützte. Blöd wäre es, wenn er sich auf die Seite seiner Stellvertreterin schlug.
Einen Versuch wäre es jedenfalls wert.
Vielleicht erinnerte Stephen sich ja an ihre Vorzüge, zumal die Tage des Massenexodus in den Vorruhestand lange vorbei waren. Zu viele vom täglichen Kampf im Klassenzimmer zermürbte Lehrer hatten sich dafür entschieden. Zwar würde man ihrem Antrag auf vorzeitige Versetzung in den Ruhestand sicher stattgeben, wenn sie den Leuten lange genug auf die Nerven ging, aber es ihr ausdrücklich nahelegen … Nein, das würde kaum passieren.
Nur wollte sie wirklich aufhören?
Claudia war unschlüssig. Eines indes wusste sie: dass es keine Alternative für sie bedeutete, sich in der Einöde zu vergraben. »Ich habe keine Lust, dämliche Hühner zu züchten. Und ich will auch nicht nach Surrey«, erklärte sie ihrem Mann.
»Das sind bloß dreißig Kilometer auf der Schnellstraße«, wandte Don beschwichtigend ein. In seinen Augen stand nach wie vor ein gefährliches Leuchten. Offenbar loderte das missionarische Feuer weiter. »Mit dem Zug höchstens eine halbe Stunde.«
»Und was ist mit mir?«, ertönte von der Tür her eine vor Empörung bebende Stimme. »Surrey ist die Heimat der lebenden Toten.« Ihre Tochter Gaby war bei der Vorstellung, aufs Land ziehen zu müssen, aschfahl geworden.
Claudia, immerhin in Surrey aufgewachsen, konnte ihr da nur zustimmen.
Gaby wohnte mit ihren achtundzwanzig Jahren immer noch zu Hause, was Claudia einerseits sehr schön fand, da ihre fröhliche, lebhafte Tochter mit ihren vielen Freunden Leben in die Bude brachte. Andererseits machte Claudia sich Sorgen, dass sie nie einen Job finden würde, bei dem man genug verdiente, um sich eine eigene Wohnung leisten zu können. Gabys Standardantwort darauf lautete, dank der Raffgier der älteren Generationen bleibe für die Jungen eben nicht genug. Manchmal aber befürchtete Claudia, dass hinter ihrem ausbleibenden beruflichen Erfolg einfach mangelndes Durchhaltevermögen steckte. Trotz ihres guten Abschlusses in Geografie hatte sie in rascher Abfolge als Schauspielerin, Kellnerin, Empfangssekretärin bei einem Tierarzt, Callcenteragentin, Zirkusmitarbeiterin und Assistentin in einer Kunstgalerie gearbeitet. Seit Neuestem strebte sie eine Karriere als Architektin an. Claudia und Don hatten nur Blicke gewechselt und die Voraussetzung, ein ziemlich zeit- und kostenintensives Studium, gar nicht erst erwähnt. Zumindest war sie derzeit in einem Architekturbüro beschäftigt, wenngleich lediglich als Hilfskraft.
»Wir könnten etwas zuschießen, wenn du eine eigene Wohnung mietest«, verkündete ihr Vater, als wäre das die Lösung schlechthin.
Gabys Miene hellte sich sichtlich auf, während Claudia einmal mehr am Realitätsbezug ihres Mannes zweifelte. »Schwebt dir vielleicht Shoreditch vor? Oder gar Hoxton?«, zählte Claudia mit beißendem Spott die angesagtesten Ecken im angesagten Londoner East End auf.
»Da bin ich nicht so sicher …«, setzte Don an.
»Ich auch nicht«, unterbrach Claudia ihn spitz. »Bei dem, was von unserem Einkommen nach Abzug der eigenen Kosten übrig bliebe, wäre eher etwas wie Penge drin. Doch wie du an diesem Beispiel siehst, ist die ganze Umzugsidee ausgemachter Quatsch.«
»Warum?« Ausnahmsweise ließ Don sich einmal nicht beirren.
»Weil ich hier einen Job habe und weil es mir in London gefällt.«
»Du hast schließlich selbst gesagt, dass du überlegst, deine Stelle zu kündigen. Was, wenn dieser Dooley Leiter des Fachbereichs wird?«
Eine schauderhafte Vorstellung, über die Claudia lieber hinwegging. Stattdessen führte sie das kulturelle Angebot ins Feld. »Willst du etwa künftig auf den Besuch von Theatern, Museen, Galerien verzichten? Oder auf nette Restaurants und Kneipen? Hier haben wir alles vor der Haustür.«
»Du nutzt das meiste sowieso nicht«, konterte er. »Dauernd sagst du, Theaterkarten seien so teuer, dass nur russische Oligarchen sie sich leisten können.«
»Dann eben Kunstausstellungen.«
»Wann warst du zuletzt in einer?«
Claudia bekam ein schlechtes Gewissen. Es stimmte irgendwie: Sie wohnte in einer der aufregendsten Städte der Welt und nahm trotzdem am kulturellen Leben so gut wie nicht teil. Also verlegte sie sich auf eine andere Argumentation. »Und dann wären da noch meine Freundinnen. Wie soll ich sie regelmäßig sehen, wenn ich dreißig Kilometer weit nach draußen ziehe?«
»Findest du nicht, dass du ein bisschen egoistisch bist?«
»Vielleicht, aber das gilt genauso für dich«, schleuderte sie ihm entgegen. »Bislang hast du einen Umzug mit keinem Wort erwähnt, und jetzt machst du mir Vorwürfe, weil ich keine Lust verspüre, in einer pseudoländlichen Gegend zu versauern.«
»Dort ist es nicht pseudoländlich – es ist Londoner Einzugsgebiet. Wir könnten natürlich auch richtig aufs Land ziehen, da wäre es sicher noch billiger.«
»Und noch weiter weg von meinen Freundinnen.«
Inzwischen war Don regelrecht aufgebracht, was bei ihm selten vorkam. »Bei dir dreht sich alles um diesen Hexenklüngel, richtig? Die sind der Mittelpunkt deines Lebens.«
»Hexenklüngel – eine Unverschämtheit!«
»Die machen nichts als Blabla und zerreißen sich die Mäuler über andere Leute. Sal jammert über ihre Kollegen, und Laura beurteilt jeden Mann danach, ob er schon mal eine Frau sitzen gelassen hat oder nicht.«
Claudia konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. So ganz daneben lag er mit seiner Beschreibung nicht.
»Gelobt sei Gott«, stöhnte Gaby auf. »Ich begann bereits zu fürchten, dass ihr zwei euch jetzt auf den Weg zum Scheidungsanwalt macht anstatt aufs platte Land. Ihr streitet doch sonst nie.«
»Übrigens«, wandte Claudia sich wieder an Don. »Was ist eigentlich mit deinen Freunden? Du würdest die rehgelmäßigen Treffen genauso vermissen wie ich meine geliebten Abende beim Griechen.«
Jeden Mittwoch hockte Don mit drei Freunden in einem Pub zusammen, um über Direktoren und Kollegen, die Schulbehörde und den Zustand des britischen Bildungswesens herzuziehen. Aber offenbar kam Freundschaft bei Männern nicht derselbe Stellenwert zu, den Frauen ihr beimaßen.
»Wie wär’s mit einem Tee?«, schlug Don vor, als hätte das Getränk die Zauberkräfte des Heiligen Grals. »Rotbusch?«
Claudia nickte. »Mit Vanillearoma.«
»Ich weiß, mit Vanillearoma.«
Sie küsste Gaby und ging nach oben, um über ihren Disput mit Don nachzudenken. Nach dreißig Jahren kannte er ihre Vorlieben und Abneigungen eigentlich gut genug, um ihre Reaktionen abschätzen zu können. Und meistens funktionierte es auch. Alle Entscheidungen, kleine wie große, hatten sie bisher zusammengeschweißt, jede davon ein Mauerstein in der Festung ihrer Ehe. Nur dienten Festungen bisweilen nicht allein dazu, Eindringlinge abzuwehren, sondern entpuppten sich als Gefängnisse.
Passierte ihr das gerade?
Rasch zog Claudia sich aus und schlüpfte ins Bett. Ihre Nerven waren noch immer angespannt. Kurz darauf erschien Don mit dem Tee, stellte ihn ab und verschwand im Bad. Zwei Minuten später legte er sich nackt neben sie ins Bett, das übliche Vorzeichen für Sex.
»Tut mir leid, ich hätte dich nicht so überrumpeln sollen. Das war unfair.«
»Kannst du laut sagen.«
Er fing an, ihre Brust zu küssen. Claudia schauderte es, allerdings nicht vor Lust. Warum glaubten Männer immer, mit Sex alles wiedergutmachen zu können, während Frauen zuerst eine ehrliche Entschuldigung brauchten, bevor sie in der Lage waren, an so etwas zu denken?
Ella stieg aus dem Bus und ging den Fußweg an der Mündung von Grand Union Canal und Themse entlang. Es war eine helle Nacht. Der breite Strahl des Mondlichts, der sich auf dem in einen zarten Nebel gehüllten Wasser spiegelte, erinnerte sie an die Heiligenbilder, die sie als Kind in der Klosterschule gesammelt hatte. Die optische Wirkung hatte darauf als Symbol eines überirdischen Friedens häufig eine Rolle gespielt. Nur dass Ella sich heute Abend nicht friedlich fühlte.
Es war eine der Nächte, in denen sie Laurence vermisste.
Falls sie überhaupt je gläubig gewesen war, hatte sich das schon lange gelegt. Sie fragte sich bisweilen, ob ihr die Religion wohl eine Hilfe gewesen wäre, mit dem Entsetzlichen besser klarzukommen. Oder ob sie dadurch endgültig den Glauben verloren hätte. Von einer Minute zur anderen war Laurence tot gewesen, ohne dass sie sich von ihm verabschieden konnte. Wurde Opfer eines statistisch unwahrscheinlichen Zufalls. Er hatte einfach das Pech gehabt, in einem Zug zu sitzen, der verunglückte. Dabei galten Bahnfahrten als sicherste Form des Reisens. Außerdem war er gewissermaßen stellvertretend gestorben, weil er kurzfristig für einen Kollegen eingesprungen war.
Nicht seine Geschäftsreise.
Nicht sein Mandant.
Diese Ungerechtigkeit des Schicksals machte sie wahnsinnig. Unwillkürlich musste Ella an Claudias Frage denken, was sie mit dem Rest ihrer Lebenszeit anfangen sollten. Ja, was? Ihr hatte damals ihr Beruf geholfen. Er war, mehr noch, ihre Rettung gewesen.
Allein dank ihrer Arbeit war sie damals aus ihrer Trauer nach Laurences’ Tod wieder aufgetaucht und hatte ins Leben zurückgefunden. In den Alltag und in die Normalität. Ihre Töchter, inzwischen zweiunddreißig und dreißig, lebten nicht mehr zu Hause. Und wenn sie es recht bedachte, hatte sie sich weniger zusammengerissen, um sich vor ihnen nicht gehen zu lassen, sondern eher deshalb, um sich selbst zu schützen.
Julia, die ältere und dominantere, machte nämlich nach dem Tod des Vaters Anstalten, die trauernde Mutter zu bevormunden und ihr alles und jedes abzunehmen. Sogar weit reichende Entscheidungen. Cory, die jüngere Tochter, war allerdings untröstlich gewesen und brauchte seelischen Beistand. Exakt am Tag des Unglücks hatte sie sich mit ihrem Vater wegen einer Bagatelle gestritten und wurde nicht fertig damit, dass sie nie mehr die Gelegenheit erhalten sollte, sich mit ihm zu versöhnen.
Seitdem waren drei Jahre vergangen, doch Ella kam es vor, als wäre es gerade erst geschehen. Der Abdruck seines Kopfes auf dem Kissen neben ihrem schien kaum verschwunden, das Bett fühlte sich nach wie vor absurd groß an, und jeden Morgen beim Aufwachen lastete die unheimliche Stille im Haus auf ihr. Deshalb pflegte sie als Erstes das Radio anzuschalten. Jim Naughtie auf BBC war zwar kein Ersatz für Laurence, aber besser als nichts.
Eine taktlose Kollegin, die von ihrem Mann verlassen worden war, hatte ihr einmal erklärt, als Witwe sei man besser dran, weil einem wenigstens die Erinnerungen blieben.
Manchmal allerdings wurden genau diese Erinnerungen zum Problem. Noch immer konnte es passieren, dass sie nach Hause kam, den Schlüsselbund auf das Flurtischchen neben die Vase mit den Gartenblumen legte und die Ohren spitzte, ob wieder mal im Fernsehen eine Sportsendung lief.
Da sie selbst Anwältin war, hatte sie den Bahnbetreiber mit Erfolg auf Schadenersatz verklagt. Für sich ebenso wie für die anderen Geschädigten. Und das hatte ihr die Entscheidung leichter gemacht, sich aus dem Arbeitsleben zurückzuziehen. Denn nach ihrem Erfolg vor Gericht war bei ihr irgendwie die Luft raus, und sie beschloss, sich Knall auf Fall zur Ruhe zu setzen. Kurz nach ihrem Sechzigsten. Keiner hatte es fassen können. Sie selbst vielleicht am allerwenigsten.
In Gedanken versunken, erreichte sie ihr Haus. Es lag an einem Platz, der früher einmal ein Dorfanger gewesen war, wo Jahrmärkte und Bauernmärkte stattfanden. Und obwohl mittlerweile sehr zentral gelegen, wirkte Old Moulsford etwas rückwärtsgewandt, schien eher ins achtzehnte Jahrhundert zu gehören als in die Gegenwart. Die Zeit war hier stehen geblieben.
Ella hing an ihrem Heim, in das sie so viel Arbeit und Liebe gesteckt und in dem sie die gesamte Zeit ihrer Ehe verbracht hatte. Es handelte sich um ein hübsches vierstöckiges Gebäude aus rotem Backstein mit quadratischen, in zwölf Segmente unterteilten Sprossenfenstern und breiten Steinstufen, die zur Eingangstür führten. Besonders dieses Portal mit seinen eleganten, sich leicht verjüngenden Säulen, auf denen das Vordach ruhte, hatte es ihr von Anfang an angetan. Früher einmal hatten hier Seidenweber gewohnt und gearbeitet. Sie waren auch nicht gerade arm gewesen, inzwischen aber konnten sich nur noch sehr gut betuchte Leute ein solches Haus leisten.
Als sie den Schlüssel ins Schloss steckte, hielt sie kurz inne und schaute nach oben. Direkt über ihr schwebte ein Jumbojet im Landeanflug auf Heathrow zu. Er schien zum Greifen nah. Was für ein Widerspruch, dass dieses Haus, ein Meisterwerk frühgeorgianischer Eleganz, mitten in der Einflugschneise stand. Ihr Viertel war eine winzige Insel der Vergangenheit, auf allen Seiten von hoch aufragenden Bürotürmen umzingelt, die von der Nähe zur Autobahn profitierten. Der Platz hier gehörte zu den kleinen, überraschenden Oasen, die London so sympathisch und lebenswert machten.
Durch die Tür hörte sie das Radio.
Einen Moment blieb sie wie erstarrt stehen, fühlte sich genarrt von ihren Erinnerungen. Natürlich war es nicht Laurence. Sie musste endlich aufhören, ihn überall zu sehen, zu hören und zu fühlen. Vermutlich saß Cory im Wohnzimmer. Diese Tochter hatte die manchmal lästige Angewohnheit, unangemeldet bei ihr hereinzuschneien und zu übernachten, wenn sie zufällig in der Nähe war. Andererseits freute Ella sich über ihre Besuche, sobald der erste Schreck, es könnten Einbrecher sein, überwunden war.
»Cory«, rief sie. »Cory, bist du das?«
Auf der hölzernen Treppe vom Souterrain herauf polterten Schritte, und im nächsten Moment tauchte die junge Frau auf und warf sich ihrer Mutter in die Arme. Cory war groß und schlank und sah mit ihrer dunkelbraunen Mähne, zu der die fast wachsbleiche Haut einen ungewöhnlichen Kontrast bildete, spektakulär aus. Am auffallendsten jedoch waren ihre leuchtend dunkelblauen Augen, die jeden in ihren Bann schlugen. Manchmal sprühten sie vor Leben, meistens indes meinte Ella in ihren Tiefen eine Traurigkeit zu erkennen, die ihr Sorge bereitete.
Dabei hatte Cory eigentlich alles, was man zum Glücklichsein brauchte. Eine elfenhafte Schönheit, einen scharfen Verstand und einen Beruf, den sie liebte – sie war Kuratorin in einem Museum. Trotzdem mangelte es ihr an Selbstbewusstsein, und lediglich Laurence war es gelungen, bei ihr Vertrauen in sich selbst zu wecken. Ellas Versuche hingegen, ihre Tochter diesbezüglich zu motivieren, verunglückten mit schöner Regelmäßigkeit. Komplimente wegen eines hübschen Kleidungsstücks etwa oder wegen einer geistreichen Bemerkung pflegte sie mit einem ungeduldigen Kopfschütteln abzutun. Heute aber schien sie geradezu überschwänglich gut gelaunt zu sein.
»Hallo, Mum, wie geht’s dir? Ich hatte eine langweilige Sitzung in Uxbridge und dachte, du würdest dich freuen, mich zu sehen.«
»Ach wirklich?«, erwiderte Ella lachend und registrierte amüsiert, dass ihre Tochter ein Glas Wein in der Hand hielt, verkniff sich allerdings eine scherzhaft-spöttische Bemerkung. Nicht, dass Cory auf der Stelle ein schlechtes Gewissen bekam. »Schön dich zu sehen«, sagte sie stattdessen. »Ich würde ja einen mittrinken, doch ich war gerade mit den Mädchen unterwegs.«
»Apropos Mädchen«, warf Cory ein. »Deine Nachbarin kommt jeden Moment vorbei. Obwohl es bereits spät ist. Sie wollte dich etwas fragen.«
»Aha. Wahrscheinlich soll ich die Blumen gießen oder was weiß ich.«
»Fahren sie weg?«
»Sie sind ständig weg.«
Ihre Nachbarn, Viv und Angelo, verfügten über den beängstigenden Tatendrang wohlhabender Frühpensionäre. Obwohl beide über sechzig, pflegten sie beinahe dasselbe Image wie mit Mitte zwanzig. Viv machte sich zurecht wie Mary Quant in jungen Jahren, trug scharfkantige, geometrische Kurzhaarschnitte und dicke Halsketten. Angelo bevorzugte es, wenn sein gepflegtes graues Haar ihm bis auf die Schultern fiel, und zeichnete sich überdies durch eine Schwäche für Kapuzenpullis in einem hellen Aprikot aus. Meistens fuhren sie in einem Mini-Cabrio herum, aus dem Musik der Sechzigerjahre plärrte. Wenn es eine Grenze zwischen ewig jung und gruselig gab, hielten sie sich mit knapper Not auf der richtigen Seite. Manchmal fragte sich Ella, ob überhaupt noch jemand zu seinem Alter stand.
Gleichzeitig besaßen die beiden jedoch offenbar eine spießbürgerliche Seite, denn sie nannten eine Kleingartenparzelle ihr Eigen. Und wie sich herausstellte, war diese der Grund für einen Gefallen, den sie von Ella erbitten wollten.
»Entschuldige die späte Störung«, sagte Viv, als sie erneut klingelte. »Die Sache ist die, dass wir in aller Früh losmüssen. Ella, mein Schatz, meinst du, es wäre für dich möglich, hin und wieder einen Blick auf unseren Kleingarten zu werfen? Einmal in der Woche reicht, höchstens zweimal.«
»Wie lange seid ihr denn weg?«
»Ach, drei Wochen vielleicht. Wir wollen zum Tauchen auf den Islas Mujeres.«
»Wo um alles in der Welt liegt denn das?«
»Die gehören zu Mexiko, glaube ich. Angelo hat gebucht.«
Viv und Angelo machten so oft Urlaub, dass sie selbst den Überblick verloren. Bei Ella hingegen lösten die Schilderungen ihrer Freizeitgestaltung stets leichte Erschöpfungsgefühle aus. Paragliding. Bergwandern. Wildwasserfahrten. Radtouren von einem Weingut zum anderen. Für fitte, abenteuerlustige und gut betuchte Ruheständler gab es offenbar Betätigungsmöglichkeiten ohne Grenzen.
»Und was muss ich genau machen?«
»Achte ein bisschen darauf, dass es einigermaßen ordentlich aussieht. Die Kleingartenpolizei ist ein Albtraum. Die drohen allen mit Rauswurf, bei denen es nicht geleckt aussieht wie in einem botanischen Garten.«
»Sind das richtige Polizisten?«, wollte Cory wissen.
»Nein«, räumte Viv ein. »Eigentlich ist es bloß der Vereinsvorstand, aber die spielen sich auf wie Sheriffs. Früher waren das harmlose Opas mit Hosenträgern und Strohhüten, inzwischen hat Angelo den Verdacht, dass die alle LGBT sind.«
»Was ist denn LGBT?«, erkundigte sich Ella.
»Mum«, stöhnte Cory und verdrehte die Augen. »Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender.«
»Ach herrje.« Ella fühlte sich zwar nicht oft alt, jetzt allerdings schon. »Nun, da haben sie ja niemanden ausgelassen«, meinte sie und fand zugleich, dass die Bemerkung mehr über Angelo aussagte als über die Kleingärtner.
»Du brauchst nur ein bisschen die Pflanzen zu stutzen, Laub zu rechen und beschäftigt auszusehen. Die halten einem ständig vor, wie lang die Warteliste ist und dass lauter Leute draufstehen, die einen Kleingarten viel eher verdienen als wir. Hier ist der Schlüssel.«
Viv küsste sie dreimal. »Ach, übrigens haben wir im Haus eine Alarmanlage einbauen lassen. Angelo hat darauf bestanden.« Sie gab Ella einen Zettel. »Das ist der Code, falls sie losgeht. Du hast ja sowieso unseren Hausschlüssel, richtig?«
»Ja«, erwiderte Ella, die sich allmählich wie eine unbezahlte Hausmeisterin vorkam.
Viv entschwand bereits durch den Vorgarten. »Um sechs ist Aufbruch. Angelo kann es nicht ausstehen, einen ganzen Tag für die Anreise zu verschwenden. Deshalb nehmen wir den ersten Flieger.«
»Du musst zugeben«, stellte Cory bewundernd fest, »dass die für Senioren ziemlich aktiv sind.«
»Zu aktiv, wenn du mich fragst. Sie wollen sich lediglich beweisen, dass sie für nichts zu alt sind.«
Ella schloss zweimal ab, legte den Riegel vor und widmete sich als Nächstes den schweren seidenen Vorhängen. Bevor sie sie zuziehen konnte, musste sie zunächst die mit Fransen und goldenen Mustern verzierten Schlaufen lösen. Sie liebte dieses abendliche Ritual, denn es verlieh den Räumen mit ihren Parkettböden und Wandvertäfelungen etwas Anheimelndes. Nicht nur Ella, auch das Haus schien sich dann auf eine friedliche Nachtruhe zu freuen.
»Weißt du was, Mum«, riss Cory sie aus ihren Gedanken. »Das solltest du ebenfalls machen.«
»Was? Tiefseetauchen? Oder Paragliding?«
Cory grinste spöttisch. Offenbar fand sie die Vorstellung, dass Ella sich in ein Abenteuer stürzen könnte, ziemlich komisch. »Dir eine Alarmanlage anschaffen.«
»Ich hasse Alarmanlagen«, antwortete Ella und hätte beinahe hinzugefügt: Man kann dem Schicksal nicht vorgreifen. Schau, was mit Dad passiert ist, doch es erschien ihr zu grausam. Gerade Cory gegenüber. »Komm, wir gehen ins Bett. Möchtest du etwas Warmes trinken?«
Ihre Tochter schüttelte den Kopf. »Ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen auf und setze mich vor die Glotze.«
Ella nickte und ging in die Küche im Untergeschoss, goss sich einen Tee auf und dachte an Laurence. Es waren die kleinen Dinge des Alltags, die ihr am meisten fehlten. Die beruhigenden Angewohnheiten, die einen als Paar zusammenschweißten und die sie jetzt ohne ihn tun musste. Außerdem gab es nichts mehr, um sich darauf zu freuen. Das Haus und den Kleingarten der Nachbarn zu betreuen stellte nicht gerade ein Highlight dar. Zumal sie sich über diese beiden albernen Alten zunehmend ärgerte. Machten Aktivurlaube in der ganzen Welt, als wären sie mindestens dreißig Jahre jünger. Und merkten nicht, dass Leute, die wirklich so jung waren, sich so etwas nicht leisten konnten.
Nachdem sie das Licht gelöscht hatte, lauschte sie einen Moment in die Stille des großen alten Hauses hinein. Als sie es vor vielen, vielen Jahren gekauft hatten, war es ziemlich verwahrlost gewesen. Mit undichtem Dach und einem Keller voller Wasser. Und einem Baum in einer Ecke, wo die Mauer eingestürzt war. Mit viel Mühe und Liebe hatte sie dem Haus wieder neues Leben eingehaucht, sich eingehend mit der Geschichte und Architektur seiner Entstehungszeit beschäftigt und sich vergleichbare Häuser angesehen, damit es am Ende möglichst originalgetreu dastand und genauso hübsch aussah wie die anderen Gebäude am Platz.
»Gute Nacht, Haus«, flüsterte sie so leise, damit Cory es nicht hörte und sie nicht für endgültig übergeschnappt hielt. »Inzwischen haben wir bloß noch uns. Ich darf in meinem Alter kaum mehr auf etwas Aufregendes hoffen.«
Sie gab sich einen Ruck. In den düsteren Tagen nach Laurences’ Tod hatte sie sich mit aller Macht gegen das Selbstmitleid gewehrt, und auch jetzt würde sie es nicht zulassen. Kopf hoch, sie durfte und würde sich nicht hängen lassen. Wer wusste schon, was das Leben für einen trotz allem bereithielt.
Sal stand in der Eagleton Road und wartete vergeblich auf ein Taxi. Sie wusste, dass sie sich diese Ausgabe lieber sparen sollte, denn sie konnte sie nicht als Spesen abrechnen. Was für ein Unterschied zu den Boomjahren in der Zeitschriftenbranche, als man sich problemlos sämtliche Kosten erstatten ließ. Damals zahlte der große Ernährer, das Euston Magazine, einfach alles. Ohne mit der Wimper zu zucken. Mittlerweile sah es in der Medienlandschaft fast so trostlos aus wie in Sibirien. Außerdem arbeitete Sal nicht für das Flaggschiff des Verlags, sondern für ein Beiboot: ein hübsches, wenngleich weniger auflagenstarkes Lifestylemagazin.
Missmutig steuerte Sal auf die U-Bahn-Station zu. Nicht jedoch, ohne ihr Lieblingsspiel zu spielen: Wenn ein Taxi vorbeikam, war es Schicksal. Dann musste sie hineinspringen, selbst wenn sie fast schon am Bahnhof angekommen war. Schließlich durfte man sich dem Schicksal nicht widersetzen, lautete ihre Maxime.
Allerdings schummelte Sal insofern, als sie auf für einen Fußmarsch völlig ungeeigneten High Heels betont langsam dahinstolperte. Mit solchem Schuhwerk fuhr man Taxi und mied die Straßen nach Möglichkeit. Kein Mensch, insbesondere nicht der Designer, erwartete von der Trägerin, dass sie darin einen holperigen Gehweg entlangstakste.
Tatsächlich war das Schicksal ihr hold, denn ein freies Taxi näherte sich ihr. Sie hielt es an und ließ sich in die Polster sinken mit der Erleichterung eines Flüchtlings, dem es gelungen ist, das letzte Flugzeug aus einem Krisengebiet zu erreichen.
»Middlebridge Crescent, bitte.«
Und los ging es in Richtung einer eher bescheidenen Gegend in North Kensington, wo Sal vor dreißig Jahren eine Wohnung ergattert hatte. Die Nähe zum schicken, angesagten Viertel Notting Hill hatte die vier Zimmer gleich viel attraktiver gemacht, als sie es objektiv betrachtet waren.
Obwohl Sal wie der Inbegriff der erfolgreichen Karrierefrau wirkte, sah die traurige Wahrheit anders aus: Für einige Bereiche des Lebens fehlte ihr schlichtweg das Talent. Dazu gehörten so profane, wenngleich nicht unwichtige Dinge wie Bausparverträge, Rentenversicherungen und Geldanlagen. Kleinkram wie dieser beflügelte sie einfach weniger als Outletverkäufe, Gratisgutscheine für schicke Schönheitsfarmen und die London Fashion Week – alles Dinge, die Sals Herz höherschlagen ließen.
Sie bezahlte den Taxifahrer und war gerührt, dass er wartete, bis sie wohlbehalten die Vortreppe ihres Hauses hinaufgestiegen war – für den Fall, dass sich ein hinterhältiger Straßenräuber dort versteckt halten sollte.
»Gute Nacht, Miss«, rief er.
Sowohl er als auch sie wussten, dass es sich bei dieser familienstandstechnisch zwar korrekten Anrede um eine plumpe Schmeichelei handelte. Als ob sie jung genug wäre, mit »Miss« angeredet zu werden!
»Gute Nacht«, erwiderte sie und öffnete die grau gestrichene Haustür.
Seltsam, dass graue Haustüren neuerdings bei Backsteinhäusern der letzte Schrei zu sein schienen. Jede andere Farbe galt plötzlich als out. Was Haustüren anging, war Grau nicht bloß das neue Schwarz, sondern offenbar ebenso das neue Rot, Grün und Blau.
Zitternd vor Kälte, drehte sie den Schlüssel im Schloss und genoss die angenehme Wärme der Zentralheizung, die ihr entgegenschlug. Was zweifellos nicht so verlockend war wie die Umarmung eines Geliebten, dafür um einiges kostengünstiger im Betrieb und außerdem weniger launisch.
Schon wieder Oktober. Kaum zu fassen. Bei der Erinnerung an das Foto von den vier Freundinnen lächelte sie, um gleich darauf bei dem Gedanken zusammenzuzucken, wie viele Jahre seitdem vergangen waren. Nie hätte sie damals damit gerechnet, sich Jahrzehnte später in einer Situation wie der jetzigen wiederzufinden. Allein wohnend und finanziell auf sich selbst gestellt, der Lebensstandard abhängig von den Launen eines Maurice Euston und seiner Tochter Marian, die vor Kurzem zur Geschäftsführerin befördert worden war.
Als sie sich auf ihr auberginefarbenes Sofa setzte und die unbequemen hochhackigen Schuhe auszog, fiel ihr schlagartig ein, dass die Weihnachtsausgabe in wenigen Wochen herauskommen würde. Natürlich lag der Redaktionsschluss bereits viele Monate zurück. Die Kinder auf den Fotos, die sich in ihren niedlichen Pyjamas um den Weihnachtsbaum scharten, hatten sich während einer Hitzewelle halb tot geschwitzt.
Dennoch war und blieb Sal eine treue Anhängerin der Illusion. Selbst wenn man ein bisschen schwindeln musste, um der Fantasie auf die Sprünge zu helfen. Sal hatte nie zu zynischen Anwandlungen oder Langeweile geneigt oder das Bedürfnis gehabt, einem verunsicherten jungen Journalisten die Worte Ach, du meine Güte, diesen Vorschlag habe ich schon hundertmal gehört! entgegenzuschleudern. Sal liebte Zeitschriften. Aufgewachsen in einer Sozialsiedlung in Carlisle, im äußersten englischen Nordwesten an der Grenze zu Schottland, hatte sie als junges Mädchen kein Geld gehabt, um sich die begehrten Hochglanzmagazine zu kaufen, und deshalb so viele wie möglich beim Frisör verschlungen. Immer am Dienstagnachmittag, wenn ihre Mutter sich zum Vorzugspreis die Haare waschen und legen ließ. Für sie waren die Zeitschriften im Salon wie ein kostbares Geschenk, das für eine begrenzte Zeit ihr alleine gehörte. Verlangend betrachtete sie das schimmernde Papier, das ihr bestreut zu sein schien mit Sternenstaub, der aus der Glitzerwelt der Prominenz herabgeregnet war. Bestimmt machten sie Millionen von Menschen Freude, dachte sie damals. Nun, vielleicht nicht Millionen, aber Tausenden bestimmt.
Diese Einstellung hatte Sal nie verloren.
Bis auf den heutigen Tag liebte Sal es, eine Zeitschrift zur Hand zu nehmen und durchzublättern. Undenkbar, stattdessen die Artikel auf dem iPad anzuklicken oder sie online zu konsumieren. Allerdings wusste sie, dass man mit der Zeit gehen musste und die elektronischen Varianten nicht vernachlässigen durfte. Weshalb sie sich ungeachtet der Tatsache, dass es ihrem Geschmack zuwiderlief, im Verlag für eine stärkere Berücksichtigung der neuen Medien eingesetzt hatte.
Während sie sich einen grünen Tee aufbrühte, dachte sie darüber nach, ob sie sich nicht trotz ihrer Leidenschaft für den Beruf der Journalistin zu sehr von der Zeitschrift und ihrem Job vereinnahmen ließ und auf dem besten Weg war, vollends zum Workaholic zu mutieren. Schließlich gab es noch andere Interessen und Dinge, an denen ihr Herz hing und die gepflegt werden wollten.
Oder?
Laura parkte in der Auffahrt ihres hübschen Vorstadthauses. Sie hatte nur zwei kleine Gläser Wein getrunken, um unter der Promillegrenze zu bleiben, denn sie fuhr nicht gerne mit dem Bus oder mit der U-Bahn. In ihrem Auto konnte sie sich fühlen, als hätte sie den schützenden Kokon ihres Zuhauses niemals verlassen.
Und genau das gefiel ihr.
Natürlich konnte man dagegenhalten, dass es in der U-Bahn viel interessanter sei. Die vielen Menschen unterschiedlicher Nationalitäten. Leute, die Bücher, E-Books und Anzeigenblätter lasen oder auf ihren Smartphones herumspielten. Und die modische Vielfalt, die es zu bestaunen gab. Das alles machte Laura Spaß. Nicht aber die Bettler, die einem irgendwelche Geschichten auftischten. Oder die streitlustigen Betrunkenen mit ihren lautstarken Selbstgesprächen. Auch nicht die müden, erschöpften Menschen, die von der Arbeit kamen und bei ihr ein schlechtes Gewissen auslösten, weil sie selbst ein sorgenfreies Leben führte.
Obwohl sie es gemein fand, so zu denken, hatte sie sich heute den Freundinnen überlegen gefühlt. Weil ihr als Einziger das absolute Glück im Leben vergönnt war. Ella stand nach einer harmonischen Ehe plötzlich als Witwe da, und bei Sal drehte sich alles ständig allein um sie selbst, aller Wahrscheinlichkeit nach der Grund für ihr Singledasein. Und Claudia klagte ständig, was für ein Traumtänzer ihr Mann sei. Seelenverwandte waren sie jedenfalls nicht.
Ganz im Gegensatz zu ihr und Simon.
Laura war stolz darauf, wie sehr ihr Mann sie und ihr gemeinsames Zuhause liebte, und fühlte sich dementsprechend wunschlos glücklich. Nichts ging über Simon, und sie ließ nichts auf ihn kommen. Und sie wusste, dass er für sie genauso empfand.
Eigentlich stellten ihre Kinder den einzigen Zankapfel zwischen ihnen dar. Als Bella die Goth-Subkultur für sich entdeckte, war Simon ausgerastet. Und das Umfärben ihres seidig blonden Haares zu einer pechschwarzen Mähne hatte ihm beinahe Tränen in die Augen getrieben. Laura, wenngleich es ihr nicht gefiel, empfand so etwas wie Bewunderung für die Tochter. Sie selbst kleidete sich schrecklich langweilig und hätte manchmal gerne mehr Mut bewiesen. Bella brachte ihn auf mit ihren bizarren Kostümierungen, in denen sie bisweilen wie die Heldin eines Horrorstreifens aussah. Außerdem war es vermutlich ein unbewusster Protest gegen die Eltern, die Gesellschaft und weiß Gott was.
Auch Sam, der stille Heavy-Metal-Fan, hatte so seine Probleme. Bei aller Liebe betrachtete sein Vater ihn in gewisser Weise als herbe Enttäuschung, weil er sich so ganz anders entwickelte als er selbst. Simon war dermaßen erfreut über die Geburt des Sohnes gewesen, dass er es übertrieb und ihn schon als Baby bei Fußballspielen neben sich vor den Fernseher setzte. Mit dem Ergebnis, dass Sam Fußball sowie Sport jeglicher Art wie die Pest zu hassen begann.
Obwohl es manchmal anstrengend sein konnte, fand Laura es schön, dass beide Kinder nach wie vor zu Hause wohnten. Ein Zuhause und eine Familie waren für sie ein und dasselbe. Zugegebenermaßen hing sie nicht zuletzt deshalb so an ihren Kindern, weil es lange gedauert hatte, überhaupt schwanger zu werden. Manchmal war sie kurz davor gewesen, aufgeben zu wollen. Vor allem Simon hatte die ganze Angelegenheit, die Achterbahn der Gefühle aus Hoffnungen und Enttäuschungen, die mit einer künstlichen Befruchtung einhergingen, über Gebühr belastet.
Viel mehr als sie.
Und dann, mit vierzig, klappte es endlich. Sie wurde mit Bella schwanger. Solange Laura lebte, würde sie den positiven Schwangerschaftstest nie vergessen. Diese Erleichterung, dieses Glücksgefühl. Und um ihre Welt komplett zu machen, war zwei Jahre später Sam gekommen. Seit die Kinder da waren, widmete sie sich ausschließlich ihnen, um ihnen eine geborgene und harmonische Umgebung zu bieten. Sie hatte es genossen, zu Hause zu sein, wenn sie aus der Schule kamen und Hallo, Mum, ich bin da riefen. Jetzt waren sie zwar erwachsen, ließen sich aber dennoch gerne verwöhnen.
Ja, sie konnte sich glücklich schätzen, dachte sie und ging nach oben. In ihr Schlafzimmer, das ganz ihrem Geschmack und ihren Ansprüchen an einen solchen Raum entsprach. Weiche Teppiche, gestärktes weißes Leinen, eine Vase voller Rosen. Nur die Kälte störte sie. Simon als ehemaliger Internatszögling bevorzugte es, bei geöffnetem Fenster zu schlafen, was außer den Kindern zu den wenigen Streitpunkten gehörte. Zum Glück schlief er wie ein Stein, und so schloss sie abends heimlich das Fenster, um es morgens wieder zu öffnen, bevor er aufwachte.
Als sie ins Bett schlüpfte, murmelte Simon etwas und warf sich herum. Vielleicht war er ja in zärtlicher Stimmung, doch er drehte sich sogleich wieder um, ohne die Augen zu öffnen.
Na ja, blieb wenigstens das Bett sauber.
Heute Morgen erst hatte sie alles frisch bezogen. Laura liebte saubere Bettwäsche, sie hatte etwas Verführerisches. Weniger schätzte sie es indes, wenn die inspirierenden Laken und Bezüge durch Sex schmutzig wurden, und so war sie über sein mangelndes Interesse nicht sonderlich betrübt. Sowieso spielte sich nicht mehr allzu viel zwischen ihnen ab. Simon verhielt sich liebevoll und aufmerksam, da gab es nichts zu bemängeln, aber Annäherungsversuche unternahm er höchst selten.
Sie überlegte gelegentlich schon, ob er vielleicht Viagra brauchte.
»Man muss eine Ewigkeit warten, bis es wirkt«, hatte Susie, ihre Tennispartnerin, sie gewarnt. »Ganz zu schweigen davon, dass du ihm pausenlos einen runterholen musst wie eine Nutte, falls er das nicht selber tut. Dann, du bist fast eingeschlafen, bohrt sich dir plötzlich sein Ständer in den Hintern. Und wenn das Ding erst mal steht, dann hält das mehrere Stunden an.«
Animiert von diesem Bericht stellte Laura sich ein erotisches Puppenspiel vor, bei dem der Kasper seinen Schniedel statt der üblichen Klatsche benutzte und dabei Auf los geht’s los johlte.
Im Großen und Ganzen war sie jedenfalls eher froh, dass Simon tief und fest schlief.
Kapitel 2
»Hallo, Kind, bist du es?«
Claudias Mutter Olivia hatte die Angewohnheit, ins Telefon zu schreien, als wäre nicht sie selbst schwerhörig, sondern ihre Tochter. Allerdings fand Claudia, dass einem mit über achtzig das Recht auf ein paar Marotten zustand. Nur dass Olivia eine ganze Menge davon hatte.
»Ja, Mum. Wie geht es dir?«
»Heute Morgen habe ich solche Gliederschmerzen. Ich brauche mittlerweile über eine halbe Stunde und ein heißes Bad, bis ich in die Gänge komme. Lass dir einen guten Rat geben, Kind: Werde bloß nicht alt.«
»Ich tue mein Bestes. Und wie fühlt Dad sich?«
»Nicht schlecht angesichts der Alternativen.« Der Standardwitz ihres Vaters, wenn sich jemand nach seinem Befinden erkundigte. »Hör zu, Kind. Ich rufe wegen Weihnachten an.«
»Klar.« Claudia bekam prompt ein schlechtes Gewissen. Ihrer Mutter war es wichtig, Weihnachten so früh wie möglich unter Dach und Fach zu bringen. Meistens schon am ersten Feiertag des Vorjahrs. »Kommt ihr wieder her, oder?«
»Nein, Schatz, dieses Jahr wird leider nichts draus.«
»Ihr kommt nicht?« Claudia verstand die Welt nicht mehr. An Weihnachten kreuzten sie doch sonst immer auf. »Was wollt ihr stattdessen machen?«
»Wir hatten an Istanbul gedacht.«
»Istanbul? Warum Istanbul?«, fragte Claudia verwundert.
»Ich habe im Internet ein interessantes Angebot entdeckt. Außerdem hat Dad die Nase voll von unserem Vikar und ihm unter die Nase gerieben, wir würden diesmal islamische Weihnachten feiern. Einfach um ihn zu ärgern.«
Claudia lachte. Sie liebte ihren Vater. Den Vikar hingegen nicht, der einer von den ganz besonders Frommen war. »Feiern die in Istanbul überhaupt Weihnachten?«
»Offenbar gibt es eine reizende kleine christliche Kirche mitten in der Stadt, behauptet dein Vater zumindest. Und er hat es sich in den Kopf gesetzt zu beobachten, wie drei Boote am Weihnachtsmorgen den Bosporus entlangsegeln. Wie in dem Kinderreim. Offenbar wimmelt es an diesem Tag dort von Schiffen. Es soll ein beeindruckender Anblick sein.«
»Aha.« Das passte, wie sie zugeben musste, zu ihrem Vater. Schiffe waren seine Leidenschaft. »Wann fliegt ihr denn? Vielleicht sollten wir eine Vorweihnachtsfeier ins Auge fassen.«
»Klingt gut«, meinte ihre Mutter zögernd, und Claudia hörte den zweifelnden Unterton. »Wir sind allerdings ziemlich beschäftigt.«
Wie sie ihre Eltern kannte, war das eine glatte Untertreibung. Olivia und Len hatten einen um einiges größeren Freundeskreis als Claudia selbst. Ihr Leben schien ein Wirbel aus Bridgeabenden, Quizveranstaltungen und Dinnerpartys zu sein. Mit anderen Worten: Ihre Eltern hatten Zeit für all die Dinge, die Claudia ebenfalls gern unternommen hätte, zu denen sie aber nie kam. Olivias neuestes Hobby bestand darin, im Internet nach speziellen Offerten wie Restaurantgutscheinen, Angeboten für Wellnesstage und Ausflüge in Gartencenter zu suchen, die auf weißhaarige Onlinesurfer zugeschnitten waren. Claudia hatte ihre Mutter einmal zu einem Drei-Gänge-Menü mit Champagner begleitet, das ausschließlich von einer angegrauten Rollatorklientel besucht wurde. Das Essen selbst war grottenschlecht gewesen. Was Olivia indes nicht groß störte. »Ich weiß, Schatz, dafür kostet es schließlich gerade mal die Hälfte«, hatte sie völlig ernst und ohne den Hauch von Ironie gesagt.
»Gaby wird enttäuscht sein, wenn wir gar nichts Weihnachtliches mit euch machen«, hakte Claudia nach.
»Am Montag, dem Sechzehnten, hätten wir abends Zeit, falls dir das passt«, schlug Olivia großzügig vor. »Bestimmt finde ich irgendwo ein Weihnachtsangebot.«
»Nein, nein, ich koche etwas.«
»Wirklich, Kind? Willst du dir so viel Mühe machen?«
Olivia klang wenig überzeugt. Seit sie die Restaurantwerbung im Internet mit Gratisbesuchen und Schnäppchenpreisen entdeckt hatte, fand sie Kochen ziemlich überflüssig. Und bedrückt dachte Claudia einen Moment lang daran, dass ihre Mutter sich vermutlich besser im Internet zurechtfand als sie selbst.
Nach einigem Hin und Her und langwierigen Diskussionen, wie viel Zeit ihre Eltern trotz des vollen Terminkalenders an diesem Abend opfern könnten, einigten sie sich schließlich auf Claudias Vorschlag.
Am Ende unterbreitete Olivia ihrer Tochter noch einen besonderen Vorschlag. »Ihr könntet Weihnachten ja hier in Surrey verbringen – falls ihr mal einen Tapetenwechsel braucht. Ihr hättet das Haus ganz für euch. Gaby gefällt es sicher.«
»Danke, Mum«, erwiderte Claudia ein wenig zu schnell.
Nicht Gaby würde es gefallen, sondern Don. Sie sah es bereits deutlich vor ihrem inneren Auge. Er würde einen geradezu missionarischen Eifer entwickeln und sich nur vor den Schaufenstern von Immobilienmaklern herumdrücken.
Nach dem Telefonat saß Claudia am Küchentisch und dachte über ihre Mutter nach. Sie fand Olivias Verhalten ein wenig seltsam, obwohl sie es nicht richtig in Worte fassen konnte. Eigentlich spürte sie bloß intuitiv, dass etwas nicht stimmte. Wie sie sich begeistert auf all diese Angebote stürzte, darin lag fast etwas Manisches. Eine überschwängliche Atemlosigkeit, eine überdrehte Aufgeregtheit, was Claudia angesichts von Wellnessangeboten und Ausflügen zum Gartencenter ziemlich übertrieben vorkam.
Ihre Grübeleien wurden jedoch unterbrochen durch Gaby, die völlig niedergeschlagen von der Arbeit nach Hause zurückkehrte und gleich ihren Kummer loswerden musste. Ihr derzeitiger Freund hatte ihr erklärt, er brauche für eine Weile Abstand.
»Glaubst du, es ist vorbei, Mum?«
Gaby sah ihre Mutter unglücklich an, und die verschmierte Wimperntusche zeugte vom Ausmaß der Beziehungskatastrophe. Angesichts der schwarzen Elendsbäche, die ihr die Wangen hinunterrannen, wurde Claudia von heftigem Mitgefühl ergriffen und verzichtete auf eine ehrliche Antwort. Statt also zu sagen: Ja, es ist vorbei, beschränkte sie sich aufs Zuhören. Gaby hatte, ähnlich wie in beruflicher Hinsicht, auch in puncto Männer kein glückliches Händchen. Sie fiel immer wieder auf ältere Männer rein, die ihr zuerst den Kopf verdrehten, um ihr danach mit schöner Regelmäßigkeit das Herz zu brechen.
Claudia befürchtete schon, es könnte sich um einen Erziehungsfehler handeln. Nette, normale Männer interessierten Gaby nicht, ausschließlich die schwierigen und unerreichbaren. Vielleicht lag es ja daran, dass sie sich als Einzelkind in eine Erwachsenenwelt hatte einfügen müssen. Bereits mit achtzehn tendierte sie eher zu Fünfundzwanzigjährigen als zu gleichaltrigen Jungs.
Claudia umarmte sie tröstend.
Erst die Probleme der Mutter, jetzt die Sorgen der Tochter. Das war der Preis dafür, dass man in den wilden Sechzigern das Kinderkriegen so lange wie möglich hinausgeschoben hatte. Nun gehörte man zur Sandwichgeneration und hatte gleichzeitig die Eltern wie die Kinder am Hals.