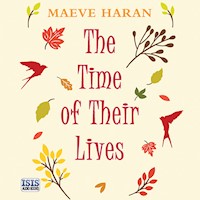9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Frauen und drei romantische Abenteuer mit jeder Menge Turbulenzen!
Eigentlich hält sich Catherine Hope für eine sturmerprobte Mutter mit liberalen Erziehungsmethoden – bis ihre 18-jährige Tochter Rachel plötzlich beschließt, sich statt auf das Abitur auf den Verlust ihrer Jungfräulichkeit vorzubereiten. Und als Großmutter Lavinia auch noch zu einer Bürgerinitiative überläuft und mit ihrer großen Jugendliebe einen zweiten Frühling feiert, gerät die Welt der Familie Hope endgültig aus den Fugen…
Mit ihren turbulent-witzigen Geschichten über die Liebe, Freundschaft, Familie und die kleinen Tücken des Alltags erobert SPIEGEL-Bestsellerautorin Maeve Haran die Herzen ihrer Leser im Sturm!
»Maeve Haran erweist sich immer wieder als Spezialistin für locker-amüsante Geschichten mit Tiefgang!« Freundin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Eigentlich hält sich Catherine Hope für eine sturmerprobte Mutter mit liberalen Erziehungsmethoden – bis ihre 18-jährige Tochter Rachel plötzlich beschließt, sich statt auf das Abitur auf den Verlust ihrer Jungfräulichkeit vorzubereiten. Und als Großmutter Lavinia auch noch zu einer Bürgerinitiative überläuft und mit ihrer großen Jugendliebe einen zweiten Frühling feiert, gerät die Welt der Familie Hope endgültig aus den Fugen …
Autorin
Maeve Haran hat in Oxford Jura studiert, arbeitete als Journalistin und in der Fernsehbranche, bevor sie ihren ersten Roman veröffentlichte. »Alles ist nicht genug« wurde zu einem weltweiten Bestseller, der in 26 Sprachen übersetzt wurde. Maeve Haran hat drei Kinder und lebt mit ihrem Mann in London.
Von Maeve Haran bereits erschienen
Liebling, vergiss die Socken nicht · Alles ist nicht genug · Wenn zwei sich streiten · Ich fang noch mal von vorne an · Schwanger macht lustig · Und sonntags aufs Land · Scheidungsdiät · Zwei Schwiegermütter und ein Baby · Ein Mann im Heuhaufen · Der Stoff, aus dem die Männer sind · Schokoladenküsse · Mein Mann ist eine Sünde wert · Die beste Zeit unseres Lebens · Das größte Glück meines Lebens · Der schönste Sommer unseres Lebens
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Maeve Haran
Und sonntags aufs Land
Roman
Deutsch von Ariane Böckler
Die Originalausgabe erschien 1999 unter dem Titel »Soft Touch« bei Little, Brown and Company,
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright dieser Ausgabe © 2020 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright der Originalausgabe © 1999 by Maeve Haran
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 1999 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Buchgewand Coverdesign | www.buch-gewand.de unter Verwendung von Motiven von depositphotos.com: © mala-ma, © MalyDesigner, © Kotkoa, © adrenalina, © PicsFive
DN · Herstellung: sam
ISBN978-3-641-26303-4V001
www.blanvalet.de
Für meine geliebte Schwester Rosaleen
und für meine Töchter
Georgia und Holly,
die sich garantiert nie und nimmer
zu aufsässigen Teenagern entwickeln werden
Ich möchte mich bei folgenden Personen für ihre geistreichen und scharfsinnigen Beobachtungen über das Leben mit einem Teenager und über andere Aspekte dieser Geschichte bedanken:
Yvonne Roberts, Barbara Toner, Angela Neustatter, Lyndsey Bareham, Claire L’Enfant, Tony Cohen, Rusty Haran, Pat Boyer, Nigel Thomas und John Vidal vom Guardian für seine wertvollen Informationen über Umweltschützer.
Und natürlich bei meiner Agentin und Freundin Carole Blake und bei Imogen Taylor, meiner Lektorin und Freundin.
Ich glaube, ich werde für die nächsten acht Jahre ausziehen.
1. Kapitel
Catherine Hope, neununddreißig Jahre alt und meist verantwortungsbewusster, als ihr guttat, lauerte in den dichten Büschen vor der Wolsey-Mädchenschule und wartete. Die Schule lag zwar in einer üblen Gegend Nord-Londons, konnte aber auf glanzvollere Zeiten zurückblicken und war von einem weitläufigen Parkgelände umgeben, das zu Catherines Glück ausreichend Sichtschutz bot.
So musste man sich als Paparazzi fühlen oder, um pedantisch zu sein (ein weiterer von Catherines Fehlern, wie ihr Mann behauptete), als Paparazzo. Und sicher wäre kein Paparazzo von der Auswahl an erblühender weiblicher Jugend enttäuscht gewesen, die aus Wolseys Toren strömte.
Obwohl schon Winter und nur noch wenige Wochen bis Weihnachten, bestand der Wolsey-Look aus einem winzigen Minirock, der unterhalb des braunen Schulblazers kaum zu erkennen war (natürlich hätten sie Wintermäntel tragen müssen, aber welche Mutter würde sich diesen Stress antun, wo man heutzutage schon froh sein musste, dass sie überhaupt noch die Uniform anzogen), einer überdimensionalen Strickjacke, dicken braunen Strümpfen und klobigen Riesenschuhen.
Der einzige Hinweis auf akademisches Potential, das Eltern in der Hoffnung, ihre Töchter an dieser Schule unterbringen zu können, von meilenweit weg hierherziehen ließ, war die Schultasche, die jedes Mädchen bei sich hatte, prall gefüllt mit Hausaufgaben für zwei Stunden, dem Anlass für zahlreiche erbitterte Streitereien mit den Eltern, ob sie vor oder nach EastEnders angegangen würden.
Catherine wusste, dass sie eigentlich nicht hier sein dürfte. Und erst recht sollte sie nicht in den Büschen lauern, sondern in sicherer Entfernung dort, wo sie selbst unterrichtete, Arbeitsblätter korrigieren, an einer Schule, die geographisch gesehen nur zwei Meilen weit weg lag, aber in puncto Privilegien Kontinente entfernt. Ihre Tochter Rachel würde sie umbringen, wenn sie erführe, dass sie hier war. Doch im Grunde war Rachel selbst daran schuld. Ein halbes Jahr vor dem Abitur, den Studienplatz in der Tasche, falls der Notendurchschnitt reichte, hatte Rachel sich in einen Alptraum von Tochter verwandelt, weigerte sich, ihre Hausaufgaben zu machen, verschwand bei der erstbesten Gelegenheit spurlos und lief in Klamotten herum, neben denen die Spice Girls geradezu dezent wirkten. Das Schlimmste war allerdings, wie sie ihre Mutter behandelte – nämlich mit der Art von Verachtung, die normalerweise Politessen und Päderasten Vorbehalten ist.
Catherine hatte die Nase voll. Konfrontation hatte nichts bewirkt. Vernunft war verlacht worden. Das Einzige, was nun noch blieb, war miese Hinterlist.
Der Gehsteig war mittlerweile voller Menschen, in erster Linie gutsituierte Mütter, die eindeutig nicht zu arbeiten brauchten, und gelegentlich ein versprengter Vater. Wie üblich war die Luft geschwängert von der elterlichen Paranoia, das Kind anderer Leute könnte die Erfolgsleiter womöglich schneller erklimmen als das eigene.
»Miranda hat einen Studienplatz in Oxford angeboten bekommen«, prahlte eine Mutter.
»Eleanor hat denen abgesagt«, entgegnete eine andere. »Archäologie wird nur in Manchester ordentlich gelehrt, meint sie. Wo verbringt Miranda denn ihr Überbrückungsjahr?«
Bevor Catherine die Antwort auf diese brennende Frage erfuhr, lehnte sie sich unklugerweise vor und spießte sich dabei selbst an dem Stacheldraht auf, der Eindringlinge abhalten sollte und im Efeu verborgen war. Vor Schmerz aufjaulend, stolperte sie aus den Büschen und vor die erstaunten Blicke von Eltern, Schülern und – was am schlimmsten war – Rachels bester Freundin Stephanie.
»Ah, Mrs. Hope.« Rachels Klassenleiterin stürzte sich aus der abendlichen Dämmerung auf sie, offenbar ohne die unorthodoxe Art ihres Auftauchens zu bemerken. »Genau Sie wollte ich sprechen. Was machen denn Rachels Zähne?«
»Ihre Zähne?« Soweit Catherine wusste, waren Rachels Zähne einer der wenigen Aspekte an ihrer Tochter, die ihr keine Sorgen bereiteten. Ihr kleiner Bruder Ricky hatte die Probleme. Rachels Zähne waren perlweiß und makellos wie in der Zahnpastawerbung.
»Ja«, plapperte die Frau weiter. »Sie ist wegen ihres Termins beim Kieferorthopäden extra früher gegangen.«
Catherine fluchte unhörbar. Ricky hatte heute Nachmittag einen Termin beim Kieferorthopäden, nicht Rachel. Das kleine Luder.
»Offen gestanden«, fuhr ihre Lehrerin fort, »bin ich ein bisschen beunruhigt wegen Rachel. Ein so kluges Mädchen, aber ich fürchte, sie ist mit ihren Gedanken nicht bei der Arbeit. Es gibt doch wohl zu Hause keine Probleme, oder?« Mit der Begeisterung eine Sexualtherapeutin, die den dringenden Verdacht auf vorzeitigen Samenerguss hegt, beugte sie sich zu Catherine hinüber.
»Nein, nein«, erwiderte Catherine hastig und verdrängte rasch den morgendlichen Streit wegen der Kleieflocken und die zunehmenden Spannungen zwischen ihr und ihrem Mann Christopher. Spannungen, die einzig und allein von Rachel ausgelöst wurden. Man sollte Anstecker drucken: Teenager schaden Ihrer Ehe. Die wären ein Verkaufsschlager.
»Gut.« Die Lehrerin lächelte aufmunternd. »Jetzt dauert es ja nicht mehr lange. Nächsten Monat sind Probeexamen. Schreckliches System, ich weiß. Dabei werden nur die getestet, die sich mit Prüfungen leichttun. Aber Rachel hat darin doch immer geglänzt, oder nicht?«
Während sie verstohlen ihr von Blättern verunziertes Haar betastete, lächelte Catherine den umstehenden Eltern zu. Vielleicht hatten sie gar nicht bemerkt, dass sie sich im Gebüsch versteckt hatte.
»Entschuldigen Sie bitte, Mrs. Hope.« Es war Stephanie, Rachels beste Freundin. Ihr Tonfall war brav und hilfsbereit, doch in ihren Augen glänzte bereits die Vorfreude darauf, Rachel alles haarklein zu schildern, sobald es menschenmöglich war. »Wussten Sie, dass Ihr Rock hinten ein großes Loch hat?«
»Hi, Mum!« Ricky rannte ihr auf dem Gartenweg entgegen und sah ganz selbstverliebt drein. Er war knapp elf Jahre alt, hatte weich fallendes braunes Haar, das sie mit Begeisterung streichelte, obwohl er das nur erlaubte, wenn niemand zusah, ein breites Grinsen und eine Nickelbrille.
»Hallo, mein Lieber. Wo ist Gran?« Catherines vornehme Schwiegermutter Lavinia hatte sich bereit erklärt, ihn zum Kieferorthopäden zu bringen. Manchmal war es den Nutzen nicht wert, Lavinia um einen Gefallen zu bitten. »Hast du deine Spange angepasst bekommen?«
»Gran ist nach Hause gefahren. Du wolltest doch schon Stunden früher kommen. Sie meinte, sie verpasst sonst ihr Bridge.« Ricky sperrte den Mund auf und enthüllte einen Kiefer voller Metall – Eisenbahnschienen nicht unähnlich.
»Guter Gott, Ricky! Warum um Himmels willen ist die Spange denn rot-weiß?«
Ricky grinste. »Die Farben von Arsenal, Dussel. Ich habe gesagt, sonst würde ich sie nicht tragen.«
»Und was hat Gran dazu gemeint?« Sie konnte sich die Miene ihrer Schwiegermutter nur allzu gut vorstellen. »Sie hat gesagt, das wäre wohl immer noch besser als diese scheußlichen vorstehenden Zähne, die ich jetzt habe.«
Das war Lavinia in Reinkultur. Bloß nicht hinterm Berg halten, wenn man eine sarkastische Bemerkung anbringen konnte. Catherine versuchte, sich damit zu trösten, dass Lavinias Generation einfach anders war. Sie hielten es für richtig, Kinder niederzubügeln, damit sie nicht hochnäsig wurden, statt sie auch noch aufzubauen, wie es ihre Generation tat.
Lavinia fand die Strategie ihrer Schwiegertochter, ihren Kindern bei jeder Gelegenheit zu sagen, wie wunderbar sie seien, exzentrisch, ja schon fast gefährlich. »Was passiert denn, wenn sie erwachsen werden und die Welt nicht deiner Meinung ist?« fragte Lavinia oft.
Catherine hoffte, ihre Kinder wären bis dahin selbstbewusst genug, um sich nicht darum zu scheren, was andere dachten. Das einzige Problem war, dass Rachel bereits jetzt zu viel Selbstbewusstsein an den Tag zu legen schien. Aber vielleicht passte ja Wallis Simpsons berühmter Ausspruch auch auf dieses Gebiet. Man konnte niemals zu dünn oder zu reich sein – oder zu selbstbewusst.
Hinter ihr donnerte die Haustür ins Schloss, und Catherine spürte, wie sich ihr Magen verkrampfte. Woran lag es, dass sie zwar mit einer Klasse Zehnjähriger zurechtkam, diejenigen eingeschlossen, die unter das übliche »Guten Morgen« ein paar »Leck-michs« schmuggelten, aber nicht mit ihrer eigenen Tochter? Bei Rachel brauchte man wirklich das Geschick eines UN-Unterhändlers. Am liebsten hätte Catherine Jassir Arafat und Gerry Adams mit Rachel in einem Raum eingeschlossen und abgewartet, ob diese beiden mehr Erfolg als sie selbst dabei hatten, sie zum Wiederholen ihres Lernstoffs zu bewegen.
»Hallo, Rach, bist du das?« rief sie.
Sie wusste, dass es Rachel war. Niemand sonst schlug die Tür dermaßen zu, dass die Fenster klirrten. Ricky und sie lauschten aus der heimeligen Geborgenheit der im Souterrain gelegenen Küche dem Bumsen von Rachels klobigen Stiefeln auf dem gebohnerten Parkett der Diele. In Catherines Ohren klang sie wie der Tyrannosaurus Rex von Rickys CD mit Dinosauriereffekten. Rachel hatte tatsächlich viel mit einem halbwüchsigen T. Rex gemein. Bestimmt streiften beide auf der Suche nach Nahrung umher, verputzten locker einen Wochenvorrat an Kartoffelchips mit Salz-und-Essig-Geschmack, Pizza-Snacks, Käsegebäck und alle möglichen anderen cholesterinhaltigen, nährstoffarmen Knabbereien, die sie finden konnten, und beschwerten sich dann bei ihren Müttern, dass nie etwas Leckeres zu essen im Haus war.
Schließlich erschien Rachel in der Tür. Die Haare wehten vom Laufen hinter ihr her, ihre Wangen waren gerötet, und ihre Augen blitzten vor gerechtem Zorn. Obwohl sie nur ungern daran erinnert wurde, ähnelte Rachel ihrer Mutter sehr. Beide hatten das gleiche üppige, lange, wellige Haar, von einer Farbe wie glänzende Kastanien, und tiefbraune Augen. »Mum …« Sie machte eine Kunstpause. »Wie konntest du nur? Wie konntest du mich vor der ganzen Schule dermaßen blamieren? Alle lachen mich aus.« Mit einer theatralisch-tragischen Geste ließ sie das Gesicht in die Hände sinken.
»Jetzt pass mal auf, junge Frau.« (Hatte sie das wirklich gesagt? Es klang nach O-Ton Lavinia.) »Zuerst musst du mir mal einiges erklären. Wie kommst du dazu, in deiner Schule zu erzählen, du müsstest zum Kieferorthopäden? Deine Lehrerin macht sich Sorgen um dich. Deine Leistungen lassen nach. Du konzentrierst dich nicht.«
»Ist das ein Wunder, wenn ich eine Mutter habe, die mich behandelt wie eine Zehnjährige, mir die ganze Zeit nachspioniert und andauernd wissen will, wohin ich gehe?« Sie reckte sich zu ihrer vollen Größe empor, mit der sie die ihrerseits hochgewachsene Catherine schon seit einigen Jahren um acht Zentimeter überragte und es dieser damit doppelt schwermachte, ihr auch nur den geringsten Hauch von Respekt abzuringen. »Steph darf hingehen, wo sie will. Ihre Eltern lauern ihr nicht im Gebüsch auf oder warten vor Partys, als wäre sie noch ein Kind.«
Catherine schäumte. Nichts wäre ihr lieber, als zu Hause bleiben zu dürfen, ins Bett oder aufs Sofa gekuschelt, statt in einem eiskalten Auto endlos darauf zu warten, dass Rachel irgendeine grauenhafte Fete am anderen Ende Londons verließ. Rachels Freunde mussten offenbar immer an der entgegengesetzten Ecke des Stadtplans wohnen. Das hieß außerdem, dass sich Catherine auf ein einziges Glas Wein beschränken und damit auch noch auf eine der wenigen Tröstungen verzichten musste, die einer Mutter bleiben, nachdem das gesellschaftliche Leben der Tochter schon lange das eigene überholt hat.
»Ist dir eigentlich klar, dass es nur noch fünf Monate sind, bis die Weichen für deine Zukunft gestellt werden?«
»Sechs, genauer gesagt. Aber wen kümmert schon das blöde Abi? Das sagt doch überhaupt nichts aus. Wolsey ist nichts als eine Wurstfabrik, die Prüfungsergebnisse ausspuckt, aber keine interessanten Menschen.«
Da Catherine diesen Spruch schon kannte, war sie klug genug, den Mund zu halten.
»Das Abi!«, schrie Rachel und kam langsam in Fahrt. »Das ist das Einzige, woran du denken kannst. ICH bin dir egal, dich kümmern nur meine Prüfungsergebnisse! Dir wäre es egal, wenn ich vor lauter Druck Selbstmord beginge, solange ich meine Noten kriege. Außerdem kann ich ja am Wochenende alles nachholen.«
»Nein, kannst du nicht.« Catherine wartete auf die atomare Explosion. »Wir fahren zu deiner Großmutter. Schon vergessen?«
»O mein Gott, das hat mir gerade noch gefehlt. Ein fades Wochenende bei Gran und nichts anderes zu tun, als ihr zuzuhören, wie sie über Bridge und den Pfarrer labert und zur Abwechslung hin und wieder eine missbilligende Bemerkung über die Manieren der heutigen Jugend einstreut. Toll.«
Im Grunde war ihre Mutter der gleichen Meinung, aber Christopher hatte Lavinia versprochen, dass sie fahren würden, und – wie Catherine ihnen allen immer wieder ins Gedächtnis rief – ab und zu musste man eben in Familie machen.
»Damit es uns allen stinkt, meinst du.« Zurzeit hatte Rachel einen Hang zu solchen Kommentaren. »Und nicht nur einer von uns.«
Catherine dachte an das, worauf die Ratgeber über den Umgang mit Teenagern pochten: Vergessen Sie nie, wer der Erwachsene ist.
Sie wollte Rachel gerade auf ruhige und erwachsene Weise empfehlen, in ihrem Zimmer zu verschwinden, wenn sie unbedingt Krach haben wollte, als Rachel ihre Schultasche nahm und hinausging.
»Ich gehe in mein Zimmer«, verkündete sie hoheitsvoll und entriss damit dem Arsenal ihrer Mutter auch noch diese schwache Waffe.
»Die erste Runde geht an Rach, würde ich sagen, Mum«, tönte Ricky.
»Pass bloß auf, sonst bist du der Nächste, der auf sein Zimmer geht.«
»Aber Mum«, erläuterte er hilfsbereit, »du willst doch sonst gar nicht, dass ich auf mein Zimmer gehe, weil ich sonst endlos im Internet surfe. Schon vergessen?«
Catherine ließ sich an den Siebziger-Jahre-Küchentisch aus Kiefernholz sinken und überlegte, ob es noch zu früh für ein Glas Wein war. Wie hatten die Kinder es nur in wenigen Jahrzehnten geschafft, sich von dem Ideal, nur sichtbar, aber nicht hörbar zu sein, zu den neuen Herren im Haus aufzuschwingen? Es kam ihr so verdammt unfair vor. Wie die anderen Mitglieder ihrer Generation war sie eingeschüchtert von den Blicken ihrer Eltern aufgewachsen, und jetzt, mit neununddreißig, schüchterten sie die Blicke ihrer Kinder ein. Wann waren sie eigentlich mal selbst an der Macht?
Sie machte sich daran, das Abendessen für die Familie zuzubereiten – eine weitere Institution, an der Catherine festzuhalten suchte, damit sie jeden Tag wenigstens fünf Minuten gemeinsam verbrachten. Aber natürlich funktionierte es nie, weil immer jemand für Rachel anrief, und wenn sie den Betreffenden baten, nach dem Essen noch einmal anzurufen, saß sie in vorwurfsvollem Schweigen da, weigerte sich, auch nur einen Bissen zu essen, und brachte es fertig, das Gespräch auf das Thema Magersucht zu lenken und einzuflechten, dass es meist die intelligenten Mädchen mit den anspruchsvollen Eltern waren, die die Krankheit bekamen.
Als sich Christophers Schlüssel im Schloss drehte, war die Lasagne fast fertig, und Catherine saß bei ihrem zweiten Glas Weißwein. Wein, so sinnierte sie, war die Antwort ihrer Generation auf aufsässige Kinder. Nach ein paar Gläsern merkte man es nicht mehr.
Christopher gab ihr einen Kuss und musterte die Flasche. »Zwei Gläser? Heißt das, es war ein guter oder ein schlechter Tag in der Schule?«
Fast hätte Catherine ihr Debakel im Gebüsch eingestanden, überlegte es sich dann aber anders. Vermutlich würde er fuchsteufelswild werden und sich auf Rachels Seite stellen, womit Catherines lächerlicher Bodensatz an Autorität noch weiter abnähme. Man sollte sich doch einig sein und sich vor den Kindern gegenseitig unterstützen, wie Ricky sie des Öfteren erinnerte, aber diese Stufe der Perfektion erreichten Catherine und Christopher so gut wie nie. Das lag in ihren Augen vor allem an ihrer unterschiedlichen Auffassung vom Elternsein. Catherine war der Überzeugung, gewisse Grenzen mussten gewahrt bleiben – ein Minimum an Höflichkeit anstelle unverständlicher Grunzlaute, etwas freie Fläche auf dem Fußboden in ihren Zimmern und gelegentliche Ansätze von persönlicher Hygiene. Christopher fand das übereifrig und unwichtig. Kinder mussten selbst entscheiden, wo die Grenzen lagen – wie könnten sie sonst je unabhängig werden? Die Folge davon war, dass Catherine seit Rachels Teenagertagen mitunter Mordgelüste gegen ihn verspürte.
»Ich hatte einen herrlichen Tag.« Catherine setzte lautstark ihr Glas ab. »Die siebte hat Läuse, die Schule wurde wegen einer Polizeirazzia geschlossen, und jemand hat die Arbeitsblätter geklaut, die ich den ganzen gestrigen Abend vorbereitet habe. Ach – und Rachel hat in der Schule blaugemacht, indem sie erzählt hat, sie müsse zum Kieferorthopäden.«
»Also ziemlich durchschnittlich?« Christopher streckte die Hand nach ihrem geplagten Gesicht aus. »Wo ist sie denn?«
»Oben in ihrem Zimmer.«
»Ich gehe mal rauf.«
Das gemütliche, verwohnte dreistöckige Reihenhaus war praktisch gewesen, als die Kinder noch klein waren, doch mit einer fast Achtzehnjährigen und einem tatendurstigen Zehnjährigen platzte es in letzter Zeit fast aus allen Nähten. Vor allem in der obersten Etage waren die Zimmer das, was ein Immobilienmakler »kompakt« nennen würde. Trotzdem hatte Rachel aus ihrem das Beste herausgeholt. Neben den Postern von Boy Bands und Kätzchen hatte sie einen Baldachin aus Schleierstoff über ihrem Bett konstruiert und ihm damit eine haremsartige Ausstrahlung verliehen, die in diesem Nord-Londoner Vorort sicher einzigartig war. Rachel hatte Secondhandshops abgeklappert und sich alte Stoffe sowie billige Tagesdecken und Kissen in edelsteinbunten Farben besorgt. Die Wirkung gab ihrem Vater das Gefühl, in ein Kaleidoskop zu treten. Sie war intelligent und künstlerisch veranlagt. Doch sah er auch, dass sie störrisch und dickköpfig sein konnte, weil er diese Eigenschaften mit ihr teilte. Wenn sie sich in etwas verbiss, konnte Rachel zur Eine-Person-Widerstandsbewegung werden. Ihre Mutter, selbst rational und vernünftig, erwartete, dass ihre Tochter für Logik empfänglich war. Aber Logik bedeutete Rachel nichts. Rachel wollte Leidenschaft und Aufregung, wollte anfangen zu leben, und die Prüfungen sollten sich zum Teufel scheren, wenn sie diesem Vorhaben im Weg standen. Obwohl Christopher heimlich Verständnis dafür hegte, wusste er, dass er dies seiner anspruchsvollen Tochter nie eingestehen durfte. Die Linie war klar: Prüfungen waren wichtig. Das Leben konnte später kommen.
»Hallo, Nudel.« Diesen Kosenamen benutzte er nur, wenn sie allein waren. »Wie läuft’s?«
Sie blickte von ihren Büchern auf und lächelte. »Bestens. Außer dass mich Mum die ganze Zeit mit der Lernerei nervt. Wenn ich nicht lauter Einser kriege, komme ich mir wahrscheinlich vor wie eine Verbrecherin.«
Christopher setzte sich auf das Haremsbett. »Sie glaubt eben, dass du mit einer guten Ausbildung mehr Möglichkeiten hast, das ist alles.«
Rachel klappte ihr Exemplar von Virginia Woolfs Die Fahrt zum Leuchtturm zu. »Ich weiß. Ich habe diese Leier schon hundertmal gehört. Wie ihr Dad gestorben ist und sie nicht auf die Universität gehen konnte, obwohl sie intelligent genug war, und dass ich meine Chancen nicht verschleudern soll. Ich weiß das alles, ehrlich. Aber ich will sie einfach nicht ständig auf der Pelle haben. Ich bin fast achtzehn. Eine Menge Mädchen sind in meinem Alter schon verheiratet und haben Kinder. Wenn sie doch nur aufhören würde, mich wie eins zu behandeln.«
Rachel, die ihre Schuluniform mittlerweile gegen Shorts aus imitiertem Leopardenfell, eine blickdichte schwarze Strumpfhose und einen weiten schwarzen Pulli eingetauscht hatte, sah weiß Gott nicht aus wie ein Kind. Manchmal rührte es Christopher bis ins Mark, wie sehr sich die beiden Frauen in seinem Leben körperlich ähnelten. Es war komisch, angesichts des Unterschieds zwischen ihren Persönlichkeiten, und vielleicht für beide schwierig – für Rachel, mit ihrer Mutter verglichen zu werden, und für Catherine, eine jugendliche, vor Leben sprühende Wiedergeburt ihrer selbst vor sich zu sehen, die anstelle von Vorsicht von Leidenschaft erfüllt war.
»Und warum hast du dann die Schule geschwänzt, wenn alles in Butter ist?«
Rachel warf ihr langes Haar nach hinten und wich der Frage geschickt aus. »Ich wette, sie hat dir nicht erzählt, was sie heute gemacht hat. Sie hat sich im Gebüsch vor der Schule versteckt wie ein Spanner. Der Hausmeister hat gesagt, wenn sie ein Kerl gewesen wäre, hätte er die Polizei gerufen.«
»Rachel, sei doch nicht albern.«
»Bin ich nicht. Geh und frag sie. Und, Dad«, Rachel beschloss, ihren Vorteil auszunutzen, während ihr Vater noch unter Schock stand, »darf ich zu Steph, wenn ich mit Lernen fertig bin?« Sie wollte unbedingt Genaueres über die Schandtat ihrer Mutter hören.
»In Ordnung.« Zu spät wurde ihm klar, dass Catherine mit dieser werktäglichen Erlaubnis nicht einverstanden sein konnte.
Unten bemühte sich Catherine gerade, Ricky vom Fernseher loszueisen und an den Esstisch zu locken.
»Cath«, fragte Christopher drohend, »stimmt das?«
»Stimmt was?« Catherine war damit beschäftigt, das Essen auf den Tisch zu stellen.
»Dass du vor Rachels Schule in den Büschen auf der Lauer gelegen hast, Herrgott noch mal!«
»Sie verschwindet, ohne sich abzumelden. Sie weigert sich, mir irgendetwas zu sagen. Sie schwänzt die Schule. Wie soll ich denn sonst etwas erfahren?«
»Du könntest ihr zur Abwechslung mal vertrauen.«
»Tschüs, Mum, tschüs, Dad.« Rachel rauschte durch den Flur zur Haustür. »Ich bin fertig mit den Hausaufgaben.«
»Wer hat dir denn erlaubt wegzugehen? Wir haben noch nicht einmal zu Abend gegessen.« Catherine war der Kommandoton zuwider, der sich in ihre Stimme eingeschlichen hatte. Aber was sollte sie tun? Wenn sie es Christopher überließ, wäre Rachel jeden Abend unterwegs und brächte ihre Individualität bis morgens um drei zum Ausdruck.
»Ich habe keinen Hunger. Ich habe ein Sandwich gegessen.«
Catherine ließ es ihr durchgehen. Sie fühlte sich nicht stark genug für eine weitere Schlacht. »Dann sei aber um zehn wieder da.«
»Versprochen.«
Nach dem Essen schwankte Catherine zwischen den unattraktiven Alternativen, die Mathearbeiten der sechsten Klasse zu korrigieren und dem Bügelkorb. Korrigieren siegte knapp. Sie war zwar todmüde, wollte aber unbedingt warten, bis Rachel nach Hause kam. Nicht, um sie zu überwachen. Oder vielmehr, nicht nur, um sie zu überwachen, sondern weil sie mit ihr reden wollte.
Um fünf vor zehn war sie sowohl mit Korrigieren als auch mit Bügeln fertig und sehnte sich nach ihrem Bett. Christopher war gerade nach oben gegangen. Sie sah an seinem steifen Rücken und daran, wie er ihrem Blick auswich, dass er immer noch wütend war.
Drei Minuten nach zehn erschien Rachel, zuckersüß lächelnd. »Möchtest du eine Tasse Tee, Mum?«
Catherine war von der Idee begeistert. Ein derartiger Vorschlag war ungefähr so häufig wie Rachels Angebot, ihr Zimmer aufzuräumen oder von sich aus von ihrem Abend zu erzählen.
Rachel machte sich friedlich in der Küche zu schaffen, setzte Wasser auf und nahm Tassen aus dem vollgestopften Geschirrschrank. »Haben wir noch Kekse?«
Catherine wies auf die Dose. »Ich habe vorgestern drei Päckchen KitKats gekauft.« Wie naiv von ihr, sich einzubilden, sie würden sich halten. Lediglich die Verpackungen lagen verlassen in der Dose.
»Hör mal, Rach, das mit heute tut mir leid. Aber wenn du mir sagen würdest, wo du hingehst, bräuchte ich mir keine Sorgen zu machen. Wo warst du denn überhaupt?«
»Bitte, Mum, wir wollten eine Tasse Tee trinken, nicht die spanische Inquisition wieder einführen.«
Catherine schluckte eine bissige Bemerkung hinunter. In Rachels Augen war es ein Bruch der Genfer Konvention, wenn sie vor dem Ausgehen eine Telefonnummer hinterlassen sollte.
Auf halbem Weg die Treppe hinauf blieb Rachel stehen und umarmte sie. Es dauerte nur eine Nanosekunde, war aber unendlich beruhigend.
»Ich meine es doch nur gut mit dir, wenn ich streng bin, weißt du?«, erklärte Catherine ihr sanft. »Eines Tages wirst du mir dafür noch dankbar sein.«
»Wie die Tschechen Hitler dankbar dafür waren, dass er in ihr Land einmarschiert ist?«
Catherine zuckte zusammen und fragte sich, ob Rachel eigentlich wusste, wie verächtlich sie klang.
Es ist nur eine Phase, wiederholte Catherine innerlich immer wieder wie ein Mantra. Bestimmt ist es nur eine Phase.
Christopher schlief bereits auf seiner Seite des Betts und kehrte ihr den Rücken zu. Meistens kuschelte sie sich eng an ihn, sei es der Geborgenheit wegen oder aus Lust oder wenn sie in der Schule Schwierigkeiten gehabt hatte. Egal, aus welchem Grund, normalerweise funktionierte es. Aneinandergekuschelt, zu zweit gegen die Welt, gab seine Nähe ihr Kraft. Doch heute Abend loderte ihr Ärger noch hell. Es war eine kalte Nacht mit einem hochstehenden, fast vollkommen runden Mond, der ihr Schlafzimmer mit seinem flüssigen weißen Licht erhellte. Einen Augenblick lang überlegte sie, ob sie ihn wecken und es ihm zeigen sollte. Einmal, als jung Verheiratete, waren sie im Mondschein durchs Schlafzimmer getanzt, bis sie gemerkt hatten, dass die alte Frau von gegenüber ihnen schmunzelnd zusah. Stattdessen schlüpfte sie nun in das kalte Bett und fröstelte. Sie liebte elektrische Heizdecken, aber Christopher, der unter Lavinias strengem Regiment groß geworden war, fand sie unerträglich. Der Text eines Songs von Paul Simon kam ihr in den Sinn:
You like to sleep with the window open
I like to keep the window closed
so goodbye, goodbye, goodbye.
Sonst musste sie über die Absurdität dieser Zeilen immer lachen. Aber heute Nacht erschienen sie ihr unheilschwanger.
2. Kapitel
»Wo ist denn Rachel geblieben?«
Christopher hatte den Wein und die Pralinen, pflichtbewusste Gaben für seine Mutter, bereits im Auto verstaut. Lavinia behauptete stets, kein Geld für solche Luxusartikel zu haben, obwohl sie in einem beneidenswert schönen Cottage wohnte, ein Rover Cabrio fuhr und Mrs. Wright zweimal die Woche zum Putzen kam. Da Christopher überdies einer der Testamentsvollstrecker seines Vaters war, wusste er ganz genau, dass es ihr am nötigen Kleingeld nicht mangelte. Und so nahmen sie sämtliche Sparmaßnahmen Lavinias – Kerzenreste einzuschmelzen, Papierservietten mehrmals zu verwenden, einen Teebeutel für drei Tassen zu nehmen – mit einer nachsichtigen Toleranz hin, die Lavinia aufbrachte.
»Vor zehn Minuten hat sie gesagt, sie sei fertig«, erklärte Catherine. »Das ist nur eine Verzögerungstaktik, weil sie keine Lust hat.«
Bevor Catherine aus dem Wagen steigen und nach ihrer Tochter rufen konnte, kam Rachel schon die Stufen heruntergehopst. Sie trug eine weit ausgestellte schwarze Samthose, Turnschuhe mit Plateausohlen und ein nabelfreies T-Shirt, das über der Brust die Aufschrift SEMTEX trug.
»Rachel«, kreischte ihre Mutter, »so kannst du nicht mitfahren. Gran kriegt einen Anfall. Zieh wenigstens ein anderes Oberteil an.«
»Das soll ein Witz sein, Mum.«
Catherine fing den Blick ihres Mannes auf und stellte fest, dass er sie anlachte. Trotz allem lächelte sie zurück. »Okay, okay«, gab sie nach, »komm mir nicht mit einer strukturalistischen Analyse. Humor ist das Zusammentreffen des Erwarteten mit dem Unerwarteten. Geschmacklosigkeit kann lustig sein. Ich hoffe nur, dass sie nicht irgendwelchen Leuten von der Friedensbewegung über den Weg läuft.«
»In Maxted?«, fragte Rachel zurück und stieg hinten ins Auto. »Da würden sie wahrscheinlich ohne Vorwarnung erschossen.«
In ihrem hübschen Häuschen am äußersten Ortsrand des kleinen Marktfleckens Maxted bereitete sich Lavinia darauf vor, ihren Sohn und seine Familie zu empfangen. Der Garten, Lavinias große Liebe, war zu dieser Jahreszeit spärlich bewachsen, aber sie hatte dennoch ein Arrangement aus Christrosen, flechtenbewachsenen Zweigen und Efeu zustande gebracht, das sich auch in der »künstlerischen« Abteilung der Blumenschau Maxteds nicht hätte verstecken müssen. Ja, es kam sogar so gut an, dass sie eine zweite, größere Version für die Kirche anfertigte. Sie hatte diese Woche Blumendienst, und die Vorweihnachtszeit war immer heikel. Manche der anderen ließen sich dazu herab, rote Glaskugeln oder gar Kerzen in Engelsform auf Tannenzweige zu stecken, was in Lavinias Augen hoffnungslos unpraktisch war, da diese Dinger, abgesehen von ihrer Geschmacklosigkeit, vermutlich die Kirche in Brand stecken würden, wenn man sie je anzündete. Das Schlimmste für Lavinias hohe Ansprüche waren allerdings diejenigen, die auf seidene Chrysanthemen zurückgriffen, eine vulgäre Pflanze, selbst die echten, aber als Imitat wirklich jenseits von Gut und Böse. Lavinia lächelte aus Vorfreude auf das Lob, das ihr Gesteck von den kunstsinnigeren Gemeindemitgliedern erhalten würde.
Sie hatte alles im Griff. Das Mittagessen stand unter der Warmhalteglocke auf dem Servierwagen (den Lavinia diskret in der Küche ließ, da sie vermutete, dass er ganz ähnlich wie Seidenchrysanthemen ein bisschen geschmacklos wirkte), der trockene Sherry stand bereit, und die Blumen waren arrangiert. Zufrieden sah sich Lavinia im Zimmer um. Sie liebte diesen Ort. Seit ihrer Hochzeit lebte sie hier. Trotz der Verwüstungen des zwanzigsten Jahrhunderts hatte sich Maxted viel von seinem Charme bewahrt. Bunt getünchte Häuschen in Ocker, Grün, Blassrosa und Gelb schmiegten sich an die Hügel, neben ihnen blassgraue Fachwerkhäuser, deren obere Stockwerke über die schmalen Gassen darunter ragten. Putzige ehemalige Armenhäuser säumten eine Straße, in der auch ein Zunfthaus stand, das im Mittelalter von den reichen Wollhändlern für ihre Geschäfte genutzt wurde. Am Ortsrand gab es sogar eine kleine Spinnerei, hinter der sich Feuchtwiesen und das wogende Ackerland erstreckten, das John Constable so oft gemalt hatte. »Ich liebe jeden Zauntritt, Baumstumpf und Feldweg hier«, hatte er vor dreihundert Jahren geschrieben. »Das sind die Landschaften, die mich zum Maler gemacht haben.« Lavinias Herz wurde vom gleichen Stolz und der gleichen Liebe erfüllt, doch ihr Zeichentalent war leider wesentlich weniger ausgeprägt als das Constables. Festen Willen und Zielstrebigkeit besaß sie mehr als genug, doch ihre Versuche, hübsche Aquarelle zu verfertigen, brachten ihr eher Gekicher als Anerkennung ein. Blumengestecke waren da schon leichter.
»Sind sie schon da?«, rief ihre Nachbarin Eunice über die bröckelige Backsteinmauer, die ihre Gärten voneinander trennte. Lavinia schnalzte verärgert mit der Zunge. Eunice hängte ihre Wäsche auf. Nicht dass Lavinia etwas gegen Wäsche auf der Leine einzuwenden gehabt hätte, nein, sie hatte sogar beim wöchentlichen Gemeindefrühstück des Öfteren bemerkt, dass Wäsche auf der Leine zur ländlichen Szenerie gehörte. Sie konnte die im Trockner getrocknete Bettwäsche mit ihrem grauenhaften synthetischen Gardeniengeruch nicht auf ihrer Haut ertragen. Doch es gab Regeln, vielleicht unausgesprochene, aber trotzdem Regeln, die besagten, dass man Wäsche nur werktags draußen aufhängte. Natürlich musste Eunice, die erst vor sechs Jahren aus der Stadt hierhergezogen war, noch einiges lernen und würde sicherlich etwas ländliche Weisheit von einer Frau willkommen heißen, die so viel mehr Erfahrung hatte – wie sie selbst zum Beispiel.
Doch bevor sie dazu kam, diesen Ratschlag anzubringen, hielt der alte Kombi ihres Sohnes gegenüber.
»Hi, Gran!« Ricky, der als großzügiges Zugeständnis ans Landleben zu seinem atemberaubend teuren Designer-Jogginganzug Gummistiefel angezogen hatte, kam über die Straße gesaust, umarmte Lavinia und verschwand, um sich auf die Suche nach ihrer Katze zu machen. Ricky und die Katze hatten bereits eine langwährende Beziehung, die auf gegenseitigem Misstrauen und gleichermaßen tief empfundener Zuneigung beruhte. Die Katze gestattete Ricky gewisse Freiheiten, vorausgesetzt, er ließ sich gelegentlich mit ausgefahrenen Krallen auf die Nase schlagen und steckte ihr immer wieder Leckereien zu.
Rachel, die in ihrem Semtex-Oberteil und mit nacktem Bauch aus dem Auto stieg, gelang der noch nie dagewesene Effekt, ihre Großmutter völlig zum Verstummen zu bringen. »Hallo, Gran. Du siehst gut aus.«
Lavinia, die darauf achtete, ihre Tweed-Röcke und Lambswool-Pullover (Kaschmir war zu protzig) stets in schmeichelhaften Heidetönen zu kombinieren, fand schließlich ihre Stimme wieder. »Wenn ich doch nur das Gleiche von dir sagen könnte. Frierst du denn nicht wie ein Schneider?«
Ganz kurz musste Lavinia an die Kinder ihres anderen Sohnes Martin denken. Lucy und Robin waren immer so adrett gekleidet.
»Hallo, Lavinia.« Catherine küsste ihre Schwiegermutter auf die gepuderte Wange und nahm den schwachen Duft von Chanel No. 5 wahr, ein erstaunlicher Luxus an der sonst so unerschütterlich praktischen Lavinia. »Wie geht es dir? Dein Garten sieht herrlich aus.«
Lavinia beäugte sie misstrauisch. Der Garten sah überhaupt nicht herrlich aus, also musste dies ein Versuch sein, ihr zu schmeicheln. Lavinia lehnte unaufrichtige Schmeicheleien aus ganzem Herzen ab. »Findest du?«, erwiderte sie in einem Ton, der nahelegte, dass Catherine entweder verrückt sein musste oder ihr Urteilsvermögen dadurch massiv beeinträchtigt war, dass sie in einer schäbigen Ecke Londons lebte, in der sich Lavinias Meinung nach kein denkender Mensch jemals freiwillig niederließe. »Wie läuft’s in der Schule?«
Catherine wusste, dass sich Lavinia nicht ernsthaft für die Hoffnungen und Träume eines Haufens Rotznasen aus Londoner Sozialwohnungen interessierte. »Gut.«
Christopher kämpfte sich mit dem Übernachtungsgepäck durch. »Cath«, begann er das altbekannte männliche Klagelied, »war es wirklich nötig, für eine einzige Nacht so viel Zeug mitzunehmen? Hallo, Ma, wie geht’s?«
»Blendend, danke.« Lavinia hatte die lästige Gewohnheit, stets bei bester Gesundheit zu sein, und verfügte über ausgesprochen wenig Mitgefühl für anfälligere Mitmenschen, die Husten, Grippe oder tödliche Krankheiten bekamen.
»Also« – Lavinias Stimme schwand zu einem Flüstern, als wäre ihr Sohn Heroindealer und kein respektabler Teeimporteur –, »hast du es geschafft, mir etwas von diesem feinen Lapsang Souchong zu besorgen, den du mir versprochen hast?«
Christopher tätschelte die Tragetüte voller Leckereien. »Ist hier drin. Wann gibt’s denn Mittagessen? Ich bin am Verhungern.«
»In zehn Minuten. O Gott, wir haben kein Johannisbeergelee für das Tamm.« Lavinias bestürzter Tonfall machte diesen lebensbedrohlichen Mangel sofort allen klar. »Wenn diese blöde Eunice nicht ihre Wäsche hinausgehängt hätte …«
Christopher und Catherine wechselten Blicke. Beide kannten Lavinia gut genug, um sich den Hinweis darauf zu verkneifen, dass das Fehlen von Johannisbeergelee im Rahmen des Weltgeschehens vernachlässigbar war.
»Nur die Ruhe, Gran, ich gehe welches holen«, bot Rachel diplomatisch an.
Lavinia stand eindeutig vor einer der schwersten Entscheidungen ihres Lebens. Lehnte sie ab, wäre das Essen in ihren Augen ruiniert. Ließ sie aber Rachel zum Laden gehen, sähe die ganze Straße ihre Enkelin in diesem albernen Oberteil, den Bauchnabel den Elementen ausgesetzt, während der grässliche Nasenstecker, den ihre Mutter ihr nie hätte erlauben sollen, in der Wintersonne glitzerte.
Catherine, die die Schwierigkeiten ihrer Schwiegermutter erahnte, fand einen Kompromiss. »Nimm meinen Mantel, Rach, sonst frierst du dich zu Tode. Hier ist es doppelt so kalt wie in London.«
Lavinia ignorierte diese Beleidigung ihres geliebten Maxted und scheuchte Rachel zur Tür hinaus. »Sie machen in zehn Minuten zu, also beeil dich.«
»Am Samstag?« Rachel war an eine Welt aus Einkaufszentren gewohnt, an Kreditkartenkäufe und rund um die Uhr geöffnete Supermärkte.
Der Laden, allgemein der »Dorfladen« genannt, obwohl er strenggenommen zu Maxted gehörte, lag nur ein paar hundert Meter weit weg. Um ihn über Wasser zu halten, gehörten ein Postamt, ein Schreibwaren- und Zeitschriftenladen und ein kleiner Supermarkt dazu. Seine gegenwärtigen Besitzer, ein Ehepaar, das erst vor kurzem aus Purley hergezogen war, hatten die gesamte Abfindung des Ehemannes dazu benutzt, das glatte Schaufenster herausnehmen und an seiner Stelle rhombenförmige Butzenscheiben einbauen zu lassen, rustikale Kiefernregale aufzustellen und überall weiße Spitzendeckchen auszulegen, um alles wie eine altmodische Anrichte wirken zu lassen und den Laden in genau die Art von kitschigem Idyll zu verwandeln, in dem es kein echter Landbewohner länger als fünf Minuten aushielt.
Rachel ging schneller, was angesichts der Höhe ihrer Plateau-Turnschuhe nicht ganz ungefährlich war. Vor dem Laden erblickte sie zu ihrem Erstaunen eine junge Frau, die einen Hund an einem Stück Schnur hielt. Keiner von beiden gehörte zu der Sorte von Wesen, die man in Maxted normalerweise antraf. Das Mädchen hatte störrische blonde Haare, die hinten kurz geschnitten und vorne zu Rastazöpfchen geflochten waren, die sie mit Stofffetzen umwickelt hatte. Sie war hübsch, wirkte allerdings etwas mitgenommen. Der Hund war nicht hübsch, machte diesen Mangel jedoch durch seine Freundlichkeit wett. Rachel versuchte, seine Abstammung zu ergründen. Bärtiger Collie mit einer Spur Rennhund und ein Hauch Pudel vielleicht. Rachel streichelte ihn und betrat eilig den Laden. Das Mädchen sagte nichts.
Drinnen waren nur zwei Leute. Einer von ihnen ein Einheimischer, der allerdings aus einem gesellschaftlich weniger anerkannten Viertel Maxteds namens »Die Höhe« stammte, das von den betuchteren Einwohnern aber meist abschätzig »Die Flöhe« genannt wurde, wo die wenigen Arbeiter der Gegend lebten. Er jammerte gerade über die Erklärung der jüngsten Lottosieger, wegen dieses Gewinns ihr Leben nicht ändern zu wollen.
»Ich würde mein Leben garantiert ändern, verflucht noch mal«, vertraute er dem neuen Ladenbesitzer an. »Mich hätten alle gesehen. Ich würde diesen Snobs da oben ein paar Flötentöne beibringen, das kann ich Ihnen sagen.«
Der andere Kunde stand am entgegengesetzten Ende des Ladens und füllte gerade einen Einkaufskorb mit etwas, das aussah wie ein lebenslanger Vorrat an Orangenkeksen. Das einzig andere, was ihr an ihm auffiel, war ein Vorhang dunklen, glänzenden Haares, fast so lang wie ihr eigenes, aber glatt, nicht so wellig wie ihres. Es stand nicht fest, ob sich darunter ein männliches oder ein weibliches Wesen verbarg.
Eilig sah sie sich nach dem Johannisbeergelee um. Es gab nur eine Gourmetversion zu einem horrenden Preis, aber Rachel wusste genau, dass sie nicht mit leeren Händen zu ihrer Großmutter zurückkommen durfte, und so trug sie es zur Kasse.
Der Käufer der Orangenkekse war bereits vor ihr dort angelangt. Aus diesem Blickwinkel konnte kein Zweifel mehr an seinem Geschlecht bestehen. Er winkte ihr, dass sie vorgehen sollte, und Rachels Herz machte einen Satz.
Sie war groß für ein Mädchen und er nur eine Idee größer, gekleidet von oben bis unten in Schwarz, angefangen bei dem weiten schwarzen Mantel bis zu einer engen schwarzen Hose, die in Motorradstiefeln steckte. Doch es war sein Gesicht, das ihren Blick lähmte wie den eines verängstigten Kaninchens. Dunkle, grollende Brauen, die fast in der Mitte zusammenwuchsen, jedoch erstaunlich blaue Augen freigaben, welche Rachel in diesem Moment mit wissender Eindringlichkeit musterten. Dann lächelte er. »Nach dir.«
»Ich habe nur das hier, danke.« Sie war dankbar, einen Grund zum Wegschauen zu haben. So konnte er in ihren Augen nicht die schockierende Wahrheit erkennen, nämlich dass er der erste Mann in ihrem Leben war, mit dem sie wirklich ins Bett gehen wollte.
Als ihr das Johannisbeergelee, verstaut in einer winzigen Tragetüte aus Papier, wieder gereicht wurde, kam er an die Reihe. Rachel, die von seiner dunklen Attraktivität wie gebannt war, fand sogar seine Einkäufe faszinierend.
»Das hier, zwei Flaschen Milch und ein Päckchen Zigarettenpapier, bitte.«
»Tut mir leid.« Der Ladeninhaber knallte seine Kasse zu. »Wir haben leider schon geschlossen.«
Rachel schnappte nach Luft und erwartete, der junge Mann würde protestieren oder Einwände vorbringen. Stattdessen gab er ein warmes, gutgelauntes Lachen von sich, das weder erstaunt noch verärgert klang. Sein silbernes Piercing, das seine schwarzen Brauen zierte, klirrte dabei leise. »Jammerschade«, sagte er gelassen und ignorierte das verschlossene Gesicht des Mannes, »für die Orangenplätzchen hätte ich einen Mord begehen können.«
Rachel, die an seiner statt wütend geworden war, kramte in ihrer Tasche herum und reichte Lavinias Wechselgeld über den Ladentisch. »Hier, ich kaufe welche.«
»Danke.« Ohne Hast öffnete er das Päckchen und hielt es ihr hin. »Komm, nimm dir einen. Unser Freund hier hat ja wohl keinen Hunger.«
Rachel, die Orangenkekse noch nie hatte ausstehen können, nahm trotzdem einen.
»Ich heiße übrigens Marko. Das da draußen ist mein Hund.« Das Lächeln wurde nun leicht verlegen. »Ich fürchte, er heißt Polo.«
»Polo?«
»Du weißt schon, wie in Marco Polo.«
Jetzt musste Rachel lachen. Auf einmal fiel ihr das bevorstehende Essen wieder ein, das ohne Johannisbeergelee bleiben würde, bis sie zurückkehrte. Inzwischen hatte das Lamm vermutlich die exakte Rosafärbung verloren, die ihre Großmutter verlangte. Einen verrückten Moment lang erwog sie, Marko und Polo und sogar das Mädchen dazu einzuladen, doch sie konnte sich Lavinias Reaktion nur allzu gut vorstellen.
Inzwischen waren sie an der Tür angelangt. Der Ladeninhaber hielt sich dicht hinter ihnen. »Hören Sie«, wandte sich Marko an den Mann, da sich nun doch der Ärger in ihm regte. »Ich lasse nicht anschreiben, ich falle weder Ihnen noch dem Staat zur Last, und ich habe nichts geklaut. Okay? Tut mir echt leid«, sagte er zu Rachel, als sie draußen standen.
»Dir tut es leid …« Rachel explodierte. »Dieser Mann hat sich unmöglich benommen. Ich werde meiner Großmutter sagen, dass sie hier nie wieder einkaufen soll.«
Das Lächeln kehrte zurück. Rachels Rückgrat fühlte sich an wie das Johannisbeergelee, das sie sich gegen die Brust drückte. »Man gewöhnt sich daran. Wir sind der Feind, verstehst du? Die netten Menschen von Maxted wollen eine Umgehungsstraße, um ihr historisches Erbe zu bewahren, und wer könnte ihnen das schon verdenken? Nur leider würde dann eine sechsspurige Autobahn durch Gosse’s Wood gebaut, und der Wald ist noch älter als Maxted. Also tun wir, was wir können, um sie aufzuhalten.«
»Und wie?«
»Auf Bäume klettern, Tunnels graben und ein klein wenig harmlose Sabotage betreiben.«
»Jetzt ist mir klar, was dich hier unbeliebt macht.«
»Ach, aber schließlich stört es uns nicht, wenn wir unbeliebt sind, oder, Zo?« Er ignorierte den durchdringenden Blick des Mädchens. »Komm doch mit zu unserem kleinen Lager und sieh’s dir an.«
Rachel zögerte. Sie wollte unbedingt erfahrener wirken, als sie sich fühlte.
»Vielleicht nächste Woche?«
»Das ist ein bisschen schwierig. Wir besuchen gerade meine Großmutter. Ich wohne in London. Zurzeit lerne ich fürs Abi.«
»Dann eben, wenn du mal wieder hier bist. Wo wohnt denn deine Großmutter?«
»In dem Häuschen ganz unten am Ortsende.«
»Lass doch, Marko«, sagte das Mädchen ein bisschen zu hastig. »Sie will eben nicht. Sie ist ein braves, gutbürgerliches Mädchen. Warum sollte sie daran interessiert sein, in den Wald scheißen zu müssen, wenn sie zu Hause vermutlich ein hübsches eigenes Badezimmer hat?«
Rachel wollte einwenden, dass sie alles andere als ein eigenes Bad hatte, sondern sich vielmehr die ganze Familie in ein scheußliches kackbraunes Badezimmer quetschen musste.
Marko lächelte bedauernd, und seine blauen Augen eröffneten Ausblicke auf Möglichkeiten, die die achtzig Kilometer, die bald wieder zwischen ihnen lägen, augenblicklich zunichtemachten. »Dann eben ein andermal. Komm schon, Junge«, zischte er Polo zu. »Zurück zum Vergnügen.«
Rachel sah ihnen nach. Die ganze Straße entlang wackelten Vorhänge, als sie vorbeigingen.
Sie waren schon fast außer Sichtweite, als Zoe zu sprechen begann. »Ein Schulmädchen, was? Das wäre eine Premiere. Sogar für dich.«
»Ein intelligentes Schulmädchen.« Er tippte sich an die Stirn. »Wir brauchen Intelligenz, wenn wir gewinnen wollen.«
»Irgendwie«, sagte Zoe gedehnt und in sicherer Entfernung von Rachels Hörweite, »bin ich nicht davon überzeugt, dass es ihre geistigen Fähigkeiten sind, die dich interessieren.«
»Wo ist nur dieses schreckliche Kind abgeblieben?« Lavinia hüpfte herum wie ein aufgeregter Wellensittich. Das Fleisch war aufgeschnitten, der Wein eingeschenkt, das Gemüse dampfte, und noch immer keine Spur vom Johannisbeergelee. Wirklich eine Zumutung.
Sie wollten sich gerade alle an den Tisch setzen, als Rachel mit glänzenden Augen hereingestürmt kam und Catherines Mantel auf Lavinias zierliches Sofa warf. Es war erstaunlich, wie hübsch sie sogar in diesen grässlichen Klamotten aussehen konnte. »Tut mir unheimlich leid, Gran. Hier ist das Johannisbeergelee. Übrigens musst du diesen Laden boykottieren. Der Besitzer ist total daneben.«
»Mr. Benson? Er und seine Frau sind ausgesprochen nett. Sie arbeiten den lieben langen Tag und haben die Auswahl an Lebensmitteln enorm erweitert. Bei den früheren Besitzern bekam man lediglich Fertigbackmischungen, Bohnen in der Dose und abgepackten Käse, aber wisst ihr, was ich letzte Woche entdeckt habe?« Lavinia wartete, bis sie sich alle auf ihren Stühlen vorlehnten. »Bath-Oliver-Kekse.«
»Tatsächlich?«, wiederholte Ricky mit gespielter Ehrfurcht. Seine Mutter versetzte ihm unter dem Tisch einen Tritt.
»Jedenfalls«, fuhr Rachel fort, indem sie ihren kleinen Bruder ignorierte, »hat er diese Leute unglaublich grob behandelt. Er hat sich sogar geweigert, sie zu bedienen.«
»Waren das Londoner?« Lavinias Ton ließ vermuten, in diesem Fall sei sein Benehmen vollkommen verständlich gewesen.
»Offen gestanden kampieren sie im Wald.«
»Pfadfinder, meinst du, oder Wichtel? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mr. Benson böse zu einem Wichtel ist.«
»Nicht direkt. Sie haben gesagt, sie protestieren gegen irgendein Straßenbauprojekt.«
»Waldbesetzer?«, jaulte Lavinia auf. »Tagediebe, meinst du. Sozialschmarotzer. Da stehe ich voll und ganz hinter Mr. Benson. Die sind doch Abschaum.«
»Gran! Wie kannst du nur! Du klingst ja noch schlimmer als er. Wir leben in einer Demokratie, weißt du? Nicht unter einem faschistischen Regime.« Rachel warf ihre Gabel beiseite und stolzierte hinaus.
»Wie kann sie es wagen?«, zürnte Lavinia. »Ich weiß wesentlich mehr über faschistische Regimes als sie. Immerhin habe ich den letzten Krieg überlebt, vergesst das nicht.«
Klugerweise unterließ es Christopher, seine Mutter daran zu erinnern, dass sie den gesamten Krieg außerhalb Londons auf dem Land verbracht hatte, wo man faschistische Regimes höchstens ansatzweise in den Aufnahmekommissionen der lokalen Golfclubs antraf. Aber Lavinia war nicht mehr zu bremsen. »Also wirklich, Christopher, du lässt diesem Kind ja alles durchgehen. Seit sie auf der Welt ist, bist du nur noch für sie da. Du bist schuld daran, dass sie sich einbildet, der Nabel der Welt zu sein, und so was kommt dann dabei heraus. Das Problem mit deiner Generation ist, dass ihr die Autorität eines feuchten Spüllumpens habt!«
Ja, hätte Catherine am liebsten geschrien, und zwar, weil eure Jahrgänge uns dermaßen verpfuscht haben. Wir wollten unsere Kinder nicht mit Hilfe von Angst und Schrecken erziehen. Wir wollten, dass sie uns mögen, mit uns reden und mit uns in italienische Restaurants essen gehen.
Aber leider hatte ihre mitfühlende, verständnisvolle Generation irgendwo zwischendrin die Kontrolle über ihren Nachwuchs komplett verloren, obwohl sie lieber gestorben wäre, als dies ihrer Schwiegermutter gegenüber zuzugeben.
Nach den Spannungen des Wochenendes wirkte der Montagmorgen geradezu verlockend. Catherine betrat die Rosemount-Grundschule durch den Seiteneingang, über den asphaltierten Spielplatz. Eine schnatternde Kinderschar sauste herbei. »Gu-ten Mor-gen, Miss-is Hope«, zwitscherte Dorene, ein fröhliches Mädchen karibischer Abstammung, das in Catherine regelmäßig den Wunsch weckte, sie auf den Arm zu nehmen und abzuküssen. »Sie sehen sehr hübsch aus heute, Miss-is Hope.«
Catherine lachte. Diesen Morgen hatte derartige Hektik geherrscht, dass sie noch nicht einmal dazu gekommen war, einen Blick in den Spiegel zu werfen. »Vielen Dank, Dorene, das ist sehr nett von dir.«
»Morgen, Miss Hope«, brüllte Wesley, ein frecher Zehnjähriger. »Wir haben heute Sie in Turnen. Miss Wilson ist krank.« Spontan schlang er ihr den Arm um die Taille, als sie vorüberging.
»Das wird lustig. Da kannst du mir zeigen, wie man Sternsprünge macht. Die kriege ich nie richtig hin.«
»Kein Problem.« Er zwinkerte ihr beruhigend zu und raste davon, um sich zu seinen Freunden zu gesellen. In Catherine wallte der gewohnte Stolz darüber auf, was sie in Rosemount geschafft hatten. Freundinnen, die an besser ausgestatteten Schulen arbeiteten, fragten sie oft, wie sie es an einem so rauen Ort aushielt. Was sie nicht begriffen, war, dass für solche Kinder die Schule alles bedeutete. Sie waren wie kleine Schwämme, so wissbegierig, dass es einen tief berührte.
Im Lehrerzimmer herrschte der gewohnte Mief aus Heizlüfter, Zigarettenrauch und Tratsch. Es hatte schon mehrere politisch korrekte Versuche gegeben, das Rauchen im Lehrerzimmer zu verbieten, doch sie waren allesamt niedergeschlagen worden. Eine schnelle Kippe, so behauptete Catherines Freundin Anita, war oft das Einzige, das einen Durchschnittslehrer vor dem Nervenzusammenbruch bewahrte. Heute war der Dunst so dicht, dass die Fensterscheibe am Ende des Raums völlig beschlug. Das Fenster ging auf den Spielplatz hinaus, und die Lehrerschaft war angewiesen, die dort spielenden Schüler im Auge zu behalten. Eigentlich sah es aber eher so aus, dass die Schüler die Lehrerschaft im Auge behielten, erpicht darauf, einen von ihnen mit einer Zigarette zu erwischen und es ihrer Mutter oder ihrem Vater zu petzen, die daraufhin wutschnaubend gelaufen kämen, um sich zu beschweren, man gäbe kein gutes Beispiel ab – auch wenn sie selbst jeden Tag drei Päckchen pafften.
Im Lehrerzimmer, dem einzigen Zufluchtsort, der innerhalb der Schule Ungestörtheit und Ruhe bot, herrschte das gewohnte Chaos. Es war schwer zu glauben, dass hier jeden Abend geputzt wurde. Um neun Uhr morgens stand man schon wieder bis zu den Knien in Styroporkaffeebechern, alten Ausgaben der Bildungsbeilage der Times, die vor allem bei den Stellenangeboten intensiv durchgeblättert worden war, geleerten Fünf-Minuten-Terrinen und unbequemen Schuhen.
»Wer geht denn heute etwas holen?«, wollte Anita wissen. Das Essen an der Schule war so unbeschreiblich schlecht, dass das Kollegium einen alltäglichen Gnadenmarsch zum Supermarkt organisierte. »Ich möchte Hühnchen in Pitabrot ohne Mayonnaise, und für die Kalorien, die ich bei der Mayo gespart habe, könnt ihr mir einen Knusperriegel mitbringen.«
Die Aushilfslehrerin, die an der Reihe war, erbleichte angesichts der komplizierten Bestellungen. Nur einer beteiligte sich niemals daran, sondern brachte stets seinen eigenen, ordentlich gepackten Brotzeitbehälter aus Plastik mit. Es war derselbe, der auch seinen eigenen gemahlenen Kaffeevorrat im Kühlschrank verwahrte. »Habt ihr schon mal diese Zeitschriftenanzeigen für Kaffeemaschinen für nur eine Tasse gesehen und euch gefragt, welche traurige Gestalt sich so eine kaufen würde?«, fragte Anita oft, wenn er den Raum verlassen hatte. »Brian Wickes wäre der richtige Kandidat. Wahrscheinlich macht er auch Markierungen auf die Milchflasche.«
Catherine war seit acht Jahren in Rosemount, Brian Wickes seit sieben, und die ganzen Jahre über hatte er nie aufgehört, ihr ihren einjährigen Vorsprung ebenso zu neiden wie ihre Freundschaft mit Simon Marshall, dem Rektor. Seine Art, dies zu kompensieren, bestand darin, sich so autoritär wie möglich zu gebärden.
Ein schüchternes Klopfen ertönte an der Tür, und die Hälfte der Lehrerschaft bedeckte ihre Zigaretten mit irgendetwas, das gerade greifbar war. In einem Fall war dies die Beilage des Guardian, die prompt Feuer fing und mit Brians frisch gemahlenem Kaffee gelöscht werden musste.
»Ja, was ist denn?«, bellte Brian, dem es ein Dorn im Auge war, wenn Schüler auch nur in die Nähe seines Heiligtums kamen.
In der Tür erschien eine gedrungene Gestalt in einem wenig schmeichelhaften fliederfarbenen Trainingsanzug aus Nylon, schob sich in den Raum und blickte nervös durch Brillengläser, so dick, dass sie wie ein altmodischer Fernsehbildschirm wirkten. »Entschuldigen Sie bitte, Mrs. Hope, aber Sie haben gesagt, ich dürfte die Glocke zur Morgenversammlung bringen.«
»Genau«, erinnerte sich Catherine schuldbewusst. »Hier ist sie, Bonnie. Ich komme sofort.«
»Ihre Eltern müssen blind gewesen sein, dass sie ihr einen solchen Namen gegeben haben«, höhnte Brian, als Bonnie geschäftig mit der Glocke davonmarschierte.
»Ich habe ganz vergessen, es dir zu sagen«, vertraute Catherine Anita an, ohne Brians Bemerkung einer Entgegnung zu würdigen. »Bonnie macht die Aufnahmeprüfung für Wolsey, Rachels Schule.«
»Dann sollte sie sich mal lieber andere Gene besorgen«, meinte Brian. »Ich habe die ganze Familie unterrichtet, und die meisten von ihnen sind schon überfordert, wenn sie im Fernsehen auf ein anderes Programm umschalten sollen.«
»Zufälligerweise«, fauchte Catherine und hätte ihm am liebsten den restlichen Kaffee über seinen kahl werdenden Schädel gekippt, »ist Bonnie ein sehr intelligentes Mädchen. Sie hat gute Chancen, wenn sie sich ordentlich vorbereitet.«
»Und wie«, murmelte Brian.
Oben, vor der großen Aula, läutete Bonnie mit der Glocke, um den Beginn der Morgenversammlung anzukündigen. »Komm schon.« Anita nahm ihre korrigierten Arbeiten unter den Arm. »Simon sieht es gern, wenn die Lehrer als Erste da sind, damit wenigstens irgendjemand ›All Things Bright and Beautiful‹ richtig singt. Übrigens«, fügte sie hinzu und dämpfte ihre Stimme zu einem Flüstern, damit Catherine sich näher zu ihr recken musste, »ich habe spannende Neuigkeiten. Etwas, das dich betrifft.«
»Du liebe Zeit, was denn?« Cath hatte schon Erfahrung mit Anitas Geheimnissen.
»Kann ich jetzt nicht sagen.« Sie tippte sich an die Nase. »Treffen wir uns doch zum Mittagessen im Pub.«
Catherine platzte den ganzen Morgen über fast vor Neugier auf das, was Anita ihr zu sagen hatte. Sie tat ihr Bestes, um sich auf die Blockdiagramme zu konzentrieren, die die sechste Klasse zum Thema »Mein Schulweg« anfertigte. Fünf Achtel kamen zu Fuß, zwei Achtel mit dem Auto, der Rest mit dem Bus, und Damon, der immer etwas Besonderes sein wollte, war der statistische Ausreißer, der darauf bestand, mit dem Raumschiff zu kommen.
Normalerweise hatte Catherine viel zu viel zu tun, um auch nur daran zu denken, ins Pub zu gehen, wenn nicht gerade jemand Geburtstag hatte. Abgesehen davon, dass sie nie Zeit hatte, geschweige denn die Energie, reichte mittlerweile schon ein Glas Wein, und sie schlief bei »Spaß mit Mathe« glatt ein. Doch sie war unheimlich gespannt darauf, was Anita für Neuigkeiten hatte.
Der Morgen zog sich in die Länge, und zur Mittagszeit war Catherine dankbar für die Ablenkung. Auf dem Weg zum Spielplatz sah sie, wie ein Trupp Jungen lautstark Bonnie beschimpfte, was diese allerdings tapfer ignorierte, während sie versuchte, das Klettergerüst zu erklimmen.
»He, schaut mal, Bonnie, die Fettsau«, plärrte einer.
»Spotz! Spei! Echt voll eklig«, stimmte ein zweiter mit ein.
»Jungs, wir sprechen uns später«, fauchte Catherine. Irgendwie war Bonnie ständig Zielscheibe solcher Bosheiten. »Um Punkt fünf vor zwei steht ihr vor meinem Klassenzimmer. Ist das klar?«
»Ja, Mis-sis Hope.«
Das Pub lag nur zwei Minuten zu Fuß von der Schule entfernt, direkt am anderen Ende des Spielplatzes – ein weiterer Grund für die Lehrer, es selten aufzusuchen. Für einen Werktag war es erstaunlich gut besucht. Eine Reihe Männer unterschiedlichen Alters saßen mit Pintgläsern voller Lagerbier vor sich an der Bar und starrten auf die großen Fernsehbildschirme, auf denen Sky Sports lief. Nur Anita war nirgends zu sehen.
Schließlich entdeckte Catherine sie in dem kleinen gepflasterten Biergarten hinter dem Haus, wo sie an einem frostigen Picknicktisch saß und in die Hände blies, dass die zahlreichen Silberreifen an ihrem Arm fröhlich klingelten.
Voller Zuneigung betrachtete Catherine ihre Freundin mit ihrer Sechziger-Jahre-Frisur und der flippigen Kleidung. Anita hatte ihren Look nicht mehr verändert, seit sie einundzwanzig war. »Man ist so alt, wie man sich fühlt«, lautete ihr Wahlspruch. Es hatte schon Phasen gegeben, da hätte es Catherine in Rosemount vielleicht nicht mehr ausgehalten, wenn Anita nicht gewesen wäre. In letzter Zeit wurde geradezu penetrant von den Lehrkräften verlangt, Listen aufzustellen und Formulare auszufüllen, und dazu kamen noch die ständige Kritik und das Gefühl, für sämtliche Gebrechen der Gesellschaft verantwortlich gemacht zu werden. Anita hatte sie immer wieder aufgeheitert und sie daran erinnert, was für eine gute Lehrerin sie doch sei und dass die Kinder ihr Leben lang an sie zurückdenken würden.
»Herrgott, Anita. Es ist eiskalt hier draußen. Warum sitzt du denn nicht drinnen?«
»Zu verraucht und ekelhaft.«
»Im Lehrerzimmer ist es auch verraucht und ekelhaft.«
»Ja, aber das ist weiblicher Rauch. Der hier ist männlich.«
»Ich dachte schon, du wirfst in der Schule den Schwamm hin und schließt dich einer Polarexpedition an.«
»Nein.« Anita schob ihr ein Glas Glühwein hin. »Aber es könnte dich trotzdem interessieren, was ich dir zu sagen habe.«
Catherine setzte sich. Es sah Anita gar nicht ähnlich, so geheimnisvoll zu tun. »Dann schieß mal los.«
»Es dreht sich um Simon.« Simon war ihr charismatischer Rektor, ein menschlicher Dynamo, dessen Tag fünfundzwanzig Stunden zu haben schien. Catherine und Simon hatten ihre Ausbildung zusammen gemacht, und es war Simon gewesen, der sie vor acht Jahren nach Rosemount geholt hatte. Damals hatte die Schule einen so schlechten Ruf gehabt, dass niemand etwas mit ihr zu tun haben wollte. Damals schickten nur völlig entmutigte Eltern ihre Kinder nach Rosemount. Doch mittlerweile hatte sich der Ruf der Schule entscheidend verbessert. Erst gestern hatte Catherine einige Elternpaare herumgeführt, die mit sanfter Bestechung versucht hatten, ihr Kind dort unterzubringen, anstatt mit allen Mitteln darum zu kämpfen, dass es nicht dorthin gehen musste. Es war ein herrlicher Augenblick gewesen.
»Was ist mit Simon?«
»Es geht das Gerücht, dass er uns verlässt.«
Catherine fühlte sich wie getreten. Nicht so sehr, weil Simon ging; es war ganz normal, dass Rektoren nach der Zeitspanne wechselten, die er hier gearbeitet hatte, sondern weil er es ihr nicht gesagt hatte. Sie und Simon waren Freunde.
Sie stammten aus ähnlichen Verhältnissen und teilten die gleichen Ideale. So hatte er sie auch dazu überredet, an diese Schule zu kommen, wo sie doch mit Blick auf ihr berufliches Fortkommen etwas Besseres hätte haben können. »Unterrichte an einer netten, gutbürgerlichen Schule, wenn du möchtest«, hatte er sie beschworen. »Dann hast du ein leichteres Leben. Aber du kannst nicht so viel bewirken. Das hier sind die Kinder, deren Leben du verändern kannst.«
Sie hatte ihm geglaubt und es nie bereut. Nicht einmal, wenn Freundinnen, die an Privatschulen arbeiteten, mit ihren langen Ferien und ihren höflichen, wohlerzogenen Schülern prahlten. Es hatte einmal eine Zeit gegeben, damals am College, als Simon sich eine Liebesbeziehung mit ihr gewünscht hatte. »Dicke Freunde sind wir doch schon«, hatte er mit all seinem beträchtlichen Charme angeführt, »warum sollen wir uns damit zufriedengeben?« Auch sie war in Versuchung gewesen. Wie auch nicht? Aber dann hatte sie ganz unerwartet Christopher kennengelernt.
»Wohin geht er denn?«, fragte Catherine schließlich.
»An eine ›Schule in der Krise‹ – als ob das nicht alle wären. Aber du hast das Schlimmste noch nicht gehört. Wer angeblich anschließend Rektor werden soll.«
Catherine hörte nur mit halbem Ohr zu. Sie dachte daran, wie anders Rosemount ohne Simon wäre, ohne die Möglichkeit, Erfahrungen mit ihm auszutauschen. Die Vorstellung, dass er ging, war noch schmerzhafter, als sie befürchtet hatte.
»Nämlich Brian Wickes, verdammt noch mal«, flüsterte Anita.
»Das können sie doch nicht machen, oder?«
»Offenbar gefallen dem Schulbeirat seine Vorstellungen von Disziplin. Nachsitzen, Unterrichtsausschlüsse, Hinauswürfe. Vermutlich setzen sie Köpfen wieder auf die Schulordnung.«
»Und wie sicher ist dieses Gerücht?«
Anita tätschelte ihrer Freundin leicht die Wange. »Mehr oder weniger bombensicher. Jane Jones hat Brian im Computerraum einen Vermerk schreiben sehen, und als sie reinkam, hat er ihn wieder gelöscht.«
»Also ehrlich, Nita. Das könnte alles Mögliche sein.«
»Mhm. Nur dass die Datei REKTORENSTELLEROSEMOUNT hieß.«
Falls Catherine noch irgendeine Bestätigung gebraucht hatte, so bekam sie diese, als sie Simon bei ihrer Rückkehr vor ihrem Klassenzimmer stehen sah.
»Hast du mal einen Moment Zeit?«, fragte er.
Sie wies auf die Jungen, die sie zu sich bestellt hatte, weil sie Bonnie gequält hatten. »Kommt in einer halben Stunde in mein Büro«, wies er sie an. Mit unruhigen, schuldbewussten Mienen schlurften sie davon und machten nicht einmal eine freche Bemerkung, um ihre Freunde zu beeindrucken.
Catherine wusste sofort, dass das Gerücht mehr als nur Klatsch war. Simon trug eines seiner jugendlichen Jeanshemden, die Sorte, in der er eher wie ein markantes männliches Model aussah, nicht wie ein Schulrektor, doch seine Schultern nahmen eine defensive Haltung ein. In seinen Augen lag der mitfühlende Blick, den er für Gespräche mit Eltern reserviert hatte, deren Kind nicht richtig mitkam.
»Es stimmt also«, fiel Catherine mit der Tür ins Haus, ohne seine Erklärung abzuwarten.
»Leider ja. Pass mal auf, Cath, ich habe mich, so massiv ich konnte, für dich anstelle von Brian ins Zeug gelegt. Du wärst viel tüchtiger. Aber sie wollen unbedingt den vermaledeiten Brian.«