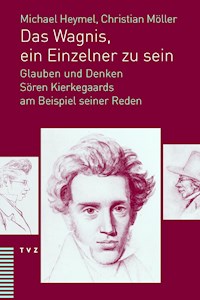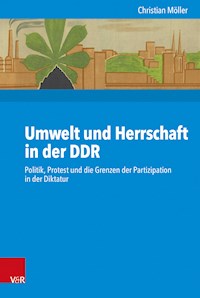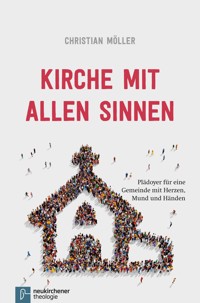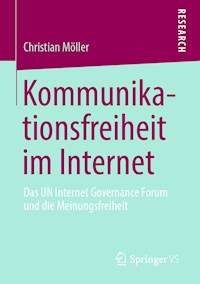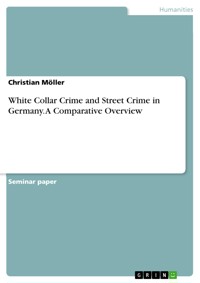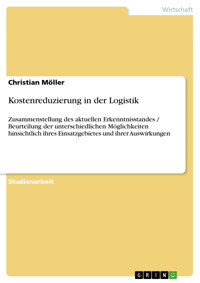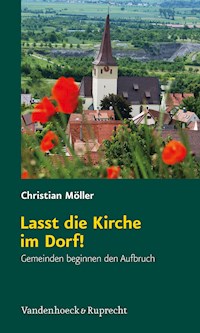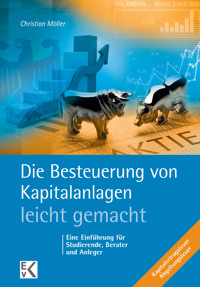
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Wissenschaft & Praxis
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Steuern und Kapitalanlagen? Wie ist der Staat an den Erfolgen von Geldanlagen beteiligt? Ein erfahrener Professor vermittelt verständlich die Besteuerung von Kapitalerträgen. Aus dem Inhalt:
– Abgeltungsteuer, Kapitalertragsteuer, Quellensteuer
– Sparbücher, Aktien, Investmentfonds
– Darlehn, Lebensversicherungen, Renten
– GmbH-Beteiligungen, Anleihen, Genussrechte
– Freistellung, Verlustverrechnung, Auslandserträge
Die kurze und präzise Erläuterung der nationalen und internationalen Aspekte. Ein Beistand für Studium, Beruf und private Anlage.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
leicht gemacht®
Die prägnanten, verständlichen Lehrbücher der
leicht gemacht® SERIEN
mit Beispielfällen, Übersichten und Leitsätzen
Unsere leicht gemacht® SERIEN haben Generationen von Studierenden erfolgreich in die verschiedenen Themenbereiche eingeführt.
►Die BLAUE SERIE vermittelt Themen der Bereiche Steuer und Rechnungswesen
►Die GELBE SERIE erläutertInhalte aus der Rechtswissen-schaft
Die Lehrbücher sind so angelegt, dass Vorkenntnisse nicht erforderlich und nach dem Durcharbeiten des Textes die wichtigen Grundlagen vermittelt sind. Sie eignen sich als Einstieg, aber auch zur Wiederholung vor Prüfungen.
Unsere Lehrbücher wenden sich an Studierende der Universitäten, Hochschulen und Berufsakademien, aber auch an Teilnehmer der berufsbezogenen Ausbildungen. Die Bücher der leicht gemacht® SERIEN vermitteln ebenso jedem Interessierten auf verständliche und kurzweilige Weise die Grundlagen von Steuer, Rechnungswesen und Rechtswissenschaft.
Die leicht gemacht® SERIEN erscheinen im
Ewald v. Kleist Verlag, Berlin
[1]
BLAUE SERIE leicht gemacht®
Herausgeber: Richter Dr. Peter-Helge Hauptmann
Die Besteuerung von Kapitalanlagen
leicht gemacht
Eine Einführung für Studierende, Berater und Anleger
von
Prof. Dr. Christian Möller, LL. M.
Professor an der Hochschule Hannover
Steuerberater
Ewald v. Kleist Verlag, Berlin
[2]
Besuchen Sie uns im Internet:www.leicht-gemacht.de
Autoren und Verlag freuen sich über Anregungen
Umwelthinweis: Dieses Buchwurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedrucktGestaltung: M. Haas, www.haas-satz.berlin; J. Ramminger Druck & Verarbeitung: Druckerei Siepmann GmbH, Hamburgleicht gemacht® ist ein eingetragenes Warenzeichen
© 2016 Ewald v. Kleist Verlag, Berlin
[3]
Inhalt
I.Überblick: Besteuerung von Kapitalerträgen
Lektion 1: Grundlagen
Lektion 2: Freistellung, Nichtveranlagung, Günstigerprüfung
II.Einkünfte aus Kapitalvermögen
Lektion 3: Überblick
Lektion 4: Klassische zinstragende Anlagen
Lektion 5: Aktien, GmbH-Beteiligungen und Genussrechte
Lektion 6: Investmentfonds
Lektion 7: Lebensversicherungen
Lektion 8: Kapitalanlagen im Betriebsvermögen
III.Einkünfteermittlung und Steuersatz
Lektion9: Ermittlung der Einkünfte und Steuersatz
Lektion 10: Zu- und Abflussprinzip
Lektion 11: Behandlung von Verlusten
IV.Die Rolle (vor allem) der Banken: Kapitalertragsteuer
Lektion 12: Erfasste Einkünfte und Abzugsverpflichteter
Lektion 13: Berechnung der Kapitalertragsteuer
Lektion 14: Ausländische Steuern, Verlustverrechnung
Lektion 15: Einzelfragen zur Kapitalertragsteuer
V.Die Sicht des Anlegers
Lektion 16: Abgeltungswirkung und Ausnahmen
Sachregister
[4]
Übersichten
Übersicht1 Steuerliche Anträge
Übersicht2 Wichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen
Übersicht3 Steuerliche Einordnung der Kapitalanlagen
Übersicht4 Geschlossene Fonds / Offene Fonds
Übersicht5 Besteuerung von Fonds
Übersicht6 Besteuerung von Kapital-Lebensversicherungen
Übersicht7 Subsidiäre Behandlung von Kapitaleinkünften
Übersicht8 Gewinn- und Überschusseinkünfte
Übersicht9 Ausländische Steuern im Veranlagungsverfahren
Übersicht 10 Ausnahmen vom Abgeltungsteuersatz
Übersicht 11 Verrechnung von Verlusten
Übersicht 12 Dividenden und GmbH-Gewinnausschüttungen
Übersicht 13 EK-Genussrechte / FK-Genussrechte
Übersicht 14 Verlusttopf und Verlustbescheinigung
Übersicht 15 Ausnahmen von der Kapitalsetragssteuer
Übersicht 16 Deklarierungspflichtige Kapitalerträge
Übersicht 17 Privatanleger und Betrieblicher Anleger
Übersicht 18 Optionale Veranlagung
Übersicht 19 Veranlagung durch den Anleger
[5]
I.Überblick: Besteuerung von Kapitalerträgen
Lektion 1: Grundlagen
Die folgenden kleinen Fälle rund um Herrn Ackermann und dessen Tagesgeldkonto geben einen ersten Einblick in die Besteuerung von Einkünften aus Kapitalvermögen. Gleichzeitig werden grundlegende Begriffe - Einkommensteuer, Kapitalertragsteuer, Abgeltungsteuer - und deren Verhältnis zueinander geklärt.
Fall 1
Der ledige und konfessionslose Herr Ackermann hat ein Tagesgeldkonto bei der Commerzbank. In einem Veranlagungszeitraum (= Kalenderjahr, § 25 Abs. 1 EStG) hat die Bank 20.000 € Zinsen errechnet und Ackermann nach Abzug von Kapitalertragsteuer (5.000 €) und Solidaritätszuschlag (275 €) einen Betrag von 14.725 € gutgeschrieben. Ackermann hat dazu einige Fragen. Zunächst möchte Ackermann wissen, warum die Commerzbank überhaupt Kapitalertragsteuer einbehalten hat. Unterliegen Zinsen nicht der Einkommensteuer?
Der Einkommensteuer unterliegt nach § 1 Abs. 1 S. 1 EStG das Einkommen der natürlichen Personen (Menschen). Einkommen kann sich aus verschiedenen Quellen ergeben. Das Einkommensteuergesetz (EStG) zählt sieben Einkunftsarten auf, die die steuerbaren von den nicht steuerbaren Einnahmen abgrenzen.
Nach § 2 Abs. 1 EStG unterliegen der Einkommensteuer:
1.Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
2.Einkünfte aus Gewerbebetrieb
3.Einkünfte aus selbständiger Arbeit
4.Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
5.Einkünfte aus Kapitalvermögen
6.Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
7.sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 EStG
Unter anderem unterliegen nach dieser Aufzählung Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer (§ 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 EStG). Was darunter im Einzelnen zu verstehen ist, regelt § 20 EStG. Darin enthalten [6]ist ein Katalog der Einkünfte aus Kapitalvermögen. Teil dieses Kataloges sind „Erträge aus sonstigen Kapitalforderungen“ (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 S. 1 EStG). Darunter fallen die Zinsen, die Ackermann für sein Tagesgeld bekommt.
In Fall 1 unterliegt Ackermann mit den Zinsen auf sein Tagesgeld also der Einkommensteuer.
Leitsatz 1
Einkünfte aus Kapitalvermögen
Die Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 EStG) sind eine der sieben vom Einkommensteuergesetz erfassten Einkunftsarten. Entsprechend unterliegen der der Einkommensteuer.
Fall 2
Ackermann fragt nun, ob die demnach geschuldete Einkommensteuer noch zu der von der Commerzbank einbehaltenen Kapitalertragsteuer hinzukommt. Ist das der Fall?
Die Kapitalertragsteuer, geregelt in §§ 43 ff. EStG, ist keine eigene Steuerart, sondern lediglich eine spezielle Erhebungsform (Verwaltungsform) der Einkommensteuer (wenn der Anleger eine natürliche Person ist) oder der Körperschaftsteuer (wenn der Anleger eine Körperschaft - insbesondere GmbH oder AG - ist). Um die Besonderheit dieser Verwaltungsform zu verstehen, müssen wir uns zunächst vor Augen führen, wie Einkommen- und Körperschaftsteuer üblicherweise erhoben (verwaltet) werden. Die folgende Betrachtung beschränkt sich auf die Einkommensteuer. Für die Körperschaftsteuer gelten aber dieselben Grundsätze.
Regelmäßig wird Einkommensteuer in der Weise erhoben, dass der Steu-erpflichtige zunächst Einkünfte erzielt und diese dann jährlich in einer Steuererklärung deklariert (§ 25 Abs. 3 S. 1 EStG). Das Finanzamt berechnet nach den Angaben des Steuerpflichtigen die Steuer und setzt sie in einem Steuerbescheid fest. Erst dann zahlt der Steuerpflichtige die entstandene Steuer. Dieses übliche Erhebungsverfahren (als „Veranlagung“ bezeichnet) ist fehleranfällig. Es setzt nämlich voraus, dass Einkünfte vollständig und richtig angegeben werden. Nicht jeder Steuerpflichtige tut dies. Wenn dem Finanzamtunrichtige Angaben auffallen (etwa im [7]Rahmen einer Außenprüfung nach §§ 194 ff. AO), drohen zwar nicht nur Nachzahlungen, sondern auch eine Strafbarkeit wegen Steuerhinterziehung (§ 370 AO).
Diese Androhung verhindert unterbliebene oder falsche Steuererklärungen - und damit Steuerausfälle - in der Praxis aber nicht. Das Veranlagungsverfahren führt zudem dazu, dass der Fiskus Steuerzahlungen erst spät erhält (die Festsetzung von Vorauszahlungen nach § 37 EStG schafft hier eine gewisse Abhilfe).
Im Bereich der Einkünfte aus Kapitalvermögen hat der Gesetzgeber mit der Kapitalertragsteuer (geregelt in §§ 43 ff. EStG) ein besonderes Erhebungsverfahren eingeführt, das die geschilderten Nachteile vermeiden soll: Nach § 43 Abs. 1 S. 1 EStG „wird die Einkommensteuer durch Abzug vom Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) erhoben“. In dieser Erhebung spielt (bezogen auf unser Beispiel der Tagesgeldzinsen) die Bank als auszahlende Stelle die zentrale Rolle. Der Staat spannt die Bank als seinen „Erfüllungsgehilfen“ in die Steuerverwaltung ein. Sie wird verpflichtet, geschuldete Zinsen nicht vollständig (brutto) an den Sparer auszuzahlen, sondern davon zunächst die Kapitalertragsteuer (nebst Solidaritätszuschlag, dazu unten) abzuziehen. Die einbehaltene Kapitalertragsteuer ist an das Finanzamt abzuführen. Der Sparer erhält nur den sich nach diesem Abzug ergebenden Nettobetrag ausgezahlt.
Bei einem zu geringen Kapitalertragsteuer-Abzug haftet die Bank dem Finanzamt für den Fehlbetrag (§ 44 Abs. 5 EStG). Das gilt auch bei einem fälschlich ganz unterlassenen Abzug. In dieser Haftung liegt ein starker Anreiz für die Bank, bei der Berechnung genau hinzusehen. Die Gewähr dafür, dass die geschuldete Steuer tatsächlich gezahlt wird, steigt dadurch gegenüber dem üblichen Erhebungsverfahren durch Veranlagung. Nach § 44 Abs. 1 S. 5 EStG ist die innerhalb eines Kalendermonats von einer Bank einbehaltene Steuer zudem jeweils spätestens bis zum zehnten Tag des folgenden Monats an das Finanzamt abzuführen. Die Kapitalertragsteuer führt also auch dazu, dass der Fiskus im Vergleich zur Steuerzahlung nach Veranlagung früh an sein Geld kommt.
Exkurs:Genau wie die hier behandelte Kapitalertragsteuer ist übrigens auch die Lohnsteuer (§§ 38ff. EStG) keine eigene Steuerart, sondern lediglich eine besondere Erhebungsform der Einkommensteuer, die eingreift, wenn Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 EStG) erzielt werden [8](insb. Arbeitslohn). Auch bei der Lohnsteuer zieht derArbeitgeber vom Bruttolohn des Arbeitnehmers die dadurch ausgelöste Einkommensteuer ab und führt sie an das Finanzamt ab; dem Arbeitnehmer wird nur der verbleibende Nettolohn ausgezahlt.
Weil Kapitalertragsteuer und Lohnsteuer zu einem Steuerabzug „an derQuelle“ führen, werden sie als „Quellensteuern“ bezeichnet. Genau genommen - das sei noch einmal betont - handelt es sich aber nicht um eigenständige Steuern, sondern nur um spezielle (aus Sicht des Fiskus komfortable) Verfahren zur Verwaltung der Einkommen- und Körperschaftsteuer.
Die Lösung zu Fall 2 lautet daher: Die Einkommensteuer kommt nicht noch zu der von der Commerzbank einbehaltenen Kapitalertragsteuer hinzu. Die Einkommensteuer ist vielmehr bereits erhoben worden - im Wege der Kapitalertragsteuer.
Leitsatz 2
Besondere Erhebungsform
Die Kapitalertragsteuer ist keine eigene Steuerart, sondern lediglich eine besondere Erhebungsform der Einkommen- oder Körperschaftsteuer.
Fall 3
Ackermanns nächste Frage: Woher kommt der fixe Steuersatz von 25 %, den die Commerzbank angewendet hat? Gilt bei der Einkommensteuer nicht sonst ein progressiver Tarif (also die Regel, dass der Steuersatz mit steigendem Einkommen steigt)?
Es ist richtig, dass der allgemeine Einkommensteuertarif (geregelt in § 32a EStG) progressiv ist: Das zu versteuernde Einkommen wird bis zu einem Grundfreibetrag von ca. 8.500 € (regelmäßige Anpassungen) gar nicht besteuert. Die darüber hinausgehenden Einkommensteile werden zunächst moderat besteuert - der erste Euro mit 14 % - und inder Spitze mit 45 %. Je höher das Einkommen ist, desto höher ist also nicht nur der absolute Steuerbetrag, sondern auch der in Prozent ausgedrückte Steuersatz.
[9]
Dieser progressive Tarifverlauf gilt für alle sieben Einkunftsarten mit einer Ausnahme - den Einkünften aus Kapitalvermögen. Hier gilt gemäß § 32d Abs. 1 EStG ein spezieller Steuersatz von 25 %. Dieser ist von der Höhe der Kapitaleinkünfte unabhängig. I.H.v. 25 % nimmt die Bank in unserem Beispielsfall auch den Kapitalertragsteuer-Abzug vor (§ 43a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG). Mit diesem Abzug ist die Einkommensteuer in vielen Fällen abgegolten (§ 43 Abs. 5 S. 1 EStG; zu Ausnahmen s.u. Lektion16). Diese Abgeltungswirkung ist der Grund dafür, dass dann, wenn Einkommensteuer im Wege der Kapitalertragsteuer erhoben wird, häufig auch von Abgeltungsteuer die Rede ist.
Wegen der abgeltenden Wirkung des Steuerabzugs an der Quelle sind die davon erfassten Einkünfte i.d.R. nicht mehr in der ESt-Erklärung anzugeben.
In Fall 3 ist bei Ackermann die Einkommensteuer im Wege der Kapi-talertragsteuer (Einbehaltung und Abführung durch die Bank) erhoben worden. Mit diesem Abzug ist die Einkommensteuer für Ackermann abgegolten.
Leitsatz 3
Einkommensteuer, Kapitalertragsteuer und Abgeltungsteuer
Einkommensteuer, Kapitalertragsteuer und Abgeltungsteuer sind nicht drei verschiedene Steuerarten. Richtig ist vielmehr: Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen der Einkommensteuer. Diese wird regelmäßig im Wege der Kapitalertragsteuer erhoben - also im Wege eines speziellen Erhebungsverfahrens, das den Steuerabzug durch den Schuldner vonKapitalerträgen oder eine andere Zahlstelle mit einem speziellen Steuersatz von 25 % (nebst SolZ) vorsieht. Weil sich mit diesem Abzug die Steuererhebung für den Steuerpflichtigen regelmäßig erledigt hat (die Einkommensteuer ist durch den Abzug „abgegolten"), wird dieses System häufig (nicht vom Gesetzgeber) als Abgeltungsteuer bezeichnet.
[10]
Leitsatz 4
Begriff Quellensteuern
Kapitalertragsteuer und Lohnsteuer sind (nur) eine besondere Erhebungsform der Einkommensteuer. Weil in beiden Fällen die Steuer bereits „an der Quelle" für Rechnung des Gläubigers abgeführt wird, werden Lohn- und Kapitalertragsteuer auch als „Quellensteuern" bezeichnet.
Fall 4
Ackermann fragt weiter, warum die Commerzbank neben 25 % Kapitaler-tragsteuer auch einen Solidaritätszuschlag einbehalten hat.
Der Solidaritätszuschlag (umgangssprachlich „Soli“) ist eine Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer und zur Körperschaftsteuer. Die Einführung dieser Abgabe wurde mit den hohen Staatsausgaben zur Bewältigung der deutschen Einheit begründet. Das Aufkommen steht allein dem Bund zu.
Wie oben ausgeführt, ist die Kapitalertragsteuer als „Quellensteuer“ nur eine besondere Erhebungsform der Einkommen- oder Körperschaftsteuer. Es ist daher folgerichtig, dass auch auf die Kapitalertragsteuer der Soli-daritätszuschlag als Ergänzungsabgabe erhoben wird (§ 3 Abs. 1 SolZG). Bemessungsgrundlage für den Solidaritätszuschlag ist der Steuerbetrag, an den die Ergänzungsabgabe anknüpft. Der Steuersatz beträgt 5,5 %.
Die Lösung des Falls 4: Die Commerzbank hat zutreffend neben Kapi-talertragsteuer von 5.000 € auch einen Solidaritätszuschlag von 275 € einbehalten.
Leitsatz 5
Solidaritätszuschlag
Der Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabezur Einkommensteuer und zur Körperschaftsteuer beläuft sich auf 5,5 % des Betrages dieser Steuern (Achtung: nicht auf 5,5 % der Bemessungsgrundlage dieser Steuern). Weil die Kapitalertragsteuerlediglich eine besondere Erhebungsform der Einkommen- oder Körperschaftsteuer ist, wird auch darauf der Solidaritätszuschlag erhoben.
[11]
Lektion 2: Freistellung, Nichtveranlagung, Günstigerprüfung
Freistellungsauftrag
Fall 5
Die Commerzbank hat bei der Auszahlung von Zinsen in Höhe von 50.000 € an Herrn Buffet Kapitalertragsteuer in Höhe von 12.500 € nebst Soli einbehalten. Herr Buffet überlegt, was er hätte tun können, um den Steuerabzug (teilweise) zu vermeiden.
Einkünfte aus Kapitalvermögen bleiben bis zu einem Betrag von 801 € (Bei zusammenveranlagten Ehegatten und Partnern einer eingetragenen Lebenspartnerschaft: 1.602 €) steuerfrei („Sparer-Pauschbetrag“, § 20 Abs. 9 EStG). Der Sparer kann seiner Bank einen Freistellungsauftrag erteilen und damit erreichen, dass die Bank die Kapitalertragsteuer nicht auf die vollen Zinsen berechnet, sondern davon zunächst den Sparer-Pauschbetrag abzieht (§ 44a Abs. 1 S. 1 Nr. 3, Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EStG).
Lösung des Falls 5: Hätte Buffet der Commerzbank einen Freistellungs-auftrag über den vollen Sparer-Pauschbetrag erteilt, hätte diese Kapi-talertragsteuer nur auf 49.199 € (48.398 € wenn verheiratet) berechnet. Entsprechend hätte sich auch der Solidaritätszuschlag reduziert.
Wer Anlagen bei mehreren Banken unterhält, kann mehrere Freistel-lungsaufträge erteilen. Insgesamt darf dabei der Sparer-Pauschbetrag von 801 €/1.602 € nicht überschritten werden. Wer auf einen oder mehrere Freistellungsaufträge verzichtet, kommt trotzdem in den Genuss des Sparer-Pauschbetrages, allerdings nur im Rahmen des Veranlagungsver-fahrens. Die Kapitalerträge müssen dazu in der Einkommensteuererklä-rung angegeben werden (dies ist sonst regelmäßig entbehrlich). Zudem ergibt sich ein kleiner Liquiditätsnachteil, weil die von der Bank in einem Kalenderjahr einbehaltene Steuer erst angerechnet oder erstattet wird, sobald ein Einkommensteuerbescheid ergangen ist - meistens also in der zweiten Hälfte des folgenden Kalenderjahres.
Die Banken melden jeweils dem Bundeszentralamt für Steuern die Höhe der vom Quellensteuerabzug freigestellten Kapitalerträge (§ 45d EStG). Das Amt kann so prüfen, ob Steuerpflichtige mehrere Freistellungsaufträge[12]erteilen, die in der Summe zur Überschreitung des Pauschbetrags führen.
Nichtveranlagungsbescheinigung
Eine weitere Möglichkeit haben Steuerpflichtige, deren gesamte Einkünfte (einschließlich jener aus Kapitalvermögen) so gering sind, dass Einkom-mensteuer voraussichtlich nicht anfallen wird. Dazu ist insbesondere der Grundfreibetrag zu berücksichtigen, wonach ein zu versteuerndes Einkommen von ca. 8.500 € (regelmäßige Anpassung) steuerfrei bleibt.
Wer „Geringverdiener“ in diesem Sinne ist, kann eine Nichtveranlagungs-bescheinigung (NV-Bescheinigung) bei seiner Bank einreichen. Dadurch wird jeglicher Kapitalertragsteuer-Abzug vermieden (§ 44a Abs. 1 S. 4, Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EStG). Während der Anleger einen Freistellungsauftrag selbst ausstellt, muss er eine NV-Bescheinigung bei seinem zuständigen Wohnsitzfinanzamt beantragen.
In der Praxis nutzen vor allem Ruheständler, die insgesamt nur geringe Einkünfte haben, die Vorzüge der NV-Bescheinigung.
Im Fall 5 wird Buffet eine NV-Bescheinigung dagegen nicht erhalten, weil schon seine Einkünfte aus Kapitalvermögen deutlich über dem Grundfreibetrag liegen.
[1]