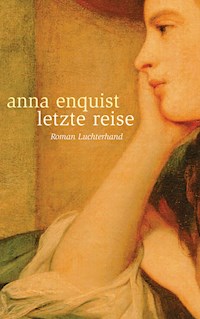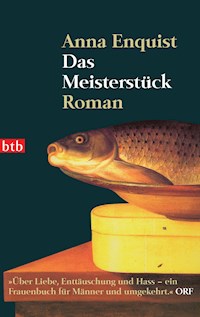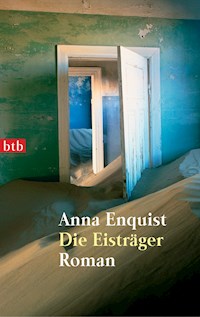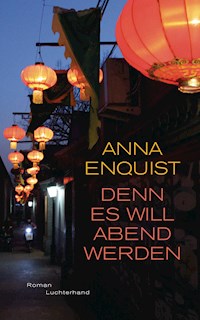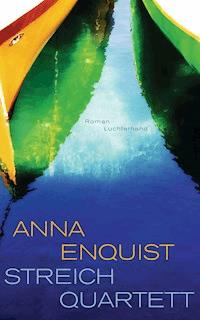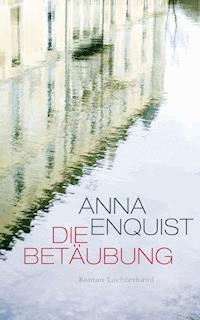
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Tod eines geliebten Menschen trifft uns alle gleich. Aber jeder reagiert anders darauf: Die einen stürzen sich in die Arbeit, um sich abzulenken, andere beginnen an sich und der Welt zu zweifeln, verlieren den Boden unter den Füßen. Und so sehr wir uns auch vielleicht um eine Rückkehr zur Normalität bemühen, eine Frage bleibt: Können wir den Verlust eines geliebten Menschen wirklich jemals verwinden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Anna Enquist
Die Betäubung
Roman
Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers
Luchterhand
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel De verdovers bei De Arbeiderspers, Amsterdam.
Die Übersetzerin und der Verlag danken Prof. Dr. Stephan Loerfür seine Beratung in Fragen der medizinischen Fachterminologie.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2011 Anna Enquist
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2012
Luchterhand Literaturverlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-08563-6
www.luchterhand-literaturverlag.deBitte besuchen Sie auch unseren LiteraturBlog www.transatlantik.de
I. Exposition
1
Drik de Jong wartet.
Er wartet in seinem eigenen Wartezimmer, das eigentlich kein Zimmer ist, sondern eine Nische unter der Treppe, in die nur ein einziger Sessel passt. An der geraden Wand hängt ein Foto von einer Baumreihe in einer Polderlandschaft.
Drik de Jong wartet auf einen neuen Patienten. Will er spüren, wie es für so jemanden sein mag, hier zu sitzen und zu warten? Unwahrscheinlich. Hier sitzt so gut wie nie jemand, denn Drik legt seine Termine so, dass reichlich Zeit dazwischen ist und sich die Patienten nicht über den Weg laufen.
Die Flügeltür zu seinem Sprechzimmer steht offen, die Lampen über dem Schreibtisch und schräg hinter dem Therapeutensessel sind an, obwohl es elf Uhr vormittags ist. Er hat kurz dort Platz genommen und auf die schmuddelige Gardine vor dem bewölkten Himmel geschaut – es ist Oktober, das Licht nimmt ab. Aber nicht hier, dachte er, in dieses Zimmer gehört warmes, gelbliches Licht. Einen Vorrat Glühbirnen anlegen, jetzt, da es noch geht, die vorgeschriebenen neuen Energiesparlampen sind grässlich. Gefängnisbeleuchtung.
Er blickt auf seine Armbanduhr. In drei Minuten. Noch kurz pinkeln? Lieber nicht. Da wäschst du dir dann gerade die Hände, und hinter dir gurgelt der Spülkasten, wenn es klingelt.
Nicht nur der Patient ist vor dem Erstkontakt angespannt. Auch für den Therapeuten ist das ein kritischer Moment. Da hat so vieles gleichzeitig zu geschehen. Hinschauen, zuhören, Kontakt herstellen, sich ein Bild machen, urteilen, entscheiden, einprägen. Während man sich bestmöglich konzentriert, muss man dennoch so entspannt sein, dass man auch wirklich einen Eindruck von seinem Gegenüber gewinnen kann. Drik holt tief Luft.
Er hat mehr als ein halbes Jahr lang nicht gearbeitet. Als seine Frau ernstlich krank wurde, hatte er seine Praxis zugemacht. Zwei Analysen konnte er noch abschließen, vorzeitig und etwas zu abrupt, aber es ging. Einen dritten Analysanden überwies er an einen Kollegen, ebenso wie einige Therapiepatienten. Neue Fälle nahm er nicht mehr an. Mit einem Mal waren die Tage leer, und er kam kaum noch in sein Sprechzimmer.
Das Gartenzimmer wurde zum Schwerpunkt des Hauses. Dort lag Hanna in so einem viel zu hohen Krankenhausbett und erwartete ihren Tod. Dort tauchten Sauerstoffflaschen, Morphinpumpe, Infusionsständer auf. Dort drängten sich viele Menschen – der Hausarzt, Freunde, Krankenschwestern, ein Anästhesiepfleger aus dem Krankenhaus. Drik selbst stand mit dem Rücken an der Wand und hielt sich aus allem raus. Seine Schwester war da, Suzan.
Er hatte sie immer als die kleine Schwester gesehen, die vier Jahre Jüngere. Jetzt übernahm sie die Regie. Zu seiner Verblüffung setzte sie ihre Beurlaubung auf unbestimmte Zeit durch. Es treffe sich gut, sagte sie, sie hätten ohnehin gerade zu viele Anästhesisten auf der Abteilung, weil die Hälfte der Operationssäle umgebaut werde, da könne sie getrost eine Zeitlang wegbleiben. Sie hatte Hanna gern und wollte ihm eine Stütze sein. Sie wollte es ihrer Schwägerin ermöglichen, den ganzen traurigen Weg in ihrem eigenen Haus, mit Blick auf den Garten zurückzulegen. Gegen Ende blieb sie oft über Nacht. Auf der Analysecouch.
Nicht daran denken jetzt. Nicht an das Ende. Die Beziehung zu Suzan, das ist etwas, woran er denken kann. Sie kam ihm so nahe wie früher, aber in einer anderen, vertauschten Rolle. Auf einmal war sie die Tonangebende, und er wurde von ihr abhängig. Dabei ist es in mancher Hinsicht auch geblieben. Mindestens dreimal die Woche setzt er sich bei seiner Schwester an den Tisch und isst mit ihr, ihrem Mann Peter – der zugleich sein bester Freund ist – und manchmal auch ihrer beider Tochter Roos zu Abend. Das gefällt ihm, das ist, als sei er Teil einer Familie. Er möchte nicht, dass sich das ändert. Eine regressive Regung. Er gesteht sie sich zu.
Drik lehnt sich im Sessel zurück und lässt den Kopf an der Wand ruhen. Irgendwo draußen sitzt jetzt ein junger Mann im Auto und wartet, dass es elf Uhr wird. Vor ein paar Wochen hat Peter angerufen: »Wird es nicht allmählich Zeit, dass du wieder etwas tust? Du beteiligst dich bei unseren Intervisionsabenden immer so rege, da dachte ich mir, es wäre vielleicht gut, so langsam wieder anzufangen.«
Obwohl Drik seine Arbeit niedergelegt hatte, war er weiterhin zu den zweiwöchentlichen Intervisionstreffen gegangen. Er konnte zwar selbst keine Patienten mehr einbringen, hörte sich aber gerne an, was seine Analytikerkollegen aus ihrer Praxis erzählten. Manche hatten ja auch ehemalige Klienten von ihm in Behandlung, so dass er deren Leben ein bisschen weiterverfolgen konnte. Doch je schlechter es Hanna ging, desto weniger Anteil konnte er nehmen. Er saß noch dabei, weil Worte gesprochen wurden, die nicht Hanna betrafen, weil er unter Freunden, aus dem Haus sein wollte. Aber gerade weil es nicht um Hanna ging, schienen die Freundschaftsbande immer dünner zu werden. Er fühlte sich mehr und mehr allein. Gegen Ende war er nicht mehr hingegangen.
»Hast du eine Überweisung?«, hat er Peter gefragt. Peter arbeitet im Psychiatrischen Krankenhaus und ist dort für die fachärztliche Weiterbildung zuständig. Dazu gehört auch, dass er die Lehrtherapie koordiniert, die alle angehenden Psychiater im Laufe der Weiterbildung machen müssen. Gerade hatte ein junger Mann bei ihm vorgesprochen, der schon ernsthaft an eine Therapie dachte, obwohl er gerade erst angefangen hatte – die meisten schoben das bis zum dritten oder vierten Jahr der Weiterbildung hinaus, wenn sie selbst bereits längere Behandlungen übernehmen mussten. Dieser junge Mann wollte jetzt schon. Peter dachte dabei an Drik.
»Sag ihm, er soll anrufen. Wie heißt er?«
Wenn einer so schnell anfangen will, steckt etwas dahinter, überlegte Drik. Er dürfte irgendwas auf dem Herzen haben, Hilfe benötigen. Da kann ich gleich richtig anfangen und brauche nicht wochenlang herumzustochern, bis das verdrängte Elend zutage kommt.
Er streckt die Beine aus. Zwei gleiche Socken, das ist schön. Ungeputzte Schuhe, das schon weniger. Der Holzfußboden im Flur glänzt. Die Garderobe ist bis auf einen Regenschirm leer. Durch die offen stehenden Türen des Sprechzimmers strömt Licht. Alles bereit, denkt er. Jetzt noch ich. Bekanntschaft schließen, Anhaltspunkte dafür finden, was er will und was er erwartet, Konditionen vereinbaren, eine feste Zeit – obwohl, ich bin jetzt so flexibel wie nur was –, den Tarif, die monatliche Abrechnung, die vermutliche Dauer des Ganzen, fünfzig Sitzungen werden ihm im Rahmen seiner Ausbildung vergütet, alles darüber hinaus muss er selbst zahlen, gut, das schon mal zu sagen, Zeitdruck kann ich nicht brauchen – ob Suzan heute Abend kocht oder Peter? Nachher, nach diesem Patienten, eine Runde Fahrrad fahren oder laufen, das hebt die Laune. Nur nicht, wenn man dabei ins Grübeln gerät. Er sieht das bleiche Gesicht Hannas vor sich, und ein übermächtiges Gefühl des Scheiterns ergreift Besitz von ihm.
Die Kinderlosigkeit. Krampfhaft hatten sie sich ihrer Arbeit gewidmet, waren bemüht gewesen, für alles Mögliche Interesse aufzubringen – Bergwandern, Oper, Freunde. Alles vom Scheitern gefärbt, wenn sie auch nie darüber redeten. Hanna hatte wirklich Spaß an ihrer Arbeit gehabt. Historische Untersuchungen zur Mentalität der Menschen im achtzehnten Jahrhundert – Aufklärung, Wissenschaft, religiöser Wandel. Sie gab glutvolle Seminare für Studenten, von denen sie mit aufrichtigem Engagement sprechen konnte. Er spitzte dann sein professionelles Ohr und forschte nach Spuren von Ambivalenz, nach allzu aufgesetztem, allzu rigidem Optimismus, nach Hinweisen für innere Abwehr. Lass sie doch, dachte er anschließend, sie heuchelt nicht, sie scheint das wirklich zu genießen. Diese Kinder mögen sie, und sie ist dort in ihrem Element, Zufriedenheit allenthalben. Warum musst du denn wieder etwas zu bemängeln haben? Was sie tut und wie sie es tut, unterscheidet sich doch nicht wesentlich von deiner Haltung zur Arbeit, und die ist in deinen Augen ganz normal. Du liebst deinen Beruf und findest ihn faszinierend, obwohl man ihn genauso gut blödsinnig finden könnte. Eine rund zehnjährige Ausbildung, nach dem Facharzt für Psychiatrie oder, wie Peter es gemacht hatte, nach der Ausbildung zum klinischen Psychologen. Völliges Eintauchen in ein größtenteils überholtes psychoanalytisches Denken, Unterwerfung unter ein obsoletes Konstrukt aus Kursen, Seminaren und Supervision, jahrelange Lehranalyse. Das kostete insgesamt so viel Zeit, Geld und Aufmerksamkeit, dass man den Eindruck haben konnte, es sei das Allerwichtigste auf Erden. Die hierarchische Struktur der psychoanalytischen Vereinigung, in deren Händen die Ausbildung lag, hatte etwas von einer Glaubensgemeinschaft, einer Sekte, und ließ die angehenden Psychoanalytiker zu Schulkindern mutieren. Beim wöchentlichen Kursabend saßen sie zu zehnt mit dem Dozenten am Tisch und hatten Angst, dass sie drankommen könnten. Sie hatten ein schlechtes Gewissen, wenn sie die aufgegebenen Artikel nicht gelesen hatten, und alberten herum wie Grundschüler. Tagsüber leisteten sie eine schwere und verantwortungsvolle Arbeit, abends fielen sie in eine Rolle zurück, die nicht zu ihrem Alter passte. Gar nicht so unangenehm oft. Aber schon seltsam.
Es gab auch eine andere Seite: Er hatte dort viel gelernt und die Gelegenheit gehabt, sich in unterschiedlichen Ausbildern zu spiegeln, ein Gefühl dafür zu entwickeln, ob er so werden wollte oder nicht. Er war gezwungen gewesen, zu reflektieren und seinen eigenen Weg zu finden, und dieser Prozess hatte ihn zu dem Therapeuten geformt, der er heute war. Die Freundschaft zu Peter war dabei von unschätzbarem Wert gewesen. Mit gegenseitiger Hilfe war es ihnen gelungen, sich von der vorgeschriebenen analytischen Identität zu lösen, und begeistert hatten sie ihr neues Wissen in die psychiatrische Weiterbildung eingebracht, in der sie beide tätig waren. Peter war es früher als ihm selbst geglückt, die Bedeutung der psychoanalytischen Vereinigung zu relativieren, weil die Familie für ihn von größerer Wichtigkeit war. Kinder gehen vor.
Drik hatte mit dem unerfüllt bleibenden Kinderwunsch, dem Misserfolg, dem Scheitern jahrelang ganz gut umgehen können. Er hatte sich an Hannas Unerschütterlichkeit aufgerichtet. Und als die Phase der Fruchtbarkeitsuntersuchungen vorbei war, hatten sie ihr gemeinsames Geheimnis stillschweigend für sich behalten. Eine merkwürdige Erleichterung hatte ihn damals erfasst. Es musste nicht mehr sein.
Unterdessen war Roos zur Welt gekommen. Drik sieht noch vor sich, wie Hanna das Baby im Arm hielt, ein stehendes Bild mit der Klarheit eines Jan van Eyck, in kräftigen Farben, ohne Ton. Er selbst stand, von sinnlosen, bleischweren Schuldgefühlen gepeinigt, in der Tür, hin- und hergerissen zwischen Hoffnung und Angst. Sie wird in eine unbehandelbare Depression stürzen, apathisch werden, mich verstoßen. So dachte er. Das Baby griff nach Hannas Finger und führte ihn an seinen Mund. Saugte daran. Hanna lachte und schaute ihn an. Sie sah glücklich aus.
Er hatte daran glauben wollen. Sie hatten sich beide für ihre kleine Nichte ins Zeug gelegt, waren neben den Eltern zu wichtigen Bezugspersonen für Roos geworden. Peter und Suzan hatten sie großherzig und wie selbstverständlich an allen Familienfeierlichkeiten teilhaben lassen. Geburtstage, Sinterklaas, Ferien.
Jede innige Beziehung birgt Schmerz in sich. Roos ist an Hannas Krankheit fast kaputtgegangen. Anfangs wollte sie es nicht wahrhaben und ging hartnäckig davon aus, dass sie wieder gesund werden würde. Als sie daran nicht mehr festhalten konnte, brachte sie es kaum noch fertig, ihre Tante zu sehen. Wenn sie kam, sagte sie kein Wort, sondern stürmte gleich wieder aus dem Krankenzimmer hinaus in die Küche und weinte untröstlich. Sie wandte sich von ihrer Mutter ab – die war Ärztin und konnte das Unheil doch nicht verhüten. Roos fühlte sich verraten. Zwanghaft und überstürzt suchte sie sich eine eigene Wohnung, sie musste weg von zu Hause, so schnell wie möglich. Suzan ließ es geschehen, schließlich war das Kind ja neunzehn und studierte schon. Peter machte sich Sorgen, wollte seiner Tochter aber keine Steine in den Weg legen. Er tat alles dafür, den Kontakt zu ihr nicht zu verlieren.
Das Arbeitsbündnis gewährleisten, denkt Drik. Er muss schmunzeln und merkt, wie sehr er die Gesichtsmuskeln angespannt hat. Das Arbeitsbündnis hat Priorität, das darf ich nicht vergessen. Keiner hat etwas davon, wenn der Patient wegläuft. Und das tut er, wenn du ihn mit Ansichten und Erkenntnissen konfrontierst, bevor er dir ausreichend vertraut. Also: Nicht alles sagen, was du dir denkst, verkneif dir das, versuch zu erspüren, was dein Patient in diesem Moment braucht.
Es ist zwei Minuten nach elf. Der Patient ist entweder spät dran, oder Driks Uhr geht vor. Er erhebt sich und spaziert durch den Flur. Auf dem lackierten Holz des Fußbodens machen seine Sohlen ein klatschendes Geräusch. An der Schwelle zu seinem Sprechzimmer bleibt er stehen und schaut.
Was für eine abgewohnte Rumpelkammer eigentlich. Dieser Therapeutensessel mit den blank gewetzten Armlehnen und der speckigen Kopfstütze. Mit der Mulde, die er in zwanzig Jahren hineingesessen hat. Im Fußbereich verschlissene Stellen im Teppich, eingetretene Pfade zu Patientensessel und Schreibtisch. Die nutzlos gewordene Couch mit ihren Kissen, das wackelige Tischchen mit der Box Papiertaschentücher. Das Bücherregal mit uralten analytischen Standardwerken: Kohut und Kernberg, Karen Horney, Fenichel, ein Meter Freud, der rätselhafte Greenson. Auf den unteren Regalbrettern liegen ungeordnete Stapel kopierter Artikel, noch vom Kurs. Staubiges, teilweise eingerissenes Papier. Es sieht aus wie die Zeitungssammlung eines Messies in seiner zugemüllten Wohnung. Wenn das einer vom Sozialamt sähe, würden sie mich gleich abtransportieren lassen. Im »blauen Wagen«, wie wir früher sagten. Damit drohte ich Suzan immer, wenn sie nicht tat, was ich sagte. Warum werfe ich dieses ganze Zeug nicht weg? Ich schaue ja doch nicht mehr rein.
Die neueren Bücher, viel Psychiatrie und Neurowissenschaften, stehen zum Teil auf Regalbrettern über dem Schreibtisch. Der Tisch selbst ist leer. Alle alten Patientenakten sind in Schubladen darunter verstaut. Neue Akten gibt es nicht. Hier wird nicht geschrieben, keine Fachliteratur gelesen.
Notizblock, denkt er. Stift. Lesebrille. Er sucht die Sachen zusammen und legt sie auf das Tischchen neben seinem Sessel. Ein paar Dinge wird er notieren müssen. Er kann sich auf einmal nicht mehr auf sein Gedächtnis verlassen, sein Erinnerungsvermögen, seine Fähigkeit, alle neuen Informationen und Eindrücke rasch zu ordnen. Das erfüllt ihn mit gemischten Gefühlen, Enttäuschung, aber auch Verärgerung. Früher wusste er immer alles, konnte darauf bauen, dass er sich mühelos würde merken können, was ein Patient während der fünfzigminütigen Sitzung sagte, und alle Gegebenheiten mitsamt den dazugehörigen Gefühlen hervorzaubern würde, wenn er den Patienten wiedersah, ob das nun in der darauffolgenden Woche im Sprechzimmer war oder zehn Jahre später auf der Straße. Er wusste es einfach wieder: die Selbstmordgedanken, das schamvolle Liebesleben, der Charakter der Mutter, die Todesursache des Vaters, der gehasste kleine Bruder, das abgebrochene Studium.
Er betrachtete seine Gedächtnisleistung distanziert, von höherer Warte. Man durfte sie gar nicht näher untersuchen, dann litt die Zauberkraft. Total aufmerksam zuhören und zugleich entspannt, ja fast willenlos im Sessel lehnen, darauf kam es an. Nicht zu bemüht sein. Nicht abschweifen. Ein Widerspruch in sich. Drik weiß es und weiß es nicht. Ganz normal, denkt er, verhalt dich ganz normal, wie du es immer getan hast. Aber was ist mit dem Notizblock? Na gut, Adresse, Telefon, Alter, und dann die Hände ruhen lassen und zuhören. Wenn der Patient gegangen ist, gleich alles aufschreiben. Auf der Schreibtischplatte liegt eine dünne Staubschicht.
Drik erschrickt, als es klingelt. Ein kurzes, fast versuchsweises Klingeln und dann noch einmal, etwas länger. Betont langsamen Schrittes geht Drik den Flur hinunter. Er öffnet die Tür und streckt die Hand aus. Stellt sich vor.
Der junge Mann vor der Tür erwidert seinen Händedruck.
»Ich bin Allard Schuurman«, sagt er.
2
Während Suzan ihr Fahrrad aus dem Schuppen bugsiert, denkt sie an den Wochentag. Es ist Montag, ein Tag, den viele hassen. Für sie ganz unverständlich. Sie prüft den Reifendruck und knipst das Licht im Schuppen aus. Ist doch eher ein schöner Tag, denkt sie. Alles geht wieder los und erwacht zum Leben. Eine ganze Woche liegt vor dir, voller Ereignisse und Überraschungen. Sie bleibt kurz auf dem Gehweg stehen, knöpft ihren Mantel zu und legt ihre Tasche in den Fahrradkorb. Ihr Blick wandert nach oben, und im Licht der Straßenlaternen sieht sie, dass die Platane ihre Blätter verliert. Das Geäst zeichnet sich schwarz gegen den schmutzig grauen Himmel ab. In einer halben Stunde wird es hell, wird es richtig Montag.
Der Asphalt ist nass und dunkel. Suzan atmet die feuchte Luft tief ein. Kaum zu glauben, dass der Regen immer gerade aufgehört hat, wenn sie aufs Rad steigt! Sie schaut noch einmal zum Küchenfenster zurück und sieht schemenhaft Peter an der Spüle stehen. Psychologen fangen nicht so früh an. In der Anästhesiologie hat man allerspätestens um halb acht zur Morgenbesprechung zu erscheinen. Auch wenn man gerade Dienst in der Ambulanz hat oder seinen Schreibtischtag in Anspruch nimmt. Sie empfindet es nicht als Strafe, zeitig anfangen zu müssen. Der Tag ist dann schön lang, und es hat etwas, wenn man die Sonne aufgehen sieht, ihr voraus ist.
Nasses Laub auf dem Radweg, das saugende Geräusch der Reifen, der angenehme Widerstand der Pedale. Platz da, ich komme! Sie beschleunigt, schwenkt in das Viertel mit den frei stehenden Häusern in weitläufigen Gärten und ordnet sich in den Verkehr auf der Durchfahrtsstraße ein. In der Ferne sieht sie schon das Krankenhaus. In den beiden obersten Stockwerken, wo sich die Operationssäle befinden, sind die Fenster erleuchtet. Unwillkürlich erhöht sie das Tempo, das Pferd wittert den Stall. Sie lacht.
Als Hanna krank wurde, hat sie, ohne lange zu überlegen, Urlaub genommen, damit sie die Pflege ihrer Schwägerin koordinieren konnte. Kein Gedanke daran, dass ihr die Arbeit fehlen würde. War auch eigentlich nicht so. Ein bisschen merkwürdig anfangs, dass sie nicht mehr um sechs aus dem Schlaf gerissen wurde. Ungewohnt, so lange mit ihrem Becher Kaffee in der Küche zu sitzen, Peter zu verabschieden und dann erst zu duschen und ihre kleinen Aufgaben anzugehen. Nach und nach wurde das Tagesprogramm voller, hektischer, unvorhersehbarer. Je näher der Tod rückte, desto länger blieb sie bei Hanna. Als wohnte sie im Haus ihres Bruders. Sie hat Besucher hereingelassen und ihnen gesagt, ob sie das Krankenzimmer betreten durften oder nicht, sie hat Kaffee gemacht, Suppe gekocht.
Sie erinnert sich, wie sie erschrak, als eines Tages, kurz nach Mittag, zu einer irgendwie toten Stunde, ihre eigene Tochter vor der Tür stand. Fast hätte sie es nicht gehört, denn Roos hatte in der Aufregung auf den Klingelknopf der Praxis gedrückt. Oder wollte sie eigentlich Drik sprechen? Suzan hatte, während sie in der Küche beschäftigt war, ein entferntes Summen gehört und war sicherheitshalber zur Tür gegangen. Da stand Roos, einen Topf weißer Narzissen in den Händen. Stumm.
Suzan bewegt im Fahren die Schultern, als wollte sie eine Last von sich abwerfen. Rollenverwirrung, Ungeschicklichkeit. Sie war als Pflegerin da, als Ärztin, und musste bei Roos’ Erscheinen unvermittelt Mutter sein, was dazu führte, dass sie beide Rollen unzulänglich ausfüllte.
»Du kannst gern zu ihr gehen«, sagte sie, »sie ist frisch gewaschen und hat was gegen die Schmerzen bekommen.« Ihre Tochter schaute sie schief an und lief den Flur hinunter Richtung Gartenzimmer, ohne ihren Mantel auszuziehen. Später kam sie aber doch kurz in die Küche, immer noch bis oben hin zugeknöpft.
»Bist du jetzt Hannas Ärztin?«
Suzan überlegte. »Nein, nicht direkt, sie hat natürlich ihren Hausarzt. Ich helfe nur. Bei den Medikamenten ist das schon praktisch. Kaffee?«
»Weißt du, wann es so weit ist, wann sie stirbt? Lasst ihr sie sterben, wenn es nicht mehr geht?«
»Das weiß ich nicht, Roos. Auf jeden Fall möchte ich nicht, dass sie Schmerzen hat oder keine Luft mehr bekommt.«
An die Arbeitsplatte gelehnt, trank Roos ihren Kaffee und schaute ihre Mutter nachdenklich an.
»Ich finde das merkwürdig. Warum ist sie nicht im Krankenhaus, sie ist doch krank?«
Neunzehn, in dem Alter dürfte man eigentlich nicht mehr so naiv sein, dachte Suzan ärgerlich. Lies doch mal was, denk doch mal nach. Gleichzeitig hatte sie Mitleid mit ihrem blassen Kind, das seine Lieblingstante verlieren würde und miterleben musste, wie der Tod sie beschlich – nicht im grässlichen Krankenhaus, das nun mal für schlimme Sachen da war, sondern einfach hier zu Hause, im Gartenzimmer. Ihr war nicht wohl in ihrer Haut, sie hätte gern etwas getan, aber sie wusste nicht, was.
»Wie ist es in deiner Wohnung?«
»Geht so. Ich komme heute Abend zum Essen nach Hause. Oder bleibst du hier?«
Dankbar für die Annäherung beteuerte Suzan, dass sie zu Hause sein würde. Roos war schon wieder auf dem Weg zur Tür.
Der letzte Streckenabschnitt führt durch ein Neubaugebiet. Die Straßen sind nach Entdeckungsreisenden benannt: Tasman, Kolumbus, Cook. Es wäre doch mal nett gewesen, wenn der Stadtrat die Lage dieses Viertels berücksichtigt und die Wundermittel ihres Fachgebiets zur Namensgebung herangezogen hätte. Fentanylsteg, Propofolallee, Sevofluranplatz! Sie hätte denen gern eine Liste gemacht. Ignoranten.
Von der Fahrradgarage eilt sie zum Eingang. So früh es ist, herrscht doch bereits reger Betrieb. Vor der Tür rauchen Mitarbeiter noch rasch eine Zigarette, bevor ihr Dienst beginnt, der Pförtner sitzt auf seinem Posten, Menschen strömen in die Empfangshalle. Sie nimmt den Fahrstuhl nach oben. Umziehen muss sie sich heute nicht, die Ambulanz kann sie mit weißem Kittel über der Straßenkleidung machen. Sie strebt gleich dem Konferenzraum zu. An dem großen ovalen Tisch sitzen schon ein paar Kollegen, die sich weiße Kittel über die blaue OP-Kluft gezogen haben. Auf dem Kopf tragen sie den vorgeschriebenen Haarschutz. Bei den einen sind das wenig kleidsame Duschhauben, bei anderen kecke Kappen, auf die offensichtlich Sorgfalt verwendet wurde. Einer hält die Kopfbedeckung noch in der Hand. Sie geht zu einem freien Stuhl neben Kees, einem kräftigen Mann mit Schnurrbart, der sie stürmisch begrüßt. Die Assistenten stehen um den Tisch mit dem Kaffee und tauschen sich darüber aus, bei wem sie heute eingeteilt sind. Schade, dass ich nicht im OP bin, denkt Suzan. Das wird ein langweiliger Tag. Am Schreibtisch habe ich nicht viel zu erledigen. Andere Fachärzte jammern über die Berichte, die sie schreiben müssen. Bei uns ist das anders. Wir haben keine eigenen Patienten. Das eigentliche Narkoseprotokoll wird vom Gerät selbst ausgespuckt. Unsereins braucht nie das Gefühl zu haben, dass noch eine schwere Aufgabe wartet, wenn die normale Arbeit getan ist. Was Peter und Drik dagegen erledigen müssen: Protokolle von Therapiesitzungen, Arztbriefe, Mitteilungen an Versicherer, Abschlussberichte. Grässlich. Bei uns rattert eine Seite aus dem Drucker, das ist alles, was vom Abenteuer im OP bleibt.
Das Zimmer hat sich gefüllt. Der Weiterbildungsassistent, der diese Nacht Dienst hatte, geht ans Rednerpult. Er nimmt einen Schluck Wasser aus dem Plastikbecher und wartet. Simone, Facharztkollegin und Freundin Suzans, bittet laut um Ruhe. Sie war heute Nacht die Supervisorin.
Der junge Assistent beginnt zu erzählen, springt von einem Vorfall zum nächsten. Eine Reanimation in der Notaufnahme, eine Epiduralanästhesie auf der Entbindungsstation, eine Notoperation wegen Blutungen nach einem Baucheingriff, ein komplizierter Kaiserschnitt.
»Produktiv?«, fragt ein älterer Mann mit spitzem Gesicht und Brille.
Der junge Assistent ist etwas verwirrt und blättert fahrig in seinen Unterlagen. Er kann seine Notizen zu dem Kaiserschnitt nicht gleich finden.
»Was kam raus?«
»Ach so«, sagt er, »ein Baby.«
Alle lachen, und der junge Mann wird rot.
»Gesund, ein gesundes Mädchen.«
Er fährt fort. Dem Herrn mit der Nachblutung geht es gut. Ein Patient, der über heftige Schmerzen klagte, ist mit hoher Schmerzmitteldosis und Interkostalblockade erfolgreich behandelt worden. Ein weiterer Kaiserschnitt ging weniger glücklich aus, das Baby musste beatmet werden, es sah nicht gut aus. Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Einer konnte mit leichten Prellungen gleich wieder nach Hause, beim anderen besteht Verdacht auf eine intrathorakale Blutung. Er wartet auf die Operation. Bei einer Frau, die heute entbinden soll, muss eine Epiduralanästhesie gesetzt werden. Aufgaben für den Tagdienst.
Suzan ist mit ihren Gedanken abgeschweift und hört kaum, was der junge Assistent sagt. Ob er sich wegen der Frage nach dem Resultat des Kaiserschnitts verulkt gefühlt hat? Muss nicht unbedingt sein, die Atmosphäre in der Weiterbildung ist seit den letzten Jahren ausgesprochen angenehm. Nicht streng, sondern ernsthaft, seriös. Kollegial. Die angehenden Fachärzte dürfen wirklich etwas lernen: Fertigkeiten, Abläufe, Szenarien bei Notfällen. Sie brauchen nicht alles schon zu können und zu wissen, nur aufmerksam sollen sie sein und lernfähig. Jeder von ihnen hat einen Supervisor an seiner Seite oder kann ihn sofort hinzurufen. Jeden Tag einen anderen, so dass sie alle fachlichen Variationen zu sehen bekommen. Das kann schon mal verwirrend sein, ist aber bestimmt besser als das alte System, bei dem man wochen- oder gar monatelang an ein und denselben Anästhesisten gekoppelt war.
Ich bin heute allein, denkt Suzan. Ach Quatsch, ich bin überhaupt nicht allein, ich sehe fünfzehn Patienten, die mir die Ohren vollquasseln werden. Und am Nachmittag Unterricht vor voll besetzten Klassen. Trotzdem fühlt es sich so an.
Mit großen Schritten betritt ein Mann in leuchtend orangefarbener Sicherheitskleidung den Raum und entschuldigt sich für sein spätes Kommen. Die Abteilung ist auch für den Rettungsdienst zuständig; auf dem Dach des Krankenhauses steht der Rettungshubschrauber. Heldenhaft, denkt Suzan. Eine tolle Arbeit, bei der es wirklich darauf ankommt. Man muss improvisieren und blitzschnell überlegen können, während man auf dem Pflaster kniet, der Wind einem um die Ohren pfeift und rundherum lautes Geschrei herrscht. Bedrohlich. Trotz aller Hochachtung hat sie aber nie Anstalten gemacht, selbst dem Rettungsdienst beizutreten. Der Fahrstil im Rettungswagen macht ihr Angst, es geht so schnell, dass sie fürchtet, sie würde dabei den Überblick verlieren. Und im Hubschrauber möchte sie schon gar nicht sitzen, so ganz ohne Halt. Sie zuckt die Achseln.
»Was ist, stört dich was?«, fragt Kees.
»Ambulanz heute. Keine Lust.«
»Dann komm doch vorher zu mir, ich habe eine mindestens fünfstündige OP am offenen Herzen. Bypass, neue Klappe, das volle Programm. Die Ambulanzpatienten kommen nicht so früh, die gehen zuerst zum Chirurgen.«
»Und danach alle gleichzeitig zu mir. Um elf Uhr. Allesamt beunruhigt, und keiner hat die Erläuterungen verstanden. Da darf ich ihnen dann die ganze Operation noch einmal auf einem Zettel aufmalen. Und das in Windeseile, weil noch zehn andere draußen auf dem Flur sitzen.«
»Man müsste das zusammen machen«, sagt Kees. »Hab ich schon oft gedacht. Eine präoperative Sprechstunde von Chirurg und Anästhesist gemeinsam. Gleich zwei Ärzte an einem Schreibtisch, das macht einen guten Eindruck. Und keiner von beiden könnte sich so ohne weiteres verdrücken. Da kann der Chirurg nicht mehr nach zwei Minuten aufstehen und ganz lapidar verkünden: ›Ich operiere Sie dann nächste Woche, auf Wiedersehen.‹ Du, ich muss los. Ich will den Chirurgen nicht warten lassen.« Er zwinkert ihr zu. »Harinxma. Den darf man nicht schon so früh am Morgen auf die Palme bringen.«
»Frohes Schaffen«, murmelt Suzan. Sie erhebt sich langsam, um noch ein paar Worte mit Simone zu wechseln, die mit grauem Gesicht an der Tür steht.
»Schöner Dienst«, sagt sie, »aber jetzt reicht’s. Ich gehe schlafen. Ein richtiger Schatz, dieser Jeroen. Wir haben alles zusammen gemacht, er hat ja gerade erst angefangen. Und es macht Spaß, alles zu erklären. Er fragt die verrücktesten Sachen, über die du selbst nie nachdenkst. Wer ist für den Blasenkatheter verantwortlich? Warum schreien sie in der Notaufnahme alle so? Wer hat dort eigentlich das Sagen? Richtig süß. Wollen wir nächste Woche mal zusammen essen?«
Suzan nickt und tätschelt kurz den Arm der Freundin. Dann geht sie auf den Flur hinaus, in den Fahrstuhl, ins Freie.
Die Ambulanzen befinden sich in einem separaten Gebäude, das vom Krankenhaus aus nur über eine Grünfläche zu erreichen ist. Suzan pflügt mit ihren schönen Stiefeln durch den Matsch. Die Ambulanz ist eine Vorhölle, ein Übungsraum, wo andere Gesetze gelten. Simone macht hier Forschung, wird darüber promovieren. Ein Buch schreiben. Artikel. Wer schreibt, ist wirklich existent. Hanna schrieb auch. Ihr Buch – über die Popularität der Wissenschaft um das Jahr 1780 – liegt zu Hause neben Suzans Bett. Ein tolles Buch, mit flüssig geschriebenen Schilderungen von Klubs aus Hobbywissenschaftlern, Menschen des achtzehnten Jahrhunderts, die im Verein mit Chemikalien und Elektrizität zu experimentieren begannen. Man hört Hanna reden, wenn man das liest. Drik hat auch einiges über sein Fachgebiet publiziert. Nicht, dass sie die Bücher alle gelesen hätte, aber sie stehen im Regal. Es gibt sie.
Für ihre präoperativen Befragungen dürfen die Anästhesisten ein kleines Zimmer im Erdgeschoss benutzen, das sich neben den Behandlungsräumen der Schmerzambulanz befindet. Dort steht eine Tür offen. Suzan schaut hinein.
»Berend!«
»Suus, nett, dass du vorbeischaust, komm rein.«
Sie nimmt Berends Zimmer in sich auf. Zeitschriften- und Bücherstapel, eine Kaffeemaschine oben auf einem Aktenschrank, an der Wand, zwischen Fotos von Segelbooten, eine prachtvolle anatomische Zeichnung vom Nervensystem des Menschen. Das Fenster ist mit Zimmerpflanzen zugewuchert.
Berend, ein großer, hagerer Mann um die fünfzig, sieht ihren Blick.
»Wenn ich mit den Nadeln arbeite, gehe ich in ein anderes Kabuff, wo es sauberer ist. Möchtest du Kaffee, ich habe eine neue Maschine?«
»Ich hole noch kurz meinen Plan.«
Die Sekretärin am Empfangstisch vom Warteraum hat eine Namensliste für Suzan.
»Sie können sie im Computer aufrufen, der Chirurg müsste seine Planungen schon eingegeben haben. Ihr erster Patient ist bereits da.«
Auf einer der Bänke sitzt eine dicke Frau, eine Tasche neben sich, einen Stock zwischen den Knien.
»Ich habe noch kurz zu tun«, sagt Suzan. »Ich rufe die Dame dann gleich herein.« Sie nickt in Richtung der Frau, die verwundert zurückschaut.
Bei Berend duftet es nach frischem Kaffee. Sie bleibt an der Tür stehen. Berend zieht fragend die Augenbrauen hoch.
»Ich muss noch den ganzen Vormittag sitzen.«
»Hübsch getöpferte Stiefel hast du an.«
Sie schaut auf ihre Füße und muss lachen. Gelbgrauer Schlamm bedeckt das weiche schwarze Leder.
»Unter dem Schreibtisch kein Problem. Wann fängst du an?«
»Erst um halb neun. Setz dich doch!«
»Wie gefällt es dir eigentlich, tagaus, tagein auf der Ambulanz? Fehlt dir der OP nicht?«
»Keine Sekunde«, sagt Berend. »Das war genau die richtige Entscheidung. Ich sehe wirklich nicht den ganzen Tag Patienten, weißt du, ich muss auch Assistenten anleiten und betreuen, wir machen Forschung, und wir konferieren eine ganze Menge. Beraten uns mit Neurologen und Physiotherapeuten. Und der Psychologie natürlich. Ich habe es gut hier. Es ist schön, die Patienten richtig kennenzulernen, das sind mitunter jahrelange Kontakte. Der Partner kommt oft mit, ich weiß, wo sie arbeiten, wenn sie arbeiten, wie es ihren Kindern geht, wie sie wohnen. Einen OP-Patienten siehst du nie wieder. Ein dösiger Blick bei der Ausleitung, und wenn du besonders eifrig bist, schaust du im Aufwachraum noch mal kurz nach ihm. Der Kontakt im Vorfeld ist auch superkurz – bei wie vielen Patienten, die du gleich sehen wirst, machst du selbst die Anästhesie? Das sind ein oder zwei von fünfzehn. Oder auch kein einziger. Kann keiner steuern. Ich will nicht sagen, dass es unpersönlich ist oder dass die Versorgung schlecht ist oder so, aber da fehlt die durchgehende Linie. Da wird verkannt, wie sehr sich persönlicher Kontakt auswirken kann. Bei uns ist das anders, wir arbeiten damit, setzen ihn als Instrument ein. Neben den Medikamenten und den Nadeln natürlich.«
Suzan trinkt ihren Kaffee aus. Er hat recht, er kann so reden, dass er immer recht hat, auch wenn es Unsinn ist. Das jetzt ist zwar kein Unsinn, aber trotzdem. Wenn ich jemanden zur Operation hole, denkt sie, wenn ich ein Gesicht sehe, jemandes Haut fühle, Angst registriere, Schmerzen, wenn ich etwas erkläre, wenn ich beruhige, wenn ich jemandem auf den Tisch helfe und ihm leise zurede, während ich den venösen Zugang lege, wenn ich dafür sorge, dass es einen Moment still ist im OP, und ihn dann erst in Schlaf versetze – dann ist das genauso wie früher, wenn ich Roos ins Bett gebracht habe.
Sie verabschiedet sich von Berend und tritt in ihren Schlammstiefeln auf den Flur hinaus.
3
Auf Driks Schreibtisch liegt nun ein Notizblock. Er reißt die beschriebenen Seiten ab und breitet sie vor sich aus. Viel Text ist es nicht. »Schuurman«, steht da, »27«. »Mutter!«, mit einem Kreis darum herum. Alles in großer, krakeliger Schrift. Um vernünftig schreiben zu können, müsste er die Lesebrille aufsetzen, aber das will er nicht, weil das den direkten Kontakt zum Patienten behindern würde.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!