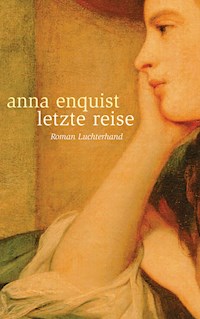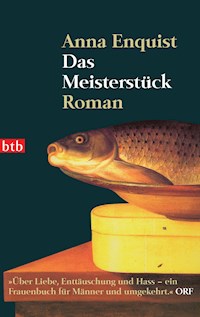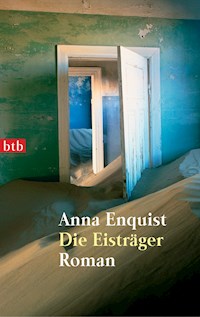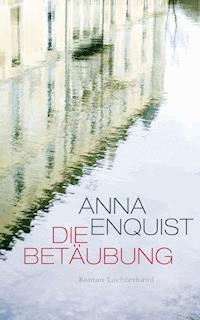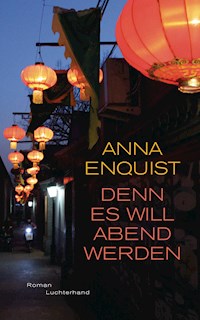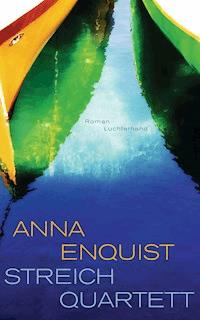
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kann Musik uns zu besseren Menschen machen?
In einem Streichquartett kommt es auf jeden Einzelnen an, aber auch auf die Beziehungen untereinander. Und die vier Freunde, die abends auf einem Hausboot in Amsterdam zusammenkommen, um zu musizieren, kennen sich schon lange. Die Musik von Mozart oder Schubert hilft ihnen, ihr Leid kurz zu vergessen, den zuweilen tristen Alltag zu erhöhen oder zumindest vorübergehend auszublenden. Doch dann holt sie die Wirklichkeit eines Tages grausam ein …
Die Ärztin Carolien, ihr Mann Jochem, die Krankenschwester Heleen und Hugo, Leiter des örtlichen Musikzentrums, kommen regelmäßig auf Hugos Hausboot zusammen. Sie kennen sich schon lange, haben das Einstudieren klassischer Musik und das gesellige Beisammensein stets genossen. In letzter Zeit fällt es ihnen jedoch immer schwerer, den Alltag hinter sich zu lassen. Carolien und Jochem können kaum noch miteinander reden, seit sie bei einem tragischen Verkehrsunfall beide Söhne verloren haben, Hugo sieht keinen Sinn mehr in seiner Arbeit, und Heleen, deren besonderes Engagement der Altenpflege gilt, kann nicht umhin zu realisieren, dass das Gesundheitswesen immer unsozialer und rigider wird. Auch die Spannungen in der Gruppe sind unübersehbar. Trotzdem üben sie unbeirrt weiter. Als sie beim fünfzigsten Geburtstag eines Freundes Mozarts Dissonanzenquartett aufführen, scheint es, als hätte das Blatt sich gewendet, als könnte die Musik wie einst wieder heilen und trösten, ja sogar Glück schenken. Doch gerade in diesem Augenblick wird die Idylle gesprengt, denn ein flüchtiger Mörder sucht ausgerechnet auf dem Hausboot Schutz vor der Polizei … Anna Enquist erweist sich mit ihrem neuen Roman einmal mehr als Meisterin des psychologischen Romans wie der musikalischen Komposition, als europäische Erzählerin höchsten Ranges.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Zum Buch
Die Ärztin Carolien, ihr Mann Jochem, die Krankenschwester Heleen und Hugo, Leiter des örtlichen Musikzentrums, kommen regelmäßig auf Hugos Hausboot zusammen. Sie kennen sich schon lange, haben das Einstudieren klassischer Musik und das gesellige Beisammensein stets genossen. In letzter Zeit fällt es ihnen jedoch immer schwerer, den Alltag hinter sich zu lassen. Carolien und Jochem reden kaum noch miteinander, Hugo sieht keinen Sinn mehr in seiner Arbeit, und Heleen, deren besonderes Engagement der Altenpflege gilt, kann nicht umhin zu realisieren, dass das Gesundheitswesen immer unsozialer und rigider wird. In der Welt draußen nehmen Korruption und Gewalt überhand. Trotzdem üben sie unbeirrt weiter. Als sie beim fünfzigsten Geburtstag eines Freundes Mozarts Dissonanzenquartett aufführen, scheint es, als hätte das Blatt sich gewendet, als könnte die Musik wie einst wieder heilen und trösten, ja sogar Glück schenken. Doch gerade in diesem Augenblick wird die Idylle zerstört … Anna Enquist erweist sich mit ihrem neuen Roman einmal mehr als Meisterin des psychologischen Romans wie der musikalischen Komposition, als europäische Erzählerin höchsten Ranges.
Zur Autorin
ANNA ENQUIST wurde 1945 in Amsterdam geboren. Sie wuchs in der niederländischen Stadt Delft auf, studierte Klavier am Königlichen Konservatorium in Den Haag, anschließend Klinische Psychologie in Leiden und arbeitete als Psychoanalytikerin. Seit 1991 veröffentlicht sie Gedichte, Romane und Erzählungen. Anna Enquist zählt neben Margriet de Moor und Harry Mulisch zu den bedeutendsten niederländischen Autoren der Gegenwart. Ihre Werke wurden in 15 Sprachen übersetzt und mit zahlreichen internationalen Literaturpreisen ausgezeichnet. Anna Enquist lebt in Amsterdam.
Zur Übersetzerin
HANNI EHLERS, geboren 1954 in Ostholstein, studierte Niederländisch, Englisch und Spanisch am Institut für Übersetzen und Dolmetschen der Universität Heidelberg und ist die Übersetzerin von u. a. Joke van Leeuwen, Connie Palmen und Leon de Winter.
Anna Enquist
Streichquartett
Roman
Aus dem Niederländischen
von Hanni Ehlers
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel Kwartet bei De Arbeiderspers, Utrecht, Amsterdam, Antwerpen.
Copyright © der Originalausgabe 2014 Anna Enquist
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: buxdesign | München
unter Verwendung eines Motivs von © plainpicture / Claire Morgan
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-15294-9 V003
www.luchterhand-literaturverlag.de
Besuchen Sie auch unseren LiteraturBlog www.transatlantik.de
1 Seit er im fortgeschrittenen Alter ist, wird er früh wach. Zu früh. Durch das Gartenfenster schaut er auf das blasse Licht. Er kann nicht ausmachen, welches Wetter zu erwarten ist, es kann so oder so werden. In dem kleinen Garten steht das Unkraut hoch. Wildwuchs. Um sich greifende Stängel. Er hat dem nie Bedeutung beigemessen. Jetzt befällt ihn beim Anblick des Pflanzenmeeres eine vage Unruhe. Die Nachbarn. Beschwerden sind ihm zwar noch nicht zu Ohren gekommen, doch das ist nur eine Frage der Zeit. Verbreitung schädlicher Samen in den Herbststürmen. Störung der Aussicht, die die Bewohner von ihren Balkonen und Terrassen aus genießen möchten. Zeugnis von Alter und Ohnmacht. Ein Gärtner, jemanden für einen Nachmittag anheuern, der alles herausrupft und wegschafft. Platten legen.
Mühsam schlurft er ins Zimmer zurück. Sein Knie beginnt den vertrauten stechenden Schmerz auszustrahlen. Die Schiebetür zum Vorderzimmer. Schwer. Immer dunkel dort. Stehlampe an, er muss mit dem Fuß auf einen Knopf am Boden drücken. Sich im Sessel niederlassen. Er weiß, dass er nur mit Mühe wieder hochkommen wird. Die Zeitung dürfte im Flur liegen; als er wach wurde, hörte er die Klappe vom Briefschlitz. Was soll’s. Dann eben keine Nachrichten. Jetzt muss er erst einmal seine Atmung in den Griff bekommen. Er streckt das schmerzende Bein aus, bettet den Kopf an die Rückenlehne.
Die Vorhänge sind geschlossen. Keinen Einblick gewähren, nie. Der Flügel steht seitlich vom Fenster an der Wand zum Flur. Das Elfenbein der Tasten ist vergilbt, aber makellos. Der geschlossene Schalldeckel gleicht einer glänzenden schwarzen Wasserfläche. An der gegenüberliegenden Wand ist das Regal angebracht, in dem er seine Partituren aufbewahrt. Ersatzsaiten, Harz, eine Sordine. Der Cellokasten steht in der dunklen Ecke zwischen Regal und Fenster. Ein schwerer Kasten. Altmodisch. Heute gibt es Kästen aus Kunststoff, die so gut wie nichts wiegen, man weiß gar nicht genau, ob das Instrument auch darin ist, so leicht ist die Last. Das sagen seine Schüler. Sagt seine Schülerin, korrigiert er seine eigenen Gedanken, er hat nur noch diese eine.
Auspacken. Er fühlt schon ein Stechen im Knie, wenn er nur an das Öffnen der Schnappverschlüsse denkt, vor allem des unteren, für den er in die Knie gehen muss; das Herausheben des Instruments, das Manövrieren mit dem kostbaren Holz, ohne dass der Steg gegen den Deckel des Kastens stößt – dann noch zum Bogen greifen und in einem letzten Kraftakt versuchen, mit Cello und Bogen sicher auf dem Stuhl zu landen. Und wenn er mehr will als nur Technikübungen und Tonleitern: Noten holen, Notenständer heranziehen, Brille suchen. Er schließt die Augen und streicht in Gedanken alle vier Saiten an, eine nach der anderen, mit ruhigen Bewegungen. Das ausgelassene A, das bescheidene D, das immer etwas mehr Strich braucht, das Halt gebende G, die Saite, welche die Seele des Cellos zum Ausdruck bringt, und das geheimnisvolle tiefe C. Heute tu ich’s, denkt er. Und dann nicht wieder einpacken, sondern einfach auf den Flügel legen. In Reichweite. Wenn Carolien heute Abend zu ihrer Stunde kommt, kann sie mir ja helfen, das Instrument herunterzuheben.
Die Stille mummelt ihn ein wie eine Decke. Er wird Mut brauchen, um sie zu durchbrechen. Das Zimmer ist gut isoliert. Die Vorhänge schlucken jedes Geräusch. Mein Strich ist weniger kräftig als früher. Immer mit der Ruhe. Nichts überstürzen.
Ist er kurz eingenickt? Als er zu sich kommt, ist er verstört. Erhebt sich zu abrupt und schreit unwillkürlich auf. Während er sich an der Stuhllehne festklammert, schaut er sich suchend um. Neben dem Flügel lehnt sein Spazierstock an der Wand. Fünf Schritte. Ächzend in die Küche. Es stinkt. Der Abfalleimer muss geleert werden. Er nimmt das Aspirin von einem Regalbrett, drückt drei Tabletten aus dem Kunststoffstreifen. Etwas Wasser in ein schon benutztes Glas. Warten. Umrühren. Säuerliche Körner auf dem Boden. Es muss sein.
Wie ist es möglich, dass der Körper derart versagt? Früher rannte er mit dem Cello auf dem Rücken durch die Stadt, nahm eine Treppe nach der anderen, ohne überhaupt darüber nachzudenken – glücklich? Zufrieden? Ach wo. Das war selbstverständlich. Erst wenn die Maschine ins Stottern gerät, regen sich beim Eigentümer Gefühle. Wut, Ohnmacht. Gram.
Mit den Fingerspitzen fährt er über den Granit der Arbeitsplatte. Weiche Kuppen an der rechten Hand, Hornhaut an den Fingern der linken. Mit einem Seufzen nimmt er den Deckel vom Abfalleimer und beginnt, den grauen Plastiksack herauszuziehen. Nicht an die Schmerzen denken. Tu’s einfach. Er lässt den Sack unsanft auf den Boden klatschen. Glasklirren. Nicht erlaubt. Flaschen und sonstiges Glas separat. Alte Zeitungen dazwischenstopfen? Ja, ist zwar auch nicht erlaubt, aber es dämpft. Er zieht den Müll zur Haustür; bückt sich und stopft einen Stapel bereitliegenden Altpapiers in den sperrigen Sack. Sein Blick wandert gleichgültig über die Zeitungsschlagzeilen: »Jahrhundertprozess«, »Millionen für Sicherheitsmaßnahmen«, »Robin Hood oder Blaubart?«. Er zieht einen vorsorglich eingesteckten Verschlussclip aus der Hosentasche und macht den Sack zu.
Haustür auf. Es ist bewölkt, feuchte Luft schlägt ihm ins Gesicht. Die Tür führt auf eine Art Freitreppe. Fünf tiefe Stufen, bevor man auf dem Gehweg steht. Früher, denkt er, war ich ein gefragter Cellist. Reiste umher und spielte. Außerdem Privatdozent am Konservatorium, für einige wenige Schüler, die talentiertesten. Und hier stehe ich nun, ungewaschen, einen stinkenden Müllsack zu den Füßen, und weiß nicht, wie ich den zum Müllcontainer kriegen soll, da, ganz hinten an der Straßenecke. Wenn ich mir sicher sein könnte, dass mich niemand dorthin tapern sieht, mit Stock, nach jedem fünften Schritt kurz verschnaufend. Doch hinter allen Fenstern verbergen sich Augen, aufmerksame Blicke, lauert die Gefahr, beobachtet und verraten zu werden.
Er streckt den Rücken durch und versucht, sich die Haltung eines vitalen Seniors zu geben, einer mit Lust auf den Tag, der schon eine Stunde Hausarbeit hinter sich hat. Mit gespieltem Interesse betrachtet er die Bäume. Kaum Menschen auf der Straße. Jemand steigt in sein Auto und fährt davon. Einige heben ein Kind hinten aufs Fahrrad und radeln die Straße hinunter. Hort, denkt er, Kinderaufbewahrung. Heute Abend werden todmüde Eltern erschöpfte Kinder abholen, um schnell nach Hause und ins Bett zu gehen.
Eine Gruppe dunkelhaariger Jungen kommt um die Ecke. Sie gehen langsam und unterhalten sich in einer Sprache, die er nicht versteht. Der Kleinste hat einen Fußball unter dem Arm und schaut ihn, als sie vorüberkommen, aufmerksam an. Den habe ich öfter gesehen, denkt er – beim Spielen auf der Straße? Neben einer verschleierten Mutter, deren Einkäufe er trug? Der Junge hat ein sympathisches, offenes Gesicht, findet er. Er hat wahrscheinlich gelächelt, denn der Junge lächelt unversehens zurück.
Um die Treppe hinunterzukommen, wird er beide Hände brauchen, für das Geländer und für den Stock. Den Müllsack auf die Straße zu schmeißen empfiehlt sich nicht, Plastik reißt, seine armseligen und teilweise unerlaubten Abfälle werden den Blicken preisgegeben sein. Ich fand es vornehm, denkt er, so ein Haus mit erhöhtem Eingang. Das große Souterrain erschien mir praktisch. Jetzt steht dort alles voller Krempel, und die Stufen werden zu meinem Untergang. Er blinzelt. Der Nebel hat sich nahezu aufgelöst, er spürt die zögernde Sonne hinter den Wolken.
Die Jungen sind weitergegangen, doch der Kleine mit dem Fußball hat sich umgedreht und bleibt unten an der Treppe stehen.
»Soll ich den Sack schnell für Sie wegbringen?«
Er erschrickt und weiß nicht, wie er antworten soll. Blitzartig sieht er vor sich, wie der Junge die Treppe heraufrennt, ihm ein Messer in die Kehle rammt und das Haus betritt. Ich diskriminiere, denkt er, das darf man nicht. Das ist ein Kind, ein freundliches Kind, das von seiner Mutter gelernt hat, dass man alten Menschen helfen muss. Einfach, weil es sich so gehört. Der Junge wird das Gewicht der Flaschen fühlen, das Altpapier erahnen und es vielleicht zu Hause erzählen. Er schaut zum Müllcontainer am Ende der Straße. Dann nickt er dem Jungen dankbar zu.
Mit den Augen folgt er ihm. Fußball in der einen Hand, Müllsack in der anderen. Mühelos, fast tänzelnd. Mit einem leicht klirrenden Plumps verschwindet der Sack im Container. Der Junge dreht sich zu ihm um und reckt grinsend den Daumen in die Höhe. Er nickt, antwortet mit einem Lächeln. Muss ich ihm jetzt Geld dafür geben? Süßigkeiten? Mich kurz mit ihm unterhalten?
Er macht einen Moment die Augen zu. Als er sie wieder öffnet, ist die Straße verlassen. Er geht hinein und schließt die Haustür.
2 Angenehm, schon so früh da zu sein, denkt Heleen. Sie schließt die Praxis auf und öffnet da und dort ein Fenster, schaltet ihren Computer ein, füllt die Kaffeemaschine. Sie gleitet durch die Räume, als laufe sie Schlittschuh. Für die beiden Hausärzte druckt sie den Terminplan für den Vormittag aus und legt ihnen die Blätter auf die abgestaubten Schreibtische. Service. Ist nicht ihre Aufgabe, aber sie macht es sehr gern. Auf Daniels Schreibtisch türmen sich die Stapel: Briefe, Zeitschriften, Formulare. Bei Carolien sieht es kahl aus.
Heleen wirft einen Blick ins Wartezimmer: aufgeräumt, das ist gut. Spielzeug in der Kiste, Broschüren im Halter an der Wand, Lesefutter auf den Tischchen. Die große Zimmerpflanze in einer Ecke sieht etwas verwahrlost aus. Sie hebt ein Blatt an und inspiziert die Unterseite. Kleine, nahezu unsichtbare Tierchen fressen sich in das Blatt, sieht sie. Es wird sich kräuseln und verdorren. Nicht gut für das Wartezimmer eines Hausarztes. Sie würde lieber jede Woche frische Blumen hinstellen, aber als sie einmal mit einem üppigen Strauß ankam, runzelte Daniel die Stirn. Ob sie schon mal was von allergischen Reaktionen gehört habe. Heuschnupfen. Niesende Patienten, fatale Atemnot. Sie sei doch Krankenschwester, oder? Er hatte natürlich recht. Dumm. Nicht dran gedacht. Sie stellte den Blumenstrauß in die Küche. Das Personal war Gott sei Dank gegen nichts allergisch. Carolien fand den Strauß wunderschön.
Man muss die Blätter mit Seifenlauge abwischen, wie sie weiß. Oder mit Wasser, in dem eine Zigarette gelegen hat. Sie packt den Blumentopf mit beiden Händen und trägt ihn durch die kleine Küche hindurch nach hinten auf den Dachbalkon.
Mollie, die Praxishelferin, betritt mit viel Getöse den Eingangsbereich. Prompt klingelt das Telefon, das sie, über den Empfangstresen gelehnt, abnimmt. Den einen Arm noch im Ärmel ihrer Jacke, mit dem rechten Fuß über die linke Wade scheuernd, spricht sie professionell mit der offenbar beunruhigten Patientin am anderen Ende der Leitung.
Kinder machen alles gleichzeitig, denkt Heleen, sie springen ohne Unterbrechung von einer Situation in die andere. Herrlich.
»Frau Pasma, ob sie heute um halb elf einen Termin hat«, sagt Mollie. »Ich habe auf gut Glück ja gesagt, denn ich hatte den Plan nicht zur Hand. Okay?«
»Sehr gut. Immer her mit ihnen. Sie kommt zu mir, zur Zuckerkontrolle. Braucht diesmal nicht zum Arzt.«
Zwei Leute betreten das Wartezimmer. Heleen gibt Mollie ein Zeichen und deutet zur Kaffeemaschine. Dann geht sie auf die Straße hinaus, um zu sehen, ob Carolien schon im Anmarsch ist. Daniel schließt gerade sein Fahrrad ab. Er macht eine spöttische Verbeugung, als sie auf ihre Armbanduhr tippt. Dann eilt er zu seinem ersten Termin hinein.
Carolien stellt ihren Wagen in einer fließenden Bewegung auf ihrem Parkplatz ab und steigt aus. Hübsche Jeans, taillierter Blazer, etwas herausgewachsene Frisur. Die grauen Augen leicht geschminkt. Heleen findet, dass sie immer gepflegt aussieht. Wenn sie das doch nur könnte. Hat nicht viel Sinn, sie ist zu dick. Da muss man vor allem Sachen tragen, die weit genug sind. Was ihr übrigens nicht viel ausmacht.
»Ist schon wer da?«, fragt Carolien.
»Für dich noch nicht. Pasma rief gerade an, die kommt später. Ich möchte noch einmal versuchen, ob ich ihr nicht doch beibringen kann, sich selbst zu spritzen. Dass wir noch einen Monat abwarten, meine ich. Bist du einverstanden?«
Carolien nickt.
Alte Leute. Wenn sie nicht mit ihren Gebrechen umzugehen lernen, verwahrlosen sie und können nicht mehr eigenständig leben. Für Heleen ist das schwer erträglich, und deshalb tut sie alles, um die in die Jahre Gekommenen an Bord zu behalten.
»Sie ist so eine liebe Seele, es wäre doch ein Jammer, sie der Altenpflege zu übergeben, nicht?«
Sie bleiben kurz in der Sonne stehen, nebeneinander an die Hauswand gelehnt.
»Du kannst das System nicht ändern«, sagt Carolien. »Wir müssen uns fügen, sonst können wir gar nicht mehr arbeiten. Das weißt du.«
Sie kramt in ihrer Tasche und zündet sich eine Zigarette an.
»Nur ganz kurz«, sagt sie, »es sieht natürlich verboten aus, aber nur ganz kurz. So zusammen.«
Sträflich, denkt Heleen. Vor den Augen von Patienten in aller Öffentlichkeit rauchen, wie kann sie es wagen. Von der Seite blickt sie auf Caroliens ruhiges Profil. Kein Ausdruck, keine Emotion zu erkennen.
»Und wie ist’s?«
Carolien brummt.
»Man kann das System abmildern«, sagt Heleen, »umschiffen. Das habe ich mit den Asylanten probiert, bis es auf einmal nicht mehr genehmigt wurde. Dabei haben wir eigentlich nichts Weltbewegendes gemacht, nur einmal im Monat einen Brief geschrieben. Zeitschriften geschickt, zur Förderung der Sprachkenntnisse. Das ganze Zeug aus dem Wartezimmer ist dorthin gewandert. Donald Duck für die Kinder. Lebensgefährlich!«
»Dass du das alles schaffst. Neben der Familie, der Arbeit. Deiner Geige.«
»Ich bin mit unbändiger Energie gesegnet. Weil ich so viel esse. Nein, im Ernst, es ist schön, etwas tun zu können. Gemeinsam. In unserer Briefgruppe machen wir auch weiter, wir nehmen uns jetzt die Langzeitinhaftierten vor. Leute, die zwanzig Jahre im Gefängnis sitzen müssen, weißt du. So jemand bekommt nun einen Brief von uns.«
»Schreiben sie zurück?«
»Ja, klar. Aber es ist kompliziert, alles muss über die Gefängnisleitung laufen. Die schauen sich an, was in den Briefen steht. Man darf keine Namen nennen, keine richtigen Namen. Wenn sie den Brief absegnen, leiten sie ihn weiter, denn man darf auch keine Adresse angeben. Ich habe zwei Männer und eine Frau. Die kenne ich so langsam ganz gut, aber wie sie heißen, weiß ich nicht.«
»Und du?«
»Ich heiße Rosemarie. Glauben sie. Möchtest du nicht auch mitmachen?«
Carolien lacht.
»Ich wüsste nicht, was ich schreiben sollte. Nein, das kann ich überhaupt nicht. Ich grüble schon wie blöd über die Zustände hier, da kann ich keine zusätzlichen Unannehmlichkeiten brauchen. Sind auch gruselige Leute, scheint mir.«
Sie schnippt ihre Kippe in einen Gully. Es ist so still auf der Straße, dass sie hören können, wie die Glut erlischt.
3 Am Ende des Nachmittags schaut Carolien bei Daniel rein und setzt sich ihm gegenüber an den chaotischen Schreibtisch. Ihr Kollege hämmert wütend auf seiner Tastatur, mit gesenktem Kopf und Schweißperlen auf der Glatze.
»Kann ich dir helfen?«
»Bind mich fest. Wenn ich jetzt aufstehe, wird nie mehr was draus.«
Warum nimmt er sich nicht nach jedem Patienten mal zwei Minuten Zeit, um einzutragen, was er gemacht hat, was er weiter vorhat und welche Diagnose an die Versicherung gehen soll, dann könnte er dieses ganze Drama vermeiden, denkt sie. Aber so tickt er nicht. Irgendetwas zu notieren und zu kategorisieren bringt ihn völlig aus seiner Arbeitshaltung, aus der Einstellung, die er braucht, um sich seine Patienten aufmerksam anzusehen und anzuhören. Es gibt Kollegen, die im Beisein des Patienten alles Mögliche in den Computer eingeben; da sitzt man dann halb vom Gesprächspartner abgewandt und ist sichtlich mit etwas anderem beschäftigt. Dass er dafür nichts übrig hat, versteht sie gut, aber diese tagtägliche Quälerei grenzt an Masochismus.
Es hat Zeiten gegeben, da er sich einfach nicht dazu durchringen konnte. Überweisungen blieben liegen. Es gab kein Geld von den Versicherungen. Da hat sie Heleen gebeten, die Terminpläne herauszukramen, mehrere Wochen am Stück, und hat sich neben Daniel an den Computer gesetzt. Gemeinsam phantasierten sie sich dann den Inhalt der Sprechstunden zusammen, um auf dieser Grundlage einen ganzen Stapel formvollendeter Briefe zu schreiben.
Sie stellt sich neben ihn und schiebt ihn mit der Hüfte zur Seite.
»Lass mich mal tippen. Du erzählst.«
Im Zimmer auf und ab tigernd, resümiert er die Befunde seiner Sprechstunden, die er mit persönlichen Kommentaren und emotionsgeladenen Ausrufen spickt. Carolien übersetzt seine Eruptionen in gepflegten Hausarztjargon. Nach einer knappen Viertelstunde sind sie fertig.
»Ich bin ein intuitiver Arzt«, sagt er, »ich brauche eine Gouvernante, die meine Einfälle ordnet, sonst werde ich verrückt. Eigentlich bin ich zu alt für diesen ganzen bürokratischen Quark. Früher hab ich was auf eine Karteikarte geschrieben. Konnte keiner lesen, ich selbst auch nicht, aber das war egal, weil sowieso keiner draufgeguckt hat. Diese Kartei! Man konnte anhand der durchgestrichenen Adressen verfolgen, welchen Weg eine Familie durch die Stadt gemacht hat. Kinder, die hinzukamen, ein Kreuzchen hinter dem Namen eines verstorbenen Patienten.«
Er seufzt.
»Weißt du, dass ich nächsten Monat fünfzig werde? Zum Glück bist du jünger, da schaffe ich es vielleicht noch bis zur Ziellinie, solange du hier weiterarbeitest. Falls nicht, werde ich schon vorher aus dem Register gestrichen.«
Carolien reckt sich. Der Nachmittag ist immer besser als der Vormittag. Die Last eines ganzen Tages ist zu groß, zumal wenn auch noch die Sonne scheint. Ihre Stimmung hellt sich auf, wenn der Abend, wenn die Nacht in Sicht kommt. Dabei schlafe ich schlecht, denkt sie, so berauschend ist die Nacht gar nicht. Trotzdem ist der frühe Vormittag am schlimmsten.
»Spielst du noch mit Heleen?«, fragt Daniel.
»Streichquartett. Nächste Woche wieder.«
»Herrlich muss das sein. Ich beneide euch.«
»Ja, ich glaube, es gibt gar nichts Besseres, als mit Freunden Musik zu machen. Heleen spielt übrigens gut, sie war früher in diversen Amateurorchestern mit beachtlichem Niveau. Sie hat ein gutes Gehör und ist behände.«
»Die zweite Geige muss eine gute Krankenschwester sein«, sagt Daniel. »Wer ist bei euch eigentlich die erste Geige?«
»Hugo. Ein Cousin von Heleen. Er hat richtig Geige studiert, am Konservatorium. Von dort kenne ich ihn auch. Weil es für Musiker heute keine Stellen mehr gibt, ist er Direktor der früheren Musikhalle geworden. Zentrum heißt es jetzt. Zentrum von was, fragt man sich. Er organisiert vor allem Vorträge und Konferenzen, aber Musik, richtige Musik, findet praktisch nicht mehr statt.«
»Neulich schon, da habe ich dort ein Quartett aus Frankreich gehört. Lauter wunderschöne Stücke, Haydn, Schubert, Mozart. Es kostete ein Vermögen, aber das war es auch wert. Das Dissonanzenquartett, kennst du das?«
Natürlich kennt Carolien Mozarts schönstes Quartett. Dessen langsamer Satz hat es ihr besonders angetan. Sie lässt die Musik im Kopf ablaufen, während sie stumm an Daniels Schreibtisch sitzt. Wie kann es nur sein, dass Musik in der Welt, in der sie leben, derart in den Hintergrund gerückt ist? Für sie ist die Musik, die »klassische« Musik, etwas, das sie nicht entbehren kann. Wenn sie das aktive Musizieren nicht hätte, wäre sie verloren, davon ist sie überzeugt. Sie hat immer irgendein Thema oder eine Akkordfolge im Ohr, selbst wenn sie arbeitet. Worte machen sie müde, Musik schenkt ihr Ruhe. Wird der Musik keine Aufmerksamkeit mehr gewidmet, weil sie gefährlich ist? Sie erinnert sich an eine Szene aus einem Film über einen zum Tode verurteilten Mann. Die Frau, die ihn zu dem Raum begleiten soll, in dem die Hinrichtung stattfinden wird, fragt den Gefängnisdirektor, ob sie auf diesem Weg ein Lied singen dürfe. »Nein«, sagt er, »Musik weckt bei den Leuten Gefühle. Das können wir hier nicht gebrauchen.«
Es geht eher um Gleichgültigkeit als um vermeintliche Gefahr, denkt sie. Die Musik hat ihre Bedeutung verloren, an den Schulen wird sie nicht mehr unterrichtet, und es gehört schon lange nicht mehr zur Erziehung, dass man lernt, ein Instrument zu spielen. Musikschulen haben zugemacht, Orchester wurden aufgelöst, die berufliche Ausbildung ist so gut wie gestorben. Niemand kümmert’s.
Mollie steckt den Kopf zur Tür herein.
»Mir reicht’s für heute! Ich gehe! Schließt ihr selbst ab? Ciao!«
»Hast du das Telefon …«, beginnt Daniel, und sie kappt seine Rede mit einem ungeduldigen »Ja«.
Wir haben Feierabend, denkt Carolien. Anrufe werden automatisch auf die Nummer des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes umgeleitet, wir brauchen nichts mehr zu tun.
Daniel hat sich auf den Patientenstuhl gesetzt. Schweigend sehen sie sich an. Gleich wird er seine Sachen zusammenraffen und Anstalten machen, nach Hause zu gehen. Zu seiner Familie. Zu seinen Kindern. Ich gehe mit und steige in mein Auto. Es muss sein.
»Was machst du heute Abend«, fragt Daniel, »du hast doch hoffentlich was vor?«
»Cellostunde.«
»Ah. Gut.«
»Er ist über achtzig, mein Lehrer. Seine Frau ist schon seit Ewigkeiten weg, er lebt allein. Wie er das hinkriegt, weiß ich nicht, aber es geht. Wenn ich komme, zieht er die Vorhänge zu. Wir spielen in einer gepolsterten Schachtel.«
»Noch gesund? Hat er noch die eigenen Zähne?«
»Das weiß ich eigentlich gar nicht. Ich frage auch nicht. Für mich bleibt er ein vitaler Mann. Lachhaft, er ist ein gebrechlicher Greis. Das will ich nur nicht sehen. Komm, wir schließen den Laden hier ab.«
Brüsk erhebt sie sich, um ihre Tasche aus dem Sprechzimmer zu holen.
»Ich denke an dich, das weißt du doch, hm?«, sagt Daniel.
Obwohl seine Worte sie wirklich sehr berühren, kann sie nicht antworten. Sie hört, wie ihre Füße einen Tick zu fest auf den Boden stampfen. Sie fühlt, wie ihre Wangen starr werden, wie sie die Lippen zusammenpresst, so dass ihr Mund zu einem strengen Strich wird. Nach Hause, zu Jochem, zum Esstisch, zur Cellostunde. Wenn sie den Pfeilen folgt, wird der Tag vorbeigehen.
4 Jochem schließt sein Atelier. Zugluft führt Staub mit, und er hat gerade eine Geige lackiert. Er hängt seine Lederschürze an einen Nagel, wirft einen letzten Blick auf das geordnete Sortiment der Beitel und Hobel und macht die Tür hinter sich zu. Heute Abend, wenn Carolien weg ist, macht er weiter. Reparieren, neu besaiten, justieren. Die Nachfrage nach neuen Instrumenten ist nicht groß, die Geige, die er gerade baut, ist ein Glücksfall. Aber instandsetzen ist auch gut. Er ist zufrieden, wenn er ein Instrument, dem nur noch grausige Töne zu entlocken sind, so regulieren kann, dass der Klang aufblüht und einen Kern bekommt. Es ist Arbeit. Und Arbeit ist das, was er will und braucht. Arbeit hält ihn aufrecht. Er wüsste sich keinen Rat ohne den stetigen Strom kranker Cellos, Geigen und Bratschen, die in seine Werkstatt getragen werden, um unter seinen Händen zu genesen. Er spricht mit dem Holz, das überall in seinem Atelier verteilt liegt, in allen möglichen Formen: als dreieckig gesägte Keile, in denen noch kein Instrument zu erkennen ist, als blassgraue, samtweiche, gewölbte Deckblätter, als glänzende, rotbraun lackierte Geigen. Murmelnd redet er dem Holz zu, schnippt dagegen, um zu hören, in welcher Tonart es antwortet.
Er nimmt die Zeitung von der Fußmatte und breitet sie auf dem Küchentisch aus. Die gesamte Titelseite ist dem großen Erpressungsprozess gewidmet, der in dieser Woche beginnen wird. Warum lese ich das alles, denkt er, es ist mir eigentlich völlig schnurz. Das Verbrechen stellt einen Staat im Staat dar, das wird jedem klar, der mal ein bisschen darüber nachdenkt. Dass dieser kriminelle Schattenstaat größer und weiter verzweigt ist, als man dachte, überrascht kaum. Minister und hohe Beamte werden erpresst und geschmiert, und wer sich querstellt, verschwindet auf Nimmerwiedersehen oder stirbt urplötzlich. Man ist naiv, wenn man glaubt, dass die kompetentesten Unternehmen die größten Aufträge bekommen. So läuft das nicht. Tunnel, fortschrittliche Bahntrassen, Sportstadien, Krankenhäuser – den Zuschlag für den Bau erhält derjenige, dem es nach den Kriterien der Schattenregierung gebührt. Mit Qualität hat das nichts zu tun. Das Verfahren ist völlig undurchsichtig, niemand kommt dahinter.
Er setzt sich, steht wieder auf, um sich ein Glas Wein einzuschenken, und stützt dann beide Ellenbogen auf den Tisch. Was er liest, vergisst er sofort wieder. Aber es ist Arbeit. Um halb sieben nimmt er zwei Mikrowellengerichte aus dem Kühlschrank. Carolien wird gleich da sein. Er stellt Teller auf den Tisch, räumt die Zeitung weg, nimmt Besteck aus der Schublade. Er hört das Auto in der Einfahrt und stellt die erste Plastikschale in die Mikrowelle.
Caroliens Gesicht ist starr. Sie versucht, durch die Maske hindurch zu lächeln. Ohne Erfolg. Sie blickt auf die Verpackung des Fertiggerichts. »Lecker«, sagt sie ohne Überzeugung. Gesprochene Sprache muss sein, am Tisch sitzen muss sein, Essen muss sein. Na los, denkt er, tu deine Pflicht.
»Ging’s gut heute?«
»Ja, ja. Ruhiger Tag. Und bei dir?«
Er erzählt von einem nörgeligen Kunden, einem Mann, der mit einem Stück Brennholz zu ihm kam, aber Wunder was für eine Stradivari in seinem Kasten zu haben meinte, von seiner Geige, die er mit der letzten Lackschicht bestrichen hat.
»Oh. Fein«, sagt sie.
Was zum Teufel ist daran fein? Noch dazu in so gleichgültigem Ton dahergesagt; man hört einfach, dass sie das überhaupt nicht tangiert. Wie er sie über den Tisch zieht, ihr in die starre Visage schlägt, ihren mageren Leib schüttelt – er sieht es detailliert vor sich: eine Haarsträhne, die schmerzhaft straffgezogen wird, als seine große Hand ihre Schulter packt, ihre schlaffen Arme, die seitlich wegpendeln, blitzende Zähne, über die Blut zu rinnen beginnt.
Sorgsam und mit Bedacht schöpft er Essen aus der Plastikschale auf ihren Teller: ein Hügelchen Pasta, ein Stück Fisch, eine kleine grüne Wiese aus Zuckerschoten. Die zweite Schale dreht sich in der Mikrowelle. Wein aus dem Kühlschrank, einschenken, hinstellen.
»Danke«, sagt sie.
Er dreht ihr den Rücken zu und hantiert an der Arbeitsplatte. Die Wut überträgt sich nicht auf seine Bewegungen, er ist darin geübt, seine Motorik zu beherrschen. Ein Geigenbauer muss eine feste Hand haben. Selbst wenn er schier platzt vor Verärgerung über einen nervigen Kunden, kann er den Stimmstock von dessen Geige mit kleinen, sicheren Bewegungen richtig platzieren. So pfeffert er die Schalen auch jetzt nicht in die Spüle und lässt kein Messer auf den Boden scheppern. Langsam dreht er sich mit seinem eigenen Teller in der Hand wieder um. Setzt sich. Isst.
Carolien fährt mit ihrem Besteck über den Teller, verteilt die Essenshäufchen, ohne dass viel davon verschwindet. Wenn sie so weitermacht, denkt er, verschwindet sie noch selbst. Warum isst sie nicht? In bedrohlichen Situationen muss man stark sein, muss sich behaupten. Das geht nur mit der entsprechenden Ernährung. So macht er es ja auch. Er sieht, wie sie mit Mühe einen Bissen zu sich nimmt. Kaut. Jetzt, da er so genau darauf achtet, kann er ihren Widerwillen fast fühlen. Sie kann einfach nicht. Er greift zur Weinflasche.
»Ich gehe nachher zur Cellostunde«, sagt sie. »Wenn ich zurückkomme, können wir noch ein Glas trinken, wenn du magst.«
Annäherung. Seine Wut verraucht. Wir müssen das Beste daraus machen, denkt er, was immer dieses »Beste« auch sein mag. Es hat keinen Sinn, sich die Köpfe einzuschlagen. Besser, man ist freundlich zueinander und akzeptiert, dass jeder tut, was er kann, aber dass es dabei Differenzen gibt. Unüberbrückbare Differenzen. Es fühlt sich wie eine Niederlage an. Würde es mir besser gehen, wenn ich sie erschlage oder aus dem Haus jage? Wohl kaum. Ich muss für sie sorgen, mich aufregen, mich ärgern. Das ist Arbeit. Das ist gut.
»Was steht bei van Aalst auf dem Programm?«
Carolien scheint bei der Frage ein wenig aufzuleben.
»Technik«, sagt sie, »ich habe den ganzen Tag nicht gespielt, da muss ich zuerst einfach mal ein bisschen streichen. Und dann dieses Solo aus dem Dvořák-Quartett. Hast du dir den Mozart übrigens schon mal angeschaut?«
»Das Dissonanzenquartett war es doch, nicht?«
»Ja. Ich dachte heute plötzlich, dass es vielleicht eine nette Idee wäre, das für Daniel zu spielen. Er wird fünfzig, und er liebt Musik so sehr. Richtige Musik, wie er selbst sagt.«
»Auf einer Party, meinst du?«
Das ist nichts für ihn, so verletzlich den Blicken ausgesetzt zu sein, mit lauter angetrunkenen Gästen um sich herum. Und wer kann überhaupt noch einem Stück zuhören, das fast eine Stunde dauert? Da reden die Leute dann dazwischen, rücken mit den Stühlen, klirren mit Gläsern. Schreien. Nein, das möchte er nicht.
»Ich dachte eher tagsüber, bei ihm zu Hause«, sagt Carolien. »Nur für ihn und seine Familie. Ein kleines Hauskonzert.«
Sie lacht sarkastisch. Aber sie lacht. Jochem nickt.
»Ich sehe es mir heute Abend mal an. Übe ein bisschen. Gute Idee.«
5 Sehr gut, denkt Hugo. Dann habe ich den letzten Termin des Tages, und das Gespräch steht nicht unter Zeitdruck. Es sei denn, die Dezernentin muss noch zu einem Abendessen mit Firmenchefs oder Hafenbaronen. Sie hat es offenbar eilig. »Sekretariat R und E!«, blaffte die Frau, die über den Terminkalender der Dezernentin wacht, ins Telefon. Hugo hatte sie schnell so weit, dass sie einen anderen Ton anschlug. Weil er als Direktor des Zentrums, ehemals Musikzentrum, persönlich den Hörer abnahm oder weil er so entspannt und freundlich rüberkam? R und E, die ticken doch nicht mehr richtig! Die Buchstaben stehen für »Recreation« und »Events«, dabei umfasst das Ressort einen Großteil dessen, was früher unter Wirtschaft und Kultur firmierte. Er zuckt die Achseln und betrachtet sein Spiegelbild im riesigen Fenster. Schlank. Eng geschnittener Anzug. Absolut passabel. Kann so bleiben.
Seine Zimmertür ist halb geöffnet. Transparenz und Zugänglichkeit: Die Angestellten sollen zu ihm reingehen können, wenn sie etwas auf dem Herzen haben. Sie sollen ruhig hören, wie er telefoniert, sehen, wie er seine Berichte schreibt, mitbekommen, dass er sich mächtig dafür ins Zeug legt, das sinkende Schiff auf Kurs zu halten. Es ist still auf dem Flur. Die Putzkolonne kommt nur noch zweimal die Woche, und seine Sekretärin wurde auf eine Halbtagsstelle heruntergestuft.
Ist er enttäuscht? Er denkt mit Wehmut an die Zeit kurz nach der Eröffnung des Gebäudes zurück, als Abend für Abend interessante Ensembles und renommierte Solisten auftraten. Als die Presse seine Programmgestaltung wohlwollend kommentierte. Als noch Publikum im Saal saß. Die Subventionen versiegten, die Preise stiegen, und die Belegung des Saals nahm ab. Ensembles gingen zugrunde, Orchester wurden aufgelöst. Er hat es hautnah miterlebt. Die Lücken im Programm füllte er mit Kommerz auf: Verkaufsbörsen, Modeschauen, Betriebsfeste. Er findet das schlimm, aber unterschwellig verspürt er auch eine vage Neugier, ja beinahe Freude, die etwas mit dem stetigen Niedergang zu tun hat. Er hat keine Ahnung, woher diese Empfindung kommt, aber er weiß, dass sie ihm hilft weiterzumachen.
Unter seinem Schreibtisch steht der Geigenkasten. Noch ein Stündchen üben? Er könnte sich auf die leere Bühne stellen. Die Akustik des großen Saals wurde allseits gerühmt. Ein bisschen den Solisten mimen, Klang erzeugen, den Raum ausfüllen. Er nimmt den Kasten und steuert durch die verlassenen Flure.
Nach Dienstschluss setzt er sich aufs Rad und fährt zum Rathaus. Auch die Dezernentin hat ihre Tür offen stehen. Die Frau mit blondiertem Igelhaar und feuerrot geschminktem Mund tippt auf ihrer Tastatur. Sie hebt kurz die linke Hand, winkt ihn auf einen Stuhl und tippt dann weiter, bis sie mit einer theatralischen Gebärde beide Hände hebt – ein Pianist vor dem Schlussakkord. In einem großen Bogen lässt sie den Zeigefinger hinabtauchen und klickt auf Senden. Jetzt aufstehen und den Applaus entgegennehmen, denkt er. Schade, dass ich keine Blumen dabeihabe.
»Schön, dass du so schnell kommen konntest«, sagt sie. »Nicht viel los, hm?«
Die Häme ist nicht zu überhören, aber mich direkt zu fragen, wie es läuft, das traut sie sich nicht, weil sie Angst hat, ich könnte sofort in Vorwürfe und Klagegesänge ausbrechen.
»Wasser gern«, sagt er, als sie ihn fragt, ob er etwas zu trinken möchte.
Während die Dezernentin mit Flaschen und Gläsern beschäftigt ist – welche Intimität übrigens, dass sie das selber macht, er soll sich offenbar wie ein besonderer Gast fühlen –, betrachtet er die Aussicht. Wasser, genau wie bei seinem Gebäude. Touristen, ein Eiswagen, Boote. Wie es wohl wäre, wenn man auf so ein Boot springen und wegfahren würde?
»Ein unmöglicher Anblick«, hört er die Dezernentin sagen. Sie spricht schon seit einer Weile, er hat nicht aufgepasst. Mit einer Delegation Chinesen sei sie am Zentrum entlanggefahren, und das habe wie ein dunkles Ungetüm ausgesehen. Keinerlei Aktivität. Am Abend darauf sei ebenfalls alles leer gewesen, sie sei selbst daran vorbeigeradelt. Keine gute Werbung für die Stadt, die sie als »pulsierend« positioniert. Mit diesem Leerstand streue er ihr Sand ins Getriebe. Oder wie sehe er das?
Hugo wirft ihr einen ironischen Blick zu.
»Ich glaube nicht, dass wir die Diskussion über die Nutzung erneut aufrollen sollten. Du weißt, dass ich nicht das Geld habe, um das Gebäude zu füllen. In den Büroräumen sollten die Ensembles sitzen, der Nationale Kammerchor, das Hauptstadtorchester, die Konzertagentur. Die Einrichtungen konnten die Miete nicht bezahlen oder wurden aufgelöst – wie auch immer: Leerstand. Jetzt vermiete ich an ein Wassertaxiunternehmen, eine dubiose Anwaltskanzlei und jemanden, der rumänische Hilfsarbeiter für den Blumengroßmarkt anwirbt. Keine Musik, aber voll. Die Säle sind schwerer zu füllen, deshalb stehen wir drei, vier Abende die Woche leer. Dann mache ich das Licht aus.«
»Ich würde dir gern helfen«, sagt die Dezernentin.
Nanu? Macht sie jetzt etwa doch noch Subventionen locker?
»Ich hörte übrigens, dass du unlängst mit großem Erfolg Geiger in deinem Saal hattest. Ausverkauft.«
»Ein Streichquartett. In der ganzen Welt berühmt, nur hier bei uns nicht. Wir haben dreihundertfünfzig Euro pro Platz genommen. Das geht nicht oft.«
Die Dezernentin nickt.
»Ja, ja. In der Tat eine fruchtlose Diskussion, wenn wir auf die Programmsubventionierung zu sprechen kommen. Und so überholt. Wer will denn noch am Gängelband des Staates oder der Stadt geführt werden? Du bist eingestellt worden, weil du kreativ bist, weil du unkonventionelle Ideen hast. Ich trage das Meinige dazu bei, dass du die Autonomie hast, die du dafür benötigst. Aber zur Sache. Ich brauche einen Raum, in dem ich große Gesellschaften stilvoll empfangen kann. Einen repräsentativen Raum, ein Aushängeschild für die Stadt. Sie sollen was zu essen und zu trinken bekommen und sich Reden anhören. Leichte Unterhaltung, etwas Nettes in einem schönen Saal. Damit könnte ich deinen Leerstand beheben. Es kommen immer mehr Handelsdelegationen zu uns, die Stadt wird zum Gesprächszentrum für Unternehmer aus der ganzen Welt. Darauf konzentrieren wir uns bei der Stadt. Das ist ein Schwerpunkt unserer Politik.«
»Ich kann ein Angebot für dich erstellen lassen«, sagt Hugo trocken. »Verschiedene Optionen, mit oder ohne Abendessen, in den Foyers oder im Saal, Licht- und Tontechnik im üblichen oder im erweiterten Umfang. Mail mir doch deine speziellen Wünsche, dann hast du die Antwort binnen einem Tag auf dem Tisch.«
Die Dezernentin lacht und schüttelt den Kopf.
»Das wäre ja noch schöner«, sagt sie. »Ich habe das Gebäude errichten lassen. Alles finanziert, das Grundstück, die Architekten, den Bau. Alles. Da ist es doch wohl mehr als logisch, dass ich dort hin und wieder ein Fest zugunsten der Stadt geben kann. Ohne Aufpreis. Also gratis.«
»Energiekosten? Garderobenpersonal? Catering? Pförtner?«
»Was Speisen und Getränke betrifft, können wir, denke ich, auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Alles andere sind Peanuts, darüber will ich gar nicht reden. Du solltest froh sein, dass dein Gebäude eine wichtige Funktion erhält. Diese Kleinkrämermentalität bringt dich nirgendwohin.«
Bloß weg, denkt er. Nicht auf Diskussionen einlassen. Keinen Streit vom Zaun brechen, ist total sinnlos. Wie komme ich hier so schnell wie möglich raus, das ist die Frage.
Er schaut auf seine Uhr und erhebt sich gespielt erschrocken.
»Hör mal«, sagt er, »ich werde das morgen mit meinem Stab besprechen und rufe dich dann an.«
Mein Stab, denkt er, als er wieder auf dem Fahrrad sitzt. Wenn die wüsste! Der Stab bin ich allein. Grinsend kurvt er am Wasser entlang. Große Schiffe fahren Richtung Meer, an den schönsten modernen Gebäuden vorbei, die die Stadt zu bieten hat. Dem Museum für zeitgenössische bildende Künste, dem neuen Gericht, seinem eigenen Zentrum in der Ferne. Alle diese Einrichtungen haben eine katastrophale Baugeschichte. Inkompetente Bauunternehmer, jahrelange Verzögerungen, himmelhohe Überschreitungen der veranschlagten Kosten. Keiner griff ein, denn die Beamten im Rathaus, die einen gewissen planerischen Durchblick hatten, waren sorgfältig geschmiert worden.
Jetzt sieht es beeindruckend aus. An die unterirdische Zerstörung denkt man besser nicht. In zwanzig Metern Tiefe wütet der hoffnungslose Kampf darum, der Stadt ein funktionierendes U-Bahn-Netz zu verschaffen. Lecks, untaugliches Material, Diebstähle im großen Maßstab. Unter der Erde Tunnelstücke, die am Ende nicht zusammenpassen, über der Erde einstürzende Häuser. Aber wenn man auf dem Rad hier am geduldigen Wasser entlangfährt, sieht es phantastisch aus. Im Museum findet irgendeine Feier statt, Leute stehen mit Gläsern in der Hand auf der Terrasse und sehen sich die Schiffe an. Auch beim Gerichtsgebäude herrscht so spät am Tag noch Betrieb, da stehen Sicherheitsfahrzeuge, und Gittertore werden automatisch auf- und zugeschoben.
Er radelt an seinem eigenen Prachtbau vorüber, einem Koloss aus dunkelgrauem Glas. Die schönste Lage von allen, und es sieht aus wie eine gespenstische Riesenruine. Er lacht laut auf, ein Passant sieht ihn befremdet an. Dann ist er zu Hause und schließt sein Rad am Gatter seines Stegs an. Zufrieden blickt er auf das mit Gräsern und Fettpflanzen bewachsene Dach seines gigantischen Hausbootes. Noch eine Runde joggen? Ja, warum nicht.
6 Es ist in der Solanderlaan abends schwer, einen Parkplatz zu finden, doch sie hat Glück. Nicht weit vom Haus ihres Cellolehrers fährt gerade ein dickes Auto weg. Carolien kann mühelos einparken. Sie begleicht die Gebühren per Handy und zerrt das Cello von der Rückbank. Der Kasten sieht aus wie mit feuchten Schuppen besetzt, glatt und schimmernd, eine Fischhaut. Er hat Riemen, so dass sie ihn wie einen Rucksack tragen kann.
Bei van Aalst sind die Vorhänge geschlossen, aber als sie auf das Haus zugeht, hat sie den Eindruck, dass sich am Fenster etwas bewegt – hält er Ausschau? Ja, bestimmt, er erwartet sie gespannt, seine liebste, seine einzige Schülerin. Oder er ist misstrauisch wie alle alten Leute und will wissen, wer klingelt, bevor er die Tür öffnet.
Vor einem Vierteljahrhundert hat sie drei Jahre lang bei ihm am Konservatorium studiert, bis sie sich entschloss, dem Medizinstudium den Vorrang zu geben. Die Arbeitsbedingungen für Musiker wurden von Jahr zu Jahr schlechter, und eine Kehrtwende war nicht in Sicht. Sie wollte Sicherheit. Sie wollte Geld, eine Familie. Sie wollte etwas tun, was einen Nutzen hat, was den Menschen dient, wofür sie dankbar sind. Jochem bestärkte sie darin. Er ist vorausschauend, weiß meist, was kommen wird. Es werde immer Menschen geben, die an irgendwas erkrankten, an irgendwas litten, sagte er, aber ob es immer jemanden geben werde, der sich Cellosuiten anhören wolle, sei ungewiss. Er hat recht bekommen. Trotzdem hat er selbst unbeirrbar an seinem Instrumentenbau festgehalten, taub für seinen eigenen Ratschlag.
Sie klingelt, und sofort geht die Tür auf, und sie blickt in das schmerzverzerrte Gesicht ihres Lehrers. Er scheint an ihr vorbei auf die dunkle Straße hinauszuschauen, wo sich die Äste der hohen Bäume sanft im Abendwind wiegen.
»Hallo«, sagt Carolien. »Du hast doch mit mir gerechnet?«
Ein Schauder durchläuft den alten Mann; dann ist er wieder bei sich und sieht sie an.
»Natürlich, ich habe mich auf dein Kommen gefreut. Tritt ein. Ich gehe hinter dir her. Mein Knie macht mir heute zu schaffen.«
Sie geht ins Musikzimmer und stellt den Cellokasten auf seiner Seite halb unter den Flügel. Im Flur hört sie das Stampfen des Stocks. Langsam. Das Geräusch entfernt sich an der Zimmertür vorbei Richtung Küche. Muss ich etwas machen, denkt sie, sagen, dass er sich setzen soll, helfen, das Teeritual übernehmen? Keine Lust. Ich lass es geschehen. Wie ist es möglich, dass ich jetzt hier bin, dass sich alles verändert hat, aber er und ich hier zusammen sind? Mit Cellos. Die Aufregung vor fünfundzwanzig Jahren – ich achtzehn und er in der Blüte seines Erwachsenenlebens! Die Verliebtheit, um ehrlich zu sein. Die Musik als so wichtig zu empfinden, dass alles andere auf der Welt wegfiel. Ich war kein besonderes Talent, eher mittelmäßig. Aber ich arbeitete hart, und ich war nicht dumm. Das gefiel ihm. Er hatte so ein schönes Quartett, wir saßen mit der Celloklasse im Saal und schwelgten, wenn sie irgendwo auftraten. Sie gingen oft auf Tournee, dann übernahm sein Assistent den Technikunterricht. Die gesamte Konservatoriumszeit war ein Rausch, ein Traum. Kammermusik, Orchester, Vorspielen. Dass außerhalb davon eine andere Welt existierte, eine Welt mit Problemen, Pflichten und Verantwortungen, wusste ich zwar, aber es gelang mir, sie auszublenden und so zu tun, als würde ich in einem gesonderten Himmelreich zur Musikerin ausgebildet, wie ein Kind, das eine Zeitlang völlig in seiner Phantasie leben kann. Ich kam erst zur Besinnung, als ich Jochem kennenlernte. Ärztin werden. Das beschloss ich gleichsam mit einem anderen Hirn, war fast ein anderer Mensch. Das Cello stand verlassen in seinem Kasten. Die Saiten sprangen, das Haar des Bogens trocknete ein. Zerstörung im Verborgenen. Ich wollte nicht mal, dass Jochem es sich ansah. Ich bewegte mich nur noch zwischen Praktikums- und Operationssälen. Die Abende waren kurz, denn um sechs Uhr früh klingelte wieder der Wecker.
Sie hört Gepolter und das Klirren von Geschirr aus der Küche. Er kann mit diesem Stock in der Hand kein Tablett tragen, sie muss zu ihm. Ich lasse ihn im Stich, denkt sie, genau wie damals. Von einem Tag auf den anderen verwandelte ich mich von der leidenschaftlichen, besessenen Musikerin, die bereit war, ihren Geliebten mit dessen Karriere und dessen Ehefrau zu teilen, in eine Frau, die gesellschaftliche Verantwortung übernahm, mit ihrem Freund zusammenzog, um Kinder zu bekommen, und einen richtigen Beruf erlernte. Auf einen Schlag war alles vorbei: die Verliebtheit, die Illusion vom Musikerdasein, die Seifenblase, in der sie drei Jahre lang gelebt hatte.
Sie geht in die Küche. Er hat dort durchaus das eine und andere hinbekommen, Tassen auf einem Tablett, eine Teekanne, aus der Dampf aufsteigt. Ohne ein Wort hebt sie das Tablett von der Arbeitsplatte und bringt es ins Zimmer.