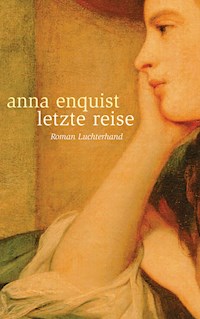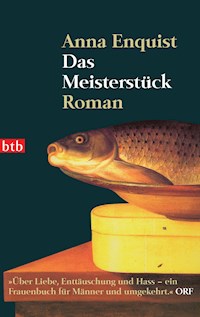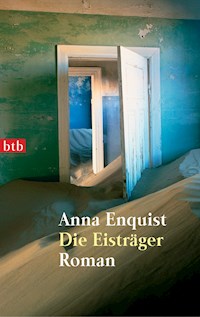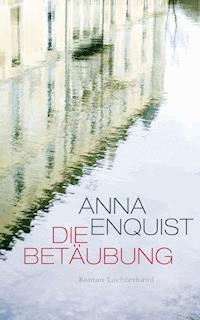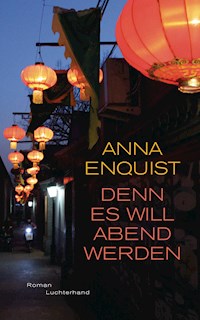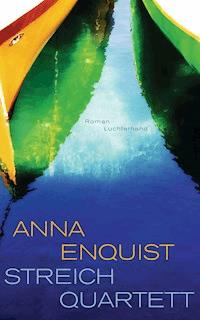Inhaltsverzeichnis
Aria
Copyright
Aria
Die Frau mit dem Bleifstift las über den Tisch gebeugt in einer Taschenpartitur der Goldberg-Variationen. Der Bleistift war aus edlem, schwarzem Holz und hatte eine Kappe aus schwerem Silber, in der sich ein Anspitzer verbarg. Der Bleistift schwebte über einem leeren Heft. Neben der Partitur lagen Zigaretten und ein Feuerzeug. Und ein kompakter kleiner Metallaschenbecher stand auf dem Tisch, das funkelnde Geschenk eines Freundes.
Die Frau hieß einfach nur »Frau«, vielleicht auch »Mutter«. Es gab Probleme mit der Benennung. Es gab viele Probleme. Im Bewusstsein der Frau waren es vorrangig Probleme mit der Erinnerung. Die Aria, die sie sich ansah, das Thema, zu dem Bach seine Goldberg-Variationen komponiert hatte, erinnerte die Frau an die Zeiten, da sie diese Musik einstudiert hatte. Als die Kinder klein waren. Davor. Danach. Auf solche Erinnerungen war sie nicht aus. Ein Kind auf jedem Schenkel, und dann mit den Armen um die Kinderleiber herum versuchen, das Thema herauszubekommen; im Kleinen Saal des Concertgebouw sitzen, den Pianisten auf die Bühne kommen sehen, atemlos auf die nackte Oktave des Einsatzes warten - den Ellbogen der Tochter spüren: »Mama, das ist unser Lied!« Das musste jetzt nicht sein. Sie wollte ausschließlich an ihre Tochter denken. Die Tochter als Baby, als Mädchen, als junge Frau.
Die Erinnerungen waren zu blassen Gemeinplätzen geschrumpft, die niemandes Interesse würden wecken können. Sie konnte nichts über die Tochter erzählen, sie kannte die Tochter nicht. Dann schreib doch darüber!, dachte sie wütend. Auch die Umgehung ist Bewegung, auch das Negativ zeigt ein Bild. Ob auch die Stille Musik war, wusste sie noch nicht so recht.
Bevor sie sich an den Tisch gesetzt hatte, hatte sie einen Artikel über die Zeitempfindung bei einem südamerikanischen Indianerstamm gelesen. Die Menschen dieses Volkes sahen die Vergangenheit vor sich und spürten die Zukunft im Rücken. Ihr Gesicht war der Geschichte zugewandt, und was noch anstand, kam als unvorhergesehener Überfall. Diese Art der Zeitempfindung spiegele sich in Sprachgebrauch und grammatikalischen Konstruktionen wider, so der Autor des Artikels. Die eigenartige umgekehrte Orientierung war von einem Sprachwissenschaftler entdeckt worden.
Der Frau fiel ein, dass sie die gleiche Geschichte schon einmal mit den alten Griechen in der Hauptrolle gelesen hatte. Doch trotz jahrelangen Unterrichts in griechischer Sprache und Literatur hatte sie davon nie etwas bemerkt. Vielleicht noch zu jung damals. Zu viel Zukunft, undenkbar, die Augen nicht darauf auszurichten.
Die Frau war noch nicht wirklich das, was man eine alte Frau nennen würde, aber ein gutes Stück dem Ende entgegengekommen war sie schon. Sie hatte eine umfangreiche Vergangenheit.
Die Vergangenheit. Das, was vergangen war. Angenommen, man würde wie so ein Indianer ganz selbstverständlich darauf blicken, man würde damit aufwachen, es würde einen den ganzen Tag begleiten, sich als Landschaft für den Traum anbieten. So eigenartig ist das gar nicht, dachte die Frau, eigentlich ist es genau so. Sie schloss die Augen und stellte sich die Zukunft in Gestalt eines Mannes vor, der hinter ihr stand, den sie nicht sah.
Die Zukunft hielt sie mit starken Armen umschlungen, ließ vielleicht sogar kurz das Kinn auf ihr ruhen. Die Zukunft war größer als sie. Lehnte sie sich rücklings an seine Brust? Spürte sie seinen warmen Bauch? Sie wusste, dass er über ihre Schulter mit in ihre Vergangenheit blickte. Erstaunt, interessiert, gleichgültig?
Mit großer Verbundenheit, nahm sie mal gutgläubig an. Er war schließlich ihre persönliche Zukunft. Sie atmete gegen seinen rechten Arm, der über ihrer Brust lag. An ihrem Hals eigentlich. Wenn er diesen Arm etwas weniger krampfhaft um sie legte, bekäme sie mehr Luft. Könnte sie etwas sagen.
Die Zukunft zog sie an sich, so fest, dass sie einen kleinen Schritt zurück machen musste. Und noch einen. Sie widersetzte sich. Die Vergangenheit musste nah bleiben, sie wollte volle Sicht darauf. Der Druck des Arms wurde unangenehm, es schien, als wollte die Zukunft sie mit aller Gewalt mit sich ziehen, sie zwingen, mit ihr rückwärts zu gehen, im Gleichtakt, mit beinahe eleganten Tanzschritten. Sie stemmte die Absätze in den Boden. Die Umarmung wurde zum Würgegriff, sie erstickte in den Armen der Zukunft. Sein Name ist Zeit. Er wird sie von dem wegführen, was ihr lieb ist, er wird sie an Orte bringen, wo sie nicht sein möchte.
Die Schlagzeuger auf dem Konservatorium waren eine Sorte Studenten für sich. Sie hausten in einer umgebauten Kirche, drehten sich ihre Zigaretten selbst und fingen spät an. Wenn sie in der Orchesterklasse mitmachten, hielten sie sich von den Streichern fern. Wie Bauarbeiter gingen sie hinten auf dem Podium zu Werke: Xylophone aufstellen, Glocken an Ständer hängen, Pauken im Format von Waschbottichen stimmen. Sie trugen Turnschuhe und riefen sich laut unverständliche Kürzel zu.
Von uns allen haben sie die größte Begabung für die Einteilung der Zeit, hatte die Frau, die damals noch jung war, gedacht, wenn sie dem Orchester vom Saal aus bei seinen Vorbereitungen zuschaute. Die Schlagzeuger tragen nicht schwer an der Zeit, machen kein philosophisches Problem daraus. Sie vernehmen den Pulsschlag, machen darüber die Rhythmen, übersetzen in Bewegungen, was sie spüren. Sie sind mit Warten und Schlagen beschäftigt, Warten und Schlagen, Schlagen.
Uns Menschen ist die Fähigkeit angeboren, aus einer Reihe genau gleicher Piepstöne bestimmte Muster herauszuhören. Wir können nicht anders. Das Strukturieren ist eine Eigenschaft unseres Gehirns, unseres Wesens, eine Überlebensstrategie, eine Krankheit. So machen wir aus dem unorganisierten, undurchsichtigen Brei um uns herum eine erkennbare und vertrauenerweckende Kulisse. Wir wissen gar nicht mehr, dass nichts davon stimmt, dass die Erkennbarkeit und das Vertrauen von uns selbst geschaffen werden. Man könnte einmal untersuchen, ob Strukturierungsmuster mit Persönlichkeitsmerkmalen zusammenhängen. Warum hört der eine einen Viervierteltakt und der andere einen Sechsachtel?
Wieso musste sie das alles jetzt denken, das war doch völlig konfus?
Es ging um die Zeit, die an ihrem Hals zog wie ein ungeduldiger Liebhaber, der sie systematisch zwang, rückwärts zu gehen, so dass die Sicht auf das, was vergangen war, immer schlechter wurde.
Mit einem großen Satz in die zurückliegende Zeit springen, dachte die Frau. Oder sich klammheimlich, in bleigrauer Vermummung zurückschleichen, zu einem Nachmittag voller Lieder, voller Musik, ein Kind links, ein Kind rechts. Diese Szenerie dann sehen, so eindringlich wie damals, als es wirklich geschah. Dasselbe fühlen, riechen, hören wie damals.
Nein, so geht das nicht, man empfindet nie dasselbe. Natürlich kann man zurückblicken (»vorausblicken«), doch die seither verstrichene Zeit, das, was in dieser Zeitspanne vorgefallen ist, färbt die Wahrnehmung. Niemals kann etwas in zwei verschiedenen Momenten dasselbe sein oder jedenfalls nicht als »dasselbe« wahrgenommen werden, weil sich der Wahrnehmende verändert hat.
Schau dir doch die Goldberg-Variationen an. Du spielst die Aria. O nein, dachte die Frau, nie mehr werde ich die Aria spielen. Na gut, du hast die Aria gespielt, Vergangenheitsform, dieses ruhige, tragische Lied. Es ist eine Sarabande, hör mal, ein feierliches Tempo und Nachdruck auf jeder zweiten Zählzeit, ein langsamer, vielleicht sogar gravitätischer Tanz. Du hast die Aria mit Einsatz gespielt, mit Leidenschaft, mit der Verpflichtung, es fehlerlos zu tun. Zum Schluss hin vervielfachen sich die Noten, aus den langen Notenwerten werden Ketten von Sechzehnteln, aber der ernste Rhythmus geht nicht verloren. Du hast der Versuchung, dann leiser, flüsternd zu spielen und mit einem kaum noch hörbaren Seufzer zu enden, nicht nachgegeben. Nein, auch damals schon hast du diese tristen Tongirlanden über der ruhig fortschreitenden Basslinie anschwellen lassen, hast nichts überhastet, sondern eher noch unmerklich ein wenig verzögert - kraftvoll, ungebrochen. Bis zum Schluss.
Nach der Aria komponierte Bach dreißig Variationen, in denen er das harmonische Schema, die Akkordfolge der Sarabande, beibehielt. Ihre Basslinie war die Konstante, gegen die er unerhörte Veränderungen abbildete. Zum Schluss erklang die Aria erneut. Die gleiche Sarabande, kein Ton mehr oder weniger. Aber war es das Gleiche? Ja, es waren die gleichen Noten. Nein, der Spieler und der Zuhörer konnten die dreißig Variationen zwischen dem ersten und dem letzten Ertönen der Sarabande nicht auslöschen. Mochte die zweite Aria auch mit der ersten identisch sein, man hörte sie doch anders, weil in der Zwischenzeit etwas geschehen war. Man konnte nicht zurück zu der Zeit, da man die Variationen noch nicht gehört hatte.
Ach, wie gern würde sie die Goldberg-Variationen einstudieren, aber sie hatte sich in die Aria verstrickt wie in ein Fangnetz. Lass es bleiben, hatte ihr Lehrer damals gesagt, das ist ein solches Gewurstel mit den Händen übereinander, viel Arbeit, wenig Ertrag. Nimm dir doch eine schöne Partita vor, eine nette Toccata, die Chromatische Fantasie!
Die Frau hatte sich gefügt, kein Problem, der Ratschlag war richtig und verständlich. Aber gleich nach der Abschlussprüfung hatte sie die Partitur aufs Notenpult gestellt.
Wenn kein Zeit- und Leistungsdruck mehr da sind, kommt es auf Disziplin an, und die kann man nur mit Leidenschaft nähren. Sie war so weit in die Musik eingedrungen, wie es ihre Möglichkeiten erlaubten. Worüber verfügt man nach einer Ausbildung am Konservatorium? Virtuosität, Beherrschung, zu viel Ohr für das Beeindruckende, den äußeren Schein. Für diese Variationen bedurfte es einer neuerlichen Demut, nur konnte man sie aus Demut heraus niemals spielen. Die Technik erforderte Überlegenheit.
Technik heißt Behändigkeit, Muskelstärke, Bewegungsautomatisierung, Wendigkeit. Mit dem Trainieren dieser Dinge kann man leicht die Stunden füllen. Man spürt seine Muskeln, das stimmt zufrieden. Der Körper sagt einem, dass man die Zeit gut und sinnvoll verbracht hat. Steht nicht auf dem Titelblatt der Goldberg-Variationen »Klavierübung«? So ist es. Die physische Technik ist um die Abschlussprüfung herum auf dem Höhepunkt. Nie wieder wird man so gut in Form sein.
Das ist trügerisch. Zur Technik gehört nicht nur die Beherrschung der Muskeln, sondern auch die Beherrschung der Gedanken. Man muss denken: die Stimmführung hören, die Platzierung von Händen und Fingern antizipieren, vorausdenken, um Tempo, Dynamik und Phrasierung zu gestalten. Ein Großteil des Trainings spielt sich im Kopf ab. Das erfordert noch mehr Disziplin als das eigentliche Üben am Klavier. Wenn man am Klavier sitzt, sorgt allein schon die Trägheit des Körpers dafür, dass man nicht aufsteht. Gedanken aber sind so flüchtig und können sich so unvermittelt wenden, dass es beinahe unmöglich ist, sie im Zaum zu halten.
Als sie die Variationen zum ersten Mal einstudiert hatte, war sie Sklave ihres spielenden Körpers gewesen. Deshalb wurde es nichts, jedenfalls nicht mehr als eine Behändigkeitsübung. Sie hatte mit der Edition von Peters geübt und die Noten genommen, wie sie ihr aufgetischt wurden. Im Laufe ihrer Ausbildung hatte sie ja gelernt, die kuriosesten und kompliziertesten Partituren in Bewegung und schließlich Klang umzusetzen, da konnten auch die merkwürdigen Situationen, die sich auf der Klaviatur ergaben, weil Bach seine Variationen für ein Instrument mit zwei Manualen geschaffen hatte, nicht wirklich problematisch sein. Dennoch hatte sie Probleme gehabt. Welche Hand oben, die, welche die Melodie spielte, oder die, welche die Gegenstimme hatte? Was war eigentlich Melodie, und was war Umspielung? In der Polyphonie waren alle Stimmen gleichwertig. Die Fingersätze in der Partitur, gemacht von einem alten Cembalisten mit Vorurteilen und Abneigungen, brachten ihr nichts. Hatte sie gedacht. Sie hatte ihn vor sich gesehen, den imaginären Cembalovirtuosen. Dicker Wanst unter stramm geknöpfter Weste, sorgfältig über den kahlen Schädel geklebte lange Nackenhaare. Missbilligender Blick im fleischigen Gesicht. Eigentlich konnte sie noch von Glück reden, dass ihre Finger zwischen die schwarzen Tasten passten, so dass sie mit der einen Hand hoch oben auf der Taste spielen konnte, während die andere weiter unten auf derselben Taste zugange war. Es gab Pianisten, die den Deckel hinter der Klaviatur entfernten, um die Goldberg-Variationen ausführen zu können. Dann schaute man geradewegs in das rohe Werk des Instruments, sah die Hämmer hochfliegen, die Saiten anschlagen und wieder herunterkommen. Da das Auge dies mit einer winzigen Verzögerung registrierte, schaute man also in die Vergangenheit; was man sah, war gerade geschehen.
Sie hatte die Variationen im Laufe von einigen Monaten abgearbeitet. Das heißt, sie konnte alles vom Blatt spielen. Von diesem speziellen Blatt, auf dem sie selbst die Fingersätze eingefügt und Handpositionen dazugezeichnet hatte. Eine andere Ausgabe hätte sie sofort verwirrt und desorientiert, und sie hätte gestümpert und danebengegriffen. Eine Schwäche. Kannte sie die Goldberg-Variationen eigentlich wirklich, oder kannte sie nur deren Niederschlag in diesem Notenbild - was war echt, was war Kopie, bloßer Abklatsch? Es war fraglich, wie fest sich die Variationen in ihrem Denken, ihrem Kopf, der Hirnrinde verankert hatten. Auf Rückenmarksebene war alles reibungslos gelaufen, ein Blick aufs Papier hatte die eingeschliffenen Bewegungen von Arm, Handgelenk und Fingern in Gang gesetzt. Aber manchmal war es für sie eine Überraschung gewesen, welche Variation beim Umschlagen der Seite als Nächstes kommen würde. Sie hatte sie nicht im Kopf. Ohne Noten hätte sie die Variationen wahrscheinlich nicht in der richtigen Reihenfolge aufzählen können. Den Anfang sicher schon, den Schluss auch, die letzten fünf oder so. Aber dazwischen war ein einziger Brei, genau wie es die Lernpsychologie prophezeite. War der Lebensabschnitt schuld gewesen? Die Kinder waren damals klein und vereinnahmend. Sie musste jederzeit vom Klavierschemel aufspringen können, um etwas zu trinken zu holen, vorzulesen, eine Frage zu beantworten. Die Schlafphasen der Kinder waren gerade eben lang genug, um eine einzige schwierige Passage zu üben, nie war genügend Zeit, einmal alles hintereinander durchzuspielen, Tempi aufeinander abzustimmen, ein größeres Ganzes zu entdecken. Ja, gib nur den Kindern die Schuld. Sie hatte sich selbst nicht genügend dazu angehalten, hatte sich einfach von den Noten leiten lassen und sich darin verloren.
Über Bach hatte sie seinerzeit auch nicht viel gewusst, obwohl sie ungemein schwierige Stücke von ihm gespielt hatte und nicht wenige. Früher Bach, später Bach, Köthen, Leipzig, erste Frau, zweite Frau? Keine Ahnung. Wie man diese schnellen kleinen Noten von Variatio 17 non legato, weich und doch gleichmäßig ausführen konnte, das hatte sie interessiert. Sie hatte, als sie eine Zeitlang Beschwerden an der rechten Hand gehabt hatte, Brahms’ für die linke Hand geschriebene Klavierbearbeitung von Bachs berühmter Violinchaconne einstudiert, aber die Übereinstimmungen zwischen diesem Stück und den Goldberg-Variationen waren ihr nicht aufgefallen. Sie hatte genug zu tun mit den Sprüngen und Tremolos.
Alles geschieht zweimal, hatte sie unlängst irgendwo gelesen, das erste Mal als Tragödie und das zweite Mal als Farce. Sie las einfach zu viel. Der Ausspruch wurde mehreren Philosophen zugeschrieben. Der Frau am Tisch, der Frau mit dem Bleistift, war gleichgültig, wer es gesagt hatte - nicht aber, ob es der Wahrheit entsprach. Es lag in ihren Händen, es zumindest teilweise wahr zu machen. Nichts hinderte sie daran, jetzt, nach dreißig Jahren, die Goldberg-Variationen noch einmal einzustudieren. Als Farce.
Sie zögerte. Langsam durchblätterte sie die kleine Partitur. Dreiergruppen, dachte sie, und jede besteht aus einem »freien« Stück, einem virtuosen Stück und einem Kanon. Die Kanons schienen ihr der rote Faden zu sein, der den Spieler durch das ganze Werk führte. Im ersten Kanon machte die eine Stimme die andere buchstäblich nach. Das hatte fast etwas Piesackendes. Unter den beiden aneinander zerrenden Stimmen brummte ein unruhiger Bass. Sie blätterte von Kanon zu Kanon. Die Stimmen entfernten sich immer weiter voneinander, die zweite Stimme antwortete mit einem Ton Abstand, dann, im dritten Kanon, mit einer Terz dazwischen. Immer weiter liefen die Stimmen auseinander. In manchen Kanons wurde die Antwort in der Umkehrung gegeben, die ganze Melodie wurde andersherum gespielt. Weiter, weiter. Canone all’ Ottava, die gleichen Noten, aber durch das perfekte Intervall getrennt. Alla Nona, zum ersten Mal ohne Bass, nur die zwei Stimmen, die einander mit drastisch differierender Ausgangsposition umspielten. Und bei der dreißigsten Variation, dort, wo eigentlich der letzte Kanon stehen müsste, stieß sie auf das seltsame »Quodlibet«, ein vierstimmiges Gespinst aus Liedfragmenten. Sie schlug die Partitur zu.
Überblick wollte sie haben, diesmal. Eine Farce sei schwieriger als eine Tragödie, sagten Schauspieler, die was davon verstanden. Sie musste sich gründlich vorbereiten, wenn sie dieses Werk erneut einübte. Auf eine Tragödie bereitete man sich nicht vor, die stieß einem zu. Aber sie war doch glücklich gewesen damals, beim ersten Einstudieren, oder? Wo verbarg sich denn im Bild einer jungen Mutter mit zwei kleinen Kindern die Tragik? Vielleicht lag das Tragische in der Intensität der Erfahrung. Sie war völlig absorbiert gewesen vom Gefühl minutiöser Mutterschaft. Sie hatte sich in der Mutterschaft aufgelöst, nein, die Mutterschaft hatte sich in ihr aufgelöst, hatte sie bis in die Fingerspitzen erfüllt, mit denen sie ihren Kindern die Variationen vorspielte. Die Tragödie ließ keinen Raum für Reflexion und verbot die Distanz, die nötig war, um Überblick zu gewinnen. Die Tragödie war eine Welle, die einen fortriss, ein Lavastrom, eine Windhose. Für die Farce nahm man in einer Beobachtungshütte Platz. Man schaute, verglich, sorgte für ein genaues Timing. So würde es diesmal gehen müssen.
Vergleichende Textforschung. Mit dieser blöden Peters-Edition kam sie nicht weit. Auf das ärgerliche Geschiebe mit übereinander spielenden Händen, nur um dem Notenbild zu gehorchen, hatte sie keine Lust mehr. Es musste möglich sein, Stimmen zu verlegen, das, was für die eine Hand notiert war, mit der anderen Hand zu spielen. Das war das erste Ziel: eine Partitur zu besorgen, aus der man einigermaßen bequem spielen konnte. Keine Zugeständnisse, sie saß nicht hier, um ein Cembalo nachzuahmen. Bach ging immer, er war universell und klang auf der Gitarre, dem Akkordeon wie auch auf dem Flügel.
In der Musikhandlung verstand man nicht, wovon sie redete. Der Mann hinter dem Ladentisch zog einen Stapel Goldberg-Ausgaben hervor - einen »Urtext« des Henle Verlags, den von Peters und eine Ausgabe von Kirkpatrick der Schirmer’s Library. Die nahm sie mit nach Hause, obwohl auch Kirkpatrick Cembalist gewesen war. Er war wohl schon tot. Sie entsann sich einer Goldberg-Aufnahme von ihm auf zwei Langspielplatten. Sechziger Jahre. Die dicke Partitur bestand zur Hälfte aus Text, bösem, vorwurfsvollem Text. Warum, rief der alte Cembalomeister verzweifelt, warum weiß kein Mensch, dass man einen Pralltriller IMMER mit der Obersekunde beginnt? Das sei in allen maßgeblichen Texten so beschrieben, er selbst predige es seit Jahren, und dennoch beharrten alle auf ihren Fehlern. Auch in Bezug auf das Instrument brachte er ernstliche Ermahnungen vor. Der Pianist - der Terminus klang in diesem Kontext wie ein Schimpfwort - müsse sich darüber bewusst sein, dass er eine BEARBEITUNG spiele. Die Ausnutzung pianistischer Ausdrucksmöglichkeiten habe zu unterbleiben, das gehöre sich nicht und zeuge von schlechtem Geschmack. Sie schämte sich fast für ihren klobigen, lauten, ordinären Flügel.
Zu den Fingersätzen hatte Kirkpatrick ebenfalls eine Meinung. Der Daumen durfte gegebenenfalls auf die schwarzen Tasten, Gott sei Dank, aber praktische Beispiele wurden leider nicht mitgeliefert. In seiner Ausgabe standen keine Fingersätze. Nicht ein einziger. Die müsse der Spieler schon selber machen, schrieb er, denn »es gibt kein besseres Mittel gegen Faulheit als ARBEIT«.
Eine durch und durch masochistische Anschaffung also. Aber Grund dafür, dass das Buch trotzdem in ihrer Tasche steckte, waren die mit dünner, gräulicher Tinte gedruckten alternativen Versionen einiger schneller Variationen. Bei diesen Alternativen war die Position der Hände verlegt, genau so, wie sie es sich wünschte. Sie waren über die Originalzeilen gedruckt, so dass man die ursprüngliche Stimmführung leicht verfolgen konnte. Das habe er, Kirkpatrick, gemacht, damit man das eine und andere gleich vom Blatt spielen könne. Als ob je ein Mensch diese Variationen auf Anhieb spielen könnte! Aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, es war genau das, was sie brauchte. Kopieren, ausschneiden, die Originalzeilen wegwerfen und die Alternativen auf ein weißes Blatt kleben. Fingersätze machen. Arbeit.
Klavier zu üben war für die Frau am Tisch eher Betäubungsmittel als sonst etwas. Sie musste sich zwingen, den Überblick zu behalten. Wenn alles in etwa sitzt, dachte sie, muss ich die Variationen in Gruppen üben, für den besseren Überblick. Zehn Gruppen à drei, fünf à sechs, drei à zehn, zwei à fünfzehn. Und dann … das Ganze. Und lies mal was, dachte sie, eine musikwissenschaftliche Abhandlung über das Werk, eine Biographie seines Schöpfers. Nicht noch mal Thomas Bernhards Der Untergeher, nicht wieder alles Mögliche zu Glenn Gould - nicht die Sentimente, die das Werk aufrührt, sondern dessen eigentliche Hintergründe.
Wer es schrieb? Der reife, erwachsene Bach. Der Komponist, der Ehemann, der Vater. In Leipzig, wo er den miserablen, undisziplinierten Knabenchor beaufsichtigte. Die Frau war schon einmal in Bachs Haus gegenüber der Thomaskirche gewesen, sie hatte auf dem Hof gesessen und eine Zigarette geraucht, sie hatte seit Jahrhunderten verflogenen Cembaloklängen nachgehorcht.
Für wen er es schrieb? Für sein liebstes Kind, Wilhelm Friedemann, den ältesten Sohn aus erster Ehe. Seinen Virtuosen. Der sollte mit den Variationen bei seiner neuen Stellung in Dresden glänzen können. Bach besuchte seinen Sohn dort 1741. Schliefen sie zusammen in einem Zimmer, unterhielten sie sich im Dunkeln, sangen sie einander Themen und Liedfragmente vor? Friedemann war fast zehn gewesen, als seine Mutter gestorben war, es könnte sein, dass er mit seinem Vater über sie sprach, bevor der Schlaf beide überwältigte. Gab es Vorwürfe? Ein Jahr nach dem Tod seiner Frau hatte Bach Anna Magdalena, eine einundzwanzigjährige Sopranistin, geheiratet. Sie waren mit dem gesamten Haushalt nach Leipzig gezogen, und jedes Jahr kam ein weiteres Kind. Was hatte Friedemann davon gehalten?
Die Frau am Tisch dachte an die Violinchaconne. Es hieß, Bach habe sie zum Gedenken an seine erste Frau komponiert. Wie konnte er sich bei solchem Kummer in eine kleine Sängerin verlieben? Hatte er den Schmerz in die Chaconne gesteckt und war danach frei davon gewesen? Jedenfalls hatte er sich verliebt und schrieb einfache, anmutige Klaviermusik für seine neue Gemahlin, die aus dem Notenbüchlein, das ihr Mann für sie zusammenstellte, Cembalo lernen wollte. Wie rührend. Der Mann, der die Brandenburgischen Konzerte entworfen und sich das Wohltemperierte Klavier ausgedacht hatte, schrieb kleine Menuette und Gavotten für seine junge Frau.
Und die Sarabande, die zur Aria der Goldberg-Variationen werden sollte, zum Keim, aus dem alle dreißig Variationen hervorwachsen würden. Anna Magdalena übertrug die Noten eigenhändig in ihr Lehrbüchlein. Hörte sie nicht den Schmerz in dieser schlichten Melodie? War sie taub für die letzten acht Takte, in denen ihr Schöpfer seine Verzweiflung zu unterdrücken und sich mit letzter Kraft aufrecht zu halten versucht?
Es musste einen unüberbrückbaren Unterschied zwischen Bach und seiner zweiten Frau gegeben haben. Sie, noch am Anfang, verlor sich in einem Leben voll wunderbarer Musik und bewegte sich zwischen Cembalos, Bratschen, überquellenden Notenschränken durchs Haus. Er, fest entschlossen, neu anzufangen, aber noch im Schlick der Vergangenheit watend, war vermutlich von Dankbarkeit erfüllt - und von einem Schmerz, den er mit niemandem teilen konnte und daher nur in der Musik durchschimmern ließ, die er schrieb. Er kannte die perverse Unzuverlässigkeit des Lebens, wusste, dass nichts und niemand vor Verlust schützte. Man ging altbekannte Wege, und plötzlich tat sich ein Abgrund auf, in dem alles verschwand. Lautlos.
Vielleicht dachte er daran, als er in Dresden neben seinem Sohn lag, auf dessen Atmung horchend und mit weit geöffneten Augen ins Schwarze starrend. Womöglich schwindelte ihm, konnte er sich die Maße des unbekannten Zimmers nicht mehr vergegenwärtigen: Wer weiß, ob er nicht am Rande eines Abgrunds ruhte und in die stille Leere stürzen würde, sowie er sich umdrehte? Schweißgebadet lag der große Bach regungslos in seinem Gästebett in der Stadt Dresden, ohne Halt und Überblick.
Die Frau mit dem Bleistift stellte sich vor, wie er sich zwang, an seine Variationen zu denken. Ein schön gebundenes Exemplar mit Goldprägung lag, in ein Stück Leinen gewickelt, in seinem Reisegepäck. Er würde es am nächsten Tag Seiner Königlichen Hoheit dem Kurfürsten, oder wie immer der Mann tituliert zu werden wünschte, bei dem Friedemann in Diensten war, überreichen. Für Friedemann selbst hatte er ein Exemplar in schlichterer Ausführung bei sich. Die Variationen! In der bedrohlichen Stille baute Bach sie aufs Neue auf, spielte sie, in Gedanken, im richtigen Tempo. Er reihte eine an die andere, die Stimmen breiteten sich in seinem Kopf aus und vertrieben Verzweiflung und Angst. Er erzählte sich selbst eine Geschichte ohne Worte und fiel noch vor Variatio 16 in Schlaf.
Die Frau seufzte sehnsüchtig. So weit war sie noch lange nicht. Die Variationen wie Perlen auf einer Schnur, in der richtigen, der logischen Reihenfolge; die beiden identischen Arias wie ein Verschluss ineinanderklickend, der Anfang ins Ende. Oder: das Ende hörbar im Anfang.
Üben war der einzige Weg. Nach dem Moment suchen, da das Werk zu schrumpfen begann, das Detailchaos, die überwältigende Fülle einer Ordnung Platz machte. Dazu musste man sich hartnäckig in die kleinsten Fragmente vertiefen. Einen anderen Weg gab es nicht. Erst wenn alles, jede Note, in höchster Ausarbeitung durchdacht, gemeistert und in die Motorik aufgenommen war - erst dann konnte die Aufmerksamkeit eine Stufe höher steigen und das Blickfeld sich weiten.
Geduld. Dranbleiben. Irgendwann, in einem unverhofften Moment, würde sich der Horizont erweitern, und die Variationen würden in einer Konfiguration daliegen, die so selbstverständlich war, dass man gar nicht mehr verstand, wieso sie je Verwirrung gestiftet hatten.
So kann man auch ein Leben umreißen, dachte die Frau. Sie malte mit ihrem Bleistift Kreise auf das Papier, verbunden durch eine Linie. Die gleiche Harmonie in stets neuen Formund Klangfächern, die schließlich ein komplettes Bild vom Geschehenen lieferten. Von der Vergangenheit, die vor ihr lag.
Sie musste hinein. Sie musste sich trauen, so, wie man als Kind mit achtloser Verzweiflung zum ersten Mal vom Dreimeterbrett ins Wasser springt. Hinein.
Im Fernsehen kam ein Film über Glenn Gould. Er hatte die Goldberg-Variationen zweimal eingespielt, am Anfang und am Ende seiner Pianistenkarriere. Es war Nacht. Die Frau saß im Schneidersitz vor dem Bildschirm und schaute sich den aufgedunsenen, ungesund aussehenden Pianisten an. Nicht lange danach würde er sterben, der Tod versteckte sich schon unter seiner Haut, aber jetzt, aber noch beugte er sich tief über die Klaviatur. Seine schwere Brille mit dem dunklen Gestell berührte beinahe das Elfenbein der Tasten. Er hockte auf dem Rand eines ramponierten Holzstuhls ohne Sitzfläche. Bei der ersten Aufnahme des Stücks, 1955, war der Stuhl noch ganz gewesen. Damals war Glenn Gould ein junger Mann mit dichtem, welligem Haarschopf und trug ein kariertes Hemd. Natürlich hatte ihm die Plattenfirma geraten, für diese - seine erste - Platte ein leichter zugängliches Stück auszuwählen, etwas, was die Zuhörer wiedererkennen und sofort goutieren würden, etwas, was leichter ins Ohr ging. Das kam für ihn nicht in Frage. Die Tragödie nahm ihren Lauf, der junge Glenn Gould spielte im Columbia-Studio in New York die Goldberg-Variationen ein.
Beim Anhören der aufgenommenen Fragmente tanzte er mit geschlossenen Augen durch den Raum, singend, dirigierend, die Melodielinien mit ausholenden Gebärden begleitend. Die Frau hatte Fotos davon gesehen. Unschuld, Naivität, totaler Ernst. Über jemanden, der sich derart ernst nahm, hätte man die Achseln zucken, laut lachen oder mitleidig den Kopf schütteln können. Doch das tat man nicht, denn was man sah, war die Jugend selbst, die Tragik des Jungseins. Ehrfürchtiges Schweigen war die passende Antwort darauf.
Die Filmbilder, die sie sich anschaute, waren rund siebenundzwanzig Jahre später aufgenommen worden. Siebenundzwanzig Jahre. Ein ganzes, wenn auch viel zu kurzes Leben, das den Pianisten allem Anschein nach erschöpft hatte. Manchmal zitterten seine Hände, und er musste sie mit äußerster Willenskraft in den Zaum des richtigen Tempos zwingen. Er ächzte. Er bewegte die Lippen.
Mit Grausen starrte die Frau auf die gezeigten Bilder. Sie hatte sich die Partitur auf den Schoß gelegt, um mitlesen zu können. Wusste der Pianist, dass er bald sterben würde? Er schien sich unter diesem Wissen herauszuwinden. Mit seinem schwammigen Körper drehte er sich in die Musik hinein, rundete den Rücken, um die gesamte andere Wirklichkeit - die Lampen, die Techniker, die Uhr - auszuschließen. Wider besseres Wissen bildete er einen Panzer gegen die Wirklichkeit, eine Eierschale, in der er mit Bach allein war. Derweil wurde dieser intime Verkehr in Bild und Ton aufgezeichnet, so dass die Frau vor dem Bildschirm sich ihn Jahre danach ansehen konnte. Ein schmieriges Schauspiel, von dem man sich über das Ansehen distanzierte. Eine Farce.
Gould hob zur fünfundzwanzigsten Variation an, dem dramatischen Höhepunkt des gesamten Werkes. Ein Adagio. Er nahm das Tempo so weit zurück, dass er die Linien im Kopf gerade noch festhalten konnte, das Ganze stand beinahe still.
Das ist Verzweiflung, dachte die Frau. Was ich hier sehe, ist ein Mensch, der zugleich weiß und nicht weiß, der mit diesem Wissen ratlos ist, der versucht, sich in dem eng geschnittenen Mantel der Verzweiflung zu verstecken, den Bach ihm hinhält. Hier, steck nur die Arme hinein, ich werde den Kragen hochziehen, damit der Mantel perfekt um deine Schultern fällt. Spiel jetzt.
Er spielte. Er hatte seine Umgebung, die Zuschauer vergessen, solange es dauerte, und die Dauer hatte keinen Schlusspunkt. Die Melodie ging verloren, der Fuß war vom Pedal geglitten, und es bestand keine Verbindung mehr zwischen den Tönen, die - bei Glenn Gould im Kopf - fest zusammengehörten. Er schwebte hoch über der bodenlosen Tragik dieses Adagios, baute nichts auf, veranschaulichte nichts, interpretierte
Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel Contrapunt bei De Arbeiderspers, Amsterdam.
Verlagsgruppe Random House
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2008 Anna Enquist Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2008 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Druck und Einband: GGP Media GmbH, Pößneck www.luchterhand-literaturverlag.de
eISBN : 978-3-641-02506-9
Leseprobe
www.randomhouse.de