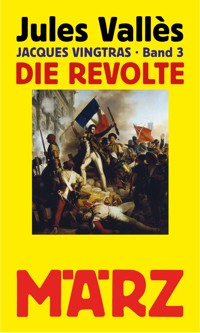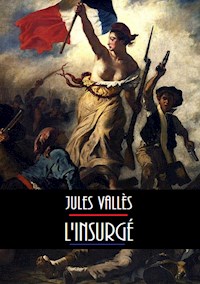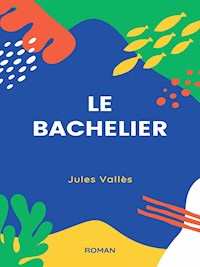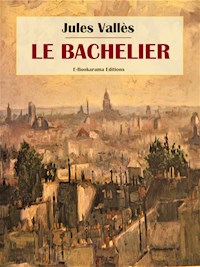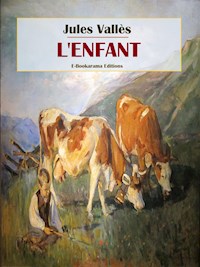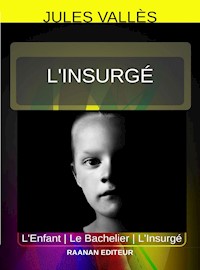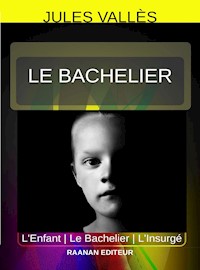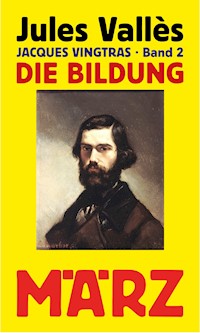
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MÄRZ Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jacques Vingtras
- Sprache: Deutsch
Ausgehend von seinen eigenen Erfahrungen führt uns Jules Vallès auf die Spuren seines Alter Egos Jacques Vingtras, einem Junggesellen, der vom Land aus nach Paris zieht, wo er politischen Hoffnungen und romantischen Desillusionen begegnet. Vallès begnügt sich nicht damit, das Portrait eines jungen Mannes auf der Suche nach seinem Lebensideal zu zeichnen. Das eigentliche Thema des Buchs ist die Entwicklung seines revolutionären Geistes gegen den Widerstand der Kirche, seiner Eltern, der Gesellschaft. Den traditionellen Entwicklungsroman überlagert Vallès mit einer Vielzahl von Stimmen: Zeitungsschlagzeilen, Gesprächsfetzen und das Geschrei auf den Straßen dringen ungefiltert in den Erzähler, bringen ihn aus der Fassung und schließlich auf den gerechten Weg der Revolution. Das alles erzählt Vallès mit feinem Gespür für menschliche Widersprüche und einem Humor, der uns noch heute, fast 150 Jahre nach der Ersterscheinung in Frankreich, zum Lachen bringt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jules Vallès
Die Bildung
Zweiter Band der Trilogie
Jacques Vingtras
Aus dem Französischen übersetztund mit Anmerkungen versehenvon Christa Hunscha
Herausgegeben vonBarbara Kalender
MÄRZ
DIE BILDUNG
DENEN,die, mit Griechisch und Latein genährt,Hungers gestorben sind,widme ich dieses Buch.
JULES VALLÈSParis
Inhalt
I Unterwegs
II Matoussaint?
III Hôtel Lisbonne
IV Die Zukunft
V Der grüne Anzug
VI Politik
VII Die Fakultäten
VIII Die Vergeltung
IX Das Haus Renoul
X Mein Zorn
XI Das Komitee der Jugend
XII 2. Dezember
XIII Nach dem Zusammenbruch
XIV Verzweiflung
XV Legrand
XVI Paris
XVII Die Kameraden
XVIII Möbliert
XIX Die Pension Entêtard
XX Ba, Be, Bi, Bo, Bu
XXI Hauslehrer, Pantoffeln
XXII Die Nadel
XXIII High Life
XXIV Der Christus von der Wurst
XXV Mazas
XXVI Journalist
XXVII Zufällige Gabelbissen
XXVIII Heiratsangebot
XXIX Herr, Herr Bonardel
XXX Unter dem Odéon
XXXI Das Duell
XXXII Agonie
XXXIII Ich ergebe mich
Anmerkungen
I
Unterwegs
Ich bin gebildet.
»Nun sind Sie für den Kampf gerüstet«, hat mein Lehrer beim Abschied zu mir gesagt. »Wer im Gymnasium triumphiert, tritt seine Karriere als Sieger an.«
Welche Karriere1?
Mein Vater bekam Besuch von einem ehemaligen Kameraden, der durch Nantes reiste; er hat erzählt, dass einer ihrer früheren Mitschüler, einer von denen, die immer Preise bekamen, tot, zerschmettert und blutig in einem Steinbruch gefunden worden war. Er hatte sich, nachdem er drei Tage hungern musste, hineingestürzt.
Diese Karriere sollte man nicht antreten, nein, jedenfalls sollte man sich nicht kopfüber hineinstürzen.
Die Karriere antreten heißt: sich auf den Lebensweg machen; wie Herkules am Scheidewege stehen.
Wie Herkules am Scheidewege. Ich habe meine Mythologie nicht vergessen. Bitte! Das ist doch schon etwas.
Während die Pferde angespannt wurden, ist der Direktor gekommen, um mir als einem seiner liebsten alumni die Hand zu schütteln. Er hat alumni gesagt.
In meinem Reisefieber habe ich nicht sofort verstanden. Herr Ribal, der Lehrer der dritten Klasse, hat mich mit dem Ellbogen in die Seite gestoßen.
Alumn – us, alumn – i hat er leise souffliert, mit Betonung auf dem Genitiv, und er tat so, als ob er seine Gürtelschnalle zurechtrückte.
– Ach ja! Alumnus … das heißt »Schüler«, ja, stimmt.
Ich will dem Direktor in toter Sprache nichts schuldig bleiben; er gibt mir Latein, ich reiche ihm Griechisch zurück:
»Χάρισ τῷ μοῦ παιδαγωγῶς.« (Das heißt: Danke, lieber Meister.)
Ich mache dazu eine tragische Geste, ich rutsche, der Direktor will mich halten, rutscht auch: Beinahe wären drei oder vier Personen wie Karten umgefallen.
Der Direktor (impavidum ferient ruinae)2 findet als Erster das Gleichgewicht, er kommt wieder auf mich zu und tritt dabei allen ein bisschen auf die Füße. Und wieder fängt er, dem würdigen Augenblick entsprechend, von meiner Bildung an.
»Mit diesem Gepäck, mein Freund …«
Der Postschaffner denkt, es geht um meine Koffer.
»Sie haben Gepäck?«
Ich habe nur einen kleinen Koffer, aber ich habe meine Bildung.
Ich bin unterwegs.
Ich kann mit Beinen und Armen schlenkern, weinen, lachen, schreien, was mir einfällt.
Ich bin Herr meiner Bewegungen, Herr über mein Reden und Schweigen. Ich steige endlich aus der Wiege, in der mich meine wackeren Eltern siebzehn Jahre lang in Windeln gehalten haben; von Zeit zu Zeit nahmen sie mich zum Prügeln heraus.
Ich wage es nicht, zu glauben! Ich habe Angst, der Wagen könnte halten, mein Vater oder meine Mutter könnten wieder einsteigen und mich in die Wiege zurückschleppen. Ich habe Angst, dass ein Lehrer, ein Händler in toten Sprachen, sich wie ein Polizist neben mir niederlässt.
Aber nein, auf dem Wagendeck gibt es nur einen Gendarmen, und der hat omelettfarbenes Lederzeug, Epauletten wie große Käse, einen Napoleonshut.
Solche Gendarmen verhaften nur Mörder; wenn sie aber ehrbare Leute verhaften, so ist es, das weiß ich, kein Verbrechen, sich zu wehren. Man hat das Recht, sie umzubringen wie in Farreyrolles! Danach werden sie dich guillotinieren; aber mit deinem abgeschlagenen Kopf bist du weniger ehrlos, als wenn du deinen Vater gegen ein Möbel gestoßen hättest, um ihn zu hindern, dich zu erschlagen.
Ich bin FREI! FREI! FREI! …
Ich habe das Gefühl, dass meine Brust weiter wird, und dass mir Stolz wie Senf in die Nase steigt … Ich habe Ameisen in den Beinen und den Schädel voll Sonne.
Ich habe mich in mich zusammengerollt. Oh, meine Mutter fände, dass ich rachitisch oder bucklig wirkte, dass mein Auge wirr, meine Hose hochgeschoben, meine Weste verrutscht wären, dass meine Knöpfe fehlten! Es stimmt, meine Hand hat alle abgerissen, um meine nackte Brust zu fühlen; ich spüre mein Herz da drin mit großen Stößen schlagen, und oft habe ich diese Schläge mit dem Hüpfen eines werdenden Kindes im Bauch einer Frau verglichen … Allmählich ebbt die Erregung ab, meine Nerven entspannen sich, es bleibt Müdigkeit wie nach einer durchsoffenen Nacht. Wehmut streift meine Stirn, so wie da oben am Himmel die Wolke hinzieht und ihre graue Wattemaske über das Antlitz der Sonne legt. Der Horizont, der mich durchs Fenster mit seiner Grenzenlosigkeit bedroht, das Land, das sich stumm und weit ausbreitet, Raum und Einsamkeit erfüllen mich allmählich mit schmerzlicher Bewegung …
Ich weiß nicht, wann die Postkutsche auf die Eisenbahn gehoben worden ist. Ich fühle eine Art religiöser Furcht vor diesen Schienen, mit denen die Kupferstirn der Lokomotive es aufnimmt, auf denen mein Leben entlangeilt … Und ich, der Stolze, ich, der Mutige, fühle, wie ich blass werde und den Tränen nahe bin.
Der Gendarm sieht gerade herüber – Mut! Ich spiele den Erkälteten, um die Feuchtigkeit meiner Augen zu erklären, ich niese, um meine Schluchzer zu verbergen.
Es wird mir noch mehr als einmal so gehen.
Ich werde ewig meine innersten Gefühle hinter der Maske der Sorglosigkeit, unter der Perücke der Ironie verstecken …
Meine Reisenachbarin ist ein hübsches Mädchen mit festen Brüsten und herausforderndem Lachen, mit ihren gepfefferten Redensarten hat sie meine Laune wieder gehoben, und sie hat mich mit ihren großen blauen Augen liebkost.
Aber bei einem Halt hat sie ihre Hand einem Blumenmädchen entgegengestreckt; sie erwartete, dass ich ihr Blumen schenkte.
Ich bin rot geworden, habe den Wagen verlassen und bin in einen anderen gesprungen. Zum Rosenkaufen bin ich nicht reich genug! Ich habe genau vierundzwanzig Sous in der Tasche: zwanzig Sous in Silber und vier Sous in Sous-Stücken … aber ich soll bei der Ankunft in Paris vierzig Francs bekommen.
Das ist eine Geschichte für sich.
Offenbar schuldet Herr Truchet aus Paris Herrn Andrez aus Nantes Geld, der ist selber im Namen eines Herrn Chalumeau aus Saint-Nazaire Schuldner meines Vaters; noch ein anderer Kerl ist in die Affäre verwickelt; naja, jedenfalls soll ich im Büro der Pariser Poststation von Herrn Truchet die Summe von vierzig Francs erhalten.
Vierundzwanzig Sous von hier bis dort!
Vierundzwanzig Sous, siebzehn Jahre, Kämpferschultern, Stentorstimme, Hundezähne, olivenfarbene Haut, Hände wie Zitronen und pechschwarze Haare.
Zu dieser wilden Erscheinung eine fürchterliche Schüchternheit, die mich ungeschickt und linkisch macht. Jedes Mal, wenn mir jemand ins Gesicht sieht, der älter, reicher oder schwächer ist als ich, wenn mich Leute ansprechen, mit denen ich mich nicht schlagen kann, deren Ironie ich nicht mit Fausthieben wegfegen könnte, stehe ich Kinderängste aus und bin verwirrt wie ein junges Mädchen.
Meine Mutter, diese wackere Frau, hat mir so oft erklärt, dass ich, angefangen bei meiner Nase, hässlich, ungeschickt, kurz, ein Tölpel wäre (ich konnte ja nicht einmal mit der Gießkanne eine 8 nachmalen), sodass ich jedem gegenüber unsicher bin, der nicht vom Gymnasium, Lehrer oder Mitschüler ist.
Ich fühle mich jedem, der vorbeikommt, unterlegen, und sicher kann ich nur meines Mutes sein.
Meine Mutter hat mir zu essen mitgegeben.
Ich werde meine vierundzwanzig Sous nicht antasten.
Als der Durst zu groß wurde, habe ich mich in einen Ausschank geschlichen, und im Rücken der Reisenden habe ich eine Karaffe an mich herangezogen und meinen Lederbecher gefüllt. Ich habe ihn damals gekauft, als ich Matrose, Abenteurer, Entdecker ferner Inseln werden wollte. Es gehört eine ganz schöne Willenskraft dazu, dieser Karaffe an den Hals zu springen und Wasser zu stehlen. Ich komme mir vor wie einer von den Armen, die am Eingang eines Dorfes die Hand nach einem Napf ausstrecken.
Es schnürt mir beim Trinken den Hals zu und presst mein Herz zusammen. Es ist etwas Demütigendes in dem Ganzen.
Paris, 5 Uhr morgens
Wir sind da.
Welche Stille! Im traurigen Morgenlicht ist alles bleich, und dörfliche Einsamkeit liegt über Paris. Es ist schwermütig wie die Verbannung: Die Morgendämmerung ist kalt, der letzte Stern zwinkert dumm im faden Blau des Himmels.
Ich fürchte mich wie ein Robinson, der an einem verlassenen Ufer gestrandet ist, aber in einem Land ohne grüne Bäume und rote Früchte. Mit ihren geschlossenen Fensterläden sind die hohen Häuser düster und wie blind.
Die Postschaffner werfen die Koffer hin und her.
Da ist meiner.
Und die Persönlichkeit zu vierzig Francs? Der Freund von Herrn Andrez? – Ich wende mich an den von den Kofferräumern, der mir am gutmütigsten vorkommt, zeige ihm meinen Brief und frage ihn nach Herrn Truchet – der Name steht auf dem Umschlag.
»Herr Truchet? Da drüben ist sein Büro, aber er ist gestern nach Orléans abgereist.«
»Abgereist! … Kommt er heute Abend wieder?«
»Nicht in den nächsten Tagen; auf der Strecke hat ein Postillion einen Diebstahl begangen, er soll der Sache nachgehen.«
Herr Truchet ist abgereist. Meine Mutter ist ja kriminell! Das hätte sie voraussehen können, dass dieser Mann verreisen konnte, sie musste wissen, dass es diebische Postillione gibt, sie hätte es mir ersparen müssen, mit einem Ein-Franc-Stück auf dem Pflaster zu stehen, in einer Stadt, in der ich als Schüler eingesperrt war, sonst nichts.
»Gehört dieser Koffer Ihnen?«, fragt ein Angestellter.
»Ja.«
»Wollen Sie ihn bitte mitnehmen? Wir bewahren schließlich noch mehr Gepäck im Büro auf.«
Ihn mitnehmen! Ich kann ihn doch nicht auf den Buckel nehmen und quer durch die Stadt schleppen … nach einer Stunde würde ich zusammenbrechen. Oh, mir kommen Zornestränen, und mein Hals fühlt sich an, als ob ein abgebrochenes Messer drin herumstochern würde …
»Also was ist hier mit diesem Koffer!«
Der Beamte kommt zur Laderampe zurück und stößt mit einer wütenden Geste meinen Koffer zu mir herüber. »Mein Herr«, sage ich mit zitternder Stimme … »Ich habe für Herrn Truchet … einen Brief von Herrn Andrez, dem Direktor der Poststation in Nantes …«
Der Mann wird freundlicher.
»Herr Andrez? … Kenn’ ich! Sie brauchen also eine Unterkunft? … In der Rue des Deux-Écus ist ein Hotel, nicht teuer.«
»Nicht teuer«, hat er allzu gönnerhaft gesagt. Ich fühle, wie er auf den Grund meiner Börse schaut!
»Für dreißig Sous bekommen Sie ein Zimmer.«
Dreißig Sous!
Ich nehme meinen Hut in beide Hände, und den Koffer beim Griff.
Aber mir kommt eine Idee.
»Kann ich ihn nicht hierlassen? Ich komme ihn später holen?« – »Sie können … Ich stelle ihn in die Ecke da … Verdammt, sie werden ihn hoffentlich nicht verwechseln!«, sagte er und sieht auf die Adresse. »Ich hoffe, dass Sie da Vorsorge getroffen haben.«
Meine Mutter hat eine Karte an meinem Gepäck festgemacht:
Die Wörter sind wie die Grabinschrift auf einem Dorfkreuz angeordnet. Der Beamte sieht mich von oben bis unten an, und ich stottere eine Lüge:
»Das hat meine Großmutter geschrieben. Sie kennen das, die guten alten Bauernweiber …«
Ich hoffe, der Lächerlichkeit zu entkommen, wenn ich die Inschrift einer alten Bäuerin zuschreibe.
»Sie hat eine schwarze Haube, und hinten wippt ihr Unterrock in der Luft, ich sehe sie vor mir«, sagt der Beamte gut gelaunt. Wenn er den gelben Hut mit dem pickenden Vogel, den Lieblingskopfputz meiner Mutter gesehen hätte! … Ich habe soeben meine Mutter verleugnet …
Endlich ist der Koffer verstaut. Ich grüße, drehe am Türknopf und gehe fort.
Da bin ich also in Paris.
So fange ich an.
Der Anfang ist gut! Wie wird sich das Leben gestalten, das unter einem solchen Stern begann?
Ich verlasse den Hof; ich bummle herum … Schlächterwagen fahren im Galopp vorbei; die Pferde haben feurige Nüstern (in der Provinz sagt man, es kommt davon, dass man ihnen Blut zu trinken gibt); das Blechzeug an den Milchwagen hüpft über das Pflaster. Arbeiter kommen und gehen, ein Stück Brot und ihr Handwerkszeug in ihre Blusen gerollt; ein paar Läden machen die Augen auf, Küster erscheinen auf den Kirchenstufen, große Schlüssel in der Hand; Gehröcke tauchen auf.
Paris erwacht.
Paris ist wach.
Ich habe mich bis acht Uhr in den Straßen herumgetrieben.
II
Matoussaint?
Was tun?
Ich habe nur eine Möglichkeit: Matoussaint finden, den alten Kameraden aus der Rue de l’Arbre-Sec. Wenn er da ist, bin ich gerettet. Er ist nicht da!
Matoussaint hat das Haus vor einem Monat verlassen, und es ist nicht bekannt, wohin er gezogen ist.
Man hat ihn mit Dichtern davongehen sehen, sagt mir der Hausmeister, Leuten, denen die Haare bis da hingen, und dabei macht er eine Geste.
»Das sind doch Dichter, nicht wahr? Nicht gerade fein angezogen. Nein wirklich, mein Herr … Dichter …«, sagt er kopfschüttelnd. O ja, das sind wahrscheinlich Dichter!
In der letzten Zeit machte Matoussaint der Nichte einer Obsthändlerin Ecke Rue des Vieux-Augustins den Hof. Hatte sie nicht auch, nach allem, was Matoussaint mir erzählt hatte, einen Onkel, der die Bastille gestürmt hatte? Er trieb bis heute seinen Kult mit dem Platz, und er war immer in der Kneipe an der Ecke, aus der er jeden Abend besoffen wie Robespierres Eselin herauskam und die Witwe Capet1 beschimpfte. Vielleicht finde ich ihn mit der Nase im Glas, und er setzt mich schwankend auf die Spur meines Freundes.
Oje! Die Pinte ist abgerissen, der Kreuzhacke zum Opfer gefallen, ich sehe nur einen Kartenleger, der mir gute Abenteuer voraussagen will.
»Wie viel?«
»Zwei Sous, fürs kleine Spiel.«
Ich ziehe eine Karte – aus Aberglauben –, um mein Horoskop zu haben, um zu erfahren, was aus mir werden wird. Zwei oder drei Leute tun das gleiche. Nach fünf Minuten hat der Mann seine Kundschaft zusammen, ein Dienstmädchen, zwei Maurer und mich, und lässt uns wie Rekruten, die der Sergeant anführt, zum nächsten Gasthaus marschieren. Da mustert er uns verächtlich:
»Herz As!«
»Ich habe Herz As.«
»Mein Herr«, sagt der Hexenmeister und zieht mich an sich, »wünschen Sie das kleine oder das große Spiel?« Ich fühle, dass er mir, wenn ich das kleine Spiel verlange, Selbstmord, Hospital, Dichtkunst, nichts als Unglück vorhersagen wird; ich verlange das große Spiel.
»Noch fünfzehn Centimes.«
Ich gebe meine fünfundzwanzig Centimes hin.
»Geben Sie ein Glas Wein aus?«
Ich befinde mich bereits auf dem abschüssigen Weg der Feigheit. Er wird eine Flasche von mir verlangen, und ich werde ihm diese Flasche spendieren, ja, sogar bis zu einem Liter werde ich gehen. Es werden Gläser gebracht.
»Auf Ihre Gesundheit!«
Er trinkt, leckt sich die Lippen, setzt seinen Hut zurecht und fängt an:
»Sie sehen arm aus, Sie sind schlecht gekleidet, Ihr Gesicht gefällt nicht jedem; eine Person, die Ihnen übelwill, wird Ihnen in den Weg treten, wer Ihnen wohltun will, wird daran gehindert werden, aber Sie werden über alle Hindernisse triumphieren mithilfe einer dritten Person, die in dem Augenblick erscheint, da Sie es am wenigsten erwarten. Um ihren Namen zu erfahren, müsste ich im Spiel der Gaukler nachsehen. Fünf Sous für die ganze Wahrheit.« Ich kann keine fünf Sous mehr hinlegen, auch nicht für die ganze Wahrheit!
Der Mann beeilt sich, mich hinauszuekeln.
»Bis Sie vierzig sind, werden Sie den Teufel am Schwanz ziehen; dann werden Sie heiraten wollen, aber es wird zu spät sein: Die, die Ihnen gefällt, wird Sie zu alt und hässlich finden, und Ihre Familie wird Sie verstoßen.«
Er stößt mich in den Korridor und ruft nach der Kreuz Zehn.
Es bleibt mir nichts anderes übrig, als zur Geliebten von Matoussaint zu gehen. Ich kenne unglücklicherweise nur ihr Gesicht und ihren Vornamen. Matoussaint hatte sie Torchonette getauft.
Ich trotte die Rue des Vieux-Augustins entlang und halte nach den Obsthändlerinnen Ausschau: Es gibt zwei oder drei. Ich pflanze mich vor den Kohlköpfen und dem Salat auf und schaue die vorübergehenden Frauen an; alle sehen mich mit Affenbewegungen herumturnen, denn ich schneide Grimassen, um nach was auszusehen, ich drehe und wende mich wie einer, der auf Böses sinnt … ich ähnele einem Affen wahrscheinlich aufs Haar. Ich kann ja nicht auf die Händlerinnen zugehen und fragen: »Haben Sie eine Nichte, die Torchonette heißt und Herrn Matoussaint liebte? Haben Sie einen Verwandten, der sich alle Tage bei der Bastille besoff?«
Ich kann nur warten, weiter vor den Läden auf- und abgehen und hoffen, Torchonette vorbeikommen zu sehen.
Ich war so blöd, ich war so dreist, hoffte auf den Zufall, und ich blieb zwei Stunden in dieser Straße, von Gendarmen beobachtet. Mein Benehmen war verdächtig, mein Herumlungern beharrlich und beunruhigend.
Da war ausgerechnet ein Uhrmacherladen, im Fenster lagen Uhren aus. Wenn man am Abend im Viertel einen Diebstahl entdeckt hätte, hätte man mir angehängt, dass ich Schmiere gestanden, Abdrücke von Schlüssellöchern genommen hätte. Man hätte mich verhaftet und wahrscheinlich verurteilt.
Bis Mittag war ich zwanzigmal in Aufregung geraten, hatte zwanzigmal geglaubt, Matoussaints Geliebte zu erkennen und zwanzigmal die Mädchen an den Türen der Werkstätten oder des Käseladens zum Lachen gebracht. »Wer ist bloß dieser Riesentölpel, der jeden angafft?« Sie zeigten mit Fingern auf mich und grinsten, und ich wurde rot bis an die Ohren.
Ich floh in die Umgebung, lief schmutzige, übelriechende Gassen entlang. Frauen mit violetten Gesichtern, lila Kleidern, mit rauen Stimmen machten mir Zeichen und zogen mich am Ärmel in schmierige Hauseingänge. Ich kam unter einem Platzregen schmutziger Redensarten davon und landete, vergehend vor Scham und vor Hunger, wieder in der Rue des Vieux-Augustins.
Einige hielten mich für einen Spitzel.
»Das ist so einer«, habe ich einen Arbeiter zu einem andern sagen hören.
»Der ist ja noch so jung.«
»Na hör mal! Und der Sohn von Mutter Chauvet, der bei der Polizei war, ist der kein Spitzel?«
Es war warm. Die Sonne kochte den Dreck in den Kanalisationslöchern und ließ die Kohlabfälle in der Gosse schmoren. Aus dieser belebten Straße, in der eine Bratküche an der andern war, stieg ein Geruch von Schlamm und Fett auf, von dem mir schlecht wurde.
Meine Füße waren wund, mein Kopf brannte. Fieber hatte mich ergriffen, und mein Hirn pulste unter meinem Schädel wie ein Strom flüssigen Bleis.
Ich verließ meinen Beobachtungsposten und eilte dahin, wo ich mehr Luft bekam, ließ mich auf eine Bank auf einem Boulevard fallen und betrachtete die vorüberziehende Menge.
Ich stammte aus der Provinz, wo dich fünf von zehn Leuten kennen. Hier ziehen die Menschen zu Hunderten vorbei: Ich hätte sterben können, ohne dass ein Passant es bemerkt hätte!
Es gab nicht einmal mehr die menschliche Vertrautheit der bevölkerten und ordinären Straße, aus der ich gerade kam.
Auf diesem Boulevard erneuerte sich die Menge ohne Unterlass; es war das Blut von Paris, das zum Herzen lief, und ich war in dem Wirbel verloren wie ein Kind von vier Jahren, das sich auf einem Marktplatz verlaufen hat.
Ich habe Hunger!
Muss ich die Sous, die ich noch habe, angreifen?
Was wird, wenn ich sie ausgegeben habe, ohne Matoussaint gefunden zu haben! Wo sollte ich heute Abend schlafen?
Aber mein Magen heult, und mein Kopf fühlt sich dick und hohl an; mir laufen Schauer über den Körper wie warme Lappen.
Auf! Die Würfel sind gefallen!
Ich gehe zum Bäcker und kaufe mir ein kleines Brot zu einem Sou, an dem ich herumkaue wie ein Hund.
Bei dem Weinhändler an der Ecke verlange ich einen Schoppen.
Ah! Dieses Glas frischen Weins, dieser Purpurtropfen, diese Tasse voll Blut!
Es blendet mir die Augen, wäscht das Gehirn, und das Herz geht auf. Das hat mir Feuer in die Adern gegeben. Ich habe niemals eine so intensive Empfindung gehabt!
Eine Minute vorher hatte ich noch die Idee mich zum Hof der Poststation zurückzuschleppen und dort zu bitten, wieder zurückreisen zu dürfen; hätte ich auch die Pferde striegeln und die Koffer unter die Dachplane schleppen müssen, um die Rückreise zu bezahlen. Ja, diese feige Idee war mir durch den Kopf gegangen, unter dem Gewicht der Müdigkeit und des schwindelnden Hungers. Dieses Glas Wein hat genügt, mich wiederherzustellen, ich richte mich wieder auf im flutenden Menschenstrom!
Es ist zwei Uhr nachmittags.
Meine Füße pellen sich; ich habe Torchonette nicht bei den Obsthändlerinnen getroffen.
Was soll werden?
In einem der Sträßchen, durch die ich vorhin gekommen bin, habe ich ein Hotel für sechs Sous die Nacht gesehen. Werde ich dahin gehen müssen, zu den Nutten, Zuhältern und Filous? Es roch da nach Laster und Verbrechen!
Es wird wohl sein müssen.
Und morgen?
Morgen bin ich bereits ein Vagabund. Noch ein Glas Wein!
Das bedeutet zwei Sous weniger, aber für tausend Francs mehr Mut!
»Noch so einen Schoppen«, sagte ich mit kecker Miene zum Schenkwirt, überzeugt, er müsste mich für einen wütenden Lebemann halten, der alle Stunde verdoppelte, als ob er mich überhaupt wiedererkannt hätte! Ich gebe zehn Sous zum Bezahlen hin – ein silbernes Stück statt des Kupfers; wenn man arm ist, muss man oft die silbernen Stücke wechseln.
»Fünfzig Centimes: Da sind sechs Sous.« Der Mann gibt mir das Kleingeld heraus.
»Ich hatte nur ein Glas.«
»Sie haben gesagt: Noch einen … «
»Ja … ja …«
Ich wage nicht, ihm zu erklären, dass ich auf den Wein angespielt habe, den ich bei meinem ersten Besuch, eine Stunde zuvor, getrunken hatte. Ich nehme, was er mir herausgibt, werde rot dabei und höre, wie der Händler zu seiner Frau sagt:
»Der Flegel da wollte mich übers Ohr hauen!«
Ich kann Matoussaint nicht finden!
Wenn ich woanders anklopfe?
Ist Royanny nicht hergekommen, um Jura zu studieren?
Er soll im ersten Jahr sein, ich kann zur Fakultät hinübergehen und am Tor auf ihn warten.
Also! Das mache ich jetzt.
Ich kenne den Weg: Es ist derselbe wie damals zur großen Prüfung, zur Sorbonne hinauf.
Da bin ich!
Ich mache es mit den Studenten genauso, wie ich es mit den Obsthändlerinnen gemacht habe. Ich laufe allen nach, die Royanny ähneln; ich stürze mich auf Greise, die Angst bekommen, auf Jungen, die in Kampfstellung gehen, ich spreche Royannys an, die keine sind; verstört, mit fiebrigen Bewegungen.
Fürchterlich belästigt mich mein Wintermantel, den ich für die Nacht in der Postkutsche behalten und seit meiner Ankunft mit mir herumgeschleppt habe wie eine Schnecke ihr Haus oder wie eine Schildkröte ihren Panzer.
Hätte ich ihn im Postbüro gelassen, hätte ich riskiert, dass er verschwunden, gestohlen worden wäre. Und dann war auch ein Funke Koketterie im Spiel. Meine Mutter hat oft gesagt, dass nichts sich besser mache als ein Mantel über dem Arm eines Mannes, dass es die Toilette vervollständige, dass Bauern keinen Mantel mit sich trügen, so wenig wie Arbeiter oder irgendwelche einfachen Leute.
Mit der Nachlässigkeit eines Edelmannes hab ich meinen Mantel über den Arm geworfen.
Der Mantel ist gelb – von seltsamem Gelb, mit großen Knöpfen, die sich hässlich auf dem steifen Stoff abdrücken. Das Kleidungsstück sieht aus, als hätte es eine Kolik.
In der Rue des Vieux-Augustins oder auf den Boulevards hat man ihn nicht beachtet, oder zumindest habe ich es nicht bemerkt, aber hier erregt er Aufsehen. Sie glauben, ich will ihn verkaufen; die jungen Leute wenden sich mit Schrecken ab, aber die Kleiderhändler kommen näher.
Sie nehmen die Rockschöße in die Hand, betasten die Knöpfe wie Ärzte, die einen Ausschlag versorgen, und gehen; aber keiner bietet mir etwas. Sie schütteln traurig den Kopf, als ob der Stoff eine kranke Haut wäre und ich ein verlorener Mann.
Und er ist schwer, dieser Mantel!
Vom Herumlaufen in der frischen Luft, mit dem Stoffgewicht über dem Arm, bin ich ausgelaugt, heißhungrig, besoffen! Ich habe schon ein kleines Brot gegessen, zwei Schoppen Wein getrunken, und ich habe immer noch Durst, und ich habe immer noch Hunger! Reißenden Hunger! Kein Matoussaint, kein Royanny!
Ich habe mich entschlossen, in die Hörsäle zu gehen. Dort habe ich großes Aufsehen erregt, aber die, die ich suchte, habe ich nicht gefunden.
Einer nach dem andern leeren sich die Säle. Einer nach dem andern entfernen sich die Studenten, ziehen sich die Professoren zurück. Nur ich war noch auf den Treppen, im Hof zu sehen – ich und mein gelber Mantel.
Der Hausmeister hat mich bemerkt, und als er die dicke Tür in den Angeln bewegt, sieht er mich neugierig an; ich meine sogar, Güte in seinen Augen zu sehen.
Er wird eine Menge Schüchterne und Arme gesehen haben, seit er in dieser Loge sitzt. Er hat von mehr als einem tragischen Ende und mehr als einem schmerzlichen Anfang reden hören, wenn er Brocken von Unterhaltungen aufgeschnappt hat. Vielleicht könnte er mir einen Rat geben.
Ich traue mich nicht, ich drehe mich pfeifend um, wie ein Mann, der seinen Hund ausgeführt hat, der seine liebe Freundin erwartet, der einen gelben Mantel mitgenommen hat, weil er diese Farbe liebt.
Das Tor dreht und dreht sich, es knirscht, seine Flügel kommen aufeinander zu, sie berühren einander – aus!
Es zeigt mir sein totes Gesicht. Ich weiß nicht, wo Matoussaint ist, ich habe Royanny nicht finden können. Ich werde zum Schlafen in die Straße mit dem Sechs-Sous-Hotel gehen.
Ich balle die Faust vor diesem verschlossenen Haus, das mir den Namen keines Freundes geliefert hat, bei dem ich ein Asyl oder einen Rat finden könnte.
Warum habe ich den Portier nicht angesprochen, der mir ein wackerer Mann zu sein schien? Was bin ich für ein Feigling!
Ach, wenn er herauskäme! …
Er kommt heraus.
Ich spreche ihn mutig an. Ich frage ihn – was soll ich ihn also fragen? – Ich weiß nicht, ich zögere, ich verheddere mich. Er ermutigt mich, und schließlich teile ich ihm mit, dass ich einen suche, der Royanny heißt, und dass die Fakultät sicher seine Adresse hat, da Royanny Jura studiert. »Gehen Sie zum Sekretär der Fakultät, zu Herrn Reboul.« Er geht mit mir in die Universität zurück und zeigt mir die Treppe.
Herr Reboul macht selbst auf – ein bleicher, langsamer, trauriger Mann mit grauer Haut auf den Fingern.
»Was wünschen Sie? Die Büros sind geschlossen … Sie haben jemanden bei sich?« Er sieht zur Tür hinaus.
Ich habe meinen Mantel dahin gepflanzt, er sieht aus wie ein Mensch; Herr Reboul hat Angst und stößt mich ins Treppenhaus zurück.
Der Hausmeister nimmt mich wieder in Empfang, ich greife meinen Mantel, wie man einen Gelähmten aufhebt, gehe fort, und Herr Reboul verbarrikadiert sich.
»Hören Sie«, sagt der Hausmeister, »ich nehme es auf mich, mal in die Register zu sehen, wenn ich ausfege. Tun Sie so, als ob Sie hier angestellt wären und gehen Sie in die Anmeldung hinunter.«
Ich tue so, als ob ich angestellt wäre. Ich lege meine Mütze in eine Ecke und kremple die Ärmel hoch. Ach, wenn ich doch eine rote Weste hätte statt eines gelben Mantels!
Wir treten in den Sekretariatsraum und suchen unter R. Ro … Ro … Royanny (Benoit), Rue de Vaugirard 4.
Der Hausmeister schlägt das Register schnell wieder zu und stellt es an seinen Platz.
Ich danke ihm.
»Ist schon gut. Aber hauen Sie ab, schnell. Herr Reboul kommt vielleicht, und er ist imstande, um Hilfe zu rufen, wenn er Ihren Mantel wiedersieht!«
III
Hôtel Lisbonne
Rue de Vaugirard 4 … Hôtel Lisbonne? Es ist an der Ecke Rue Monsieur-le-Prince.
Ich frage nach Herrn Royanny.
»Er ist nicht da. Was wollen Sie von ihm? Sind sie vielleicht aus Nantes? …«
Die Concierge ist eine fröhliche Person und fragt mich direkt und ohne Umschweife.
»Ich bin aus Nantes, aber ich war mit ihm im Gymnasium.«
»Ah! Sie waren in Nantes? Kennen Sie Herrn Matoussaint?«
»Herrn Matoussaint? Ja.«
Ich erzähle ihr meine Geschichte. Nach Herrn Matoussaint laufe ich mir seit fünf Uhr morgens die Hacken ab! … »Das ist vielleicht ein komischer Mensch, hm! Er wohnt oben, neben Herrn Royanny – der bürgt für ihn, verstehen Sie. Matoussaint hat keinen Sou … er ist abgebrannt … und so einer schreibt.«
Die Hausmeister haben anscheinend alle die gleiche Meinung über Schriftsteller.
»Und Matoussaint ist da?«
»Nein, aber er wird die Essensstunde nicht versäumen, der nicht! Sie werden ihn mit seinem Tambourmajor-Stöckchen und seinem Gärtnerhut hereinspazieren sehen, sobald zur Suppe geläutet wird.«
Tatsächlich sehe ich kurz darauf einen großen Hut, unter dem niemand zu erkennen ist, das Treppenhaus heraufkommen – Krempen wie die Flügel eines großen Vogels, der einen Hammel in die Lüfte entführt.
»Bist du es? …«
»Matoussaint!«
»Vingtras!«
Wir sind einander in die Arme gefallen und halten einander umschlungen.
Wir sind umschlungen.
Ich wage nicht, als Erster loszulassen, aus Angst, zu wenig bewegt zu wirken, ich warte, dass er beginnt. Wir sind wie zwei Kämpfer, die sich messen – in einem Gefühlskampf, aus dem Matoussaint über Vingtras siegreich hervorgeht. Matoussaint kennt die Traditionen besser als ich und weiß, wie lange Umarmungen dauern müssen; wann man lockerlassen und wann wieder zugreifen muss. Ich bin schon längst der Ansicht, gerührt genug gewesen zu sein. Aber Matoussaint hält mich immer noch ganz fest.
Schließlich gibt er mir die Freiheit zurück: Wir kämmen uns, und er will in zwei Worten meine Geschichte wissen. Ich erzähle ihm von meiner Jagd auf Torchonette.
»Torchonette gibt es nicht mehr: Die Neue heißt Angelina. Ich stelle sie dir vor. Komm mit.« Und er führt mich zu Fräulein Angelina. »Ich stelle dir einen Bruder vor, einen zweiten Bruder, Vingtras, ich habe dir oft von ihm erzählt, er kommt, mit uns das Brot der Fröhlichkeit zu brechen«, zu mir gewandt, »dazu kommst du doch, nicht wahr? Also:
Unsere Zukunft soll erblühen
In der zwanzig jähr’gen Sonn’.
Lasst uns lieben, lasst uns singen,
Denn wir sind nur einmal jung!
Alle den Refrain, los, ihr beiden!«
Lasst uns lieben, lasst uns singen,
Denn wir sind nur einmal jung!
Angelina ist eine große Magere, blass, mit spitzer Nase, aber feinen Lippen.
»Übrigens«, sagt sie, nachdem sie den Refrain mitgesungen hat, »der Bäcker war da und hat gesagt, dass er kein Brot mehr heraufbringt, wenn er die letzte Rechnung nicht bezahlt bekäme.«
»Und Royanny?«
»Royanny! Der ist fragen gegangen, ob er seine Hose beim Leihhaus in der Contrescarpe versetzen kann, beim Conde haben sie sie nicht genommen.«
Matoussaint hat seinen immensen Hut an einen Garderobenhaken an der Wand gehängt (wie ein Grieche seinen Schild aufhängt), und kratzt sich am Kopf.
»Bruder, du siehst, das Elend verfolgt uns.«
Bruder? – Ah! Ich bin das! Ich habe nicht mehr dran gedacht. Ich habe nie einen Bruder gehabt, und ich kann mich nicht auf Anhieb an diese zarte Anrede gewöhnen. »Aber hör mal«, sagt er und wechselt den Ton, »du kommst doch gerade an? Du hast doch Geld? Die Neuen sind immer ausstaffiert.«
Ich lege meine Bilanz offen.
Angelina sieht mich verächtlich an.
»Und das da«, sagt Matoussaint und stürzt sich auf das, was mich begleitet, was seit dem Morgen entweder für einen Kranken oder einen Dieb gehalten worden ist, »das, das könnte man zum Leihhaus tragen.«
Angelina zuckt die Schultern bis zur Decke.
»Wir können es immerhin verkaufen! Willst du es verkaufen? Oder hängst du an dieser Gelbsucht?«
»Nein …«
Ein heuchlerisches »Nein«.
Armer alter Mantel! Er ist wirklich hässlich, und er hat mir heute manche Demütigung eingebracht, aber ich war an ihn gewöhnt wie an ein altes Möbel zu Hause. Er war mir den ganzen Nachmittag über zu warm und zu schwer auf dem Arm, aber in der Nacht hat er mich vorm Frieren bewahrt. Es wird noch mehr kalte Nächte in meinem Leben geben! In den kommenden Wintern könnte er mir als Decke dienen, wenn mein Bett nur eine hat. Und dann hat er auf dem Rücken meines Vaters, des Lehrers, gelegen, bevor er an mich abgegeben wurde! Die Schüler haben über ihn gelacht, aber das war kindliche Fröhlichkeit; es war nicht die Brutalität des Versetzens, auch nicht so, wie wenn man einen gebrauchten Gegenstand zur Auktion gibt. Er hatte, so lächerlich er auch war, die Aura einer Reliquie …
Mein Zögern hat nur einen Moment gedauert. Es ist ein schlechtes Zeichen, dass ich beim Antritt meiner Karriere solche Empfindungen habe!
»Hallo, he! Kleiderhändler!« Der Händler ist heraufgekommen und hat uns vierzig Sous für die Reliquie gegeben … Diese vierzig Sous bringen zusammen mit den acht Sous, die ich noch hatte, Fröhlichkeit in die Mansarde.
Brot, ein Liter Wein, Koteletts in Soße: Das alles ist mit unsern achtundvierzig Sous möglich!
Ich werde bestellen. – Ich werde sagen: »Koteletts mit vielen Gürkchen«, und wenn der Kellner mit dem Blechgeschirr heraufkommt, gebe ich ihm zwei Sous Trinkgeld; ich werde ihm sogar drei Sous statt zwei geben; es ist mein gutes Recht, Dummheiten auf Kosten meiner Zukunft zu machen.
Haben wir gut gegessen, mein Gott!
Um die letzte Gurkenscheibe haben wir gelost, wir haben noch Geld für ein großes Brot zusammengekratzt und für den Kaffee, und wir haben gejohlt, gelacht und gesungen, bis Angelina fand, es sei Zeit, zu überlegen, wo sie mich für die Nacht hinstecken sollten. Die Concierge, die wir in die Affäre Truchet eingeweiht haben, würde mich sicher aufnehmen, wenn Platz wäre, und sie würde mir eine halbe Woche Kredit gewähren. Aber alles ist belegt.
Sie erinnert sich glücklicherweise, dass die Riffaults von einer leeren Kammer gesprochen haben. Die Riffaults haben ein Hotel in der Rue Dauphine 6, beim Café Conti.
In ihrer Portiersorthografie schreibt sie ein Wort an die Riffaults, sie kennen sich, die Riffaults waren Concierges, ehe sie selbst ein Hotel aufgemacht haben.
Mit dem Zettel, fettig wie die Finger eines Schlachters, der Koteletts verkauft, gehe ich zur Rue Dauphine. Matoussaint kommt mit, und obwohl es Mitternacht ist, machen sie auf, und ich werde in die Kammer geführt.
Ich gelange dahin über eine Leiter mit morschen Sprossen und einer schimmligen, schmierigen Leine als Geländer. Oben zwischen vier Bretterwänden ein Stuhl, dem die Strohfüllung fehlt, ein wackliger Tisch, ein ganz niedriges Bett aus rohem Holz mit einer staubigen Wolldecke – so staubig, wie die Wolle auf einem Hammelrücken. Der Wind rüttelt am Fenster, das nicht schließt, und kommt durch eine zerbrochene Scheibe herein.
Selbst Matoussaint sieht erschreckt aus; er hat sich beinahe die Rippen gebrochen, als er die Leiter hinabstieg.
»Bist du gefallen?«
»Nein.«
Aber ich weiß, dass Matoussaint nicht gern zugibt, wenn er hingefallen ist. Er lachte immer (ganz schön verkniffen), wenn er im Gymnasium mit dem Fußboden Bekanntschaft machte; er behauptete, es sei Absicht.
ICH BIN ZU HAUS!
Diese Kammer ist elend, aber ich werde nur dem die Tür öffnen, der mir passt, und ich werde sie wem ich will vor der Nase zumachen; wer sich weigern würde zu gehen, dem würde ich die Finger im Türspalt zerquetschen, den Ersten, der mich beleidigen würde, würde ich diese Leiter hinunterwerfen, und wenn ich mich mit ihm zusammen hinunterwälzen müsste, falls ich nicht der Stärkere bin, was möglich ist, aber beide würden wir hinabstürzen.
ICH BIN ZU HAUS!
Ich streiche wie ein Bär an den Wänden entlang … ICH BIN ZU HAUS!
Ich werde es gleich herausschreien! Ich muss mir die Hand vor den Mund halten, um ein tierisches Brüllen zurückzuhalten. Seit zwei Stunden koste ich das Gefühl aus.
Schließlich lege ich mich auf mein schmales Bett, und durch die zerbrochenen Scheiben sehe ich in den Himmel, fülle ihn mit meinen Träumen, bringe meine Hoffnungen in ihm unter, ritze meine Ängste in ihn ein; es ist mir, als ob mein Herz sich im Raum bewegt, sich emporschwingt wie ein Vogel.
Dann kommt der Schlaf … Träume treiben in meinem Ausreißerhirn umher … Schließlich fallen mir die Augen zu, und ich schlafe angezogen ein, wie der Soldat im Feld.
Am Morgen, beim Erwachen war meine Freude so groß wie am Vorabend. Die Sonne schien hell vom blauen Himmel herab, und ihre Strahlen zeichneten ein Streifenmuster auf meine düstere Decke. Im Haus sang eine Frau, Vögel piepten vor dem Fenster.
Ich bekam eine Blume geschenkt. Der kleinen Riffault hatte jemand die Schürze mit roten Nelken gefüllt, und als sie meine Tür offen sah, hat sie die Leiter hinaufgerufen: »Willst du eine Nelke, mein Herr?«
Ich habe sie in ein dickes Glas getan, das auf dem hinkenden Tisch stand.
Eine venezianische Phiole, ein Kelch aus Kristall hätten mich weniger glücklich gemacht: auf dem Grunde des Glases las ich Erinnerungen an mein Leben auf dem Lande und hörte Kneipenlieder widerhallen. In den Gasthäusern der Haute-Loire hat man solche dicken Gläser …
Ich habe endlich mein Geld bekommen! Herr Truchet ist zurückgekehrt.
Ich habe sechs Francs für die Riffaults zurückbehalten. Mein Zuhause kostet sechs Francs; was sein muss, muss sein! Den Rest habe ich Angelina für den Suppentopf gegeben. Schon am ersten Tag haben wir der Suppentopf-Kasse sechs weitere Francs entwendet, um ins Theater zu gehen. Nach einem guten Abendessen sind wir zur Porte-Saint-Martin hinuntergegangen, wo sie das Stück spielen, das wir sehen wollen: Das Elend, von Ferdinand Dugué. Unterwegs trinken wir, und Matoussaint kommt mächtig in Schwung. Der Vorhang hebt sich. Der Held (es ist der Schauspieler Munié) kommt mit einer Pistole auf die Bühne. Er zögert. »Die Frage ist: Ehrbar leben oder morden? Bourgeois oder Schafott?«
Matoussaint brüllt: Schafott, Schafott!
So sind vierzig Francs draufgegangen.
Wir haben uns zehn Tage lang gut amüsiert, und ich habe nicht eine Minute lang an den Augenblick gedacht, da wir keinen Sous mehr haben würden.
Dieser Augenblick ist gekommen; keine fünfzig Centimes sind mehr übrig, die zwischen dem Hôtel Lisbonne und dem Hôtel Riffault geteilt werden könnten.
Ich bin meine Leiter hinaufgestiegen, habe die Tür zugemacht. Ich hatte nur mit spitzen Zähnen zu Abend gegessen, es war zu wenig da, aber ich habe einen Zopf Schwarzbrot gekauft, an dem ich in meinem Verschlag knabbere. Es ist erst acht Uhr. Der Abend wird lang werden in diesem Loch, aber ich muss allein sein; ich muss auf das hören, was ich denke, statt zu grölen und Gegröle anzuhören, wie ich es seit acht Tagen tue; seit ich da bin, lebe ich für die andern; am Abend bleibt nur ein Brummen in den Ohren zurück, und die Zunge tut mir vom vielen Reden weh; sie brennt und pellt sich vom vielen Rauchen. Dieses Glas Wasser aus meiner trüben Karaffe schmeckt mir besser als der schwarze Kaffee aus dem Hôtel Lisbonne. Mein Kopf ist frisch, ich sehe klar, oh, sehr klar!
Morgen geht das Elend los.
Matoussaint versichert, das mache nichts.
Leben Schaunard, Rodolphe, Marcel1 etwa nicht im Elend, und amüsieren sie sich etwa nicht wie verrückt mit Mädchen, Verseschreibern, Picknicks und Spott auf die Bürger? Ich habe noch kein Picknick erlebt; ich habe nicht einmal zu Abend gegessen, um das klarzustellen.
Arme Mutter Vingtras, sie hat mir vorausgesagt, dass ich mich nach ihren Töpfen zurücksehnen würde! Vielleicht behält sie recht …
Ich habe ihr geschrieben, um ihr mitzuteilen, dass ich ins Hôtel Riffault, in ein sehr sauberes Zimmer eingezogen bin. Ich habe hinzugefügt, dass ich Leute kennengelernt hätte, die mir sehr nützlich sein könnten (!).
Ich meine Matoussaint, Angelina und Royanny. Sie sind mir in der Tat nützlich gewesen, in der Sache mit meinem gelben Mantel, und sie können mir die Adressen von allen Pfandleihern des Viertels geben.
Meine Mutter hat mir geantwortet.
Aus ihrem Brief fällt ein rotes Stück Papier: Gutschrift über vierzig Francs, schräg drübergeschrieben. Eine Postanweisung! Und zwei Zeilen: »Dein Vater wird dir jeden Monat vierzig Francs schicken.«
Jeden Monat vierzig Francs! Damit habe ich nicht gerechnet, ich dachte, dass die vierzig Francs von Vater Truchet einmalig waren. Vierzig Francs! …
Mit vierzig Francs im Monat kann man sein Logis bezahlen, Brot und Koteletts mit Soße kaufen und sogar noch Das Elend an der Porte-Saint-Martin ansehen gehen! …
Ich war bewegt, als ich auf der Post meine rote Anweisung präsentierte.
Ich hatte Angst, für einen Fälscher gehalten zu werden.
Nein! Ich habe acht schöne Fünf-Francs-Stücke bekommen! … Ich habe sie auf meinen Dachboden getragen, und den ganzen Tag über habe ich herumgerechnet.
Ich habe einen Haushaltsplan gemacht.
Nochmal überprüfen!
TABAK: Drei Sous pro Tag fürs Rauchen.
ZEITUNGEN: Den Peuple von Proudhon2, jeden Morgen. Bibliothek: Wenn ich diesen Passus streichen würde, würde ich nicht nur drei, sondern 4 Francs 50 sparen, denn ich rechne dreißig Sous für Kerzen, um die geliehenen Bücher zu Hause zu lesen. Aber nein! Das ist meine reinste Freude, das Schönste an meiner Freiheit, mich auf die Bücher zu stürzen, die im Gymnasium verboten waren, Liebesromane, Volkspoesie, Geschichte der Revolution! Lieber würde ich nur Wasser trinken, aber bei Barbedor oder Blosse abonnieren.
WÄSCHE: Meine große Wäsche wird mich nichts kosten. Alle zehn Tage werde ich sie dem Postschaffner nach Nantes anvertrauen, er nimmt es auf sich, sie meiner Mutter schmutzig zu übergeben und sie sauber zum Sohn zurückzubringen. Meinen Vatermördern aber weihe ich einen Franc: Ich möchte sie nur einmal tragen; meine Eltern sind für zweimal. Zwanzig Sous fürs Feine sind nicht zu viel.
KLEINIGKEITEN: Zum Flicken reicht mir ein Sou für Faden und ein Sou für Nadeln.
ZIMMER: Das steht fest, sechs Francs.
ESSEN: Einundzwanzig Francs. Das reicht.
Es bleiben mir 1 Franc 20 Centimes für unvorhergesehene Ausgaben. Man muss immer etwas für unvorhergesehene Ausgaben bei der Hand haben. Man weiß nicht, was kommt.
Ich ersticke vor Freude! Ich muss Luft saufen und sehen, ob Paris noch da ist. Ich recke den Hals gegen das Fenster. Ich dachte, es wäre offen: Es war zu, und ich zerbreche eine Scheibe. Wie gut ich daran getan habe, einen Posten für Gelegentliches einzurichten!
Ich habe meine Hundert-Sous-Stücke gewechselt und kleine Häufchen gemacht, auf die ich Zettel lege: Tabak, Seife, Kleinigkeiten.
Ordnung muss sein, und ohne Tricks.
Ich bin zu Barbedor am Pont-Neuf gesaust. Er hat die meisten Stücke und Romane.
»Ich will ein Abonnement.«
»Das macht drei Francs.«
»Da sind sie.«
»Und hundert Sous müssen hinterlegt werden.«
Ich Unglücklicher, daran hatte ich nicht gedacht!
Ich musste herumstottern, mich zurückziehen … Sollte ich zurückgehen und die andern Häufchen anreißen?
Damit geriete ich womöglich gefährlich ins Schlittern! Es ist besser, zu warten und zu versuchen, diese kleine Kaution zusammenzubekommen. Ich vermisste diese hundert Sous schmerzlich! Ich musste aus meinem eigenen Fundus leben, während die, die hundert Sous für die Kaution aufbrachten, alle die schönen Bücher zu ihrer Verfügung hatten. Ich konnte zwar drei Francs mehr für Essen oder Vergnügungen ausgeben; ich sparte auch an den Kerzen; aber ich machte erst spät mit der modernen Literatur Bekanntschaft, aus Mangel an Startkapital.
IV
Die Zukunft
Und jetzt, Vingtras, was wirst du tun?
Was ich tun werde? Aber ist denn der Journalist, den ich bei Matoussaint kennengelernt habe, nicht da, und kann er mich nicht als Lehrling in der Druckerei der Zeitung unterbringen, für die er geschrieben hat?
Ich gehe zu ihm.
Er lacht mir ins Gesicht.
»Sie und Arbeiter!«
»Aber ja! Es wird mich nicht hindern, Revolution zu machen – im Gegenteil! Ich habe mein Brot, also kann ich reden, schreiben, handeln, wie es mir gefällt.«
»Ihr Brot? Wann denn? Da sind Sie erst einmal der Laufjunge für die ganze Werkstatt; mit siebzehn Jahren, und Sie sehen aus wie zwanzig! Sie sind verrückt, und der Druckereichef wird Ihnen das als Erster sagen! Aber passen Sie auf, es geht ganz einfach! Geben Sie mir meinen Mantel, setzen Sie ihren Hut auf, und wir gehen hin!«
Wir sind hingegangen.
Er hatte Recht! Sie wollten nicht glauben, dass es mir Ernst war. Der Drucker hat zu mir gesagt:
»Mit zwölf Jahren hätten Sie kommen müssen.«
»Aber mit zwölf Jahren war ich in der Tretmühle des Gymnasiums! Da habe ich das Latein-Rad getreten.« – »Ein Grund mehr, dass ich Sie nicht nehmen werde! In diesen revolutionären Zeiten sind wir nicht scharf auf die Entwurzelten, die vom Gymnasium in die Werkstatt springen. Sie verderben die andern. Und dann lässt das auf einen wankelhaften Charakter schließen, oder man hat schon was auf dem Kerbholz … Ich sage nicht, dass es bei Ihnen so ist, der Herr empfiehlt sie, und Sie sehen aus wie ein ordentlicher Junge. Aber glauben Sie mir, Sie bleiben besser in dem Milieu, aus dem Sie kommen, und machen es wie alle.«
Damit hat er mich gegrüßt und ist verschwunden.
»Was habe ich Ihnen gesagt?«, schrie der Journalist. »Sie machen sich zu spät auf, mein Lieber! Schnurrbart, ein Examen! … Damit und im Laufe der Zeit können sie Kutscher werden, aber kein Arbeiter! Ich muss Sie verlassen. Bis bald!«
Ich bin beschämt und wie blöde mitten auf der Straße stehen geblieben. Aber nein, noch habe ich nicht lockergelassen, und ich bin durchs Druckerviertel gestrolcht, wie an dem Tag, als ich Torchonette suchte.
Ich habe vor den Türen gewartet, mit den Füßen in der Gosse; auf den Treppen, mit der Nase gegen die Wand; wenigstens zwei Druckereichefs sollten mich anhören!
Sie haben mich zur Kenntnis genommen, einer hielt mich für einen Bettler, dem es um hundert Sous ging, der andere für einen Dichter, der mal vier Tage lang Arbeiter spielen wollte, um Gilbert oder Magu1 nachzueifern.
Ich kann mir die Papiermütze und den blauen Kittel aus dem Sinn schlagen!
Was für ein Handwerk sonst? – Das vom Onkel Tischler, das vom Schuhmacher Fabre? Ich habe mich gehütet, dem Journalisten oder Matoussaint und seiner Clique gegenüber davon zu sprechen, aber ich bin in die Garküchen gegangen – und habe mich neben Leute mit der vom Firniss gezeichneten Hand des Schreiners oder dem platten Daumen des Schuhflickers gesetzt. Ich habe Bekanntschaften geknüpft, ich habe einen ausgegeben, ich habe mein Budget durcheinandergebracht, meine Rechnungen verraten, auf die Gefahr, dass ich die letzten Tage im Monat nichts fürs Essen hätte.
Alle haben mich entmutigt.
Einer, ein Alter mit einem ehrlichen Gesicht, blassen Wangen, grauen Haaren, hat mir bis zum Schluss zugehört, und dann hat er mit einem schmerzlichen Lächeln gesagt: »Sehen Sie mich an. Ich bin vor der Zeit gealtert. Und doch habe ich nie getrunken oder vagabundiert. Ich habe immer gearbeitet, und mit zweiundfünfzig Jahren habe ich es so weit gebracht, dass ich kaum genug zum Leben verdiene. Mein Sohn unterstützt mich. Er hat mir die Schuhe da gekauft. Er ist verheiratet, und ich bestehle seine kleinen Kinder.«
Er sprach so traurig, dass mir die Tränen kamen. »Wischen Sie sich die Augen, mein Junge! Sie sollen mich nicht beklagen, sondern nachdenken. Versteifen Sie sich nicht darauf, Arbeiter zu werden!
So spät wie Sie anfangen, werden Sie immer nur ein Stümper sein, und gerade wegen Ihrer Bildung werden Sie unglücklich werden. Wenn Sie sich auch für noch so revolutionär halten, fühlen Sie sich doch noch zu sehr als Gymnasiast, als dass Sie sich unter den Ungebildeten in der Werkstatt wohlfühlen könnten. Und denen würden Sie auch nicht gefallen! Sie sind kein Pariser Lausejunge gewesen, Sie würden die Manieren eines Herrn haben. Auf jeden Fall, das kann ich Ihnen sagen: Am Ende des Lebens im Kittel steht das Leben in Lumpen … Alle Arbeiter enden bei Almosen, vom Staat oder von ihren Söhnen …« – »Außer Sie sterben unter dem Roten Kreuz!«
»Wenn das Leben Ihnen zu schwer vorkommt, müssen Sie nicht unbedingt Arbeiter werden, um auf eine Barrikade zu steigen und sich töten zu lassen! … Hören Sie! Leben Sie Ihr Leben im armseligen Gehrock, und tun Sie, was man tut, wenn einem die Arme mit Gewalt in die Ärmel von so einem Rock da gesteckt worden sind. Sie können vor Müdigkeit und Elend umfallen wie die Hilfslehrer oder die Lehrer, von denen Sie reden! Wenn Sie fallen, Gute Nacht! Wenn Sie widerstehen, dann bleiben Sie inmitten der Gehröcke aufrecht so gut wie einer, der sich in der blauen Bluse verteidigt. Junger Mann, da gibt es eine Aufgabe! Seien Sie nicht zu klug für Ihr Alter! Denken Sie nicht nur an sich, an Ihre hundert Sous pro Tag, an das sichere Brot, das jeden Samstag in Ihrer Arbeitertasche sein würde … Das ist ein bisschen egoistisch, Kamerad! … Man soll nicht allzu sehr an den Magen denken, wenn man etwas im Herzen hat, wie Sie anscheinend haben!« Er hielt an, gab mir die Hand und ging.
Er muss schon lange im Grab liegen. Vielleicht ist er am nächsten Tag gestorben. Ich habe ihn nicht wiedergesehen. Er hat über mein Leben entschieden!
Dieser Greis hat mir erst einmal gezeigt, wie das Brot des Arbeiters am Anfang sicher ist, am Ende des Weges aber als Almosen aufgeklaubt wird, dann hat er meine Jugend beschuldigt, egoistisch und feige vor dem Hunger zu sein. Ich kehrte unter die Armen mit Abitur zurück.
Acht lange Tage bin ich traurig gewesen, aber es ist Herbst! Der Jardin du Luxembourg ist so schön mit seinem gefärbten Laub, und die Kameraden sind so sorglos und fröhlich!
Ich lasse meine siebzehn Jahre lachen und träumen!
Wir genießen unsere Jugend mit leidenschaftlichen Diskussionen, mit Streitereien bei jeder Gelegenheit, mit Zwiebelsuppe und Wein zu vier Sous!
Der Wein für vier Sous,
Der Wein für vier Sous.
»Wie ist der gut!«, sagte Matoussaint und schnalzte mit der Zunge. Matoussaint fand ihn vielleicht schlecht, aber als Cliquenchef ließ er die Sorglosigkeit wie Flöhe in die Runde springen, so wie den Glauben an billige Gesöffe. Und der Wein zu vier Sous war durchaus nicht zu verachten! Was für schöne Abende ich in dem Ausschank in der Rue de la Pépinière in Montrouge verbracht habe, der zu unserm Café Procope wurde, wo Fässer im Freien standen, wo man den Wein aus Flaschenhälsen gluckern und Verse sich vom Herzen lösen hörte; wo man an morgen nicht mehr dachte, als wenn man Millionär gewesen wäre; wo man sich Uhrketten aus kleinen roten Perlen auf die Weste kullern ließ; wo man für vier Sous Gesundheit, Hoffnung und Glück kaufen konnte. Ja, ich bin sehr glücklich gewesen an diesem Kneipentisch, wo wir auf leeren Fässern saßen!
Wenn wir heimkehrten, packte uns die Melancholie des Abends, und unsere Bohémien-Masken fielen ab; wir wurden wieder wir, besangen keine Zukunft, sondern ließen unser Denken leise in die Vergangenheit zurückgleiten.
Bis auf zehn Minuten von der Kneipe entfernt grölten wir noch, aber eine Viertelstunde später erstarb das Lied, und wir plauderten – wir plauderten halblaut von zu Hause! – Wir taten uns zu zweit oder dritt zusammen, redeten von den Stunden im Gymnasium und in der Schule und tauschten die Erinnerung an die Gefühle von damals aus. Wir waren schlicht wie Kinder, fast so ernst wie Männer, wir waren keine Dichter, Künstler, Studenten, wir waren aus unserm Dorf.
Diese Heimwege von der kleinen Kneipe, wo Wein für vier Sous verkauft wurde, waren gut.
Einmal haben wir eine Verrücktheit begangen, wir haben feinen Wein bestellt, einen Muskat, der im Glas verkauft wurde, einen Muskat, der mir noch die Zunge verzuckert und der uns lange vorgeworfen wurde.
Royanny und ich hatten in der Woche die Kasse. Muskat trinken bedeutete Gaunerei, Verrat!
Für zwei Gläser wurden wir zu Verrätern.
Wenn aller Verrat einen so guten Nachgeschmack hinterlässt, dann kann man zu niemandem mehr Vertrauen haben.
Es ist das einzige Extra, die einzige Verrücktheit, der einzige Luxus in meinem Pariser Leben, seit ich da bin.
Da ist noch der Kauf einer Geranienpflanze und eines Rosenstocks, dann eines Klumpens Erde mit Margeriten drin. Immer wenn ich der Clique drei Sous abknapsen konnte – ohne zu stehlen (die Gewissensbisse wegen des Muskat waren genug) –, dann ging ich zum Blumenquai Erinnerungen pflücken. Ich trug für meine drei Sous die Pflanze oder das Blattwerk davon, das am meisten nach Le Puy oder Farreyrolles roch. Ich trug es versteckt davon, zwischen Herz und Hand, als ob ich, wenn mich jemand gesehen hätte, bestraft worden wäre! So groß war mein Wunsch – und auch mein Bedürfnis –, mich aus dem Dreck von Paris manchmal in die glücklichen Winkel meiner ersten Jugend zu flüchten!
Ein Unglück!
Einen Monat nach meiner Ankunft wurde mir meine kleine Kammer im Hôtel Riffault genommen. Die Besitzer haben das Haus renovieren lassen, die Leiter wurde abgerissen, meine Klause entweiht; aus dem, was bei meiner Ankunft zu meinem Paradies wurde, haben sie einen Speicher gemacht … Ich habe ausziehen, ein anderes Asyl suchen müssen.
Ich habe nichts unter zehn Francs gefunden. Die Mieten steigen, steigen!
Ich habe alle Pensionen in der Rue Dauphine abgegrast und bin aus allen vom Gestank der Kloaken oder dem Lärm von Streitereien vertrieben worden. Ich wollte Ruhe haben in dem Loch, in dem ich mich einnisten würde. Ich bin überall auf schreiende Kinder und betrunkene Nachbarn gestoßen.