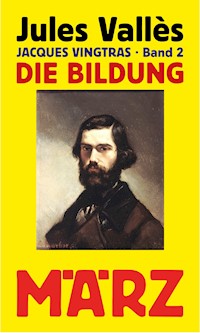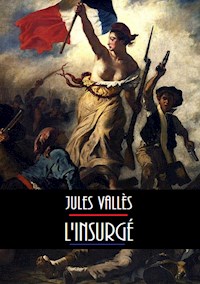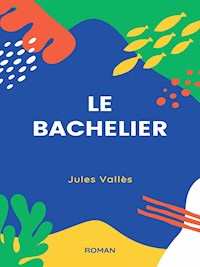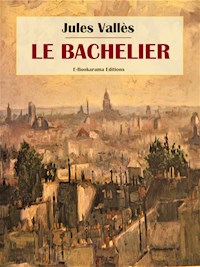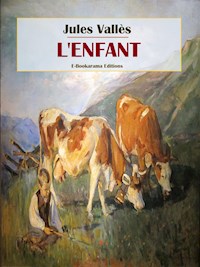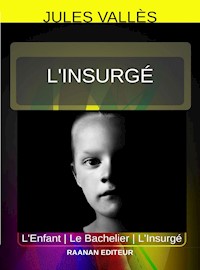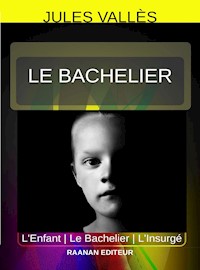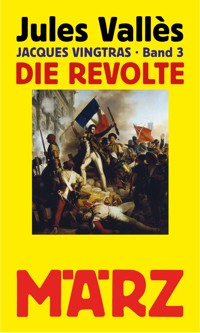
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MÄRZ Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jacques Vingtras
- Sprache: Deutsch
Im dritten Band von Jacques Vingtras kommt es zum dramatischen Höhepunkt, sowohl im Leben unseres Romanhelden als auch im Frankreich des ausgehenden 19. Jahrhunderts: Sein Leben lang hat Vingtras darauf gewartet, dass das Volk sich endlich an den bürgerlichen Unterdrückern rächt. Nun kommt es nach heftigen Unruhen zur Errichtung der Pariser Kommune von 1871, und wir erfahren von der Armee von Versailles, einer von Adolphe Thiers organisierten bewaffneten Einheit, die in Paris einmarschiert, vom Barrikadenkrieg, von den Querelen einer Volksregierung, in der Vingtras zu einem der einflussreichen Mitglieder aufsteigen wird, von der »Blutigen Maiwoche«, von zahlreichen Bränden und von Massakern an Geiseln. Und obwohl er glaubt, verloren zu sein, wird es Vingtras am Ende gelingen, dem Tod zu entkommen. Wie auch der Autor dieser nun endlich wieder vollständig vorliegenden Trilogie, Jules Vallès. Sein literarisches Werk machte ihn schlagartig zu einem der meistgelesenen Autoren Frankreichs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jules Vallès
Die Revolte
Dritter Band der TrilogieJacques Vingtras
Aus dem Französischen übersetztund mit Anmerkungen versehenvon Christa Hunscha
Herausgegeben vonBarbara Kalender
Vorbemerkung
Für mich hat Jacques Vingtras eine Frische und Kraft, die therapeutisch wirkt, Jules Vallès erzählt von den aufsässigen, jungen Intellektuellen am Rande der Gesellschaft zur Zeit der Pariser Bohème vor etwa hundertfünfzig Jahren. Das akademische Proletariat schlägt sich notdürftig durch, kämpft mit Armut und Arbeitslosigkeit. Parallelen zu den heutigen Verhältnissen drängen sich auf, Stichwort: »Digitale Bohème«.
Die erste Ausgabe der deutschen Übersetzung von Jacques Vingtras erschien 1979 in einem Band. Walter Boehlich schrieb in der Frankfurter Rundschau darüber: »Manchmal haben die Leser Glück – wenn nämlich ein Verleger sich nicht auf das schon zehn- oder zwanzigmal Veröffentlichte stürzt und nicht auf die Bücher, die in aller Munde sind und hohe Auflagen versprechen, sondern wenn er etwas ausgräbt, eine Entdeckung macht. Das ist Jörg Schröder in seinem MÄRZ Verlag gelungen.« Boehlichs Fazit: »Eine solche Jugendgeschichte gibt es höchstens alle hundert Jahre einmal: im 18. Jahrhundert den Anton Reiser von Karl Philipp Moritz, im 19. Jahrhundert eben den Jacques Vingtras.«1
In all den Jahren, die ich mit Jörg Schröder arbeitete und lebte, fragte ich immer wieder, wie er auf dieses oder jenes Buch aufmerksam wurde. Hier ist die Antwort in Bezug auf Vallès: »Ende der Siebziger besuchten mich Christa Hunscha und Klaus Roth übers Wochenende im Vogelsberg. Sie berichteten von Jules Vallès, ihnen verdanke ich also den Hinweis auf eines der wichtigsten MÄRZ-Bücher. Ich besorgte mir seine Werke, die bei den Éditeurs Français Réunis und in der Bibliothèque de la Pléiade erschienen waren, und stellte fest, daß es die drei Bände des Jacques Vingtras – Das Kind, Die Bildung, Die Revolte – in Deutschland vollständig noch nie gegeben hatte. Also schlug ich in der Geschichte der französischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert von Victor Klemperer nach, weil ich LTI 1966 bei Melzer verlegt hatte, stand auch dieser Band in meinem Bücherschrank. Klemperer räumt im letzten Kapitel ›Beginn einer sozialistischen Sonderliteratur‹ Jules Vallès breiten Raum ein. Er schildert ihn als Individualist und Einzelgänger mit anarchistischen Neigungen, nicht als Marxist, sondern als Erfinder einer spezifisch sozialistischen Kunstsparte: der Reportage und des operativen Genre. Jacques Vingtras ist Jules Vallès selber, und das ganze Werk steht einer Autobiographie oder einer Memoirensammlung näher als einem Roman.«2
»Vallés gehört durchaus und ebenbürtig in die Reihe, die von Flaubert über die Goncourts zu Zola läuft«, erklärt Victor Klemperer und findet: »Nein, ein klarer Theoretiker ist Vallès ebensowenig wie ein ganz an sein Metier hingegebener Romanautor oder ein ruhig formender Memoirenschreiber. Aber ein Dichter ist er immer wieder und ein Maler. Man sieht die Menschen, die er schildert, vor sich mit ihren charakteristischen Gesichtszügen und Bewegungen, man hört den Ton ihrer Stimme, und für jede Nuance ihrer Erscheinung und ihres Wesens verfügt er unbekümmert über einen sprachlichen Reichtum sondergleichen, über das klassische Pathos, über die Worte des Alltags, über die Wendungen der verschiedenen Gesellschaftsschichten. Seine Bilder sind ebenso überraschend wie treffend. Meist denkt man an den Stil der Goncourts; aber wie er Zolas Leidenschaft für die Partei der Misérables teilt, so findet er auch Zolas Kraft des Symbols.«3
Der Text wurde der neuen aktuellen Rechtschreibung angepasst, aber nicht neu übertragen, weil uns die Übersetzung von Christa Hunscha gefiel, sie ist so zeitlos, dass man sie auch noch in Zukunft als gegenwärtig wird lesen können. Jochen Schimmang war gleicher Meinung: »Zum anderen kommt Vallès seine außerordentlich sinnliche Schilderungskraft zugute, die auch die Klaviatur der verschiedenen Redeweisen souverän beherrscht. An dieser Stelle ist von dem eher seltenen Fall einer Übersetzung zu berichten, die nicht gealtert ist. Die deutsche Version der viel zu früh gestorbenen Christa Hunscha hat […] nicht die geringste Patina angesetzt.«4 Bisher waren alle Rezensenten von der Qualität der Trilogie überzeugt. Enno Stahl urteilt: »Vallès schreibt einzigartig: Mit seinem mal schnoddrigen abgerissenen, mal fließenden Stil steht er Ende des 19. Jahrhunderts komplett allein.«5
Mit diesem Band ist nun Jules Vallès Hauptwerk wieder komplett. Denn die neue Ausgabe erscheint in drei Einzelbänden, mit oder ohne Schuber, dafür danke ich Richard Stoiber.
Barbara Kalender im Dezember 2022
1Walter Boehlich, »Erziehung zum Aufstand«, in: Frankfurter Rundschau, 29. Dezember 1979.
2Jörg Schröder erzählt Barbara Kalender, Schröder erzählt: Wie neu, 32. Folge der Weißen Serie, Berlin: MÄRZ Desktop Verlag, 1998.
3Victor Klemperer, Geschichte der französischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert, Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften 1956.
4Jochen Schimmang, »Nicht nur Zähneknirschen bei Demütigungen«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6. April 2022.
5Enno Stahl, »Immer auf dem Sprung«, in: neues deutschland, 8. Dezember 2022.
DIE REVOLTE
DEN TOTEN VON 1871
ALLEN,die als Opfer der sozialen Ungerechtigkeit gegeneine schlecht eingerichtete Welt zu den Waffen griffenund unter der Fahne der Kommunedie große Föderation der Schmerzen bildeten,widme ich dieses Buch.
JULES VALLÈS
Paris 1885
Inhalt
Vorbemerkung
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Kapitel XXIX
Kapitel XXX
Kapitel XXXI
Kapitel XXXII
Kapitel XXXIII
Kapitel XXXIV
Kapitel XXXV
Nachwort
Anmerkungen
Einige Daten der französischen Geschichte
Einige historische Namen zur Kommune
I
Vielleicht bin ich wirklich ein Feigling, wie die Rotkappen und die Schwarzfüße unter dem Odéon gesagt haben! Jetzt bin ich seit Wochen Hilfslehrer und empfinde weder Kummer noch Schmerz. Ich bin nicht verärgert und schäme mich nicht.
Im Gymnasium habe ich die Trockenbohnen1 beleidigt; hier sind die Bohnen offensichtlich besser, denn ich verschlinge ganze Schüsseln voll, lecke und schlecke den Teller ab.
In die vollkommene Stille des Refektoriums habe ich neulich, wie einst bei Richefeu, gerufen:
»Kellner, noch eine Portion!«
Alle haben sich umgedreht und gelacht.
Ich habe auch gelacht – ich lege mir die Unbekümmertheit von Galeerensträflingen zu, den Zynismus von Gefangenen, ich richte mich in meinem Zuchthaus ein und tränke mein Herz mit einem Glas dünnen Weins – ich fange an, meinen Trog zu lieben!
Wie lange habe ich gehungert!
Ich habe mir so oft die Seiten gehalten, um den Hunger abzuwürgen, der in meinen Eingeweiden rumorte und nagte.
Ich habe mir so viele Male den Bauch gerieben, ohne dass es auch nur einen Hoffnungsschimmer auf ein Abendessen gegeben hätte, dass ich jetzt meine ausgetrockneten Gedärme mit warmer Sauce schmiere, einem Bären gleich, der sich wollüstig unter Weintrauben räkelt.
Es ist fast so genussvoll wie eine heilende Wunde, die noch juckt.
Sicher ist, dass ich keine grünliche Haut und keine hohlen Augen mehr habe; oft hängt mir Ei im Bart.
Früher habe ich diesen Bart nicht gekämmt; meine Finger haben ihn durchwühlt und zerrupft, während ich über meine Ohnmacht und mein Elend nachdachte.
Heute striegle und bürste ich ihn … ebenso meinen Haarschopf, und vergangenen Sonntag, als ich vor dem Spiegel die letzten Hüllen fallen ließ, habe ich mit verhaltenem Stolz meinen kleinen Schmerbauch betrachtet.
Mein Vater war mannhafter, ich erinnere mich an den funkelnden Hass in seinen Augen, als er Studienaufseher war, obwohl er nicht Revolution spielte, nicht die Zeiten des Aufruhrs erlebt, nicht zu den Waffen gerufen hatte, nicht durch Aufstand und Duell geschult war!
So weit ist es mit mir gekommen – in diesem Gymnasium habe ich die Ruhe eines Asyls, mein Armenbrot, meine Spitalsration gefunden.
Einer von den Alten aus Farreyrolles, der Waterloo mitgemacht hatte, erzählte an Feierabenden, dass er am Abend der Schlacht, noch bevor sie beendet war, an einem Wirtshaus gleich hinter den heiligen Stellungen vorbeikam, sich über einen Holztisch fallen ließ, sein Gewehr wegwarf und sich weigerte weiterzugehen.
Der Oberst beschimpfte ihn als Feigling.
»Wenn Sie wollen, bin ich ein Feigling! Ich kenne keinen lieben Gott und keinen Kaiser mehr … Ich habe Durst und Hunger!«
Und er hat seinem Leben im Speiseschrank des Wirtshauses nachgejagt, inmitten von Leichen; niemals hat er, wie er sagte, besser gespeist, das Fleisch war köstlich, der Wein frisch. Dann hat er sich ausgestreckt, sein Ranzen war die Schlummerrolle, und beim Donnern der Kanonen hat er donnernd geschnarcht.
Mein Geist schläft fern von Kampf und Getöse ein; die Erinnerung an die Vergangenheit hallt in meinem Herzen nur noch nach wie im Ohr des Flüchtlings der Trommelwirbel, der sich allmählich entfernt und dann stirbt.
Möbliertes Freiwild, das Jahre hindurch gezwungen war, das erstbeste Loch zum Schlafplatz zu nehmen und aus Angst vor Schlaflosigkeit oder der Wirtin nur zu dunkler Stunde hineinzukriechen; ein vom Land Entlaufener, der mehr Luft brauchte als andere, aber in den Hinterhöfen der Hotels nur üble Ausdünstungen einzuatmen bekam; ein Ausgehungerter, der sich nie satt aß, aber Heißhunger und Wolfszähne hatte – so sieht der Bursche aus, der sich eines Morgens vor Brot und Bett wiederfindet, vor einem sauberen Tischtuch, einem Schlaf ohne Wanzen, einem Erwachen ohne Gläubiger.
Und Vingtras der Wilde hat keine Wut mehr im Herzen, dafür die Nase im Teller, eine Serviette mit Serviettenring und ein schönes Besteck aus Neusilber.
Er sagt dir sogar das Benedictus her wie jedermann, mit gehörig demütiger Miene, an der die Autoritäten keinen Anstoß nehmen.
Nach der Mahlzeit dankt er Gott (immer lateinisch), lässt die eine Hand auf den Rücken gleiten und eine Westenschnalle lockern, macht vorn einen Knopf auf und schlägt seinen Gehrock darüber zusammen – er hat ihn aus dem Schrank des Toten geholt und für sich zurechtschneidern lassen, ganz der Papa. Mit vollen Eingeweiden und fetten Lippen schlägt er dann mit der Klasse, die er leitet, den Weg zum Hof der Großen ein, von dem man wie von einer Schlossterrasse weit übers Land blickt.
Von dieser Höhe kommt mir der Himmel zu gewissen Stunden wie ein zartes Seidenkleid vor, streichelt die Brise mir den Hals wie mit einem Flügelschlag.
Ich habe nie zuvor so viel Sanftheit und Heiterkeit erlebt.
Abends
Das kleine Zimmer am Ende des Schlafsaals, wo die Studienaufseher in ihrer Freizeit arbeiten oder träumen können, geht auf Bäume und eine von Flüssen zerschnittene Landschaft hinaus.
Mit dem Atem des Windes weht ein Geruch von Meer heran, der mir die Lippen salzt, die Augen erfrischt, das Herz besänftigt. Unter dem Ansturm meiner Gedanken zuckt dieses Herz nur wie der Fenstervorhang unter einem stärkeren Lufthauch.
Ich vergesse meinen Beruf, ich vergesse die Lausejungs, die ich hüte … ich vergesse Kummer und Revolte.
Ich drehe den Kopf nicht in die Richtung, wo Paris tobt, ich suche nicht am Horizont nach den rauchenden Stellen, wo sich wahrscheinlich das Schlachtfeld befindet – dort ganz hinten habe ich einen Weidenstrauch entdeckt und einen Obstgarten in voller Blüte, ich starre sie mit feuchtem Blick an, finde sie süßer.
Ja, die vom Odéon hatten recht: Verdammter Feigling! Wenn ich aus dem Gymnasium trete, bin ich in stillen, verschlafenen Gassen, und mit hundert Schritten bin ich bei einem Flüsschen, an dem ich entlangschlendere, ohne viel zu denken, dösend verfolge ich Zweige und Grasbüschel, die die Strömung mit sich führt, zu unbekannten Abenteuern.
Am Ende des Weges ist eine Gastwirtschaft mit einem Kranz von Äpfeln im Schild; für ein paar Sous trinke ich Cidre, der wunderschön golden ist und mir in den Kopf steigt.
O ja! Verdammter Feigling!
Man macht es mir aber auch nicht leicht …
Ein bürgerlicher Zufall hat es so gefügt, dass dieses Gymnasium voller Licht und Luft ist; ein ehemaliges Kloster mit großen Gärten und großen Fenstern. Breit fällt das Licht in den Speisesaal und wenn die Fenster geöffnet sind, kommt das Rauschen der Blätter herein, und das Beben der vom Herbstrost schon mit warmer Bronze oder Kupfer überzogenen Natur.
Bei den Gymnasiasten habe ich keinen Anstoß erregt, sie sind gewohnt, von Neulingen überwacht zu werden, die eben erst von der Schulbank aufgestanden sind, oder von alten, verknöcherten Hilfslehrern, dümmer als Stubenfeldwebel.
Sie haben mich empfangen wie einen irregulären Offizier in Not, den der Tod des Vaters – eines regulären Haudegens – zufällig einberufen hat; im Übrigen umgibt mich der Nimbus des Parisers. Das genügt, damit diese Schar jugendlicher Gefangener mich nicht hasst.
Auch meine Kollegen finden mich ganz in Ordnung, wenn auch zu nüchtern, da sie selbst ihre freien Stunden in ein kleines dunkles feuchtes Café einsperren, wo sie mit Biertrinken, Branntweinschlürfen, Pfeifeschmauchen ihre Zeit totschlagen.
Ich trinke nicht und rauche nicht.
Die Zeit, die mir gehört, verbringe ich am Ofen in meinem Studiensaal mit einem Buch in der Hand oder auch in der Philosophieklasse mit einem Heft auf den Knien. Der Lehrer ist der Schwiegersohn vom Direktor persönlich, und es schmeichelt ihm, wenn der großspurige Pariser mit dem schwarzen Bart wie ein Schüler auf einer Bank Platz nimmt und seiner Rede von den Fähigkeiten der Seele lauscht. Beim Bakkalaureat haben sie mir übel mitgespielt, bei der Promotion dürfen sie mich nicht wieder aufs Kreuz legen. Ich muss unbedingt wissen, wie viele man im Calvados nachzählen kann: sechs, sieben, acht … oder mehr, oder weniger!
Und ich besuche den Unterricht regelmäßig, um über die Philosophie der Gegend auf dem Laufenden zu sein.
15. Oktober
Heute ist Vorlesungsbeginn in der philosophischen Fakultät, die Eröffnungsrede wird der Geschichtsprofessor halten.
Aber den Professor, den habe ich doch schon gesehen!
Er kam als Absolvent der École Normale ins Gymnasium Bonaparte und hielt die Rhetorikkurse ab, als ich Rhetorik belegt hatte. Das war 1849 – damals sprach er bei Gott kühn und revolutionär. Ich erinnere mich sogar, dass er mit Anatoly, dessen Bruder er kannte, ins Café ging und dass er den Kopf hob, als er mich am Nebentisch, wo wir diskutierten, auf Béranger schimpfen hörte.
Er hatte mich bemerkt, ohne meinen Namen zu behalten; aber er erinnerte sich an die Situation, und als ich ihn beim Verlassen der Vorlesung ansprach, erkannte er mich sofort.
»Und wie geht es Ihnen? Ich habe gehört, man hätte Sie deportiert, oder Sie wären im Duell umgekommen.«
Ich gestehe ihm, wie sehr ich hier in allem untergegangen bin, in mein Geschick ergeben, froh über die Ordnung, zufrieden, dass ich lebe, die Hand am Korkenzieher über der Cidreflasche oder am Löffel voll Trockenbohnen, die Augen auf der Strömung des Flusses.
»Teufel, Teufel!«, hat er gesagt, wie ein Arzt, der böse Dinge hört. »Besuchen Sie mich doch, dann können wir plaudern. Es würde mich freuen, ab und zu aus diesem Milieu von Dummköpfen und Halunken herauszukommen!«
Mit einer Handbewegung wies er auf die Gruppe der Honoratioren und seiner Kollegen.
Er, ein honorabler Geschichtsprofessor, spricht so!
Ah! Warum ist er mir über den Weg gelaufen!
Ich lebte ruhig, ich ruhte mich wunderbar aus; er hat mir wieder Feuer unterm Hintern gemacht, und wenn ich sonntags beim Nachtisch eine Schnalle aufmache und mich gegen Gefühle wappne, schüttelt er mich:
»Sie wenigstens werden nicht zum Bürger werden und Fett ansetzen! Lieber sollen Sie mich wegen meines Verdienstkreuzes vom Juni beleidigen.«
Ich habe ihn tatsächlich beim ersten Mal, als ich zu ihm ging, wegen der Dekoration beleidigt und bin dann zur Tür gegangen.
Er hat mich zurückgehalten.
»Ich war zwanzig Jahre … ich war mit dem ganzen Haufen von der École Normale zusammen … Ich hatte keine Ahnung von der Bedeutung des Aufstands und habe mich auf Cavaignacs Seite geschlagen, den ich für einen Republikaner hielt, und als Erster bin ich ins Pantheon eingedrungen, wo die Arbeiter sich verbarrikadiert hatten. Sie haben mich mit der Nachricht in die Kammer geschickt, und dort haben Sie mir Ihr Band ins Knopfloch geflochten. Aber ich schwöre Ihnen, weit davon entfernt, jemanden zu töten, habe ich mehreren Mitkämpfern unter eigener Lebensgefahr das Leben gerettet. Kommen Sie, bleiben Sie da! Sie wissen doch selbst, wie man sich ändern kann, da Sie gestehen, dass Sie nicht mehr derselbe sind …«
Er hat mir die Hand hingestreckt, ich habe sie genommen, und wir waren Freunde.
Ich wurde auch der Günstling seines weißhaarigen Kollegen, des Vaters Machar, der sich in der Provinz vergraben hat, nachdem sein Ruhm in Paris erloschen war.
»Welcher von Ihnen ist Vingtras?«, hat er die Studienaufseher gefragt, die sich zur zweiten Vorlesung des Jahres versammelt hatten.
Ich trete aus der Gruppe.
»Wo kommen Sie her? Wo sind Sie zur Schule gegangen? … Da unten? Ich hätte gewettet, dass Sie sie zumindest abgeschlossen haben!«
Und er ließ mich meine Abhandlung, meine Schulaufgabe, laut vorlesen.
»Sie sind ein Schriftsteller, Herr Vingtras!«
Ohne Vorwarnung hat er mir das an den Kopf geknallt, und beim Hinausgehen hat er mich bis zur Tür begleitet. Ich habe ihm meine Geschichte erzählt.
»Tja«, hat er kopfschüttelnd gesagt, »wenn es nur nach dem Kameraden Lancin und mir ginge, dann hätten Sie im August Ihren Doktor. Aber halten Sie überhaupt so lange durch? Wird der Inspektor Sie behalten? Sie sehen aus wie ein Mann – und er braucht Hunde, die kuschen …«
»Ich mache mich klein, ich bin entschlossen, feige zu sein!«
»Vielleicht, aber man sieht Ihnen an, dass Sie es nicht sind, und das Pack spürt Ihre Verachtung.«
Er behielt recht, der alte Meister! Es hat mir nichts genützt, dass ich so tat, als ob ich schliefe, Bauch ansetzte und das Benedictus hersagte!
Die Universitätsbonzen, der Direktor und der Anstaltsgeistliche des Gymnasiums, haben beschlossen, dass ich fliege. Mein Stachelbart, mein klares Auge, das Klacken meiner Absätze, wie weich ich auch auftrete, beleidigen ihr kahles Kinn, ihren trüben Blick, ihre über die Fliesen schlurrenden Sohlen.
Da sie mir nicht vorwerfen konnten, unkorrekt oder ein Säufer zu sein, sind diese Jesuiten auf eine geniale Idee gekommen!
Heimlich haben sie eine Verschwörung gegen mich angezettelt.
Mitternacht
Der Schlafsaal, wo ich bei Kerzenlicht büffelte, wurde zum Agitationsfeld der Verschwörer.
Er leistet mit seiner klösterlichen Konstruktion dem Aufruhr Vorschub. Jeder Bruder hatte einst eine zum Himmel offene Zelle, jeder Schüler hat heute das gleiche Glück, sodass niemand im Innern der Verschläge gesehen werden kann; der Studienaufseher hört die Geräusche, kann aber keine Bewegungen erkennen.
Eines schönen Abends gab es Aufruhr zwischen den Holzwänden: Es wurde gegen die Verschläge geklopft, es wurde gepfiffen, gegrunzt, geschrien, und so komisch, dass ich Lust bekam mitzumachen.
Ich habe also auch geklopft, gepfiffen, gegrunzt und mit schriller Stimme geschrien:
Nieder mit dem Hilfslehrer!
Zum ersten Mal, seit ich hier bin, fühle ich mich lebendig.
Da stehe ich, im Hemde, mitten in der Zelle, schlage mit der Kerze gegen den Nachttopf, mache Hahn und Schweine nach, und kreische andauernd: Nieder mit dem Hilfslehrer!
Die Tür wird aufgestoßen …
Der Direktor persönlich. Er ist offenbar verblüfft, mich mit wehendem Banner barfuß auf den Fliesen stehen zu sehen, mein Nachtgeschirr in der einen Hand, meinen Kerzenhalter in der andern, und er stammelt verstört:
»Hö … hö … hören Sie denn nicht?«
»???«
»Diese Revolte … dieses Geschrei! …«
»Geschrei? … Revolte? …«
Ich habe mir die Augen gerieben und eine verdutzte, wirre Miene aufgesetzt … Ah! Er sah sehr gut, worum es ging, und weiß wie das Porzellan des Nachttopfs ist er davongegangen. Im Schlafsaal wird es keine Revolte mehr geben; keine Sorge!
Ich lege mich wieder hin, untröstlich, dass der Radau vorbei ist.
Aber ich sehe wohl, dass es mit mir aus ist. Ich werde mir noch diesen oder jenen Luxus leisten, bevor sie mich hinauswerfen.
Die Gelegenheit kommt.
Der Rhetoriklehrer wird krank. Es ist üblich, dass der Studienaufseher den Lehrer vertritt, wenn dieser ausnahmsweise verhindert oder abwesend ist.
Ich werde also heute Abend den Unterricht abhalten, auf seinen Stuhl steigen.
Da bin ich.
Die Schüler warten mit der Spannung, die jedes ungewohnte Ereignis erzeugt. Wie werde ich mich aus der Sache ziehen, ich, der Schönredner, der Favorit der Fakultät, der Pariser?
Ich fange an.
»Meine Herren,
der Zufall will es, dass ich Ihren ehrenwerten Lehrer, Herrn Jacquau, vertrete. Ich erlaube mir aber, über das anzuwendende Unterrichtssystem nicht seiner Meinung zu sein. Meine Meinung ist, dass nichts, nichts von dem gelernt werden sollte, was die Universität Ihnen nahelegt. (Unruhe von der Mitte her.) Ich glaube, Ihrer Zukunft besser zu dienen, wenn ich Ihnen rate, Domino, Dame oder Karten zu spielen, die Jüngeren dürfen den Fliegen Papier in den Hintern bohren.« (Bewegung in entgegengesetzter Richtung.)
»Meine Herren, ich bitte um Ruhe! Um Demosthenes und Vergil auswendig zu lernen, braucht man nicht nachzudenken, aber um achtzig oder fünfhundert zu erreichen oder dem König Schach zu bieten oder Fliegen zu pfählen, ohne ihnen weh zu tun, dafür ist ein ruhiger Geist vonnöten, und dem unschuldigen Insekt gegenüber, das Ihre Neugier, meine Herren, ausforscht, wenn ich mich so ausdrücken darf, sind Sie zur Sammlung verpflichtet.« (Lang anhaltende Erregung.)
»Schließlich wünsche ich, dass die Zeit, die wir zusammen verbringen werden, keine verlorene Zeit ist.«
Vorhang!
Am selben Abend habe ich meine Entlassung erhalten.
II
Da stehe ich von Neuem auf dem Pariser Pflaster, mit vierzig Francs in der Tasche, überworfen mit allen Fakultäten Frankreichs und Navarras1.
Wohin mit mir? Ich bin nicht mehr der gleiche Mann: Acht Monate Provinz haben mich verändert.
Zehn Jahre lang habe ich gelebt wie der Säufer, der sich vor dem Zusammenbruch am Morgen nach dem Besäufnis fürchtet, der dem Vieh immer wieder ins Fell greift, sich auf den Weißwein stürzt, sobald er wach ist, immer eine Flasche in Reichweite seiner zitternden Hände hat. Ich besoff mich an meinen Reden.
Und die Beherztheit zahlte sich meistens nicht aus!
Sogar die, denen ich ein bisschen Freundlichkeit als Almosen zuwarf, um meine Qual zu überdecken oder die ihre zu zerstreuen, verstanden mich weder, noch dankten sie es mir, sie schimpften mich einen Auvergnaten und groben Kerl. Lausig im Geist und flau von Gemüt wie sie waren, sahen sie nicht, dass ich unsere Schmerzen mit Ironie überdeckte, wie man eine Pappnase über ein Krebsgeschwür stülpen mag, dass meine Gefühle mir die Eingeweide zerfraßen, während ich auf unser gemeinsames Elend mit Kalauern einschlug, so wie man in einem stickigen Raum mit der Faust eine Scheibe einschlägt, um Luft zu bekommen!
Es war der Mühe nicht wert, sich da wieder einzureihen!
Was habe ich gemacht, seit ich aus der Provinz zurückgekommen bin? … Ich weiß es nicht mehr. Ich habe gelebt wie ein Tier, wie dort auch, nur ohne Weide und Streu. Soll ich ins Grab hinabsinken und mich immer nur gegen das Leben verteidigt haben, ohne aus dem Schatten getreten zu sein, wenigstens eine Schlacht in der Sonne geschlagen zu haben?
Lass sie doch Verrat schreien, wenn sie wollen!
Ich werde versuchen, acht Stunden am Tag zu verkaufen, für ein sicheres Brot und einen heiteren Geist.
Schließlich ist Arnould2, der ein Ehrenmann ist, bei der Stadt arriviert. Ich habe neulich Lisette getroffen, sie hat es mir erzählt.
Mein Stellengesuch muss nun befürwortet werden … Noch ein Schwur, den ich mit Füßen trete!
Egal!
Ich war meineidig, als ich Hilfslehrer wurde, und meineidig werde ich wieder sein, wenn ich Leute, die am 2. Dezember versucht haben, uns umzubringen, um ihre Unterschrift anbettele.
Elender! Statt Terrain zu gewinnen, habe ich Terrain verloren, und meine Haare fangen an, weiß zu werden!
Es ist getan! – Ein Gardegeneral, ein Bibliothekar in den Tuilerien, ein ehemaliger Direktor meines Vaters, sie haben mich alle drei mit ein paar Zeilen empfohlen.
Und das hat genügt. In einem Bürgermeisteramt am Ende der Welt, das aussieht wie eine Baracke, haben sie mich für hundert Francs im Monat zur Aushilfskraft ernannt. Ich laufe hin, steige die Treppen hinauf und frage nach dem Bürovorsteher.
Ein Herr mit Brille und einem kleinen Buckel empfängt mich: »Ist in Ordnung. Sie machen die Geburten.«
Er begleitet mich zum Meldebüro und vertraut mich einem Angestellten an, der mich von oben bis unten misst, mir bedeutet, ich möge mich setzen und mich fragt, ob ich eine schöne Schrift (!!) habe …
»Es geht.«
»Lassen Sie mal sehen.«
Ich tauche die Feder ins Tintenfass, ich tauche sie zu tief ein, beim Herausziehen mache ich auf eine Seite des Registers, das der Mann vor sich liegen hat, einen enormen Klecks.
Er fuchtelt in heftiger Verzweiflung herum.
»Ausgerechnet auf den Namen! … Jetzt müssen wir zurückfragen!«
Er wirft sich ans Fenster, lehnt sich weit hinaus, rudert mit den Armen, stößt Schreie aus.
Ruft er um Hilfe? Fühlt er einen Schlaganfall nahen? Will er mich verhaften lassen?
Wer antwortet ihm? Ein Arzt, ein Kommissar?
Nein. Ein Kohlenhändler, ein Weinhändler und eine Hebamme stürzen fünf Sekunden später erschreckt ins Büro: »Was ist los?«
»Los ist, dass dieser Herr sich damit einführt, dass er eine Sauerei in meinem Buch veranstaltet, und dass Sie jetzt am Rand unterschreiben müssen, damit das Kind einen bürgerlichen Status hat.«
Er dreht sich wütend zu mir um.
»Hören Sie? Einen bür-ger-li-chen Sta-tus! Wissen Sie wenigstens, was das ist?«
»Ja, ich habe Jura studiert.«
»Das hätte ich mir denken können!«
Und er feixt.
»Diese Akademiker sind alle so … der Tod für jedes Register!«
Erneutes Gewimmer und das Geräusch von derben Schuhen, wieder eine Hebamme, ein Kohlenhändler und ein Weinhändler.
Mein Kollege wirft mich ins Feld.
»Vernehmen Sie die Klientin.«
Wie soll ich das machen? Was soll ich sagen?
»Sie kommen wegen eines Kindes? …«
Er zuckt mit den Schultern und sieht aus, als wollte er die Flinte ins Korn werfen.
»Warum zum Teufel sollte sie wohl sonst kommen? …
Vielleicht sind Sie wenigstens in der Lage, etwas festzustellen! Verschaffen Sie sich Klarheit über das Geschlecht.«
»Klarheit über das Geschlecht! … und wie?«
Er rückt die Brille zurecht und betrachtet mich verstört; er scheint sich zu fragen, ob ich womöglich etwas zurückgeblieben und so übertrieben schamhaft bin, dass ich den Unterschied zwischen Buben und Mädchen nicht kenne.
Ich gebe durch Zeichen zu verstehen, dass ich schon Bescheid weiß.
Er seufzt erleichtert auf und sagt zur Wöchnerin: »Wickeln Sie das Kind aus. Sie, mein Herr, sehen nach. Aber von da hinten können Sie ja nichts sehen, so treten Sie doch näher!« »Es ist ein Junge.«
»Ich glaube Ihnen!«, sagt der Vater, bläht sich auf und zwinkert dem Kohlenhändler zu.
Jetzt bin ich also Amme, oder doch nahe daran.
Ich muss höflichkeitshalber ein bisschen beim Auspacken aus den Windeln helfen, Nadeln fortnehmen, das Balg freiwickeln und leise unterm Kinn kraulen, wenn es zu sehr brüllt.
Glücklicherweise habe ich in der Pension Entêtard Routine gekriegt, und meine zarte Hand wird hier im Viertel so berühmt wie meine Gewandtheit, mit der ich die Hemdchen in die Höschen steckte. Ich schieße den Vogel ab!
Meine Kollegen sind keine Leuchten, aber sie sind auch nicht bösartig. In ihnen arbeitet nicht diese gallige, kummervolle Hefe, die in den ewig eifersüchtigen, angstgehetzten, kontrollierten Akademikern gärt.
Sie lassen mich meine Unterlegenheit nicht allzu grausam fühlen; mein Mitarbeiter hat nach zwei Tagen aufgehört, zu grimassieren und zu brummeln.
»Alles in allem, was hat man Ihnen eigentlich im Gymnasium beigebracht? Latein? Damit können Sie die Messe lesen! Lernen Sie mal lieber Grundstriche und Haarstriche machen.«
Und er erteilt mir Ratschläge, wie man die Schwänze bei langen und die Bäuche bei runden Buchstaben hinbekommt. Wir bleiben sogar nach Büroschluss noch da, um an meiner Schönschrift zu arbeiten, über der ich Blut und Wasser schwitze.
Eines Tages hat mich ein alter Kamerad, einer von der republikanischen Horde, durchs Fenster gesehen.
»Früher hast du Aufruhr gemacht; heute machst du Schnörkelbuchstaben!«
Na ja, stimmt! Aber wenn meine Schnörkel fertig sind, bin ich frei bis zum nächsten Morgen.
Mein Abend gehört mir – Traum meines Lebens! –, und ich brauche nur so früh aufzustehen wie ein Arbeiter, um noch zwei Stunden zu haben, in denen ich arbeiten kann, bevor ich daran gehe, das Geschlecht der Blagen zu überprüfen.
Ich wickle Babys aus, aber selbst habe ich die Eierschalen abgestoßen, und wer Augen im Kopf hat, kann sehen, dass ich ein Mann geworden bin.
Murgers Begräbnis
Ich habe mich beurlauben lassen, um am Leichenzug eines Erlauchten teilzunehmen.
Ich will die Berühmtheiten sehen, die zuhauf herbeieilen werden, und ich will hören, was sie an seinem Grab reden.
Sie haben geflennt, das war alles.
Es war von einer Geliebten und einem Hündchen die Rede, die der Entschlafene gern gehabt hatte; sie haben Rosen auf sein Andenken geworfen, Blumen ins Loch, geweihtes Wasser auf den Sarg – er glaubte an Gott oder meinte, so tun zu müssen als ob.
Auch Soldaten folgten dem Zug mit ihren Gewehren: das Geleit für Ordensträger.
Er hatte das Kreuz der Ehrenlegion, es war so viel wert wie eine Blindenplakette, wie ein Gutschein auf Mildtätigkeit. Ehrenlegionäre lässt man nicht vor Hunger krepieren; immer im Elend, konnte er in seinen Ruhm wie in einen Pferdeschwanz doch das rote Band flechten.
Ich kam nachdenklich nach Hause, und plötzlich zuckte ein Zorn durch meine Eingeweide. Ich brauchte noch eine ganze Woche, um zu verstehen, was in mir rumorte – eines Morgens wusste ich es.
Vor dem mit Pomp versenkten Sarg des Bohémiens, den sie da nach einem glücklosen Leben und einem dumpfen Todeskampf auf dem Friedhof verherrlichten, hatte mein Buch, der Sohn meiner Leiden, ein Lebenszeichen gegeben.
Ans Werk also! Ich werde es euch zeigen, was ich im Bauch habe, wenn der Hunger nicht drin wühlt wie die Hand der Gevatterin, die abtreibt und mit ihren schwarzen Fingernägeln die Eierstöcke zerreißt!
Ich, der ich gerettet bin, werde die Geschichte derer schreiben, die untergegangen sind, der armen Halunken, die ihren Napf nicht gefunden haben.
Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn ich mit dem Buch nicht Aufstand säe, ohne dass es auffällt, ohne dass sie sichs versehen, dass unter den Lumpen, die ich aushängen werde wie im Leichenschauhaus, eine Waffe für die zu greifen ist, die wütend geblieben sind, die sich vom Elend nicht haben aushöhlen lassen.
Sie stellen sich die Bohème feig vor – ich werde ihnen zeigen, dass sie verzweifelt und bedrohlich ist!
III
Mein Zimmer ist trostlos, für dreißig Francs habe ich einen Ausblick auf einen Schlauch von Hof, wo auf einem Haufen Gerümpel ein Taubenhaus thront, und das Gurren bringt mich zur Verzweiflung.
Ich höre kaum etwas anderes als diese aufreizende Musik und das Schluchzen einer Frau, die eine düstere Kammer nebenan bewohnt, die Miete nicht zahlen kann und jammert – eine grauhaarige Lehrerin, die keiner mehr will, sie sucht Nachhilfestunden für zehn Sous.
Die Unglückliche! Neulich Abend habe ich sie getroffen, wie sie den Pflegern vom Val de Grâce1 für diesen Preis ihre greisenhafte Zärtlichkeit anbot und ihr Kleid öffnete, um sich an die Brust fassen zu lassen.
Ich wäre gern weggezogen: Es kommt mir so vor, als ob durch die Bretterwand ein Geruch käme, der meine Gedanken vergiftet!
Ich musste aber bleiben, konnte nicht kündigen, weil ich dann vierzehn Tage Vorauszahlung verloren hätte. Mein Leben ist genau geregelt – neben dem Erinnerungsbuch liegt das Rechnungsbuch –, mein Budget ist unerbittlich. Ich brauche nur den Kopf über das Papier zu beugen und mir die Ohren mit Watte zu verstopfen, um taub zu sein gegen den schmerzerfüllten Schluckauf meiner Nachbarin und gegen das zärtliche Gurren der Tauben.
Eine von ihnen kommt oft vor das Kammerfenster und holt sich Brot, das die Finger der Armut dahin krümeln, Finger, die noch nach dem Liebesschweiß der Krankenwärter riechen.
Im Gymnasium war die Taube der Vogel der Wollust, er plusterte sich auf den Schultern von Göttinnen und Dichtern. Hier gurrt sie und wetzt ihren Schnabel an den Fenstern einer Nutte.
Ich stehe um sechs Uhr auf, wickle meine Füße in einen zerlumpten Mantel, denn der Fußboden ist kalt, und arbeite, bis ich zur Bürgermeisterei aufbrechen muss.
Nur von fünf bis acht Uhr setze ich mein Werk fort, nicht länger. Abends bekomme ich in diesem Verschlag in der Rue Saint-Jacques Angst, nahebei ist der Platz, auf dem die Guillotine stand, gegenüber das Militärhospital, um die Ecke die Anstalt für die Taubstummen. Die Umgebung entbehrt wirklich aller Fröhlichkeit!
»Aber vom Fenster aus kannst du das Panthéon sehen, in dem du eines Tages ruhen wirst, wenn du ein großer Mann wirst«, hat Arnould grinsend gesagt, als er mich besuchte.
Ich glaube nicht ans Panthéon, ich träume nicht von großen Titeln, es liegt mir nichts daran, nach meinem Tode unsterblich zu sein, sondern zu leben, solange ich am Leben bin!
Ich fange damit an, aber der Weg ist noch schmutzig und öde.
Das Weibsbild nebenan wird dreister, sie besäuft sich jetzt und bringt Männer mit herauf, die mit ihr saufen.
Eines Tages hat sich einer dieser Saufbolde geweigert, Geld auszuspucken und wollte sie verhauen; sie hat um Hilfe gerufen.
Es blieb an mir hängen, dem Betrunkenen das Handgelenk umzudrehen – er hatte ein Messer von einem Käseteller gegriffen und war drauf und dran, es der Frau in den Bauch zu jagen. Ich habe ihn bis zur Tür auf den Gang gestoßen, und die habe ich hinter ihm zugemacht, länger als eine halbe Stunde hat er dagegen geklopft und geschrien: »Komm heraus, du Zuhälter!«
Auf der Stelle wurde die Lehrerin hinausgeworfen. »Seit zwei Wochen hat sie immerhin gut bezahlt«, hat die Vermieterin mit einem Anflug von Bedauern gesagt. Und nur die Turteltauben lieben einander jetzt noch und hinterlassen ihren Dreck vor meinem Fenster, denn vor dem andern finden sie kein Brot mehr.
Trotzdem komme ich mit der Arbeit kaum voran. Es ist zu eisig in meinem Zimmer, und es dauert ewig, bis der Steinkohlehaufen brennt! Schlotternd zünde ich ein Streichholz nach dem andern an, und wenn ich mir ein Herz nehme und mich ohne Feuer im Kamin an den Tisch setze, wächst das Zittern, und die Gedanken verziehen sich.
Ich habe lange überlegt. Ich bin zur Bibliothek Sainte-Geneviève gelaufen und habe in den Büchern nach Anzündeverfahren gesucht, die mir die endlosen Versuche in der Morgenfrische, im Hemd und barfuß, vor einem Ofen voller Rauch und ohne Flammen ersparen würden.
Aber ich habe keins gefunden, und der Wind kommt von Norden. Seit acht Tagen mache ich mir nur noch Notizen und strecke dabei kaum die Arme unter der Bettdecke hervor.
Ich habe versucht, in der Bibliothek zu schreiben. Zu Hause war es zu kalt, aber da ist es mir zu heiß. In dieser drückenden, feuchten Luft werden meine Gedanken schlaff und farblos wie rotes Fleisch auf dem Grunde des Schmortopfes, und ich nicke über meinem weißen Papier ein. Ein Invalide hat mich gerade unverschämt aufgeweckt.
Werde ich mein Buch also nicht vor dem Frühling in Angriff nehmen können?
Das wollen wir ja sehen! Lieber mache ich Bankrott! Ich verlasse soeben das Haus Dulamon und Co., in das ein ehemaliger Kollege meines Vaters mich eingeführt hat, er verkauft den Kindern Latein.
Wir sind über einen Hausrock mit Kapuze, Kordel und Schleppe aus klösterlichem Tuch handelseinig geworden. In einer Woche soll er mir geliefert werden, für die Hälfte des vereinbarten Preises, die andere Hälfte soll am Ende des nächsten Monats gezahlt werden. Im Ganzen immerhin sechzig Francs.
Bis zum Empfang faulenze ich.
Das ist er!
»Da sind Ihre dreißig Francs!«
Der Mann hat sie eingesteckt und sich davongemacht. Und ich mache es mir in meiner Wollkutte bequem.
Ah! Du Bürger, der du sie zugeschnitten, du Händler, der du sie verkauft hast, ihr wisst nicht, was ihr da gemacht habt! Ihr habt gerade der Wache einer Armee, die euch noch harte Zeiten bescheren wird, zu einem Schilderhaus verholfen!
Wenn dieser Wollrock nicht geschneidert worden wäre, hätte ich vielleicht angesichts des schwarzen Ofens das Weite gesucht, wäre aus meiner eisigen Zelle geflohen, hätte die Flinte ins Korn geworfen – ich hätte mein Buch nicht geschrieben!
Der Tag des Zahlungstermins kommt näher! Es ist der 22., am 30. ist es so weit!
Es passte mir gut, dass es ein Sonntag war und ich nicht ins Büro ging, da konnte ich letzte Hand an mein Werk legen, fertig abschreiben.
Schnell noch mal überlesen! … Schere, Klammern her! Hier muss geschnitten, da zusammengeheftet werden!
Ich habe überall Tinte verkleckert. Ganze Passagen sehen aus wie schwarze Binden überm Auge, oder wie blaue Pflaster auf dem Bauchnabel! Ich habe mich mit der Schere geschnitten, mit der Nadel gestochen; Bluttröpfchen bedeckten die Seiten – es könnten die Memoiren eines mörderischen Lumpensammlers sein!
Denn der Händler wird nicht warten! Er wird mich auf dem Bürgermeisteramt aufstöbern, meine Rechnung vorzeigen, herumschreien, und dann werde ich entlassen. Ich bin jetzt nämlich Beamter und muss meiner Unterschrift Ehre machen, sonst kompromittiere ich die Regierung, die mir nicht fünfzehnhundert Francs im Jahr zahlt, damit ich das Leben eines Bohémiens führe.
Es ist drei Uhr. Die Vesper wird eingeläutet. Im Haus ist nichts zu hören – außer dem Husten eines Schwindsüchtigen, der seinen letzten Lungenlappen ausspuckt. Mein Gott! Ist es furchtbar, ein Niemand, arm und einsam zu sein!
Ein Viertel, einhalb!
Ich war mit der Hand über den Augen stehen geblieben, damit sie nicht tränten. Aber jetzt ist nicht die Zeit zum Träumen. Und die Schulden!
Jetzt heißt es, sich zum Chefredakteur des FIGARO zu begeben, in sein Heim einzudringen. Man trifft ihn in der Woche in der Zeitung, am Eingang zum Büro nicht an; einem Unbekannten zudem hört keiner dort zu. Wird er mich empfangen?
Hat er heute nicht seinen Ruhetag? Es heißt, dass er seine Kinder liebt und sie in Ruhe herzen will, ohne in diesen vierundzwanzig Stunden belästigt zu werden.
Ah! Versuchen wir’s!
Wie mir die Beine schlottern, als ich die Treppe hinaufsteige! Ich klingle.
»Ich möchte zu Herrn Villemessant.«
»Er ist nicht da. Herr Villemessant ist seit einer Woche auf dem Land und wird erst in vierzehn Tagen wiederkommen.«
Weg! … Dann bin ich verloren!
Das Mädchen hat mir wahrscheinlich die Verzweiflung vom Gesicht abgelesen.
Sie sieht auch das Ende meines zusammengerollten, zerdrückten Manuskripts, das sich in meiner Tasche wie vor Schmerzen windet.
Sie macht die Tür noch nicht zu und entschließt sich, mir mitzuteilen, dass statt Herrn Villemessant sein Schwiegersohn zu Hause sei und dass sie meinen Namen melden wolle, wenn ich ihn ihr sagte, dass sie auch übergeben wollte, was ich da mit mir trüge.
Während sie das sagt, zwinkert sie zu meinem Artikel hin, der mit den Nadeln, die ihn zusammenhalten, aussieht wie ein Igel. Ich ziehe ihn heraus und sage ihr, sie soll ihn beim Bauch greifen, damit sie sich nicht sticht. Sie lacht verständnisvoll und geht – mit ausgestrecktem Arm trägt sie ihn.
Sie lassen mich wenigstens eine Viertelstunde allein. Endlich geht die Tür auf:
»Aber ihre Abschrift beißt ja, lieber Herr!«, sagt ein dicker kahlköpfiger Mann und schüttelt seine Wurstfinger.
Ich entschuldige mich stammelnd:
»Macht nichts! Ich habe den Titel angesehen, ich habe zehn Zeilen gelesen, er wird das Publikum auch beißen! Wir werden das veröffentlichen, junger Mann! Allerdings müssen sie ein bisschen warten; es ist verteufelt lang!«
Warten? Mein Gott, ich erkläre ihm, dass ich nicht warten kann.
»Ich habe eine Spielschuld zu begleichen, darum habe ich es gewagt, direkt hierher zu kommen …«
»So, so! Sie riskieren also die Pikdame? Ziehen Sie fünf?« Ich weiß nicht, was das ist, »fünf ziehen«, aber ich muss irgendetwas antworten, also sage ich mit dumpfer Stimme:
»Ja, ich ziehe fünf.«
»Heiliger Strohsack! Sie haben einen gesunden Magen!« Allzu wahr! Ich habe es oft zu spüren bekommen, vor allem, als ich jung war.
»Da, ein Wort für den Kassierer. Überreichen Sie es ihm morgen, er wird Ihnen hundert Francs aushändigen. Das ist das Spitzenhonorar, aber Ihr Artikel hat Schmiss! Auf Wiedersehen!«
Schmiss? … Vielleicht!
Obwohl es an der Sorbonne so gelehrt wird, habe ich nicht darauf geachtet, ob das, was ich schrieb, auch war wie Pascal oder Marmontel, wie Juvenal oder Paul-Louis Courier, Saint-Simon oder Sainte-Beuve, ich habe weder den bildhaften Ausdrücken gehuldigt noch Sprachschöpfungen ängstlich gemieden, ich habe nicht nach nestorianischer Anordnung Beweise zusammengehäuft.
Ich habe Stücke aus meinem Leben genommen und sie mit Stücken aus dem Leben anderer zusammengeflickt, ich habe gelacht, wenn ich Lust hatte, und mit den Zähnen geknirscht, wenn die Erinnerung an Demütigungen mir das Fleisch von den Knochen geschabt hat – wie das Messer das Fleisch vom Kotelettknochen, während das Blut herunterpisst.
Aber ich habe einem Bataillon junger Menschen die Würde bewahrt, die alle Murgers Leben der Bohème gelesen haben und an so eine unbekümmert rosige Existenz glaubten, die armen Narren, ich habe ihnen die Wahrheit ins Gesicht geschrien!
Wenn sie dieses Leben trotzdem noch ausprobieren wollen, dann taugen sie nur für den Sumpf der Pinten, oder als Freiwild fürs Mazas! Wenn sie dreißig sind, wird Selbstmord oder Wahnsinn sie beim Kragen schnappen, ein Hospiz- oder ein Gefangenenwärter, sie werden frühzeitig sterben oder entehrt sein.
Ich werde nicht um sie weinen, denn ich habe den Verband von meinen Wunden gerissen, um ihnen zu zeigen, was für ein Loch zehn Jahre verlorener Jugend im Herzen eines Mannes hinterlassen!
IV
Öffentliche Lesungen sind groß in Mode: Im Casino-Cadet soll Beauvallet1Hemani2 lesen.
Feierliche Veranstaltung! Great attraction! Es ist ein Protest gegen das Kaiserreich und eine Ehrung für den Dichter der Châtiments3.
Aber wie im Zirkus brauchen sie einen minderbegabten Künstler, einen Clown, einen Affen, so einen, der nach der großen Darbietung in der Arena bleibt, während die Leute ihre Hüte ergreifen und nach den Wagen rufen.
Man hat mir angeboten, dass ich den Affen spiele: Ich habe angenommen.
Durch welchen Reifen soll ich springen? Ich biete etwas unter dem Titel Balzac und sein Werk an.
Die Geschichten von Rastignac, Séchard, Rubempré haben sich mir ins Hirn gegraben. Die Comédie Humaine ist weithin ein Drama vom Leben in Not – Brot oder Frack werden auf Kredit oder Raten zusammengekratzt –, vom Fieber des Hungers oder dem Schaudern vor dem Seufzer-Papier. Unmöglich, dass mir beim Sprechen von diesen Helden, meinen Brüdern im Ehrgeiz und in der Verzweiflung, nichts Packendes einfallen sollte!
Der Tag der Darbietung ist da – die Namen des Meisters und des Affen kleben auf dem Plakat.
Es wird voll werden. Die alten Bärte von 48 werden erscheinen und sich Bonaparte entgegensträuben, wann immer ein Vers eine republikanische Anspielung enthält. Auch die junge Opposition wird kommen: Journalisten, Advokaten, Blaustrümpfe, die den Kaiser, wenn er in ihre rosigen Krallen fiele, mit ihrem Strumpfband erdrosseln würden und die die Hüte aufhaben, die sie sonntags in die Schlacht tragen.
Aber ich sehe von Weitem, wie sie sich vor dem Eingang zum Grand-Orient um einen Mann drängeln, der einen frischen Streifen über das Plakat klebt. Was geht vor?
Die Lesung von Hugos Drama ist verboten worden, und die Veranstalter geben bekannt, dass Hernani durch den Cid4 ersetzt wird.
Viele gehen wieder, nachdem sie verächtlich meine vier Silben buchstabiert haben … die ihnen nichts sagen.
»Jacques Vingtras?«
»Kenne ich nicht.«
Keiner kennt ihn, außer ein paar Leuten von der Presse und den Kameraden aus unserm Café, die extra gekommen sind und bleiben, um zu sehen, wie ich mich aus der Affäre ziehe, sie hoffen auf einen Reinfall oder einen Skandal.
Ich lasse die Alexandriner hinter mir und gehe in die nächste Kneipe abwarten.
»Du bist dran! Jetzt kommst du!«
Ich habe gerade noch Zeit, die Treppen hinaufzusteigen.
»Sie sind dran!«
Ich durchquere den Saal; da stehe ich auf der Tribüne. Ich lasse mir Zeit, lege meinen Hut auf einen Stuhl, werfe meinen Mantel auf ein Klavier hinter mir, ziehe langsam die Handschuhe aus, rühre mit der Wichtigkeit eines Zauberers, der aus dem Kaffeesatz liest, im Glas mit Zuckerwasser. Dann fange ich an und bin nicht aufgeregter, als wenn ich im Café bramarbasiere:
»Meine Damen, meine Herren!«