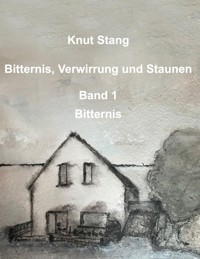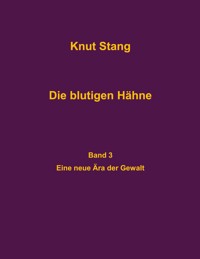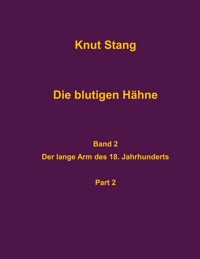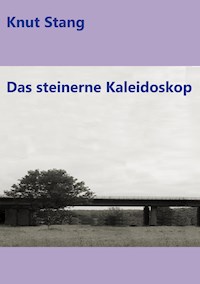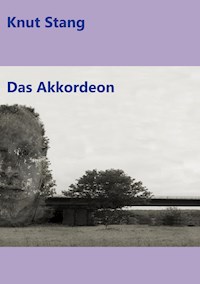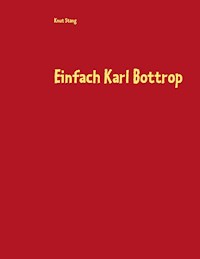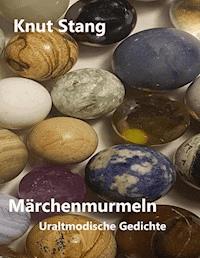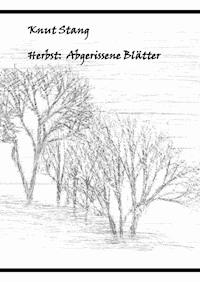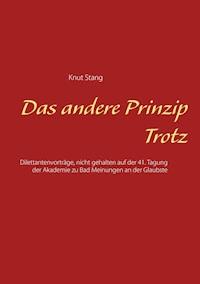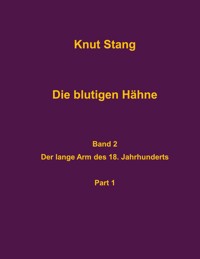
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im zweiten Band der aktuellen Dilettantenvorträge nehmen das 18. und 19. Jahrhundert einen besonderen Raum ein. Der erste Teil des zweiten Bands fokussiert dabei auf die Geschichte der Teilungen Polen-Litauens und des von der britischen Seite verübten Genozids durch Unterlassen im Irland des 19. Jahrhunderts. Auf beide Themen werde neuartige Sichtweisen angewendet, was neue Einsichten in diese scheinbar gut erforschten Themen ermöglicht. So wird die gängige Erklärung einer angeblichen Schwäche Polen-Litauens im Vorfeld der Teilungen als demokratiefeindliche Propaganda des 19. Jahrhunderts und als exkulpatorischer Mythos entlarvt. Ebenso wird klar, dass der Rückgang der irischen Bevölkerung von ca. acht auf fünf Millionen Menschen während des Great Famine 1845 bis 1849 nicht einfach eine schreckliche Katastrophe war. Sondern die britische Besatzungsmacht und die meist englischen Grundbesitzer in Irland zielten explizit darauf, die irische Bevölkerung wenigstens zu dezimieren und in vielen Gegenden auch ganz auszurotten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Beiträge zu Herrschaft, Legitimation und Kooperation
Dilettantenvorträge, gehalten auf der 43. Tagung der Akademie zu Bad Meinungen an der Glaubste
Inhalt
1. Jean-Claude Bondrit: Einleitung dieses Teilbands
2. Tirzia Ehlen: Friedrich II. und der Diebstahl von Schlesien
3. Karsten Ahldner: Ein Fest für Raubritter: Die Zerteilung Polen-Litauens ab 1791
4. Detlev Althofen: Die Koalitionskriege gegen Frankreich ab 1793
5. Arlt Neeskens: Zwischenfazit
6. Sully Lanskin: To Hell or to Connacht: Britische Okkupationspolitik in Irland
1. Jean-Claude Bondrit: Einleitung dieses Teilbands
Jean-Claude Bondrit ist seit vielen Jahren Mitglieder der Akademie, auch wenn seine Verpflichtungen als EU-Kommissar für Menschenrechte ihn in den vergangenen zwölf Jahren immer wieder stark anderweitig beansprucht haben. Nun aber verdienstvollerweise in den Ruhestand getreten, hat er die schwierige Aufgabe übernommen, die nachfolgenden Beiträge zu einer unkonventionellen Sicht auf das 18. und 19. Jahrhundert mit einer Einleitung zu versehen, die vielleicht helfen kann, den Gesamtzusammenhang dieser hier nur scheinbar zufällig zusammengekommenen Beiträge besser zu verstehen.
In den nachfolgenden Ausführungen geht es um Barbarei. Barbarei, genauer gesagt, auf höchstem, auf staatlichem Niveau. Dass man das nur selten so bezeichnet, ändert nichts an der Tatsache, dass es sich um genau dies handelt.
Barbaros heißt auf Griechisch “Stotterer”. Das ist hier nicht gemeint. Gemeint sind auch nicht Leute, die Kartoffeln mit dem Messer schneiden, bei Jazzkonzerten im Takt mitklatschen wollen oder den BigMac für den Höhepunkt westeuropäischer Kochkunst halten.
Die griechische Antike bezeichnete als Barbaren jene, welche die Regeln der Sprache nicht oder nur rudimentär kannten, im weiteren Sinne aber auch jene, denen diese Regeln einfach nur egal waren und die nach Gutdünken mit der Sprache, aber dann auch mit anderen Kulturgütern verfuhren. Entsprechend gemeint sind nachfolgend Leute, Politiker, Staaten, die kurzerhand das Völkerrecht, welches sich fragil und mühselig über zweihundert Jahre in Europa etabliert hat, auf den Müllhaufen der Geschichte werfen und stattdessen den Primat der Gewalt vor allen anderen Legitimationen durchsetzen wollen. Das sind Menschen, die man zu Recht als Barbaren bezeichnen darf, da ihre Unkenntnis oder Gleichgültigkeit gegenüber diesen gegen viele Widerstände errungenen internationalen Konventionen keinen anderen Begriff verdient.
An solchen unverhohlen gewalthaften Exzessen ist die Geschichte, darunter auch die europäische Geschichte, natürlich ausgesprochen reich. Aber spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg haben viele Menschen in Europa geglaubt, mindestens in ihrem eigenen behüteten Lebensbereich seien diese Zeiten ein- für allemal vorbei, dass jemand einfach losgeht und andere Staaten überfällt. Überfällt mit dem klaren Ziel, sich einen Teil des überfallenen Staats oder sogar die Gesamtheit desselben einzuverleiben.
Insofern markiert der russische Überfall auf die Ukraine, offiziell beginnend am 24.02.2022, eine erhebliche Zäsur der europäischen Geschichte. Dies wird umso deutlicher, wenn man sich noch einmal vor Augen führt, dass ein dem Völkerrecht so gleichgültiges Verhalten jedenfalls in Europa inzwischen eher selten vorkommt und sich häufig mit bestimmten Personen verbinden lässt. Hier fällt den meisten natürlich zunächst Adolf Hitler und die deutsche Außenpolitik seit dem Einmarsch ins Rheinland am 07.03.1936 ein. Man könnte aber bis in die Antike oder dann zu Hunnen, Franken, Arabern und Mongolen zurückgehen. Vielleicht genügt es jedoch, im 18. Jahrhundert anzusetzen, als das heute geltende Völkerrecht in wesentlichen Teilen bereits formuliert war.
Dabei sind Konflikte nicht von Interesse, die nicht von vornherein mit einem unverblümten Eroberungsziel begonnen wurden. Der Krieg Brandenburg-Preußens und seiner Verbündeten gegen Frankreich von 1870, der mit der Okkupation des Elsass und Lothringens endete, gehört hierher also ebenso wenig wie der Erste Weltkrieg mit seinen umfangreichen Gebietsverlusten seitens Deutschlands, Österreichs und der Türkei. Denn diese Kriege wie viele andere begannen aus einer anderen Motivation heraus. Die Okkupationen an ihrem Ende waren eher Teil des Versuchs, eine neue Friedensordnung herzustellen und zugleich eine gewisse Kompensation der Kriegskosten wenigstens auf Seiten der Sieger zu erreichen.
Es gab aber, beginnend im 18. Jahrhundert, eine deutlich längere Phase der europäischen Geschichte, welche von einer weitgehenden Gleichgültigkeit der europäischen Mächte gegenüber dem Völkerrecht und einem danach erst wieder von Hitler an den Tag gelegten Willen zur Eroberung ganzer Staaten gekennzeichnet war. Es war dies jene Epoche, die mit dem Überfall Friedrichs II. auf Schlesien begann und mit der endgültigen Niederlage Napoleons bei Waterloo endete. Und diese Phase lehrt bei genauerem Hinsehen, dass es letztlich nur zwei Alternativen gibt: Beachtung des Völkerrechts oder Rückkehr zu einer Epoche, in der nur das Recht des Stärkeren entscheidet. Den Preis für Letzteres zahlen nicht nur die kleinen und mittleren Staaten, nicht nur die Menschen, die auf den dann unausweichlichen Schlachtfeldern zugrunde gehen. Den Preis zahlen am Ende alle, und auch für die Sieger ist dieser in der Regel zu hoch. Vor allem aber legt jeder Krieg schon die Saat des nächsten, und wer heute Sieger ist, wird im nächsten Krieg annähernd unausweichlich der Verlierer sein.
Die folgenden Beiträge werden zeigen, dass viel von dem, was das 18. Jahrhundert auf weite Strecken geprägt hat, nicht nur einfach noch in unseren Tagen wieder und wieder kopiert wird. Sondern besonders die vier Beiträge zur Geschichte der USA werden deutlich machen, dass aus den im 18. Jahrhundert erfolgten Setzungen eine fast bruchlose Evolution bis zu den Problemen unserer Tage rekonstruiert werden kann. Das heißt zwar nicht, dass man eine Zeitreise unternehmen müsste, um diese Probleme zu lösen. Aber man versteht sie deutlich besser, wenn man ihre Herkunft aus Ereignissen schon des 18. Jahrhunderts begreift.
Nachbemerkung vor der Drucklegung: Barbarei ist selten geworden, sagt man. Das ist jedenfalls mit Blick auf die Beiträge dieses Teilbands, erst recht aber auch unsere Gegenwart eine zweifelhafte Haltung. Mindestens an diesem zweiten Tag unserer Tagung sind so viele interessante Themen zusammengekommen, dass Verlag und Herausgeber sich zu einer weiteren Aufteilung genötigt sahen. Dies wurde auch deshalb nötig, weil mehrere Beiträge im Nachgang und vor allem aufgrund der sich an sie anschließenden Diskussion noch einmal deutlich erweitert worden sind. Das ist der Grund, warum z.B. der Beitrag von Karsten Ahldner in seiner jetzigen Form mit Sicherheit ganz allein einen Tagungstag problemlos hätte füllen können, ebenso die Ausführungen von Sully Lanskin. Aber beide Beiträge beinhalten auch und gerade in ihrer erweiterten Form so wichtige Anregungen zu einem veränderten Verständnis der polnisch-litauischen bzw. der irischen Geschichte im 18. und 19. Jahrhundert, dass wir sie für unverzichtbar gehalten haben. Wir bitten Sie also, liebe Leser, uns die Länge dieser und einiger der folgenden Beiträge nachzusehen. Um Nachsicht für mangelnden Relevanz und Kurzweiligkeit an dieser Stelle zu bitten, sehen wir jedenfalls aus unserer Perspektive hingegen keine Notwendigkeit.
2. Tirzia Ehlen: Friedrich II. und der Diebstahl von Schlesien
Tirzia Ehlen hat lange in Brüssel und Straßburg an der Seite von Jean-Claude Bondrit gearbeitet. Als er sie daher gebeten hat, hier einen Blick auf Friedrich II. und seine Wegnahme Schlesiens zu richten, hat sie gleich zugestimmt. Sie hat dafür sogar das sonnige Barcelona, wo sie aktuell für Amnesty International tätig ist, für ein paar Tage gegen Bad Meinungen eingetauscht. Ihr Blick auf den Preußenkönig ist vor allem deswegen so erfrischend wie erhellend, weil sie gänzlich unbekümmert all die Weihrauchschwaden wegpustet, mit denen man insbesondere in Deutschland eine nüchterne, klare Sicht auf Friedrich II. unmöglich zu machen versucht.
2.1. Ein jugendlicher Dieb, ein greiser Räuberhauptmann
Als Friedrich II. am 08.11.1740 seine Armee gegen Schlesien in Marsch setzte, berief er sich auf eine mehr oder weniger windige Rechtfertigung, indem er auf die zweihundert Jahre alte Liegnitzer Erbverbrüderung zurückgriff.1 Es gab auch Bündnisse mit diversen Staaten, denen ebenfalls an einer Schwächung der Habsburger gelegen war. Aber im Grunde war Friedrich schlicht ausgezogen, um ein schönes Stück Land aus dem österreichischen Kuchen herauszusäbeln, welches zudem formidabel zu Preußen gelegen war. Er tat dies in der festen Überzeugung, dass Österreich-Ungarn zu geschwächt war, um ihm hinreichenden Widerstand entgegen zu setzen. Ganz falsch war das nicht, da nach dem Tod Karls VI. am 20.10.1740 die Pragmatische Sanktion von 1713 von einigen Staaten, vor allem von Bayern und Sachsen in Frage gestellt wurde. Jene hatte primär festgelegt, dass die habsburgischen Erbkönigreiche unteilbar zu vererben seien. Zudem hatte man hier, lange bevor Karl VI. die Hoffnung auf einen männlichen Erben aufgeben musste, festgelegt, dass nach Aussterben aller männlichen Nachfahren auch eine Nachfahrin erbberechtigt sei. Dies entsprach dem Bemühen, den spätmittelalterlichen imperialen Anspruch und die moderne Territorialstaatlichkeit noch einmal zu verklammern, auch wenn allen klar war, dass ein so anachronistisches Konstrukt nicht mehr ewig würde überdauern können.2
Friedrich II. bestritt die Gültigkeit der Pragmatischen Sanktion nicht, obgleich diese natürlich seinem Rückgriff auf die Liegnitzer Erbverbrüderung widersprach. Sein Vater hatte aber bereits 1726 die Pragmatische Sanktion anerkannt. Friedrich II. hoffte nun, dass Maria Theresia durch den Konflikt um ihre Erbberechtigung sich als hinreichend gebunden erweisen würde.
Was Friedrich sich im Ersten Schlesischen Krieg gestohlen hatte, musste er freilich in zwei weiteren Kriegen behaupten. Den Zweiten Schlesischen Krieg betrachtete er als Präventivkrieg, um einer drohenden Offensive Maria Theresias zuvorzukommen. Daher rückte er durch Sachsen ab dem 10.08.1744 gegen Böhmen vor. Nach der Einnahme von Prag am 16.09.1744 fand sich Friedrich aber einer hinhaltenden Kriegführung Österreich-Ungarns ausgesetzt. Nachdem Österreich-Ungarn am 08.01.1745 mit Großbritannien, Sachsen und den Niederlanden die Quadrupelallianz geschlossen hatte, war Friedrich zum Rückzug nach Schlesien gezwungen.
In den nächsten Monaten vermochte er aber infolge mehrerer unerwartet gewonnener Schlachten, vor allem bei Hohenfriedberg am 04.06.1745 und bei Kesselsdorf am 15.12.1745, seine Beute aus dem Frieden von Berlin vom Juli 1742 zu behaupten. Dies wurde am 25.12.1745 durch den Dresdener Frieden bestätigt.
In der Folgezeit kam es aber zur Verlagerung der Bündnislage in Europa, was vorwiegend mit dem sich verschärfenden Konflikt zwischen Frankreich und Großbritannien um die Vorherrschaft in Indien und in Nordamerika erklärt werden kann. In diesem „Renversement des alliances“ wendete Friedrich sich gegen seine bisherige Politik der britischen Seite zu, während Frankreich die traditionelle Konkurrenz mit Österreich-Ungarn überwand.
Das änderte die Ausgangslage des dritten Krieges um den Besitz von Schlesien, den Siebenjährigen Krieg. Friedrich begann diesen Krieg am 17.08.1756. Wieder unternahm er einen Angriff auf Österreich-Ungarn, nach eigenem Verständnis, um einer von dort geführten Offensive zuvorzukommen. Er zahlte aber in der Folge für diese erneute Verteidigung seiner Beute einen immensen Preis: die Verwüstung eines großen Teils seines Landes, wenigstens eine halbe Million Tote, darunter 180.000 Soldaten und 320.000 Zivilisten, eine unbekannte Zahl von Verkrüppelten, Traumatisierten usw., eine massive Wirtschaftskrise und ein lange anhaltender Vertrauensverlust in die heimische Währung aufgrund der von Friedrich hemmungslos praktizierten Münzverschlechterung. Und das alles in einem Krieg, der eigentlich nur ein Nebenkriegsschauplatz der Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und Großbritannien um ihre Territorien in Indien und Nordamerika war. Doch für Brandenburg-Preußen bedeutete er beinah die völlige Vernichtung.
Dennoch war Friedrichs Raubzug vom November 1740 insgesamt eine Erfolgsgeschichte. Brandenburg-Preußen wurde jetzt zu den europäischen Großmächten gerechnet. Friedrich war infolgedessen einer derjenigen, die von der Polnischen Teilung, dem nächsten gänzlich rechtswidrigen Beutezug, in erheblichem Umfang profitierte. Bis dahin konnte er sich auf seiner Beute ausruhen und das Land wieder aufbauen, das er fast in den Ruin geführt hatte. Dieses „Rétablissement“ griff auf die Wiederaufbaupolitik zurück, mit welcher Friedrichs Vater die Folgen des Großen Nordischen Kriegs vor allem im preußischen Teil Litauens und in Ostpreußen nach 1721 zu überwinden versucht hatte. Friedrich stellte nun 60.000 Mann seiner Armee auf fünf Jahre für die Landarbeit ab, auch intensivierte er die Wirtschaftskraft seiner Länder durch Straßen- und Kanalbau. Vor allem reduzierte er die Folgen seiner Münzverschlechterung der Kriegsjahre, sodass das Vertrauen in die brandenburgische Münze wieder wuchs. Er zwang die zögernden Bauern, den Kartoffelanbau aufzunehmen, und nicht zuletzt errichtete er eine staatliche Kontrolle des Getreidehandels. Das half Preußen auch, die Hungersnot von 1771 halbwegs zu überstehen. Zugleich aber sah Friedrich sich zu keinem Zeitpunkt genötigt, die durch seine Raubzüge ebenfalls erheblich verwüsteten anderen Staaten auch nur innerhalb des Reichs, vor allem Sachsen, in irgendeiner Weise schadlos zu halten.3 Ein wirkliches Unrechtsbewusstsein kann man hier insgesamt also ausschließen, einigen launigen Bemerkungen des Königs zum Trotz.
2.2. Auf dem Weg zur Großmacht: Brandenburg-Preußen nach dem Ende des Siebenjährigen Kriegs
Das Ende des Siebenjährigen Kriegs hatte das Gleichgewicht in ganz Europa auf Dauer verschoben. Großbritannien hatte Frankreich besiegt und ihm wesentliche Teile seines Kolonialreichs abgenommen, was Frankreichs Einfluss auch innerhalb Europas reduzierte. Zudem stand Frankreich am Rand eines Staatsbankrotts, was knapp drei Jahrzehnte später eine der wesentlichen Ursachen für die Französische Revolution werden sollte. Großbritannien wiederum sperrte große Teile der von ihm kontrollierten Regionen Nordamerikas für die Besiedlung durch Europäer, was in Teilen der Kolonien zu erheblichem Unmut führte. Als man dann versuchte, die Kosten des Krieges wenigstens teilweise über Steuern in diesen Kolonien gegenzufinanzieren, war dies der Auslöser der Abspaltung von dreizehn dieser Kolonien vom britischen Mutterland.
Brandenburg-Preußen hingegen wurde jetzt allgemein als Großmacht akzeptiert, was zum einen eine innerdeutsche Konkurrenz mit Österreich-Ungarn beförderte. Zugleich aber sorgte das auch dafür, dass Brandenburg-Preußen sich ein gutes Stück aus der polnisch-litauischen Beute sichern konnte, als 1772 die vor allem von Friedrich II. und der katholischen Kirche betriebene erste Teilung Polen-Litauens gegen alles Völkerrecht vollzogen wurde. Auch bei der zweiten Teilung 1793 und der dritten Teilung 1795 war Brandenburg-Preußen neben Russland und Österreich-Ungarn einer der Nutznießer. Zwar kam es bald darauf zu den Niederlagen gegen das napoleonische Frankreich und einen zeitweiligen Niedergang Brandenburg-Preußens. Aber letztlich schufen Friedrichs II. Erfolgs in den drei Kriegen um Gewinn und Erhalt Schlesiens die Basis einer Dominanz in Deutschland. Als 1871 Preußen Teil des neu gegründeten Deutschen Reichs wurde, hatte es 1866 in Königgrätz und 1871 bei Sedan eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass es im Geiste Friedrichs II. das Völkerrecht ignorieren und glänzende militärische Erfolge zu erzielen mochte.
2.3. Friedrich II. als gesamtdeutscher Mythos
Dass man einen skrupellosen Raubritter und Hasardeur wie Friedrich in den Jahrzehnten nach seinem Tod vor allem in Deutschland zunehmend glorifizierte, zeigt, dass in weiten Kreisen völkerrechtliche Bedenken keine nennenswerte Rolle spielten.4 Natürlich sind Sieger immer deutlich populärer als Verlierer. Und die deutsche, vor allem aber die preußische Seele konnte nach den katastrophalen Feldzügen gegen Frankreich seit 1792 sicher auch ein wenig Trost mit Blick auf frühere, glorreiche Zeiten vertragen. Dazu gehörte auch die ermutigende Einsicht, dass gelegentlich in vollkommen aussichtsloser Lage höchst unvorhergesehene Ereignisse dann doch noch eine Wendung herbeiführen können. So wie 1762 der bereits am Boden liegende brandenburgisch-preußische Aggressor nur dadurch noch gerettet wurde, dass die russische Kaiserin Elisabeth Ende 1761 starb und ihr Nachfolger, ihr in Kiel aufgewachsener Neffe Pjotr III (Peter III.), zu den Verehrern des Preußenkönigs gehörte und daher den Krieg umgehend beendete.5 Schon kurz darauf ließ seine Frau ihn entmachten und wahrscheinlich auch umbringen, um als Jekaterina II (Katherina II.) die Herrschaft zu übernehmen. Da hätte es trotz aller Sympathien, welche auch die neue Kaiserin für ihn empfand, für Friedrich II. wahrscheinlich keine Rettung mehr gegeben. Seine Raubzüge, das anschließende Rétablissement und die Okkupation eines wesentlichen Teil Polen-Litauens wurden als seine persönlichen Erfolge deklariert. Hinzu kamen die wohlfeilen Legenden um den Philosophen, den Künstler, den Aufklärer auf dem Königsthron. Dies alles zusammen machte ihn zum bis heute populärsten Preußenkönig und zu einem der beliebtesten Fürsten der deutschen Geschichte überhaupt.
2.4. Literatur
Aretin, Karl Otmar von: Friedrich der Große: Größe und Grenzen des Preussenkönigs: Bilder und Gegenbilder, Freiburg im Breisgau (Herder) 1985
Barsewisch, Bernhard von: Die frühe Friedrich-Verehrung, Wolfhagen (Selbstverlag) 2012
Evans, Robert John Weston: Communicating Empire: The Habsburgs and Their Critics, 1700-1919, in: Transactions of the Royal Historical
Society, Sixth Series, Vol. 19/2009, S. 117-138 Walther, Gerrit: Staatenkonkurrenz und Vernunft: Europa 1648 - 1789, München (C. H. Beck) 2021, S. 231-232
Wittram, Reinhard: Das russische Imperium und sein Gestaltwandel, in: Historische Zeitschrift, Nr. 187.3/1959, S. 568–593
1 Die Erbverbrüderung hatte Friedrichs Namensvetter, Friedrich II. von Liegnitz, 1537 mit seinen brandenburgischen Verwandten geschlossen. Sie machte diese erbberechtigt, sollten Friedrichs Nachkommen in der männlichen Linie aussterben. Der Familienvertrag war aber bereits 1546 auf dem Breslauer Fürstentag von den schlesischen Ständen und dem böhmischen König und späteren Kaiser Ferdinand I. annulliert worden.
2 Evans: Communicating Empire, S. 119.
3 Walther: Staatenkonkurrenz, S. 231-232.
4 Ähnlich die Einschätzung bei vielen jüngeren Biografen; grundlegend vor allem Aretin: Friedrich der Große, S. 150-152. Vgl. auch Barsewisch: Friedrich-Verehrung, S. 11.
5 Es ist üblich, die russischen Herrscher als Zaren zu bezeichnen. Pjotr I hatte diesen Titel allerdings durch „Imperator“ ersetzt, was als „Kaiser“ übersetzt werden sollte. Dass man in Westeuropa weiterhin den traditionellen, religiös befrachteten Titel verwendete, ist ein Hinweis darauf, dass man den mit Pjotr I verbundenen politischen und kulturellen Umbruch so weit wie möglich zu ignorieren gesonnen war; Wittram: Imperium, S. 569. Das machte es leichter, Russland weiterhin als Hort westasiatischer Rückständigkeit darzustellen. Etwaige Vergleiche zu deutschen, österreichischen, britischen oder französischen Imperatoren wurden so vermieden. Im Folgenden wird hingegen für die russischen Herrscher des 18. Jahrhunderts der Titel „Kaiser“ bzw. „Kaiserin“ verwendet. Pjotr I selbst, der zunächst noch als „Zar“ figurierte, wird ebenfalls als „Kaiser“ bezeichnet.
3. Karsten Ahldner: Ein Fest für Raubritter: Die Zerteilung Polen-Litauens ab 1791
Karsten Ahldner hat in jungen Jahren Deutsch und Geschichte studiert. Ganz fachfremd ist er also nicht, wenn er im Folgenden einige Gedanken zur Geschichte der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert darlegt. Aber da er, wie viele von Ihnen sicher hier und da schon einmal erlebt haben, seit mehreren Jahrzehnten als Kabarettist und Bauchredner seine Erfolge feiert, hat es uns umso mehr gefreut, dass er sich im Rahmen der Akademie-Tagung einmal wieder in die Gewässer der nüchternen Geschichtswissenschaft begeben hat. Ob dabei seine satirische Zunge gelegentlich durchklingt, bitten wir demgemäß jeden Leser selbst zu beurteilen. Die seinem Vortrag folgende Diskussion hat jedenfalls gezeigt, dass insbesondere seine Anmerkungen zu Friedrich II. und seine Beschreibung der Ersten Polnischen Teilung nicht gänzlich ohne Widerspruch geblieben sind.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleg_Innen,
Tirzia Ehlen hat soeben knapp, aber sehr treffend über Friedrich II. als vollkommen rechtswidrigen Nutznießer der Zerteilungen Polen-Litauens gesprochen. Ich möchte dies zum Anlass nehmen, Vorgeschichte, Gründe und Verlauf dieses vielleicht größten Bruchs des Völkerrechts in der jüngeren europäischen Geschichte ein wenig näher zu beleuchten.
3.1. Die Entstehung der polnisch-litauischen Adelsdemokratie
Die eben erwähnte Zerteilung Polen-Litauens stellte einen weiteren eklatanten Bruch des ohnehin fragilen völkerrechtlichen Grundkonsens des 18. Jahrhunderts dar. Ein Bruch freilich, der anders als Friedrichs Überfall auf Schlesien schon den Zeitgenossen offensichtlich so ungeheuerlich erschien, dass sie ihn mit allerlei Mythen und Legenden zu rechtfertigen suchten. Legenden zudem, die immer noch, selbst heute, etwa 250 Jahre später, einen fast durchgehenden Konsens bei Laien wie bei Historikern und Völkerrechtlern bilden. Ein Konsens, der sich auf eingängige verfassungsrechtliche Argumentationen beruft, aber dabei die historische Wirklichkeit angesichts ihrer Komplexität und Dynamik gern ignoriert.
Polens ursprüngliche Herrscherdynastie, die Piasten, war mit dem Tod Kazimierz III Wielki (Kasimir III. der Große) 1370 erloschen.6 Sein Nachfolger wurde zunächst Ludwik Węgierski (Ludwig I.), der bereits König von Ungarn war. Dieser vereinbarte mit den polnischen Baronen, dass seine Tochter Maria ihm auf dem polnischen Thron folgen sollte, da er keine Söhne besaß. Nach seinem Tod 1382 kam es darüber zu heftigen Auseinandersetzungen, zumal mit Ziemovit IV, Herzog von Masowien, eine Nebenlinie der Piasten Anspruch auf den Thron erhob. Als Kompromiss erhielt daher Maria den ungarischen Thron, ihre jüngere Schwester Jadwiga Andegaweńska (Hedwig von Anjou) wurde Königin von Polen. Die Union mit Ungarn wurde in diesem Zuge wieder aufgelöst.
Jadwiga war zu diesem Zeitpunkt erst elf Jahre alt, wurde aber in offiziellen Dokumenten als König, nicht etwa als Königin, bezeichnet. Zugleich wurde ihre bereits vollzogene Verlobung mit dem österreichischen Thronfolger Wilhelm gegen eine erhebliche monetäre Entschädigung gelöst. Stattdessen setzte der polnische Adel eine Vermählung der Königin mit dem litauischen Großfürsten Jogaila durch, der zum Zeitpunkt der Heirat ca. 24 Jahre alt war und damit als Erwachsener von Beginn an einen erheblichen Anteil der Herrschaftsaufgaben übernahm.
Polen und Litauen waren ursprünglich konkurrierende Mächte, was sich vor allem im Konflikt um das Erbe der 1323 im Mannesstamm ausgestorbenen Rurikiden in Halytsch-Wolodymyr (Galizien-Wolhynien) niederschlug.7 Zugleich stritt Polen sich mit dem Deutschen Orden bis zum 1343 geschlossenen Vertrag von Kalisch um Pommerellen. 1343 opferte Polen zwar seine Ansprüche im Nordwesten, konnte aber dadurch seine Kräfte im Südosten konzentrieren. Infolgedessen okkupierte Polen Galizien und das westliche Wolhynien, während Litauen sich mit dem östlichen Wolhynien begnügen musste und Ungarn ganz verdrängt werden konnte.
Dass sich Polen und Litauen nun auf eine Eheschließung einigten, verwundert daher vielleicht, zumal beide Länder kulturell, historisch und auch in Glaubensfragen kaum Gemeinsamkeiten aufwiesen. Doch war hier die Möglichkeit gegeben, die aktuelle Schwäche Polens in die Schaffung des stärksten Machtfaktors in dieser Region zu wandeln und zudem ein Gegengewicht gegen die ungarischen Expansionsversuche und die entsprechenden Bestrebungen des Deutschen Ordens zu schaffen.
Jogaila ließ sich zum Zweck der Eheschließung taufen, was auch die katholische Kirche Polens zu Unterstützern der Heiratspläne machte.
Denn in Litauen gab es zu diesem Zeitpunkt kaum Katholiken, stattdessen die litauische Kernbevölkerung, die noch heidnischen Glaubens war, sowie die vor allem durch Eroberungen in Belarus hinzugekommene orthodoxe Bevölkerungsmehrheit Litauens. Die katholische Kirche in Polen war dringend interessiert, das weitere Vorrücken der ungeliebten Konfession nach Westen zu stoppen und die litauischen Heiden zu missionieren.
Durch die Union von Krewo 1385 und seine Krönung wurde Jogaila als Władysław II Jagiełło gleichberechtigt mit Jadwiga Herrscher über die zunächst als Personalunion betrachteten zwei Länder. Aber bereits ein Jahr später entstand durch die Union von Lublin eine unbefristete Vereinigung beider Reiche zu Polen-Litauen. Mit Jadwigas frühem Tod 1399 war Władysław II Jagiełło dann Alleinherrscher von Polen-Litauen und Begründer der Jagiellonen-Dynastie.8 Als diese mit Zygmunt II August (Sigismund II. August) 1572 im Mannesstamm ausstarb, erfolgte in Polen-Litauen der Übergang zu einer Adelsrepublik. Die Erbmonarchie wurde ersetzt durch eine Wahlmonarchie, wodurch die beiden bisher noch teilweise autonom verstandenen Teile Polen und Litauen mindestens verfassungsrechtlich zur „Rzeczpospolita“ verschmolzen, auch wenn insbesondere in Litauen immer wieder auch die Unterschiede in Sprache und Kultur betont wurden.
Die Wahlmonarchie war signifikant für die starke Stellung des Adels in Polen. Aber die Ursache hierfür war sie – verbreiteten Ansichten zum Trotz – nicht. Der Niedergang des Ritterstandes, wie ihn die meisten europäischen Staaten in der Endphase des Mittelalters erlebt hatten, war in den beiden Staaten nicht eingetreten. Dazu war in dieser Zeit die Bedeutung des Adels für Polen-Litauen zu groß, einerseits im Zuge der Expansion des Landes bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts, danach vor allem in der Verteidigung und Verwaltung der so erreichten territorialen Ausdehnung. Entsprechend groß war auch der Bevölkerungsanteil des Adels, der bei allen regionalen Unterschieden bei etwa 14%, im 18. Jahrhundert sogar bei 20% der Bevölkerung lag. Denn Polen-Litauen war zu dieser Zeit nach Russland immerhin der zweitgrößte europäische Flächenstaat. Es reichte von der Ostsee bis weit in die Ukraine und Galizien, wobei die beherrschten Regionen deutliche Heterogenität aufwiesen. Bei nur etwa 40% polnischer Bevölkerung entstand ein buntes Gemisch, was Lebensweise, Bevölkerungsdichte, Infrastruktur usw. betraf. Das verstärkte die tragende Funktion des Adels als Klammer für das gesamte Land.
Polens Adel wies einige Besonderheiten auf, verglichen mit der Mehrheit der anderen Staaten Europas. Neben dem großen Bevölkerungsanteil war dies vor allem seine Heterogenität. Polen, Litauer, Ukrainer, Ruthenen usw. brachten jeweils ihre eigene Kultur in die Welt des Adels. Weiterhin gab es hier bis 1596 keine erblichen Titel. Alle Adelstitel bis zum Herrscher wurden eher als reine Verwaltungsbegriffe verstanden, welche die nächste Generation nur übernahm, wenn der entsprechende Sohn durch den König auch mit derselben oder einer gleichrangigen Aufgabe betraut wurde.
Die Ausdruck für die Gesamtheit des Adels war in der polnischen Sprache eigentlich „Szlachta“, doch wurde dieser zunehmend nur auf die untere Adelsschicht bezogen, also auf die Kleinadligen. Die einflussreichen Magnatenfamilien gehörten aber ebenso zur Szlachta, auch wenn sie auf diese Zuordnung oft nur wenig Wert legten.
Während etwa im Deutschen Reich ein großer Teil des niederen Adels von ursprünglich unfreien Ministerialen abstammte, war in Polen die Adelszugehörigkeit meist bereits bei der Okkupation neuer Regionen bestätigt worden. Das verringerte in der Zeit der polnischen Expansion das Risiko lokaler Insurrektionen. Entsprechend lebte aber die Mehrheit dieser Kleinadligen von unscheinbaren Grundherrschaften, die im Zuge der Erbteilung immer wieder auch einfach zu klein wurden, um ihren Eigner noch zu ernähren. Daher gaben immer mehr Kleinadlige ihre Unabhängigkeit auf und schlossen sich stattdessen einer der Magnatenfamilien an. So entstanden eigentlich drei Adelsschichten, nämlich die Magnaten, die Kleinadeligen mit eigenem Landbesitz, und die adligen Diener einer Magnatenfamilie, die oft nicht mehr besaßen als ihre Waffen, ihre Rüstung und meist noch ein bis zwei Pferde. Auch das Wappen und der Familienname standen oft in direktem Zusammenhang mit der jeweiligen Magnatenfamilie.9
Wenn man zu verstehen versucht, von wo die Entwicklung Polens zur Adelsdemokratie des 17. Jahrhunderts ihren Anfang nahm, so muss man einige Vorstufen berücksichtigen, wie sie allerdings in ähnlicher Weise auch andere europäische Staaten kannten, ohne dass sich daraus eine der polnischen vergleichbare Entwicklung ergeben hätte.
Wahrscheinlich markiert das Statut von Wiślica, das Kazimierz III Wielki (Kasimir III. der Große) 1334 erlassen hatte, den Beginn der polnischen Verfassungsgeschichte. Hier stärkte der König die Rechte der Bauern gegenüber dem Adel, führte westliche Rechtsprinzipien ein wie den Gesetzlichkeitsgrundsatz „nulla poena sine lege“, das Mehrfachbestrafungsverbot („ne bis in idem“), die Unabhängigkeit der Gerichte und ein allen Menschen zustehendes Selbstverteidigungsrecht.
Festgelegt wurde eine Gefolgschaftspflicht des Adels, insbesondere für Kriegsfälle, und ein allgemeines Plünderungsverbot. Zudem bestätigte das Statut das von Bolesław Pobożny (Bolesław VI. der Fromme) 1264 erlassene Statut von Kalisz, das Juden in Polen Rechtssicherheit garantierte.
Diese Regelungen stießen natürlich vor allem im Adel und seitens der Kirche auf Unmut, sodass es in den folgenden Jahrzehnten immer wieder Bestrebungen gab, die Privilegien des Adels zu stärken und die Gleichheit und Rechtssicherheit der jüdischen Bevölkerungsgruppe zu beseitigen.
1374 stand Ludwik Węgierski, der keine Söhne besaß, vor der Herausforderung, den Adel um Zustimmung zu einer weiblichen Thronfolge zu ersuchen. Im Gegenzug machte er mit dem Privileg von Koszyce (Kaschau) dem Adel erhebliche Zugeständnisse, darunter vor allem, dass jede Steuererhebung oder Verpflichtung von Adligen zu sonstigen Diensten an der Krone einer Zustimmung des Regionalparlaments, des Sejmik, bedurfte.10
Die Rzeczpospolita entstand vor allem durch das 1454 erlassene Statut von Nieszawa (Nessau). Man kann dieses Dokument durchaus mit der Magna Charta vergleichen, da hier wie dort ein Herrscher aufgrund einer tagespolitischen Notlage ein Dokument zu unterzeichnen bereit war, das weit über seine Herrschaftszeit hinaus prägend für das ganze Land werden sollte. In diesem Fall ging es um einen weiteren Krieg, den Polen-Litauen gegen den Deutschen Orden führen wollte. Kazimierz IV Andrzej (Kasimir IV. Andreas) benötigte hierfür die Unterstützung des Adels, der dies nutzte, um das Statut zu erlangen. In zwei Teilen für Wielkopolska (Großpolen) und Małopolska (Kleinpolen) verfasst, verpflichtete sich die Krone, zukünftig Gesetze nur noch mit Zustimmung der regionalen Adelsparlamente, der Sejmiki, zu erlassen. Damit wurde das Privileg von 1374 nicht revidiert, sondern deutlich erweitert. Auch die Einberufung des Ritterheers, also quasi eine Generalmobilmachung, wurde jetzt zustimmungspflichtig. Das bedeutete auch eine Stärkung des Kleinadels gegenüber den Magnatenfamilien, die aber mit ihren Privatarmeen trotzdem wesentlicher Träger der polnischen Grenzsicherung blieben. Die Flucht leibeigener Bauern, vorwiegend in die wachsenden Städte oder über die Ostgrenze Polens, sollte künftig deutlich härter bestraft werden, und die Kirche erreichte eine weitgehende Aufhebung der 1334 erlassenen Regelungen zur Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit der jüdischen Bevölkerungsgruppe.
Nachdem Kazimierz IV Andrzej 1492 gestorben war, folgten ihm nacheinander drei seiner Söhne auf dem polnisch-litauischen Thron. Direkter Nachfolger war Jan I Olbracht ( Johann I. Albrecht), unter dem sich das Nationalparlament, der Sejm, als Zweikammerparlament etablierte, mit einem Senat als beratendem Honoratiorenkreis und der eigentlich die Macht innehabenden Ständeversammlung, zu der jetzt aber nur noch Adlige Zugang hatten.
Jan I Olbracht war es auch, der das Statut von Nieszawa zu einem einheitlichen Dokument weiterentwickelte. Er musste mit Blick auf seine außenpolitischen Ambitionen dem Adel weitere Zugeständnisse machen. Fortan sollten alle höheren Kirchenämter, insbesondere die Bischofssitze, Adligen vorbehalten bleiben. Dem Bürgertum war der Erwerb von Landbesitz untersagt, was vor allem dazu dienen sollte, eine Verschmelzung des traditionellen Adels mit dem im Spätmittelalter aufstrebenden Bürgertum der Städte zu verhindern. Entsprechend wurde dem Adel jede Erwerbsform außer Ackerbau und Waffendienst verboten, was vor allem Kaufleuten den Adelsstand unattraktiv machen sollte. Um eine weitere Verarmung der Kleinadligen zu verhindern, wurde zudem ein Teil der Königsgüter parzelliert und Kleinadligen überlassen. Das führte zur Entstehung der „Adelsdörfer“, polnisch „zaścianki“ oder „okolice“, in denen ausschließlich meist mehrere Dutzend Adelsfamilien zusammen lebten, es aber keine anderen Grundeigner gab.
Offensichtlich empfanden die Kleinadeligen einen Druck von drei Seiten, nämlich einerseits durch die ihre Macht kontinuierlich ausweitenden Magnatenfamilien, andererseits durch das aufstrebende Bürgertum in den Städten.11 Die dritte Macht war die katholische Kirche, welche auch in Polen wie in den meisten europäischen Staaten ein mächtiger Feudalherr war. Immer wieder wurde der Kirche vorgeworfen, nicht das Wohl Polens zu priorisieren, sondern die Macht der Kirche und des Papstes. Entsprechend traten viele Adlige mit Auftauchen der protestantischen Konfession zu dieser über, bis in einigen Regionen fast die Hälfte der Adligen, aber ein deutlich kleinerer Teil der Bevölkerung, lutherisch geworden war.12
Ähnliche Situationen gab es mehr oder weniger zeitgleich in vielen europäischen Staaten. Aber während dieser zweiseitige Druck andernorts – in Deutschland etwa durch den Zusammenbruch des Ritteraufstands von 1522/23 – zu einem Niedergang dieses ursprünglichen Ministerialen-Adels führte, gelang es vor allem dem grundbesitzenden Teil des polnischen Kleinadels, seine Stellung zu festigen. Der Preis war allerdings eine konservative Haltung, die in jeder Neuerung zunächst vor allem eine Bedrohung insbesondere der 1454 erreichten Privilegien sah.
Diese besondere Stellung des Adels wurde vor allem in der Aufklärung als Anachronismus und Hindernis jeglichen Fortschritts kritisiert. Der Adel formulierte dagegen eine proto-rassistische Haltung, demzufolge er – anders als der Rest des polnischen Volks – direkt von den Sarmaten abstamme.13 Dieser Sarmatismus diente nicht nur als Rechtfertigung der aktuellen Privilegien, sondern normierte auch die Kultur des Adels in Sprache, Kleidung, Lebensweise, Literatur und Architektur, steigerte also durch eine solche Uniformierung die fragile Gruppenidentität dieser Schicht.14
Die Wichtigkeit des Adels spiegelte sich in einem weiteren wichtigen Baustein der polnischen Verfassung, dem „Nihil Novi“ von 1505. Hierdurch wurde die Macht des Sejm als polnischem Reichstag noch einmal deutlich erhöht. Neben der Bestätigung der Organisation des Sejm in zwei Kammern wurde ein Widerstandsrecht des Adels gegen Versuche der Krone, die Verfassung zu verändern, dauerhaft festgelegt. Dieses eigentlich durch das Statut von Wiślica 1334 abgeschaffte Widerstandsrecht konnte dann zu einem „Rokosz“ führen, einem auf dem mittelalterlichen Verweigerungsrecht beruhenden Aufstand von Teilen des Adels, mithin eine rechtskonforme Rebellion. Damit aber war die polnische Verfassung zugleich sehr rückwärtsgewandt und doch ausgesprochen fortschrittlich, da noch für die nächsten Jahrhunderte ein allgemeines Widerstandsrecht – oder auch eins in der hier auf eine Schicht beschränkten Form – zwar von diversen Philosophen diskutiert, aber nicht im Verfassungsrecht verankert wurde.15 Hingegen stand die polnische Verfassung bereits zu diesem Zeitpunkt jeder absolutistischen Ausrichtung der Herrschaft diametral entgegen. Auch der Herrscher konnte nach dieser Rechtsauffassung falsch handeln, was seinen Untertanen oder jedenfalls dem Adel das Recht auch zu gewaltsamem Widerstand einräumte.
Die wesentlichen Regeln für die Rolle des Königs fanden sich in den Articuli Henriciani von 1573.16 Diese wurden nach der Wahl von Henryk Walezy (Heinrich von Valois) zum König beschlossen und verpflichteten den König, nichts zu unternehmen, um seinen Nachfolger zu bestimmen. Ferner verzichtete er darauf, ohne Zustimmung des Sejm Steuern zu erlassen oder im Rahmen eines allgemeinen Aufgebots das Volk zu den Waffen zu rufen.
Die Articuli Henriciani legten auch fest, dass der Sejm ab jetzt alle zwei Jahre für jeweils etwa sechs Wochen tagen solle. Im Sejm waren alle Adligen unabhängig ihres Wohlstands gleichberechtigt, verfügten also jeweils nur über eine Stimme. Aufgrund des hohen Anteils von Adligen an der Bevölkerung war der Sejm extrem groß. Zeitweise erreichte er eine Kopfzahl von über 5.700 Mitgliedern. Hier gelang es, durch die Zustimmungspflichtigkeit aller Steuergesetze den Adel frei von allen direkten Abgaben zu halten.
Diese als „Goldene Freiheit“ bezeichnete Ordnung des Polnisch-Litauischen Königreichs war fast zwei Jahrhunderte lang der Garant für politischen Zusammenhalt und militärische Stärke. Sie schränkte zudem die Macht der Könige deutlich ein, zumal das Recht des „Liberum Veto“ eine Auflösung des Sejm erzwang, wenn ein Delegierter unter
Protest die Versammlung verließ. Damit konnte dann ein anstehender Beschluss nicht mehr gefasst werden, da aufgrund von Nihil Novi Einstimmigkeit aller Delegierten, nicht nur der anwesenden, erforderlich war. Vor allem aber mussten am Ende der Sitzungsperiode alle gefassten Beschlüsse von allen Vertretern unterzeichnet werden, da man alle Beschlüsse des Sejm als geschlossenes Konvolut verstand. Fehlte durch das Liberum Veto auch nur ein Delegierter, wurde eine entsprechende Bestätigung undurchführbar. Dadurch konnten dann alle zuvor gefassten Beschlüsse nicht in Kraft treten.
Die weitreichenden Folgen eines Liberum Veto führten wenigstens bis zum Ende des 17. Jahrhunderts oft dazu, dass ein Delegierter, der dieses Recht wahrnehmen wollte, massiv unter Druck gesetzt wurde. Meist nicht von der Krone, sondern von einzelnen einflussreichen Familien, und nicht selten kamen neben Bestechungen auch diverse Arten von Bedrohung zum Tragen. Nur wer selbst hinreichend mächtig war oder eine entsprechende Macht, in der Regel Russlands, manchmal auch Schweden, Brandenburg-Preußen oder Österreich-Ungarn, hinter sich wusste, konnte daher gefahrlos von seinem Recht Gebrauch machen.
Dem Liberum Veto ist oft eine Hauptverantwortung am Niedergang Polen-Litauens im 18. Jahrhundert angelastet worden.17 Das ist nicht haltbar, sonst hätte dieser Niedergang bereits zweihundert Jahre zuvor beginnen müssen. Das Hauptproblem dieser Zeit war vielmehr, dass wechselnde Herrscher nicht bereit waren, die polnischen Gegebenheiten zu akzeptieren, wo die Stärke des Landes auf einer dezentralen Machtverteilung beruhte. Und natürlich war auch die katholische Kirche aufgrund ihrer Konkurrenz zur orthodoxen Kirche ein ständiger Treiber innerpolnischer Zwistigkeiten.
Aber erst als ausländische Mächte, vor allem Russland, versuchten, ihren Einfluss in Polen-Litauen massiv zu erweitern, entstand hier eine Möglichkeit, mit wenigen gekauften Gewährsmännern den Sejm weitgehend zu paralysieren. Die hierzu unabdingbare Korruption war freilich ein Problem aller europäischen Staaten dieser Zeit. Vor allem aber hatten die Kriege des 17. und 18. Jahrhunderts insbesondere kleinere Adelsfamilien verarmen lassen. Für diese war es eine bitter nötige Einnahmequelle, ihr Stimmrecht im Sejm dem Meistbietenden zur Verfügung zu stellen. Zudem waren immer mehr Adlige gezwungen, auf ihren Landbesitz ganz zu verzichten und in den Haushalt einer Magnatenfamilie einzutreten. Auch diese waren dann nicht mehr wirklich frei in ihrer Haltung.
Dennoch sind für die Zeit des Liberum Veto zwischen 1573 und 1763 152 Sitzungsperioden des Sejm dokumentiert. Davon wurden lediglich 32 durch ein Liberum Veto ausgehebelt. Von einer allgemeinen Funktionsunfähigkeit des Sejm kann also keine Rede sein. Wohl aber bildete das Liberum Veto ein Korrektiv, das autokratische Tendenzen in Polen-Litauen verglichen mit seinen absolutistischen Nachbarstaaten deutlich erschwerte.18
Auch dass neben dem Liberum Veto das Wahlkönigtum eine Schwäche der polnisch-litauischen Verfassung gewesen sei, ist kaum haltbar. Ein solches System kannten diverse europäische Staaten, darunter auch das deutsche Kaiserreich. Zwar war hier der Kreis der Wahlberechtigten deutlich kleiner. Aber aus der Kritik an der polnisch-litauischen Verfassung spricht vor allem eine antidemokratische Grundhaltung diverser Historiker des 19. Jahrhunderts, die immer noch durch die Literatur geistert, wenn es um die Frage der polnischen Teilungen geht.19 Man überdeckte damit über lange Zeit, dass vor allem preußische und russische Expansionsgelüste sowie die antirussische bzw. anti-orthodoxe Politik der katholischen Kirche verantworteten, dass ein Jahrhunderte altes Königreich kurzerhand von der europäischen Landkarte verschwand.
Die vielzitierte Schwäche Polen-Litauens war, wenn überhaupt, eher ein Beispiel für eine allgemeine Überforderung der inneren Kräfte, ein „imperial overstretch“, da Polen-Litauen sich nach einer Phase erfolgreicher Eroberungen vor allem schwedischen Expansionsversuchen und einem russischen Rückgewinnungsstreben ausgesetzt fand.20 Zugleich verhinderte der Druck von außen und der aus den kriegsbedingten Verwüstungen resultierende wirtschaftliche Niedergang, dass Staat und Nation die nötigen Kräfte zu einer Modernisierung fanden, wie sie im 18. Jahrhundert vielen anderen europäischen Staaten gelang.
3.2. Die polnisch-litauische Heeresorganisation
Historiker des 19. Jahrhunderts, Nationalisten aller Länder und beider Nachfolger wollten in der polnischen Adelsverfassung die wesentliche Ursache der polnischen Teilungen sehen.21 Doch zeigt sich z.B. an der Entwicklung der polnisch-litauischen Armee, dass viel eher absolutistische Fantasien der jeweiligen Herrscher und sinnlose Eroberungsgelüste die im 18. Jahrhundert kulminierenden Probleme über lange Zeit aufgebaut haben.
Eine Parallelität mehrerer Fürsten-Armeen neben der Armee des Königs kannten im Spätmittelalter viele europäische Staaten, ohne dass es ihrer Entwicklung geschadet hätte. In Polen bzw. in Polen-Litauen wurde dies umso bedeutender, je schwächer die Krone wurde.
Seit dem 15. Jahrhundert gab es ein Stehendes Heer in Polen, das mit ca. 1.500 Mann aber nur wenig über eine Palastgarde hinausging. Diese als „obrona potoczna“ bezeichnete Kronarmee konnte im Kriegsfall durch Söldner, aber vor allem durch Truppen des Adels verstärkt werden. 1562 wurde die Kronarmee mehr als verdoppelt, was auch der Entwicklung im Ersten Nordischen Krieg Rechnung trug, als Iwan IV. versuchte, Teile der Ostseeküste für Russland zu erobern.22 Danach hieß diese Armee auch die „Quartegna“, da ein Viertel der königlichen Domäneneinkünfte hierfür verwendet werden sollte.
Mit dem Vollzug der Union mit Litauen kam die litauische Armee als eigenständiger Verband zu dieser Kronarmee hinzu, wobei die litauischen Truppen unter eigener Führung höchstens ein Drittel der Mannstärke bildeten.
Ihren Höhepunkt erreichte die Kronarmee mit über 60.000 Mann in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, ehe die militärischen
Eskapaden Jan III Sobieskis und Augusts II zu ihrem allmählichen Niedergang führten. Genau deshalb gewannen aber die Armeen der Magnatenfamilien an Bedeutung, waren sie es doch, die nun die Hauptlast des Schutzes der Einwohner vor Marodeuren und Plünderern und vor Überfällen aus den benachbarten Grenzregionen sicherstellten. Die Kronarmee aber schrumpfte unterdessen auf noch etwa 18.000 Mann zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Und diese Armee bestand auch noch zu mehr als der Hälfte aus verschiedenen Kavallerieverbänden, was zwar eine hohe Flexibilität in der Grenzverteidigung sicherstellte, aber die Truppe auch deutlich kostspieliger machte.23
3.3. Polnische Expansionsversuche im 17. Jahrhundert
Noch im späten 16. Jahrhundert war Polen-Litauen so mächtig gewesen, dass es sogar Russland zu okkupieren versuchte, das nach dem Aussterben der Rurikiden 1598 herrenlos war.24 Zygmunt III Waza (Sigismund III.), bis zu seiner Absetzung 1599 auch König von Schweden, wollte nicht hinnehmen, dass 1610 Schweden sich anschickte, den Moskauer Thron zu erobern.25 Gerade erst hatte er mit dem Sieg bei Guzów 1607 die Zebrzydowski-Rebellion diverser Magnatenfamilien und Teilen des Kleinadels gegen sein Streben nach größerer Macht des Königs und Vererbbarkeit der Königswürde militärisch abgewehrt, aber politisch fast allen Forderungen der Rebellen nachgeben müssen.26 Nun wendete er sich nach Russland, um hier die Gunst der Stunde nicht seinem verhassten Onkel zu überlassen.
Nach dem Sieg in der Schlacht bei Klushino über die russischen Truppen am 04.07.1610 wollte Zygmunt III zunächst seinen Kronprinzen Władysław zum Zaren krönen lassen, griff aber schließlich selbst nach der Krone. Diese Doppelmonarchie sollte die Machtbasis sichern, die schwedische Krone zurückzuholen und ein starkes Reich rund um die Ostsee zu errichten. Das scheiterte jedoch, als es 1611 in Moskau zu einem antipolnischen Aufstand kam. Das lag auch daran, dass Zygmunt III als polnischer König natürlich Katholik war, was mit der klerikalen Rolle des Zaren unvereinbar war. Zygmunt III. eroberte zwar im Juni 1611, nach fast zwei Jahren Belagerung, das strategisch bedeutende Smolensk. Aber in Moskau brach der polnische Widerstand gegen den Volksaufstand Ende Oktober 1612 zusammen. Der russische Bojaren-Adel als Führer des Aufstands lehnte einen katholischen, polnischen Herrscher – Zygmunt III oder Władysław – ebenso ab wie den protestantischen Kronprinzen Schwedens, Karl Filip, für dessen Wahl Schweden sogar auf die noch gehaltene Festung Nowgorod zu verzichten bereit war. Stattdessen wählte eine russische Volksversammlung, die Angehörige fast aller Schichten erfasste,
Michail Romanow zum Zaren.27 Die polnisch-litauischen Truppen mussten sich zurückziehen, hielten aber noch das so mühsam eroberte Smolensk. Der Krieg schlief wegen allgemeiner Erschöpfung zunächst ein, bevor im Oktober 1617 der polnische Thronfolger Władysław eine neue Armee nach Russland führte, um die Zarenkrone für sich selbst zu gewinnen. Doch gelang es ihm nicht, Moskau zu erobern, sodass Polen-Litauen und Russland im Folgejahr den Vertrag von Deulino schlossen, der Polen-Litauen die Herrschaft über Smolensk garantierte.
Dieser völkerrechtlich völlig illegitime Versuch Polen-Litauens, Russland zu okkupieren, bestimmte wesentlich das Bild Polens in der russischen Außenpolitik der folgenden Jahrzehnte. Bis heute wird in Russland gern darauf verwiesen, dass die Teilungen Polens Ende des
18. Jahrhunderts nichts wesentlich Anderes gewesen seien als die polnischen Okkupationsversuche Anfang des 17. Jahrhunderts, wenn auch letztlich erfolgreicher und im Sinne einer Friedenssicherung mit den anderen beiden beteiligten Mächten, Österreich-Ungarn und Brandenburg-Preußen eher zu rechtfertigen.28
3.4. Die Kosaken am Dnipro
Polen-Litauen hatte aber mit dem Vertrag von Deulino den Höhepunkt seiner Machtentfaltung erreicht, auch deshalb, weil die polnischen Adligen im Sejm schon unter Zygmunt III Waza sich weitgehend geweigert hatten, derlei außenpolitische Eskapaden mit Steuermitteln zu finanzieren. Indes waren auch Russland und Schweden nicht die einzigen Unwägbarkeiten einer langfristig orientierten Machtpolitik der polnischen Krone. Vor allem die Situation an der Ostgrenze Polen-Litauens wurde zunehmend unübersichtlich, auch deswegen, weil Polen-Litauen zur Sicherung seiner Grenzregionen und für den Kampf um die Zarenkrone die an den Ufern des Dnipro lebende Bevölkerung zu Hilfstruppen aufgebaut und mit umfangreichen Privilegien ausgestattet hatte. Dadurch konnten diese der Steppenräuberei, die auch zuvor schon eine wichtige Einnahmequelle gewesen war, ohne Furcht vor der polnischen Justiz nachgehen. Entsprechend wurde der Begriff „Kosake“, eigentlich ein turko-tatarischer Begriff für Freischärler oder Leichtbewaffnete, nun zur Bezeichnung eines ganzen Volks, wie es sich aus Nachfahren russischer und polnischer Einwanderer, vor allem entflohener Leibeigener, ursprünglicher Bevölkerung und Zuwanderern aus den tatarischen Regionen nach und nach entwickelte.29 Hinzu kamen Flüchtlinge aus Belarus, welche die polnisch-litauische Konfessionspolitik ablehnten, die sich vorwiegend gegen die orthodoxe Konfession richtete.30