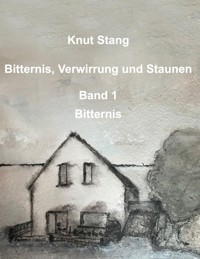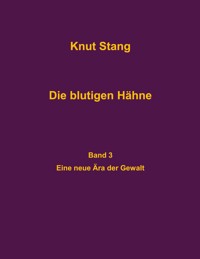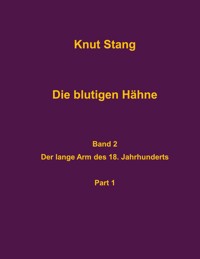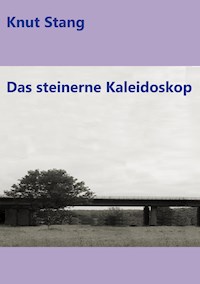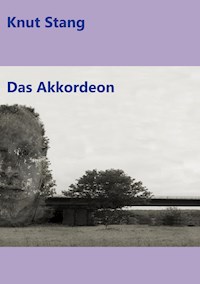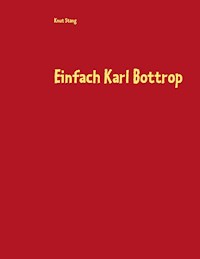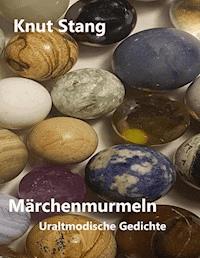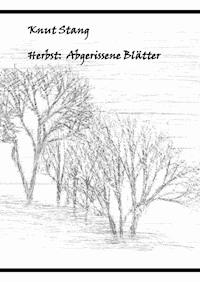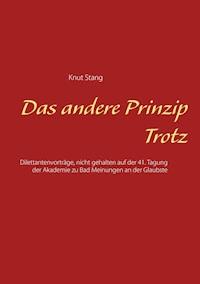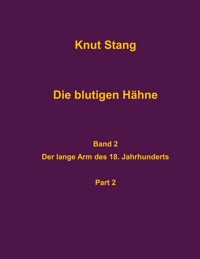
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im zweiten Band der aktuellen Dilettantenvorträge nehmen das 18. und 19. Jahrhundert einen besonderen Raum ein. Der zweite Teil des zweiten Bands gilt dabei der Geschichte der USA und einzelner Bestandteile dieser Geschichte. Es wird die Entstehung der USA aus völkerrechtlicher Sicht beleuchtet, ebenso die Staatlichkeit der USA im Rahmen eines allgemeinen Rechtsverständnisses. Sodann geht es um die weitgehende Gleichgültigkeit der US-amerikanischen Außen- und Machtpolitik gegenüber dem Völkerrecht, der philosophischen Herleitung einer angeblichen Sonderrolle der USA und nicht zuletzt um die aus diesem Geist verstehbare Geschichte der Republicans anhand ihrer Präsidenten zwischen Abraham Lincoln und Donald Trump.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Beiträge zu Herrschaft, Legitimation und Kooperation
Dilettantenvorträge, gehalten auf der 43. Tagung der Akademie zu Bad Meinungen an der Glaubste
Inhalt
7. Adelgund Mahlberg: Sezession und Unabhängigkeit: Die Geburt der USA
8. Konrad Gildner: Der Staatscharakter der USA
9. Bengo Hadone: Die USA als außenpolitisches Element nach 1788
10. Adelgund Mahlberg, Konrad Gildner, Bengo Hadone: Die USA nach 1783: ein gestohlener Staat?
11. Florian Degener: A Shining Light of Leadership: Die Rolle der republikanischen Präsidenten in der Geschichte der USA
12. Arlt Neeskens: Nachtrag aus gegebenem Anlass
7. Adelgund Mahlberg: Sezession und Unabhängigkeit: Die Geburt der USA
Adelgund Mahlberg ist Juristin, genauer Anwältin mit einem starken Schwerpunkt auf Strafrecht, insbesondere auf Kapitalverbrechen. Wir waren schon Beginn an sehr gespannt, wie sie sich jemand mit ihrer Profession der Gründungsgeschichte der USA nähern würde. Die Diskussion im Anschluss hat gezeigt, wie berechtigt diese gespannte Erwartung war.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen und Freunde, die Akademietagungen sind stets eine interessante Möglichkeit, sich dem einen oder anderen Gegenstand zu nähern, hinsichtlich dessen man deutlich mehr Interesse aufweist als Sachkunde. Entsprechend sind solche Gelegenheiten aber auch immer ein wenig nervenaufreibend, wagt man sich doch in unbekanntes Terrain und setzt sich mithin immer wieder nicht nur der Kritik, sondern auch dem amüsierten Lächeln oder entnervten Augenverdrehen fast durchweg sachkundigerer Hörer aus. Seien Sie also nachsichtig mit mir, wenn auch ich mich ein weiteres Mal in so fremdes Terrain wage. Ich hoffe immerhin, Sie werden das Nachfolgende so überraschend und faszinierend finden, wie es mir selbst ergangen ist.
7.1. Die Unabhängigkeitserklärung als Grundlegung der US-amerikanischen Unabhängigkeit
In den USA wird der Independence Day, also der 04. Juli, bis heute als Nationalfeiertag schlechthin zelebriert. Er hat mittlerweile den Charakter eines Volksfestes, ist also wesentlich weniger militaristisch aufgeladen, als die vor allem in Washington entstehenden Berichterstattungen europäischer Medien gelegentlich glauben machen wollen. Dennoch wohnt auch diesen scheinbar harmlosen Belustigungen eine verdeckte militaristische Konnotation durchaus inne. Das mag daran liegen, dass die USA ihre Gründung durch einen Gewaltakt erfuhren, der 1776 mit der Unabhängigkeitserklärung, wenn schon nicht begann, so doch erstmals manifest wurde. Es fragt sich aber, ob dieser Akt der Gewalt legitim war oder nicht.
Auftraggeber der Unabhängigkeitserklärung war der Zweite Kontinentalkongress, der seit Mai 1775 tagte. In ihm waren Vertreter von zunächst zwölf der dreizehn aufständischen Kolonien vertreten; Georgia entsandte seine Vertreter nach einigem Zögern erst im Juli 1775. Geladen waren auch Québec, Saint John’s Island, Nova Scotia, Ostflorida und Westflorida, die aber trotz gewisser Sympathien für die Aufständischen eine Teilnahme und damit eine Unterstützung der Revolte gegen die Krone verweigerten.1
Die Mitglieder des Kongresses waren nicht vom Volk gewählt, sondern waren Abgesandte der jeweiligen Kolonialparlamente. Ihre Legitimität entsprach also bestenfalls der – sehr uneinheitlichen – demokratischen Legitimation der Parlamente. Zudem fehlte es z.T. an klaren Vorgaben, welche Kompetenzen die Delegierten besaßen, vor allem aber, welche Interessen die jeweilige Kolonie verfolgte. Entsprechend intensiv war die Korrespondenz der meisten Delegierten mit ihrem heimatlichen Parlament, als die Diskussion um den Entwurf der Unabhängigkeitserklärung begann.
Offiziell galt ein fünfköpfiges Gremium, bestehend aus John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Roger Sherman und Robert Livingston als Verfasser des Entwurfs. Doch scheint Jefferson den Entwurf, welcher dann dem Kongress zur Abstimmung vorgelegt wurde, auf Basis diverser Diskussionen im Gremium letztlich weitgehend allein verfasst zu haben.2
Dieser Entwurf wurde im Grunde der Aufgabe nicht gerecht, für eine Unabhängigkeit der dreizehn Kolonien vom britischen Mutterland zu argumentieren. Denn Jefferson verzichtete darauf, eine Unabhängigkeit mit staatsphilosophischen oder völkerrechtlichen Argumenten zu begründen. Stattdessen verfasste er nach bester Anwaltsmanier eine Anklageschrift gegen den britischen König, dem er vorwarf, das traditionelle rechtliche und politische System in den dreizehn Kolonien ersetzen zu wollen durch eine Tyrannis. Dabei kreidete er ihm sowohl selbst vorgenommene Handlungen als auch die Genehmigung von Handlungen, vor allem legislativen Akten, anderer an, sodass zugleich der Eindruck entstehen konnte, Georg III. sei nur das Haupt einer gegen die Freiheit in den dreizehn Kolonien gerichteten Verschwörung.
Die Unabhängigkeitserklärung in dieser Form entsprach der in Europa bereits seit Jahrhunderten eingeführten Gravamina-Auflistung von Kritikpunkten an der aktuellen Regierung. Wie diese stellte sie jedoch keinen Gegenentwurf dar. Anklageschriften benennen Zustände, gegen die sich der Anklagende wendet, die er kritisiert, die er bestraft sehen will. Sie spezifizieren einen angestrebten Zustand nur darüber, dass in diesem die monierten Themen nicht oder nur sehr wenig Bedeutung haben, aber sie sagen nicht explizit und detailliert, welcher andere Zustand angestrebt werden soll.
Jefferson hatte kaum eine andere Möglichkeit, als zu einer solchen Anklageliste zu greifen. Da, wo er bereits positive Setzungen für die neue Staatsorganisation in den Entwurf einbrachte – etwa hinsichtlich einer Abschaffung der Sklaverei – stieß er auf den Widerstand der Delegierten. Damit musste er sich auf rein ablehnende, nicht gestaltende Themen beschränken, die den aktuellen Zustand bzw. den Versuch der Krone, zu einem neuen Zustand zu gelangen, als mit geltendem Recht unvereinbar kritisierten. Alles andere hätte den Kontinentalkongress sicherlich vor eine Zerreißprobe gestellt, auch wenn damit die Aufgabe, eine konkrete, konsensfähige Utopie zu entwickeln, lediglich aufgeschoben war bis zur Ausarbeitung einer Verfassung. Doch auch der Entwurf der ersten Verfassung, welche die Zusammenarbeit der dreizehn Staaten in einer Konföderation regeln sollte, war weitgehend konservativ, entbehrte also erneut der konkreten Utopie. Diese Verfassung, die Konföderationsartikel, wurde 1777 verabschiedet. Sie waren aber eher ein Bündnisstatut als eine Staatsverfassung im eigentlichen Sinn. Ihre Ratifizierung erforderte dennoch drei Jahre, sodass sie lediglich von 1781 bis 1789 in Kraft waren, ehe sie von der heutigen Verfassung der USA abgelöst wurden.
Diverse Autoren haben seit dem frühen 19. Jahrhundert gemeint, Jeffersons Entwurf als Ergebnis rechtsphilosophischer, theologischer oder naturrechtlicher Einflüsse interpretieren zu können. Aber tatsächlich folgte Jefferson in Form und Argumentation den gängigen juristischen Modellen seiner Zeit.3 Der wesentliche Einfluss war entsprechend vor allem „The Law of Nations“, also die englische Übersetzung von „Le Droit des gens: Principes de la loi naturelle, appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains“ von Emer de Vattel. Benjamin Franklin stellte dies Buch den Mitgliedern des Zweiten Kontinentalkongresses zur Verfügung. Es fand bei den meisten Delegierten – jedenfalls nach Franklins eigenem Bekunden – ausgesprochen großes Interesse.4
Diverse Punkte, die Jefferson zusammentrug, waren keine Besonderheit dieser Jahre; so war es z.B. seit langer Zeit geübte Praxis, dass britische Kriegsschiffe auf hoher See Schiffe auf Schmuggelware durchsuchten und anbei einen oder mehrere Seeleute zwangen, das Schiff zu wechseln und fortan in der Royal Navy zu dienen. Andere Vorwürfe waren schlicht gegenstandslos oder beruhten auf deutlich übertriebenen Gerüchten, so etwa, wenn Georg III. vorgeworfen wurde, in den dreizehn Kolonien Städte niedergebrannt zu haben. Insgesamt entstand das Bild eines Nero, eines Dschingis Khan oder Henry Morgan. Auch fand sich hier das Bild eines Verbündeten der in den Kolonien oder an ihren Grenzen lebenden indigenen Nationen, mit denen er sich gegen sein eigenes Volk verschworen hätte.
Eine solche Argumentation hätte eigentlich zur Rechtfertigung einer Unabhängigkeit nichts beitragen können, sondern allenfalls, analog zur Revolution von 1642, einen Sturz des Tyrannen zu begründen vermocht.5 Im Gegenteil ist die Anrufung eines nationalen Rechtsprinzips gegen einen Tyrannen zwar vielleicht Anlass, diesen Tyrannen zu stürzen, aber gleichzeitig die Bestätigung des diesen Staat ausmachenden juristischen Codex bzw. der Versuch, den Staat auf genau diesen zurückzuführen.
Aus England und Schottland sind zeitgleich diverse fast gleichlautende Angriffe auf Georg III. überliefert, die alle letztlich eine Rücknahme wesentlicher von ihm vor allem nach 1762 durchgeführter Maßnahmen forderten. Etliche Formulierungen aus der Unabhängigkeitserklärung finden sich zudem schon in Angriffen auf Charles I. im Vorfeld der englischen Revolution. Doch verlangte die entsprechende Gruppierung im Kontinentalkongress nach einem Dokument, welches weit hierüber hinaus gehen sollte, zumal man nicht sicher war, wirklich schon eine breite Mehrheit für die Idee einer Unabhängigkeit gewonnen zu haben. Man wollte eine rhetorisch überzeugende Argumentationshilfe, und entsprechend war man bereit, Jeffersons ausgesprochen eloquente Schrift als Begründung einer staatlichen Unabhängigkeit insgesamt anzunehmen, was sie eigentlich niemals hätte sein können.
In Philadelphia tagte vom 05. September bis zum 26. Oktober 1774 der Erste Kontinentalkongress. Dieser war notwendig geworden, weil ein Teil der britischen Kolonien in Nordamerika nicht willens war, die Kosten der im Siebenjährigen Krieg erreichten Vertreibung Frankreichs aus Nouvelle-France, dem späteren Québec, zu tragen. Diese Aufwände hatte die britische Krone teilweise über Steuern in den Kolonien zu refinanzieren versucht, stieß hier aber auf den Widerstand der Kolonisten, die bis dahin fast steuerfrei gelebt hatten. Sie konnten meist für sich in Anspruch nehmen, bereits in Form physischen Engagements mehr als das Übliche zum Sieg von 1763 beigetragen zu haben. Zudem verwiesen sie darauf, dass nach britischem Rechtsverständnis seit der Revolution das Prinzip gelte „No taxation without representation“; eine Vertretung im Unterhaus besaßen die Kolonien in Nordamerika aber nicht. Dieser Bezug auf die Bill of Rights von 1689 ignorierte allerdings die mit den Gründungsbeschlüssen aller Kolonien bereits festgelegten Regeln. Die Kolonisten hatten bewusst auf ihre Parlamentsrepräsentation verzichtet und im Gegenzug u.a. weitgehende Steuerfreiheit erlangt. Diese blieb auch weiterhin trotz der Steuerpolitik der Krone nach dem Siebenjährigen Krieg im Wesentlichen bestehen. Diese Entscheidung hatten die Bewohner des englischen Reichs vor dem Bürgerkrieg und bis zur Abfassung der Bill of Rights nie gehabt.6
Der Erste Kontinentalkongress erreichte vor allem zweierlei: einen weitgehenden Boykott britischer Waren in allen dreizehn Kolonien sowie die Einigung, im Mai 1775 einen Zweiten Kontinentalkongress einzuberufen, erneut mit Delegierten der Kolonialparlamente, also nicht mit direkt gewählten Vertretern. Durch die oben erwähnte Weigerung diverser Kolonien, die Rebellion zu unterstützen, war ohnehin nach Fläche – nicht jedoch nach Einwohnerzahl – der weitaus größere Teil des britischen Besitzes in Nordamerika auch im Zweiten Kontinentalkongress nicht vertreten.
Noch bevor der neue Kongress zusammentrat, kam es zu ersten größeren Kampfhandlungen zwischen den Milizen der dreizehn Kolonien und der Krone, was vorwiegend auf die, milde gesagt, instinktlose Politik der britischen Kolonialverwaltung zurückzuführen war.
Am 19. April 1775 versuchten etwa 700 Mann unter Lt.Col. Francis Smith, die Waffenlager der Milizen auszuheben, also diese faktisch zu entwaffnen.7 Dies gelang nicht, es kam zu Schusswechseln, vor allem bei Lexington und Concord, in deren Verlauf etwa 100 britische Soldaten getötet oder vermisst wurden, fast doppelt so viele Opfer wie auf Seiten der Milizen. Vor allem aber hatten die Milizen die eigentlich deutlich überlegenen Linientruppen zum Rückzug zwingen können. Mit der sich daraufhin formierenden Belagerung von Boston hatte faktisch der Krieg um die Unabhängigkeit der Kolonien begonnen. Doch dauerte es noch mehr als ein Jahr, bevor der Kongress diese Fakten auch in staatsrechtliche Dokumente umsetzte.
Am später so genannten Independence Day – der Ausdruck ist für 1791 erstmals belegt - ratifizierte der Zweite Kontinentalkongress Jeffersons Entwurf, welcher vor allem als Begründung der Sezession von Großbritannien dienen sollte. Dabei folgte die hitzig diskutierte Erklärung weitgehend Jeffersons Text, nur wurde mit Rücksicht auf die Staaten, in denen Sklaverei stark verbreitet war, die von ihm in den Entwurf aufgenommene Verurteilung von Sklaverei aus der Erklärung entfernt.
Grundsätzlich erklärt worden war diese Sezession aber bereits zwei Tage zuvor, als zwölf der dreizehn Kolonien – New York enthielt sich – einen von Richard Henry Lee aus Virginia hierzu eingebrachten Antrag annahm.
Es lohnt ein Blick auf die eigentliche Verkündigung der Unabhängigkeit, also den Beschlussantrag, den Richard Henry Lee am 07. Juni 1776 eingebracht hatte. Dieser war recht knapp gefasst:
Resolved,
That these United Colonies are, and of right ought to be, free and independent States, that they are absolved from all allegiance to the British Crown, and that all political connection between them and the State of Great Britain is, and ought to be, totally dissolved.
That it is expedient forthwith to take the most effectual measures for forming foreign Alliances.
That a plan of confederation be prepared and transmitted to the respective Colonies for their consideration and approbation.8
Die Annahme der Resolution verzögerte sich um fast einen Monat, weil diverse Delegierte sich von ihren Kolonialparlamenten nicht autorisiert sahen, über eine Unabhängigkeit zu entscheiden, also die Umwandlung der jeweiligen Kolonie in einen eigenständigen Staat. Aber bereits direkt nach der Annahme des Antrags verkündeten die Zeitungen in Pennsylvania, dass der Kongress die „United Colonies“ zu unabhängigen Staaten erklärt hätte. Und schon am 4. Juli 1776, also nur zwei Tage nach der Annahme von Lees Antrag, erfolgte die Annahme der Unabhängigkeitserklärung durch den Kongress. Doch unterschied diese sich vom Lees Antrag in einigen Punkten deutlich, nämlich insbesondere hinsichtlich der Frage, ob hier ein neuer Staat entstand oder eine Anzahl von Staaten, die sich zu einem befristeten und kündbaren Bündnis zusammengefunden hatten.
Waren die dreizehn Kolonien durch die Annahme von Lees Antrag oder durch die zweite später erfolgte Annahme der Unabhängigkeitserklärung nun also zu einem unabhängigen Staat oder wenigstens unabhängigen Staaten geworden? Und war dies legitim geschehen? Diese Fragen lassen sich auf mehrere Arten beantworten: völkerrechtlich, innenpolitisch, außenpolitisch.
7.2. Die Unabhängigkeitserklärung von 1776 aus Sicht des Völkerrechts
7.2.1. Voraussetzungen eines Sezessionsrechts
Einschränkend muss man zunächst sagen, dass ein normativer Charakter des Völkerrechts nach wie vor strittig ist.9 Eine einfache Parallele zum innerstaatlichen Strafrecht ist sicher nicht gegeben. Wohl aber kann man Analogien heranziehen, um besser die Legitimität einer zwischenstaatlichen Handlung zu beurteilen. Es ist dies die Frage nach der Legitimität von Handlungen, denn von Legalität kann man hier wegen der fehlenden Verbindlichkeit weiter Teile des Völkerrechts ohnehin zumeist nicht sprechen. Und es erscheint fraglich, ob heutzutage Staaten moralisch verpflichtet sein können oder durch internationale Verträge und Abkommen hinreichend gebunden sind, um dem Völkerrecht im bi- und multilateralen Miteinander der Staaten einen rechtsähnlichen, normativen Charakter zu verleihen. Im Verständnis des 18. Jahrhunderts bildete dies jedenfalls keinen Konsens und bis heute halten viele Autoren nicht Rechtskonformität, sondern Wahrung und Mehrung der eigenen Macht für die vordringliche Bestimmung und das primäre Sollen eines Staats.10
Immerhin: Wenn die Unabhängigkeitserklärung eines Volkes bereits einen neuen Staat entstehen ließe, dann wäre die Welt um zahlreiche Staaten reicher, könnten Kurden, Katalanen und Uiguren ein bisschen besser, Türken, Spanier und Chinesen hingegen eher schlechter schlafen. Die wesentliche Ursache, dass das nicht so ist, liegt darin, dass das Völkerrecht kein Sezessionsrecht im eigentlichen Sinne kennt. Wenn zwei Völker in einem Staatsgebilde zusammenleben, geht das Völkerrecht davon aus, dass das auch so zu bleiben hat. Dies gilt umso mehr dann, wenn keine der beiden Nationen auf einen eigenen Staat in der Vergangenheit verweisen kann.11
Eine Minderheit der Völkerrechtler sieht hingegen ein Sezessionsrecht dann gegeben, wenn das allgemein anerkannten Selbstbestimmungsrecht eines Volks durch das Zusammenleben mit einem anderen in einem gemeinsamen Staat aktuell und auch auf absehbare Zeit massiv eingeschränkt ist. Dies träfe zum jetzigen Zeitpunkt z.B. auf die Uiguren im Nordwesten Chinas zu. Hingegen ist eine Abspaltung eines Teils des Staatsvolkes von einem ungeliebten anderen Teil vollkommen inakzeptabel, wenn es sich nicht um zwei in Tradition, Sprache, Geschichte usw. deutlich unterscheidbare Völker handelt. Aber sogar wenn zwei Völker identifizierbar sind, ist eine Abspaltung nicht statthaft, wenn beide Völker bereits über eine langen Zeitraum im selben Staatsgebiet gelebt haben und für keinen von beiden eine akute, existenzielle Bedrohung wahrnehmbar ist.
Für die Gründung der USA wäre zunächst zu prüfen, ob in den Dreizehn Kolonien ein eigenständiges Volk existierte, das mit dem britischen Volk oder den britischen Völkern – Engländer, Waliser, Schotten, Iren – bis dahin in einem gemeinsamen Staat lebte. Nur wenn dies bejaht werden kann, stellen sich zwei weitere Fragen, nämlich
ob in Großbritannien das Selbstbestimmungsrecht dieses Volkes der dreizehn Kolonien massiv und dauerhaft in einer Weise eingeschränkt war, dass die verfügbaren Mittel und Prozesse der Willensbildung eine Verbesserung auf absehbare Zeit nicht zu ermöglichen versprachen;
ob dieses Volk der dreizehn Kolonien nur für eine Episode in Großbritannien lebte, aber eigentlich eine lange, eigenständige Geschichte vorzuweisen hatte.
Natürlich kann man diese Fragen nicht nur aus heutiger Sicht stellen. Sollte man zu der Ansicht gelangen, dass aus heutiger Sicht des Völkerrechts die Unabhängigkeit der dreizehn nordamerikanischen Kolonien nicht legitim war, bleibt immer noch die Frage, ob auf Grundlage und Kenntnis des im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts geltenden Rechts bzw. im Licht der völkerrechtlichen Diskurse dieser Zeit die Bewohner der dreizehn Kolonien berechtigterweise annehmen durften, dass die Sezession rechtlich unbedenklich sei. Und man muss fragen, ob, wenn schon in der Realität das Selbstbestimmungsrecht nicht wesentlich bedroht war, die Bevölkerung der nordamerikanischen Kolonien immerhin legitimerweise zu dieser – wiewohl falschen – Ansicht gelangen konnte.
7.2.2. Ethnische Identität und dauerhaft bedrohtes Selbstbestimmungsrecht als Voraussetzungen eines Sezessionsrechts zur Zeit der Unabhängigkeitserklärung
Thomas Jefferson verwendete einen Trick, um wenigstens in den Dunstkreis von Sezessionsfähigkeit zu kommen. Er begann die Unabhängigkeitserklärung mit einem seitdem oft wiederholten Satz:
„When in the course of human events, it becomes
necessary for one people to dissolve the political
bands which have connected them with another,
and to assume among the powers of the earth, the
separate and equal station to which the laws of nature and of nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they
should declare the causes which impel them to the
separation.“12
Zunächst einmal wird im heutigen Sprachgebrauch die Verkündung der eigenen Unabhängigkeit mit dem hier verwendeten Begriff „declare“ belegt. Ein Staat, ein Verein, ein Mensch usw. „erklärt“ seine Unabhängigkeit, wenn er sie eigentlich „verkündet“. Diese Verkündung war in den späteren USA schon erfolgt, als am 04. Juli die Declaration of Independence verabschiedet wurde. Jeffersons Dokument sollte erläutern bzw. die Gründe dessen darlegen, die bereits zuvor auf Basis des Antrags von Richard Henry Lee verkündet worden war, nämlich die Unabhängigkeit der im Kontinentalkongress vertretenen Kolonien. Dies entsprach ganz dem Geist der Aufklärung, grundsätzlich das eigene Handeln vernunfthaft erklären und insbesondere Herrschaftsakte – im Gegensatz zur Willkürherrschaft – begründen zu können.
Gleich in der Präambel der Unabhängigkeitserklärung spricht Jefferson hingegen von einem Volk, das sich genötigt sieht, die Bande zu einem anderen Volk zu lösen. Jefferson kannte aber die entsprechenden Passagen in John Lockes grundlegendem Werk zur Staatstheorie, welches ansonsten die wichtigste Formulierungshilfe für die Propagierung der Unabhängigkeit wurde. John Locke schrieb über den Gesellschaftsvertrag als Grundlage jedes Staates:
„And thus every man, by consenting with others to
make one body politic under one government, puts
himself under an obligation, to every one of that society, to submit to the determination of the majority,
and to be concluded by it; or else this original
compact, whereby he with others incorporates into
one society, would signify nothing, and be no compact, if he be left free, and under no other ties than
he was in before in the state of nature.“13
Damit ist eine Sezession explizit ausgeschlossen, wenn der sich abtrennende Teil kein eigenes Volk umfasst, sondern Teil eines Gesamtvolks ist. Und offensichtlich sah das ein großer Teil der Bevölkerung der dreizehn Kolonien, erst recht der anderen nordamerikanischen Kolonien genauso. Denn als 1783 der Krieg zu Ende ging und Großbritannien gezwungen war, die Unabhängigkeit der USA anzuerkennen, hatten Zehntausende von Einwohnern der Kolonien, insgesamt ca. 3% der Bevölkerung, ihre bisherige Heimat verlassen. Viele gingen freiwillig, andere wurden von den Anhängern der Sezession, häufig unter Anwendung von Gewalt und mit gesetzlicher Rückendeckung vertrieben. Wahrscheinlich mehr als 30.000 Anhänger der Krone hatten zudem im Krieg auf Seiten der britischen Armee gedient. Das alles spricht nicht dafür, dass 1776 eine ethnische Trennung vollzogen worden wäre, sondern dass ein politischer Bruch erfolgte, ehe dann in der Folge ein Volk in den jetzt unabhängigen ehemaligen Kolonien entstehen konnte.
Aber wenn man Jeffersons Argumentation folgte, selbst dann wäre ein Sezessionsrecht, wie oben erwähnt, völkerrechtlich noch nicht gegeben. Zudem wäre hier ein Präzedenzfall geschaffen, der es faktisch unmöglich gemacht hätte, die Sezessionisten von 1861 zum Verbleib in der Union zu zwingen. Und tatsächlich ist von diversen Autoren in der Rechtfertigung der Sezession der Südstaaten immer wieder auch der Bezug zu den Beschlüssen des Zweiten Kontinentalkongresses hergestellt worden.
Der gerade erst angenommene Antrag, den Richard Henry Lee am 07.06. eingebracht hatte, sah offensichtlich mehrere Staaten entstehen, die sich zu einem Bund zusammengeschlossen hatten. Auch die Rezeption der meisten Zeitgenossen folgte zunächst dieser Linie. Jefferson hingegen sprach von nur einem Volk, nicht von Völkern. Und damit stellt sich die Frage, ob die Bevölkerung der dreizehn im Kontinentalkongress vertretenen Kolonien eigentlich ein eigenes Volk darstellte, welchem allein, wenn überhaupt, in völkerrechtlicher Hinsicht ein Sezessionsrecht zugebilligt werden kann.
Es besteht keine durchgehende Einigkeit, wann man völkerrechtlich überhaupt von einem „Volk“ in diesem Sinne sprechen kann.14 Aber einige Merkmale eines solchen Volks sind weitgehend unstrittig. In diesen muss die aus dem bisherigen gemeinsamen Staat ausscheidende Gruppe sich eindeutig unterscheiden von der Gruppe, von der sie segregiert werden soll. Also muss nachgewiesen werden, dass hier eindeutig zwei Völker A und B in einem Staat vereint sind, den mindestens eins der beiden Völker jetzt aber verlassen will.
Damit eine Gruppe von Menschen in diesem Sinne als Volk bezeichnet werden kann, sind folgende Merkmale wesentlich:
eine eigenständige, also eine in Semantik und Grammatik autonome Sprache,
ein territorialer Verbund,
eine gemeinsame, aus Geschichte, Literatur, Kunst, Liedern usw. gebildete kulturelle Identität,
ein Bekenntnis der Menschen dieses Volks zu demselben.
Diese Merkmale sind offensichtlich so diffus, der Begriff „Volk“ zudem politisch so befrachtet, dass viele Ethnologen und Historiker ihn inzwischen insgesamt ohnehin vermeiden und allenfalls von „Ethnien“ sprechen, was aber auch nicht viel mehr ist als die griechische Version. Denn „ἔθνος“ ist im Griechischen nichts Anderes als „Volk“ im Deutschen oder „people“ im Englischen.
In einer liberalen Auslegung kann man jede Gruppe von Menschen, die sich selbst als solches empfinden und von anderen als solches empfunden werden, als „Volk“ bezeichnen. Vielleicht sogar jede Gruppe, von der ersteres, aber nicht notwendig auch das zweite gilt.
Das wirft aber für das Jahr 1776 die Frage auf, ob die Bewohner der Kolonien sich mehrheitlich als Teil des britischen Volks, als eigenständiges, nordamerikanisches Volk oder als mehr oder weniger den Kolonien zuzuordnende Völker empfanden. Und man muss auch fragen, welche Bedeutung die Idee einer nationalen Identität zu dieser Zeit für die Bewohner der Kolonien eigentlich hatte. Denn für lange Zeit war die Zugehörigkeit zum Herrschaftsbereich einer Dynastie die wesentliche Frage für die Zusammengehörigkeit von Menschen. Auch für das späte 18. Jahrhundert muss man wohl annehmen, dass stärker als heute die territoriale Zusammengehörigkeit und die Frage des Souveräns, also in der Regel des Monarchen, eine erhebliche Bedeutung hatten für die Frage, ob eine Gruppe von Menschen als Volk bezeichnet werden kann.
7.2.3. Aspekte einer ethnischen Identität im Vorfeld der Amerikanischen Revolution
Kann Jeffersons Formulierung legitim vertreten werden? Gab es 1776 ein Volk, welches sich dann in Sezession vom britischen Volk die USA als Zusammenlebensmodell und Staat schuf? Hierzu sollen nachfolgend die wesentlichen Merkmale eines eigenständigen Volks auf ihre Gültigkeit im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts untersucht werden.
a. Territorialer Verbund
Der Kontinentalkongress versammelte Vertreter aus dreizehn der britischen Kolonien an der nordamerikanischen Ostküste. Damit waren also nicht alle diese Kolonien vertreten. Es fehlten die weiter nördlich gelegenen Kolonien Upper Canada, Lower Canada, Newfoundland, St. John‘s Island, New Brunswick und Nova Scotia, ebenso die Vertreter der beiden Kolonien in Florida.15 Folglich war eine territoriale Identität faktisch kaum gegeben.
b. Eigenständiger Souverän in der Geschichte
Der Souverän der nordamerikanischen Kolonien war Georg III., also der britische König. Das war – anders als in Schottland, in Irland, in Québec oder auf St. John’s Island – in den dreizehn Kolonien völlig unstrittig. Entsprechend richtete sich die Unabhängigkeitserklärung weitgehend gegen den König, dem Jefferson die Errichtung einer Tyrannis über die Kolonien vorwarf. Damit bestätigte er zugleich, dass jedenfalls zu diesem Zeitpunkt Georg III. und mithin seine Vorgänger die Rolle von Monarchen über die Kolonien hielten. Entsprechend fehlte dann aber auch diese Basis, um von einem eigenständigen Volk zu sprechen, dem allein ein Sezessionsrecht zukommen kann. Denn einen Herrscher über Nordamerika hatte es in der Tradition der Kolonien nie gegeben, auf denen Vermächtnis man sich hätte berufen können, wie die Schotten etwa auf Bonnie Prince Charlie, die Iren auf Brian Boru oder heute die Uiguren auf Iltimis Kutluq Bilge-Kül und seine Nachfolger. Folglich fehlte ein weiteres, vor allem den Zeitgenossen als zentral erscheinendes Merkmal eines eigenständigen Volks.
c. Sprachliche Identität
Im seiner Erzählung „The Canterville Ghost“ beschreibt Oscar Wilde Mrs. Otis, die Mutter der Protagonistin in folgender Weise:
„Indeed, in many respects, she was quite English, and was an excellent example of the fact that we have really everything in common with America nowadays, except, of course, language.“16
Diese Formulierung von 1887 suggeriert in satirischer Weise, die in England bzw. in den USA gesprochene Sprache hätte sich in mehr als hundert Jahren zu zwei eigenständigen Sprachen ausdifferenziert. Jenseits der Frage, wie sehr das für Oscar Wildes Zeit galt oder wie weit das heute als richtig bezeichnet werden kann, war die im Kontinentalkongress, war die in den dreizehn Kolonien gesprochene Sprache unzweifelhaft dieselbe wie in Großbritannien, jedenfalls wenn man das Englische meint und nicht die keltischen Sprachen, die als Gaeilge in Irland und z.T. in Newfoundland, als Cymraeg in Wales, Kernowek in Cornwall, Manx auf der Isle of Man gesprochen wurden. Im Gegenteil war die englische Sprache ein wesentliches Element für die dreizehn Kolonien, um sich einerseits von der französisch sprechenden Bevölkerung von Lower Canada und anderereits von den zu dieser Zeit noch mächtigen indigenen Völkern der Ostküste, vor allem den Haudenosaunee (Six Nations), also dem zu dieser Zeit aus sechs Stämmen bestehenden Bund der Irokesen abzugrenzen.
Dass die Sprache nicht als Trennungsmerkmal für das späte 18. Jahrhundert herhalten kann, mag man auch daraus folgern, dass noch in den 1790er Jahren ca. 85% aller Einwanderer in die USA aus den United Kingdoms kamen, sofern man die Opfer des – vorwiegend auf der Verschleppung von Westafrikanern beruhenden – Sklavenhandels außer Acht lässt. Fast 60% aller Einwanderer kamen dabei aus England und brachten nicht nur grundsätzlich ihre Heimatsprache mit, sondern z.T. auch ihre lokalen Dialekte, die sich z.T. erst über Generationen in den USA verloren. Insofern ist das US-amerikanische Englisch eigentlich ein von englischen Dialekten befreites Englisch, aber keinesfalls eine eigenständige Sprache.
d. Kulturelle Identität
Eine kulturelle Identität der dreizehn Kolonien lässt sich für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts nur sehr eingeschränkt behaupten. Zwar grenzten sie sich deutlich gegen die katholischen Frankokanadier im Norden ab, ebenso gegen die ihnen benachbarten indigenen Völker, deren Staatsgebiete sich mindestens teilweise mit dem der Kolonien überlappten. Dies betraf zu diesem Zeitpunkt vor allem die Haudenosaunee (Six Nations), die Tsalagi (Cherokee) und die Shaawanwaki (Shawnee). Aber die Kolonien grenzten sich von diesen ab, indem sie eine im Wesentlichen englische Kultur propagierten, mit englischen Gebräuchen, diversen religiösen Richtungen, die aber fast alle irgendwo zwischen Anglikanismus und Puritanismus standen, mit englischen Festtagen, Musik und Literatur.
Eine eigenständige US-amerikanische Literatur etwa entstand erst im 19. Jahrhundert mit den Werken von Ralph Waldo Emerson, Edgar Allan Poe und Nathaniel Hawthorne.17 Zwar gab es schon im Zusammenhang mit der Revolution eine fulminante Entwicklung der Literatur in den Kolonien. Aber diese war in Form und Bildsprache noch eindeutig Teil der britischen Literatur, auch wenn sie geradezu euphorisch die Revolution, ihre Führer oder insgesamt das neu geschaffene Land feierten. Dies galt etwa für Philip Freneau oder die Werke der Hartford Wits, einem losen Verbund von Intellektuellen, deren wichtigster Autor wohl Timothy Dwight war. Auch die ersten nennenswerten Romanautoren, James Fenimore Cooper und Washington Irving standen noch deutlich unter britischem Einfluss, vor allem dem von Walter Scott. Ebenso war es erst Walt Whitman, der ab der Mitte des 19. Jahrhunderts eine eigenständige US-amerikanische Lyrik in die Welt brachte. Aber alle diese Autoren waren 1776 noch nicht einmal geboren.
Auch andere Zweige kulturellen Schaffens standen zur Zeit der Revolution – wenn es sie denn überhaupt gab – deutlich unter europäischem, vor allem englischen Einfluss. Dies betraf u.a. die erste nennenswerte Malergruppe in den USA, die Hudson River School, die ohnehin frühestens Mitte der 1820er Jahre mit Thomas Cole und Asher Brown Durand ihren Anfang nahm. Andere Zweige der Kunst, vor allem Bildhauerei und Plastik, emanzipierten sich erst im 20. Jahrhundert von ihren europäischen Wurzeln.
Ähnliches galt auch für die Musik in den USA. Hier lässt sich am deutlichsten zeigen, dass eine eigenständige Kunstform in den USA eine Emanzipation von den europäischen Vorbildern verlangte, aber auch, dass dies am ehesten gelingen konnte, wenn man hierzu aus anderen Quellen zu schöpfen bereit war. Dies waren in der Musik vor allem die Einflüsse der afroamerikanischen Kultur, aus denen letztlich Gospel, Blues und Jazz entstanden. Eine solche Adaption war naturgemäß erst dann möglich, wenn man das Dogma einer unbedingten Überlegenheit der eigenen „Rasse“ über schwarze oder – in geringerem Umfang – auch indianische Bevölkerungsteile zu hinterfragen begonnen hatte. Aber zwischen der Revolution und dem Ende der Indianerkriege, z.T. weit darüber hinaus und bis heute, diente und dient dieses Dogma der Legitimation eines politischen und wirtschaftlichen Primats und wäre daher vor allem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kaum überwindbar gewesen.
e. Das Selbstbild der Bevölkerung in den dreizehn Kolonien nach 1770
Es ist natürlich schwierig, das Selbstbild von mehr als zwei Millionen Menschen zu bestimmen, selbst wenn man auf diese mit heutigen Verfahren von Meinungsforschung, Social Networking usw. zugehen kann. Dennoch ist man nicht völlig ohne Hinweise für die Gründerjahre der USA. Es gibt diverse Briefwechsel, eine umfangreiche, wenn auch qualitativ nicht immer ganz überzeugende Literatur, es gibt die Protokolle der Beratungen in den Einzelparlamenten der Kolonien wie im Kontinentalkongress.
Nimmt man dies zusammen, war die Sezession insgesamt eine Idee, welche die Nation spaltete. Aber die Annahme, die Bevölkerung der dreizehn Kolonien stelle ein eigenes, eigenständiges Volk dar, wäre bei den meisten Zeitgenossen auf blankes Unverständnis gestoßen. Allenfalls hätte man zugestimmt, dass durch die Revolution und die Unabhängigkeitserklärung eine Chance entstanden sei, dass sich die Bevölkerung nach und nach zu einer eigenständigen Nation entwickle. Aber auch den Zeitgenossen Jeffersons war wohl bewusst, dass seine Einleitung der Unabhängigkeitserklärung eher das mittelfristige Ziel des Werdens zu einem Volk oder einer Nation implizierte. Die durch die Formulierung nahegelegte Idee, diese Nation existiere bereits, war aus damaliger wie heutiger Sicht nur sehr wenig plausibel.
7.2.4. Die Völker Nordamerikas
Jeffersons eingangs erwähnte Formulierung, wo er von einem „Volk“ sprach, krankte neben den aufgeführten Beschränkungen aber noch an ganz anderer Stelle. Wenn man annimmt, es habe ein „Volk“ in den dreizehn Kolonien gegeben, dessen Interessen im Kontext der britischen Kolonialorganisation nicht hinreichend umgesetzt werden konnten, so impliziert dies eine 1:1-Korrelation zwischen dem britischem Volk und dem Volk der dreizehn Kolonien. Daher bezeichnet die Unabhängigkeitserklärung das britische Volk als „brethren“. Zu diesen Brüdern soll das verwandtschaftliche Band durchschnitten werden, sodass sie danach den Status anderer Nationen einnehmen würden, also „Enemies in War, in Peace Friends.“
Aber erstens war die Bevölkerung der dreizehn Kolonien kaum ein eigenes Volk, zweitens war auch das britische Volk bei weitem keine homogene Masse, sondern bestand mindestens aus Engländern, Schotten, Walisern, Iren, von den Bewohnern anderer Kolonien gar nicht zu reden. Oder von den Sklaven, die es im britischen Herrschaftsbereich zu dieser Zeit noch zu Zehntausenden gab.18 Aber die Krone hatte auch hinsichtlich Nordamerikas es nicht nur mit einem Volk zu tun. Auf dem Boden der dreizehn Kolonien lebte neben dem von Jefferson propagierten Volk eine größere Anzahl weiterer Nationen. Die Bewohner von Québec waren durch die Eroberung der französischen Regionen von Kanada zwar Briten geworden. Aber es existierten weiterhin diverse indigene Stämme, vor allem die oben bereits erwähnten Stammesstaaten der Haudenosaunee, der Tsalagi und der Shaawanwaki. Zusätzlich waren die afrikanischen Sklaven ja nicht nur in die Karibik, sondern auch in die nordamerikanischen Kolonien verschleppt worden. Damit bestand auf dem Terrain der dreizehn Kolonien eine weitere Bevölkerungsgruppe, die mit gleichem Recht beanspruchen konnte, als Volk bezeichnet zu werden. Zwar war auch hier eine ethnische Identität nicht uneingeschränkt gegeben.19 Aber andererseits handelte es sich bei den nordamerikanischen Sklaven auch durchaus nicht um die kultur- und traditionslose Masse, als die sie in vielen Publikationen bis heute dargestellt wird. Die Sklaven brachten ihre Kultur aus Afrika mit, und dies war beileibe keine hochgradig heterogene Ansammlung verschiedenster Kulturen. Denn die weitaus meisten Sklaven dieser Zeit stammte, soweit sie nicht überhaupt bereits in Nordamerika geboren worden waren, aus Westafrika. In der großen Mehrheit waren es Kriegsgefangene und Sklaven, die im Zuge der Expansion des Oyo-Reichs oder dann durch dessen Zusammenbruch ihre Freiheit verloren hatten.20 Damit gehörten sie aber in ihrer großen Mehrheit zu den Yoruba oder zu den Fon. Verbindende Kulturelemente entstanden mithin nicht erst in Nordamerika, sondern waren bereits aus den westafrikanischen Siedlungsräumen mitgebracht worden.
Angesichts dieser Gemengelage in Nordamerika, wo man legitim von mehreren Dutzend Völkern sprechen kann, war das von Jefferson propagierte Volk, wenn überhaupt, nur eines, dessen Interessen auch nicht allein deshalb schon höher zu werten gewesen wären, weil es mit ca. 2,8 Mio. Mitgliedern das größte dieser Völker gewesen wäre. Denn die Idee des Selbstbestimmungsrechts der Völker sieht nicht vor, dass die Interessen kleiner Völker geringer als die großer Völker zu gewichten seien.
Jefferson bzw. der erste Kontinentalkongress erhoben damit einen Alleinvertretungsanspruch für einen Siedlungsraum, den das hier propagierte Volk mit anderen Völkern teilte. Vielleicht wollte Jefferson auch deshalb die Sklaverei mit der Unabhängigkeitserklärung abgeschafft sehen, was jedoch am Widerstand der südlichen Kolonien scheiterte. Und die Rolle der indianischen Staaten, welche in diesen Gebieten bereits existierten, wäre damit ohnehin nicht zu lösen gewesen.21
7.2.5. Bedrohung des Selbstbestimmungsrechts
Wenn im vorangegangenen Abschnitt gesagt worden ist, dass es Ende des 18. Jahrhunderts in den dreizehn Kolonien kein eigenständiges Volk gab, so erübrigt sich die zweite Frage eigentlich, nämlich die, ob in der konkreten Situation das Selbstbestimmungsrecht eines Volks unmittelbar bedroht oder schlicht nicht gegeben war und dieser Umstand auch nicht auf absehbare Zeit mit den vom bisherigen Staat vorgesehenen Mitteln hätte überwunden werden können. Dennoch lohnt ein kurzer Blick, in welcher Hinsicht die Bevölkerung der späteren USA sich tatsächlich einem solchen Druck ausgesetzt sah.
Die beiden Menschenrechtspakte der UNO, welche 1977 nach hinreichender Ratifizierung in Kraft traten, formulieren gleichlautend in Art. 1:
1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.
2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence.
Geht man allen Zweifeln zum Trotz davon aus, dass es in den Kolonien ein eigenständiges Volk gegeben habe, fragt sich, wie weit das hier umrissene Ideal eines selbstbestimmten Volks bedroht war. Als Merkmale hierfür können verschiedene Umstände herangezogen werden, welche in anderen Fällen herangezogen worden sind, um die Selbstbestimmtheit eines Volkes als bedroht anzusehen.
Die oben angeführten UN-Artikel nennen sieben wesentliche Kriterien, welche freilich im konkreten Fall weiter präzisiert werden müssen:
freie Entscheidung eines Volks über seinen politischen Status
ungehinderte Verfolgung seiner ökonomischen Entwicklung
ungehinderte Verfolgung seiner sozialen Entwicklung
ungehinderte Verfolgung seiner kulturellen Entwicklung
freie Verfügung über die im Siedlungsgebiet vorkommenden natürlichen Ressourcen und Bodenschätze
Unantastbarkeit der vorhandenen Lebensgrundlagen
Waren nun diese Elemente einer Selbstbestimmtheit des Volkes der dreizehn Kolonien im Vorlauf der Unabhängigkeitserklärung deutlich und dauerhaft bedroht oder eingeschränkt?
a. Die freie Entscheidung eines Volks über seinen politischen Status