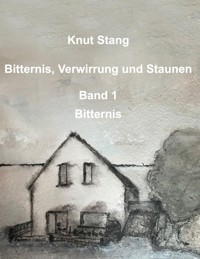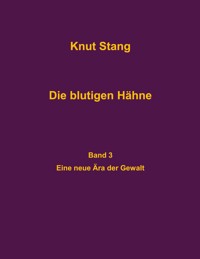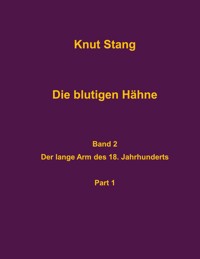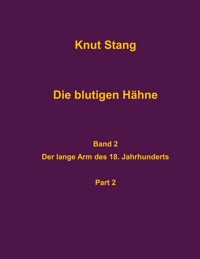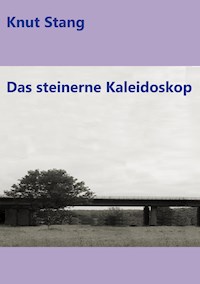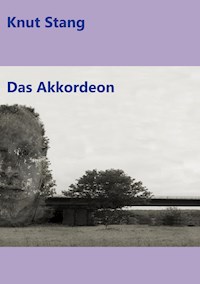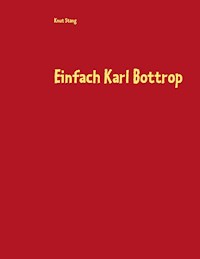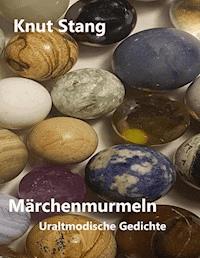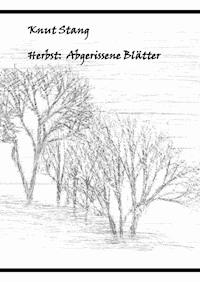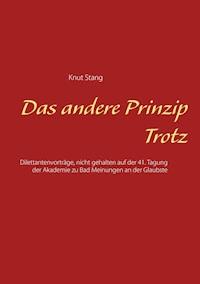Die blutigen Hähne: Beiträge zu Herrschaft, Legitimation und Kooperation - Band 1: Das Ich, die Anderen, das Recht in der Geschichte E-Book
Knut Stang
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zehn Jahre nach "Das andere Prinzip Trotz" der aktuelle Tagungsband der Akademie zu Bad Meinungen an der Glaubste. Mit einem deutlichen Schwerpunkt auf aktuelle, vor allem sicherheitspolitische und völkerrechtliche Fragestellungen. Themen sind u.a. eine Einschätzung zur Gründung der USA aus völkerrechtlicher Sicht, eine Zusammenstellung der Präsidenten der USA, soweit sie zur Republikanischen Partei gehörten, und eine historische Analyse zur Geschichte des Ukraine-Kriegs und zu Genese und Rolle der Hamas im Nahen Osten. Zudem erfolgt eine systemtheoretische Bewertung des Klimawandels, vor allem auch mit Blick auf sicherheitspolitische Fragestellungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Lied von der Moldau
Am Grunde der Moldau wandern die Steine
Es liegen drei Kaiser begraben in Prag.
Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine.
Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag.
Es wechseln die Zeiten. Die riesigen Pläne
Der Mächtigen kommen am Ende zum Halt.
Und gehn sie einher auch wie blutige Hähne
Es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt.
Am Grunde der Moldau wandern die Steine
Es liegen drei Kaiser begraben in Prag.
Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine.
Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag.
Bertolt Brecht
Inhalt
1. Karl Bröcker: Zum Geleit
2. Arlt Neeskens: Vorbemerkung
3. Pieter Skrait: Einleitung dieses Teilbands
4. Susanne Pustner: Die Verteidigung des Völkerrechts als antifaktische Sollensbestimmung
5. Stephen Ereman: Achilles und das Gift
6. Kell Burns: Solipsismus und Komplexität
7. Bertha Graanz: Die Gewalt und das Böse – das Böse und die Gewalt
8. Guido Bertoldsheimer: Kazys Škirpa als Gesandter der litauischen Republik
9. Ulf Kiernan: Physik, Forensik und Geschichtswissenschaft
10. Hans-Helmut Köchler: Überlegungen zur Motivlage der Täter im NS-Terror
11. Doris Bregnitz: Multilaterale Strategiebildung
12. Torben Remeck: Die gezähmte Revolution: Die Reformation in Bremen und der Aufstand der Männer
13. Harald Gudmunsson: Fragmentierung und Autonomie
14. Karl Germelmann: Tiger und Dachs - Tomoyuki Yamashita und das Ende der 14. Kaiserlichen Armee
1. Karl Bröcker: Zum Geleit
Meine sehr verehrten Damen und Herren, geschätzte Anwesende, bestimmt hat es irgendwann einmal eine Dekade gegeben, von der die Menschen mit Überzeugung sagten, sie sei kaum anders gewesen als die Jahre oder auch Jahrzehnte zuvor. Ich fürchte jedoch, mindestens solange die Stadt Bad Meinungen die Ehre hat, Ihre schöne Jahrestagung zu beheimaten, hat wohl niemand eine solche Zeit erlebt.
Es wäre daher zu leicht, Sie auf dieser Tagung zu begrüßen, die in ungewöhnlichen Zeiten stattfindet, da man das wahrscheinlich am Anfang jeder Tagung der Akademie hätte sagen können. Aber selbst wenn es vielleicht nur der eigenen Egozentrik geschuldet ist, scheint mir doch das Anderssein unserer Tage radikaler, existenzieller als je zuvor, und das zurück bis in Tage, wo es auch diese ehrwürdige Akademie noch nicht gab.
Sie wissen vielleicht, dass dies mein erstes Jahr als Oberbürgermeister von Bad Meinungen ist, mithin auch mein erster Versuch, die Geleitworte unserer Stadt für Ihre Tagung zu entrichten. Sehen Sie mir also meine Unzulänglichkeiten dies eine Mal noch nach. Beim nächsten Mal wird es vielleicht schon besser gehen.
Die Andersartigkeit unserer Tage scheint mir wesentlich in der existenziellen Befragung nicht nur unseres menschlichen So Seins, sondern unseres menschlichen Seins schlechthin beschlossen zu liegen. Fünfzig Jahre, gar nicht so viel mehr, sind Sie, ich, unsere Eltern, vielleicht noch unsere Großeltern mit Brandfackeln durchs Haus gelaufen und haben jeden Vorhang, jedes Sofa, jeden Kleiderschrank in Brand gesetzt. Gut, die Brandfackeln waren Autos, Industrieschlote, Heizungen und Rinderherden, aber gestatten Sie mir, in diesem Bild zu bleiben. Denn nun dämmert es uns langsam, dass das Haus, dass rings der Garten, dass die ganze Straße rauf jedes Haus in hellen Flammen steht. Wir ahnen mühsam, dass es an uns ist, das Feuer zu löschen. Doch anscheinend ist es schon zu viel verlangt, wenn man vorsichtig andeutet, man könnte mal als erstes vielleicht die Fackeln ein wenig kleiner halten, mit denen wir noch immer weitere Feuer entfachen.
Ich bin mir sicher, dass diese Fragen auch an Ihrer Tagung nicht spurlos vorbei gehen werden. Umso mehr freue ich mich darauf, hier und da als stiller Zuhörer mir auch den einen oder anderen Vortrag anhören zu dürfen.
Ich wünsche mithin uns allen spannende Vorträge, im Anschluss an jeden Vortrag eine rege Diskussion, und nicht zuletzt freue ich mich natürlich darauf, Sie am Abend des zweiten Tagungstages auf dem Akademieball wiederzusehen.
Vielen Dank.
2. Arlt Neeskens: Vorbemerkung
2.1. In schwieriger Zeit
Jede Tagung ist von ihren Teilnehmern anders als alle anderen zuvor empfunden worden. Die diesjährige Tagung auch. Die diesjährige Tagung mehr als jede andere zuvor.
Wir haben das schon im Vorfeld gespürt. Es sind uns von Mitgliedern und Vertrauten der Akademie nie zuvor so viele Beiträge angeboten worden, die sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit der aktuellen politischen Lage, ihrer historischen Entwicklung und dem Zukünftigen befassen. Wir haben daher nach intensiver Diskussion beschlossen, keine Auswahl unter den Beiträge, zu treffen, sondern nach dem ersten, etwa breiter gefassten Themenfeld der Vorträge am zweiten Tag die Beiträge zur Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts zu versammeln. Denn hier lässt sich in der Gesamtschau eine wesentliche Erkenntnis der meisten Tagungsteilnehmer historisch herleiten, nämlich die Bedeutung des Völkerrechts als vielleicht schwachem, aber doch einzigen Instrument zur Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft.
Einigen Beiträgen des zweiten Tagungstags, die nun auch im vorliegenden zweiten Teilband versammelt sind, kann man eine weit über tagesaktuelle Fragen hinausgehende Kritik an den USA entnehmen. Unser Ziel war jedoch nicht, eine Fachtagung zu US-amerikanischer Geschichte, Politik oder Soziologie ins Leben zu rufen. Da gibt es bereits mehrere sehr gute Adressen. Nein, ein weiteres Mal hat uns gerade der laienhafte Zugang unserer Referenten zu ihren Themen neue Aspekte und Sichtweisen eröffnet.
Gerade hinsichtlich dieser Beiträge wird man unser Vorgehen einmal mehr kritisieren. Naturgemäß war Grundlage ihrer Ausführungen kein Besuch in US-amerikanischen Archiven. Sie fußen lediglich auf gedruckten Beiträge der Forschung und natürlich auf dem im Internet verfügbaren Bestand von entsprechenden Quellen, den diverse Archive erfreulicherweise in immer größerem Umfang bereit stellen.
Aber auch die an die Vorträge anschließenden Diskussionen haben gezeigt, dass hier nicht eine Art dumpfer Antiamerikanismus der späten 1960er Jahre oder die Propaganda des Warschauer Pakts gegen die USA eine Renaissance erlebt hätten. Sondern dass die Auseinandersetzung mit den USA an vielen Stellen auch von großer Sympathie für dieses Land und tiefem Respekt geprägt war. Und von der Einsicht, dass eine erfolgreiche Gestaltung der Zukunft, ja ein Überleben der Menschheit ohne oder womöglich gegen die USA kaum vorstellbar ist. Wie sehr diese Zukunft heute bedroht ist, wie sehr wir aber auch schon jetzt in einem ungesunden Zustand fortgesetzter Beunruhigung leben, darauf haben uns dann am dritten Tag sehr aktuelle Beiträge hingewiesen. Hier ging es um den Klimawandel, aber auch um das aus der steigenden Bedeutung von Künstlicher Intelligenz erwachsende Risiko für das demokratische Paradigma oder um die aktuellen Konflikte in der Ukraine und im Gaza-Streifen. Insbesondere die Beiträge dieser dritten Gruppe waren dann so wichtig, dass wir das diesjährige Treffen in Bad Meinungen um einen Tag verlängert haben, auch auf dringenden Wunsch der meisten Anwesenden. Unser Dank gebührt mithin den vielen Helfern im Hintergrund, nicht zuletzt der örtlichen Verwaltung und der lokalen Hotels, dies spontan ermöglicht zu haben. Dieser dritte Tagungstag, der vor allem der aktuellen Situation unserer Welt galt, hat uns alle aber auch sehr ernüchtert, ja betroffen die Rückreise aus Bad Meinungen antreten lassen. Denn die Welt rast an uns vorbei, dass wir ihr nur staunend, mitunter bedauernd, immer öfter geradezu entsetzt zuschauen können. Nicht zuletzt dies war für alle Teilnehmer wie auch für das ausrichtende Komitee eine bittere Lehre, in deren Licht weniger als jemals zuvor in den letzten Jahrzehnten die Tagung freudevoll und beschwingt zu Ende gehen konnte. Aber wir sind stolz, dass so viele mutige und die Kritik nicht scheuende Grenzgänger aus diversen Wissenschaften sich auch in diesem Jahr wieder zusammen gefunden haben, um einander, und durch diese drei Teilbände vielleicht auch noch viele weitere Menschen, mitzunehmen auf die eigene Reise in einem jedem Einzelnen bis dahin weitgehend unbekannte Teil seiner, unserer Welt. Und das gilt dann wieder auch für die Tagung insgesamt, und für die Welt, in der wir leben: Unsere Welt ist eine Reise, aus dem Unbekannten, das wir nur in geringen Teilen erahnen, manchmal erforschen können, in ein Unbekanntes, das uns, wo wir es ahnen, leider einmal mehr in Angst versetzt. Dem wir jedoch nichts erwidern können als das unbedingte Miteinander der Wissenschaften, der Menschen in ihnen und der Menschen insgesamt. Denn mehr als dies haben wir nun einmal nicht, und niemand als nur wir selbst kann antreten, um die Nöte dieser Welt zu lindern.
2.2. Was uns leitet
Die Dilettantenvorträge der Akademietagungen in Bad Meinungen werden sicher nie eine wissenschaftliche Institution im intellektuellen Diskurs auch nur der deutschsprachigen Länder werden. Das ist einerseits verständlich, andererseits aber auch bedauerlich. Umso beruhigender, dass nicht wenige der in den vergangenen Jahrzehnten veröffentlichten Beiträge später noch den Weg in andere Publikationen gefunden oder sich sogar zu veritablen Monografien erweitert haben. In allen Fällen aber war es gerade der in Bad Meinungen seit Gründung der Akademie vertretene Ansatz eines Überschreitens lieb gewordener Grenzen, welche die Qualität dieser Beiträge wesentlich beförderte.
Nun leben wir in einer Zeit, in der das Überschreiten von Grenzen leider eine ganz andere Dimension gewonnen hat. Und zugleich scheinen viele Menschen genau deshalb in ihrem eigenen Denken wie auch im Umgang mit anderen die Grenzen nur umso stärker zu befestigen. Das mag verständlich sein; klug ist es nicht.
Daher fragt sich, wie aktuell populäre Begriffe, vor allem Strategie, Gewalt und Legitimation, aus ungewohnten Perspektiven neu betrachtet, neu verstanden, neu hinterfragt werden können. Nicht in allen Beiträgen bilden diese Themen das Leitprinzip; das passt zum breiten Ansatz der Akademie. Trotzdem halten wir diese Fragen unserer diesjährigen Tagung für aktueller denn je. Warum?
Regierungen tun abscheuliche Dinge. Zu allen Zeiten, in allen Erdteilen. Mal mehr, mal weniger. Aber es gab keine Zeit – soweit wir wissen jedenfalls – wo das nicht der Fall war.
Wir reden hier von Dingen, die auch schon von den Zeitgenossen als abscheulich wahrgenommen und auch so bezeichnet wurden. Das Entsetzen angesichts von Massakern, Genoziden, Vertreibung, planhafter Vergewaltigung, Zerstörung von Kulturgütern, Ausplünderung usw. ist also nicht die Erfindung einer angeblich ach so verzärtelten Post-Auschwitz-Generation, sondern verbindet Menschen durch Zeitalter und über den gesamten Erdball hinweg.
In vielen, oft emotional ausgetragenen Diskussionen wird jedem, der den Blick über die Stacheldrahtzäune der deutschen Konzentrationsund Vernichtungslager weitet, vorgeworfen, die Singularität der Shoah relativieren zu wollen. Das wäre tatsächlich aller Kritik wert, wenn man den Ausdruck „relativieren“ als „belanglos, zum historischen Normalfall machen“ versteht. Doch eigentlich meint „relativieren“ die Dinge in Relation zu setzen und auf ihre Beziehungen, Ähnlichkeiten, aber auch Besonderheiten hin zu betrachten.
Auf der Akademietagung wurden die Hörer, in den nachfolgend abgedruckten Beiträgen wird der Leser immer wieder mit solchen Abscheulichkeiten konfrontiert sein. Bekannteren wie der Shoah, aber auch anderen Ungeheuerlichkeiten. Etwa jenen, welche die japanischen Truppen bei der Eroberung von Nanking 1937 oder Singapur 1942 begingen. Dem Massenmord durch Unterlassen, den man der britischen Regierung im Rahmen des Great Famine in Irland 1845-1849 anlasten muss. Oder den Millionen von Toten im Kongo, die auf das Konto des belgischen Königs Leopold II. gehen.
Wir wissen alle, dass die Liste solcher Verbrechen durch die Menschheitsgeschichte hindurch lang ist. Dass sich gewiss Pol Pot, Stalin, Bahattin Şakir und Cemal Azmir, wahrscheinlich auch Dschingis Khan oder Attila problemlos in diese Reihe aufnehmen lassen. Aber dann gewinnt man vielleicht den Eindruck, wir hielten nur deswegen so entschlossen an der Singularität der Shoah fest, um nicht die Frage beantworten zu müssen, was eigentlich grundsätzlich zu solchen genozidalen Phänomenen führt. Ob sie nicht die Gattung Mensch als solche, seine Organisation in Stämmen und Staaten, mindestens aber Organisationsformen wie Militär oder Konzerne fragwürdig machen. Ist der Genozid nur eine exaltierte Form dessen, was Menschen in ihrem täglichen Leben, was Staaten in ihrer Geschichte, was Armeen in ihrem Tagewerk ohnehin tun? Und lässt sich das dann irgendwie überwinden?
Denn eins ist klar: Armeen tun abscheuliche Dinge. Immer. Als Gesamtgruppe, als Verband, als Einheit, als Einzelperson. Auf Weisung der Regierung. Mit Wissen der Regierung. Oft auch der heimischen Bevölkerung. Gegen den Widerstand der Regierung. Ohne Kenntnis der Regierung. Oder der heimischen Bevölkerung.
Die Gestalt dieser Abscheulichkeiten wechselt mitunter, vor allem aufgrund der Entwicklung neuer Waffen. Ein Flächenbombardement einer Großstadt war in der Spätantike annähernd unmöglich; die bekannten Waffen wie Ballisten und Katapulte trugen nicht weit genug und richteten auch vergleichsweise wenig Schaden an. Aber die Grundnatur der entfesselten Gewalt, die sich dann – seitens der Führung gewollt oder mindestens geduldet, manchmal aber auch im Nachhinein geahndet – gegen Unschuldige richtet, lässt sich immer und überall beobachten, wo Menschen – meist Männer – gegeneinander in den Krieg ziehen. Was auch immer man dann meint, wenn man die Opfer dieser Gräuel als unschuldig bezeichnet. Als könne es auch Opfer geben, die angesichts vorheriger Taten zu Recht, nämlich schuldig, Opfer von Vergewaltigung, Genozid usw. werden könnten oder womöglich zu anderer Zeit, an anderer Stelle tatsächlich waren.
Nun ist das Begehen von Abscheulichkeiten keine Privileg von Armeen, leider. Zivile Institutionen tun abscheuliche Dinge. Seit es Gerichte, seit es eine Polizei, seit es Priesterkasten, Kirchen usw., seit es Gilden, Zünfte, Clubs, Vereine gibt, findet sich eine unendliche Menge moralisch verwerflicher Dinge, die hier ihren Ursprung genommen haben. Dabei sind zivile Institutionen mehr als andere Organisationsformen in der angenehmen Situation, dass es immer Menschen aus der Mitte der Gesellschaft gibt, die sich ihnen zugehörig fühlen und daher ihr Handeln mehr oder weniger bedingungslos unterstützen. Es ist ja das „Wir“ und nicht das „Die da“, was da handelt. Aber damit fühlen solche Institutionen bzw. ihre Mitglieder sich oft auch weniger als alle anderen in der Pflicht, ihr Handeln moralisch zu rechtfertigen oder gar zu hinterfragen.
Wissenschaftler tun abscheuliche Dinge. Es gibt kaum eine Wissenschaft, deren Lehren, Theorien, Thesen, Meinungen, Annahmen, Hypothesen nicht schon zur Begründung von Entrechtung, Mord, Unterdrückung, Naturzerstörung und Vertreibung herangezogen worden sind. Oder die sogar die Mittel bereitgestellt hat, um all diese Abscheulichkeiten überhaupt erst Wirklichkeit werden zu lassen.
Falls jemand meint, wenigstens für die Astronomie gelte dies nicht, so muss man sehen, dass dies eigentlich nur der linke Arm einer über Jahrtausende untrennbaren Einheit von Astronomie und Astrologie ist. Was aber im Namen der Astrologie schon an Lügen, Begründungen für blutige Kriege, Morde usw. verbrochen worden ist, wäre zweifellos genug Stoff für ein eigenes Buch von nicht geringem Umfang.
Menschen tun abscheuliche Dinge. Offensichtlich ist alles, was oben angeführt worden ist, sind all die furchtbaren Dinge, die Regierungen und Staaten, die Armeen und Verbände tun, immer wieder eigentlich Abscheulichkeiten, die Menschen tun. Aber zugleich tun Menschen auch abscheuliche Dinge, die sich letztlich weder einem Regierungsauftrag, einer Ideologie, einer Religion oder einem Konzern als eigentlichem Urheber zuweisen lassen. Menschen betrügen, rauben, foltern, vergewaltigen, morden, soweit die Kriminalgeschichte zurückreicht, ohne mehr als allenfalls ein fadenscheiniges Deckmäntelchen aus der Mottenkiste von Ideologie und Religion zu zerren. Und es ist durchaus nicht nur und nicht in allen Fällen die nackte Habgier, die sie antreibt. „Follow the money!“ ist zwar ein gutgemeinter Ratschlag an junge, aufstrebende Journalisten, Kriminalisten, Historiker. Aber eigentlich ist es auch ein hochgradig blöder Satz, weil er die komplexe menschliche Motivlage auf das verkürzt, was das neoliberale Buchhaltergehirn für den alleinigen Motor der Welt identifiziert zu haben glaubt: Geld.
Wenn aber alle Abscheulichkeiten, die von Institutionen, von Staaten, von übernationalen Verbänden wie den Kirchen in der Vergangenheit ausgegangen sind und offensichtlich nach wie vor ausgehen, letztlich auf Menschen als Akteure zurückzuführen sind, so fragt sich, ob diese kollektive Gewalt durch Begreifen des Individuums verstanden werden kann. Anders gesagt, ist die Gewalt ausübende Gemeinschaft mehr als die Summe ihrer gewaltausübenden Teile? Gibt es eine kollektive, womöglich gar eine institutionelle Gewalt, die sich nicht aus individueller Gewalt zusammensetzt, sondern allenfalls diese individuelle Gewalt nutzt, aufstachelt, mit scheinbarer Legitimation versieht?
Die meisten einfachen Dinge in der Welt sind völlig harmlos. Ein paar Gramm Blei, in eine Letter gegossen, machen keinen Schaden. Auch ein paar Dutzend dieser Lettern sind harmlos, wenn man sie nicht gerade in eine Schleuder lädt und damit auf Spatzen oder Rehpinscher zielt. Aber wenn man ein paar tausend dieser Bleilettern in der entsprechenden Weise zusammenstellt und noch Tinte und Papier hinzufügt, so hat man am Ende vielleicht den „Malleus Maleficarum“, also das Handbuch der Hexenjäger von 1486, hat Hitlers „Mein Kampf“ oder die Bauanleitung einer Autobombe. Doch selbst diese Dinge sind für sich harmlos, Hitlers schwülstiges Pamphlet sogar ein wenig lächerlich. Allein zusammen mit anderen Elementen, einer entsprechenden Geisteshaltung vieler Menschen, einer Bereitschaft zu exzessiver Gewalt usw. entsteht eine unheilvolle Mischung, die keinem der Protagonisten, noch nicht einmal einem Henricus Institoris oder einem Adolf Hitler, in die Wiege gelegt war.
Also entsteht durch die Agglomeration von Menschen, vielleicht aber auch durch die Institutionalisierung dieser Agglomeration und ihre Persistenz durch Jahrhunderte, womöglich Jahrtausende etwas, dessen Wirken aus den Bestandteilen allein nicht erklärt werden kann. Dann aber fragt sich, ob diese abscheulichen Handlungen von Institutionen, Staaten, Kirchen, Konzernen usw. gelegentliche Entgleisungen dieser an sich sinnvollen Agglomerationen sind. Oder ist die Abscheulichkeit ein unabdingbares Grundelement dieser Agglomerationen, auch wenn sie sich mal stärker, mal schwächer äußert und oft genug eingeschlafen, ja entschwunden scheint? Die mal so, mal so begründet wird. Die mal im Geheimen wirkt, aber oft genug auch das Licht der Öffentlichkeit nicht nur nicht scheut, sondern sich in demselben stolz und selbstbewusst sonnt. Und ist die Gewalt der Institutionen dann nur etwas, was Einzelmenschen in die Welt bringen, um das, was sie ohnehin tun wollten, mit größerer Macht, besserer Legitimation und insgesamt erfolgreicher zu verfolgen? Oder ist in der institutionalisierten Abscheulichkeit der Einzelne in seinen Motiven und Haltungen letztlich austauschbar? Weil es eben nicht der einzelne Buchstabe oder die Giftigkeit von Blei war, was den Albtraum der Hexenverfolgungen bewirkt hat.
2.3. Die Abscheulichkeit der Agglomeration
Es ist dies die Hypothese, die in den nachfolgenden Vorträgen dieser Tagung den Hintergrund bilden wird. Die Agglomeration, vor allem aber die Institutionalisierung der Agglomeration vermag Abscheulichkeiten zu gebären, zu der einzelne Menschen, auch in großen Gemeinschaften, nie und nimmer in der Lage wären. Dass freilich diesem allen – und am schlimmsten im uniformierten Mörderberuf des Soldaten – die stillschweigende Botschaft an den Einzelnen erst zum Erfolg verhilft: „Was sonst dir stets und strikt verboten, hier darfst du’s tun und erntest, bist du nur erfolgreich, vielleicht sogar noch Orden, Ruhm und eine sichere Rente!“
Nun ist ein solcher Blick auf die von Institutionen verübten Abscheulichkeiten nie geeignet, die Hypothese als solche hinreichend zu stützen. Es finden sich zu vielen dieser Abscheulichkeiten andere Beispiele, wo dieselbe Organisation, derselbe Staat, Kirche, ja sogar Konzerne oder Heeresverbände auch ganz wunderbare, selbstlose, rettende Handlungen vollzogen haben. Das allerdings relativiert nicht den Anfangsverdacht, der dem allen zugrunde liegt, dass zur Idee der institutionalisierten, dauerhaften Agglomeration als solcher unabänderlich die Fähigkeit, mehr noch, die Neigung zur Abscheulichkeit gehört. Dass folglich die jeweilige Institution, wie auch immer sonst sie beschaffen ist, was auch immer sonst sie tut oder getan hat, die Abscheulichkeit in ihrem Besteckkasten immer bereit hält. Und man nie sicher sein kann, dass sie davon nicht eines Tags Gebrauch machen wird. Selbst wenn sie bisher als noch so friedfertig erschien.
Doch wir werden im Folgenden auch noch einem anderen Aspekt dieser unerfreulichsten Kapitel der Geschichtsbücher begegnen: Fast immer sind diese umwoben von einem dichten Gespinst aus Legenden, Mythen und schlichten Lügen. Die britische Besatzungspolitik in Irland, die litauische Verklärung der Kollaboration zwischen 1941 und 1944, aber auch unser heutiger Umgang mit Klimawandel und klimabedingten Existenzrisiken zeigen vergleichbare Tendenzen. Dass nämlich die herrschenden Kreise, dass aber immer wieder auch jeder einzelne von uns bereit ist, zu lügen oder doch jedenfalls den allfälligen Lügen zu glauben, die uns das Leben so viel angenehmer machen. Bis hin zur US-amerikanischen Geschichte, vor allem im 20. Jahrhundert, wo gezielte Mythenbildungen und mehr oder weniger plumpe Lügen anscheinend geradezu ein Hauptinstrument der Politik waren – und allem Anschein nach auch weiterhin sind.
Es wird deutlich werden, dass man diese Lügengeflechte nur los wird, wenn man versteht, dass Bequemlichkeit kein geeignetes Kriterium ist, um richtig und falsch zu unterscheiden. Das Unbequeme kann genauso falsch, genauso richtig sein wie das Bequeme. Aber wenn man bereitwillig alles glaubt, solange es nur hinreichend bequem und nützlich scheint, wird man in diesem Dickicht aus Lügen und Phrasen und Mythen irgendwann ersticken. Und es vielleicht noch nicht einmal bemerkt haben. Weil nicht mehr erstickt ist als das eigene Denken. Und unser aller Freiheit.
3. Pieter Skrait: Einleitung dieses Teilbands
Pieter Skrait hat die schwierige Aufgabe dankenswerterweise nicht gescheut, den nachfolgenden Beiträgen in gewissem Maß einen roten Faden zu verleihen. Das ist ihm bereits mit seinem einleitenden Vortrag zu Beginn der Tagung so gut gelungen, dass wir uns entschlossen haben, seine Ausführungen ohne Abänderungen in den Tagungsband aufzunehmen. Seine sonstige Tätigkeit als Journalist hat ihm dabei zweifellos das Finden überzeugender Formulierungen erleichtert. Aber da er ansonsten vor allem Artikel über Perspektiven der Informationstechnologie und ihre politischen Implikationen verfasst, hat er hier doch ein eindeutiges Bewusstsein für weit darüber hinausgehende Fragestellungen bewiesen.
3.1. Herrschaft, Gewalt und Legitimität
Herrschaft, Gewalt und Legitimität – drei verbreitete Begriffe, die gerade in unseren Tagen vermehrt wieder herangezogen werden, wenn wir die sich um uns herum wandelnde Welt in ein traditionelles Interpretationsschema zu pressen versuchen.
Was meinen wir, wenn wir von „Herrschaft“ sprechen? Was meinen wir, verwenden wir den Ausdruck „Gewalt“? Und was ist gemeint, wenn man das eine oder das andere als „legitim“ bezeichnet?
Herrschaft ist nichts, was man besitzt. Es ist etwas, was man mehr oder weniger kontinuierlich über wenigstens eine andere Person ausübt, indem man ihr sagt, was sie zu tun hat, während diese Person keine oder allenfalls nur sehr wenige Möglichkeiten besitzt, sich dem zu entziehen. Wenn unter zwei gleich freien und mit gleichen Machtmitteln ausgestatteten Menschen einer dem anderen sagt, was er tun soll, ist der so Angesprochene grundsätzlich frei in seiner Entscheidung, ob er entsprechend handeln wird oder nicht. Herrschaft basiert also auf einer ungleichen Verteilung von Machtmitteln, die es dem einen erschwert, sich frei zu entscheiden, und es dem anderen erleichtert, den ersteren zu einem gewünschten Handeln zu veranlassen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Machthabende von der ungleichen Machtverteilung Gebrauch macht. Sie steht als Menetekel immer im Hintergrund, da nützt alles egalitäre Kaschierung wenig. Entsprechend herrschen Eltern über ihre Kinder, auch wenn sie versuchen, diesen auf Augenhöhe zu begegnen. Unternehmensführer herrschen über ihre Angestellten, was der Begriff „Mitarbeiter“ kaum übertünchen kann. Und natürlich üben auch demokratisch gewählte Regierungen Herrschaft über das Volk aus, selbst über diejenigen, die bei der letzten Wahl an entsprechender Stelle das Kreuz gemacht hatten. Machtmittel können vielerlei Gestalt annehmen. Hierbei ist zunächst zu unterscheiden zwischen der bloßen Androhung des Einsatzes von Machtmitteln und der tatsächlicher Anwendung. Dabei ist die bloße Androhung des Einsatzes eines Machtmittels nicht davon abhängig, dass dieses Mittel tatsächlich vorhanden ist. Die diversen Religionen dieser Welt sind Beispiele für die Androhung der Verwendung von Machtmitteln, über deren bloße Existenz man bei nüchterner Betrachtung doch einigermaßen im Zweifel sein kann.
Des Weiteren ist ein Machtmittel immer eine mehr oder weniger domestizierte Form von Gewalt. Allerdings muss diese Gewalt nicht notwendig direkt, physisch und unmittelbar sein. In der jüngeren Diskussion hat insbesondere Johann Galtung darauf hingewiesen, dass direkte und strukturelle Gewalt einander nicht wesensfremd sind.
Wenn Machtmittel immer Voraussetzung von Gewalt sind und Herrschaft immer auf einer impliziten oder expliziten Anwendung von Gewalt beruht, dann beruht Herrschaft immer auf direkter oder struktureller Gewalt. Eine gewaltfreie Form von Herrschaft ist damit ein Widerspruch in sich.
Dennoch gelten manche Formen der Herrschaftsausübung in der Regel als legitim, andere hingegen nicht. Daher fragt sich, was legitime Herrschaftsausübung sein kann, nach welchen Kriterien dieses Attribut also zugewiesen wird.
Dem Wortsinne nach ist alles legitim, was kein Gesetz bricht. Dabei versteht man diesen Begriff meist nicht nur unter Bezugnahme auf Vorgaben der Legislative, also auf Gesetze im engeren Sinne, sondern zieht Verbindungen zu moralischen Setzungen und religiösen Prinzipien. Das ist der gängige Unterschied zum Begriff „legal“, der lediglich die Konformität einer Handlung zu positivem Recht, also Gesetzen und ähnlichen Vorgaben konstatiert. Die Legitimitätsfrage stellt sich hingegen vor allem dort, wo eine Haltung oder eine Handlung nicht dem Erwartungskonsens der Mitmenschen entspricht, aber dennoch nicht in Kollision mit den entsprechenden Gesetzen gefunden wird. Umgekehrt, Gesetze sind per definitionem legal, wenn sie nicht mit anderen, höher bewerteten Gesetzen, also z.B. den Vorgaben der Verfassung, kollidieren. Dennoch wird man ein Gesetz als illegitim bewerten, wenn es bei aller formalen Legalität den moralischen Setzungen und gesellschaftlichen Mehrheitsmeinungen zuwider läuft. Entsprechend wird der Ausdruck „legitim“ gern dort verwendet, wo eine Vorgabe zugunsten einer als höherwertig oder wichtiger eingeschätzten Vorgabe gebrochen wird. So bezeichnen die meisten Deutschen den Anschlag vom 20. Juli 1944 als völlig legitim, obgleich er natürlich geltendem Recht zuwider lief. Man sieht hier ganz offensichtlich eine Legitimität einem Prinzip entstammen, welches oberhalb des damaligen Strafgesetzes angesiedelt wird. Umso perfider übrigens, dass der mit der Verfolgung der Verschwörer beauftragte Volksgerichtshof in allen entsprechenden Verfahren selbst das ohnehin rudimentäre Prozessrecht des NS-Staats vor allem hinsichtlich der Rechte des Angeklagten oder der Beweispflicht der Staatsanwaltschaft mit Füßen trat. Die dort aktiven Richter behaupteten zudem, im Sinne einer höheren Gerechtigkeit zu handeln, also letztlich dem Rechtsgefühl des Volks weit mehr als dem geschriebenen Recht verpflichtet zu sein. Damit behauptete man, dass die dort ergangenen Urteile vielleicht nicht durchweg lupenrein legal, aber in jedem Fall hochgradig legitim gewesen seien.
Das ist natürlich eine Haltung, die heute – hoffentlich – unverändert allenfalls eine Minderheit der Gesellschaft teilt. Stattdessen sehen wir heute Gewalt nicht als legitim an, wenn sie zwar zum Zwecke der Herrschaftsausübung angedroht oder tatsächlich angewendet wird, aber mit einer der moralischen oder rechtlichen Setzungen des jeweiligen Gemeinwesens kollidiert, ohne dass man eine Rechtfertigung aus einer übergeordneten Regel gewinnen könnte.
Nun waren auch die schlimmsten Verbrecher unter den zahlreichen Herrschern dieser Weltgeschichte selten um den Beruf auf ein höheres Prinzip, einen göttlichen Auftrag, eine Einrichtung der Vorsehung verlegen, welche es ihnen nun mal gänzlich unmöglich mache, den ansonsten natürlich hoch gehaltenen Gesetzen und Regeln der menschlichen Gesellschaft gerate in diesem Moment Folge zu leisten. Die Kreuzfahrer brüllten ihr „Deus lo vult!“ ebenso bereitwillig wie die braunen Mörder ihr „Sieg Heil!“ und die islamistischen Selbstmordattentäter auf der ganzen Welt ihr „Allahu Akbar!“ Daher ist die Entscheidung über die Legitimität von Gewalt und damit auch die Legitimität der mit ihrer Hilfe erreichten Herrschaft über andere Menschen nur transparent, wenn sie auf einen offen gelegten Regelkanon Bezug nimmt.
Folglich kann Herrschaft nur legitim sein, wenn die ihr unabdingbar innewohnende Gewalt im Kontext der jeweiligen lokalen Regelsetzungen grundsätzlich gerechtfertigt werden kann. Dies kann von Mensch zu Mensch, von Kultur zu Kultur, von Epoche zu Epoche ganz unterschiedlich ausfallen. Für einen Minimalkonsens aller Menschen ist es daher hilfreich, sich zu fragen, ob man auf der ganzen Welt und zu allen Zeiten bestimmte Formen von Gewalt, bestimmte Formen von Herrschaft gleichermaßen als ungerechtfertigt, als illegitim bezeichnet hätte.
Beschlagnahmt ein Regent das geringe Vermögen eines seiner Untertanen nicht im Interesse des Gemeinwohls, sondern lediglich zur persönlichen Bereicherung, so wird man sicher lange suchen müssen, um jemanden zu finden, der das als legitim bezeichnet. Und dennoch werden völkerrechtlich in keiner Weise gerechtfertigte Eroberungen immer wieder legitimiert, ja glorifiziert, etwa jene, die man mit Alexander dem Großen, Julius Cäsar oder Friedrich II. verbindet. Zwar mag man anführen, dass zwischenstaatlich es keine illegitime Gewalt geben könne, da dies Kriterium nur innerhalb einer Gemeinschaft anwendbar sei. Aber abgesehen von hilflosen Apologeten ruhmgierender Potentaten glaubt das niemand ernsthaft. Ein Reh im Wald etwa gehört keinesfalls zum nationalen Gültigkeitskontext moralischer Regeln und Normen. Dennoch werden die meisten Menschen es als illegitim bezeichnen, dieses Tier mit einer Drahtgerte tot zu prügeln. Also gelten Illegitimitätskriterien offensichtlich auch dann, wenn das Opfer dieser Gewalt nicht zu jener Gemeinschaft gehört, welche diese Kriterien als Teil ihres virtuellen, weil nie offiziell geschlossenen Gesellschaftsvertrags vereinbart hat.
3.2. Legitime Gewalt
Wenn also jede Herrschaft eine Form von Gewalt ist und Gewalt von Fall zu Fall als illegitim angesehen werden muss, dann fragt sich, welche Kriterien über den Begriff „legitime Gewalt“ entscheiden. Was muss der Fall sein, damit Formen von Gewalt, Formen von Herrschaft als legitim bezeichnet werden können?
Einzelfälle legitimer Gewalt kennt fast jeder. In aller Regel liegt ihnen eine Notwehr oder Notrettung zugrunde. Jemand schützt sich oder einen anderen vor illegitimer Gewalt, indem er ihr Gewalt entgegensetzt. Also ist die Abwehr illegitimer Gewalt legitim, die hier zum Tragen kommende Gewalt somit ebenfalls legitim.
Das wirft aber zwei Probleme auf: Zum einen geht nach dieser Definition illegitime Gewalt der legitimen Gewalt immer voraus. Das macht es erforderlich, illegitime Gewalt besser als nur über ein allgemeines Unbehagen angesichts bestimmter Handlungen zu definieren. Dies umso mehr, als dieses Unbehagen Moden, emotionalen Schwankungen und dem Narrativ des Einzelfalls unterworfen zu sein scheint. Als Marianne Bachmeier 1981 am dritten Verhandlungstag im Gerichtssaal den mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter erschoss, waren zahlreiche hierzu befragte Bürger überzeugt, im Sinne eines übergesetzlichen Gerechtigkeitsprinzips habe sie legitime Gewalt ausgeübt. Hier lag keine Gefährdungssituation vor, die Gewalt gegen ihre Tochter lag fast ein Jahr zurück, es war auch zu diesem Zeitpunkt nicht abschätzbar und insgesamt vergleichsweise unwahrscheinlich, dass der geständige Täter freigesprochen oder auch nur – schon wegen entsprechender Vorstrafen – mit irgendeiner milderen Strafe als lebenslänglich mit anschließender Sicherungsverwahrung davonkommen würde. Bachmeier handelte nach eigenem Bekunden auch nur teilweise aus Rachegedanken, vor allem wollte sie den Beschuldigten daran hindern, zum Verhalten ihrer Tochter Aussagen zu machen. Sie beschaffte sich eine Feuerwaffe, was in dieser Zeit noch alles andere als einfach war. Sie schoss das vollkommen wehrlose Opfer in den Rücken, insgesamt siebenmal. Ein achter Schuss ging fehl.
Obwohl hier alle Merkmale von Mord vorlagen, rückte unter dem allgemeinen Druck die Staatsanwaltschaft von der ursprünglich betriebenen Mordanklage ab. Letztlich verbrachte Bachmeier knapp vier Jahre im Gefängnis wegen Totschlags. Und bis heute gilt ihr Handeln für viele als Paradebeispiel legitimer Gewalt.
Das andere Paradebeispiel verbindet sich mit dem 20. Juli 1944. Wie schon gesagt, geht auch hier eine große Mehrheit Befragter von der Legitimität der Gewalt gegen Hitler aus, obgleich auch hier eine unmittelbare Bedrohung für niemanden im Wahrnehmungsbereich der Täter gegeben war. Und natürlich wurde hier eine große Zahl damals geltender Gesetze gebrochen. Aber: Man kann sicher sein, dass ein Erfolg des Anschlags zahlreiche Leben – allein wahrscheinlich mehrere Millionen Deutsche – gerettet hätte, die erst nach dem 20. Juli in der Endphase des Krieges ihr Leben verloren.
Aber was ist mit Wilhelm Freiherr von Ketteler, Attaché an der deutschen Botschaft in Wien, der 1938 Hitler erschießen wollte? Also anders als bei dem bekannteren Georg Elser im November 1939 zu einem Zeitpunkt, als zwar einiges auf einen neuerlichen Krieg mindestens europaweiter Dimension hindeutete, eine entsprechende Gewissheit aber nicht gegeben war. Man kann zugunsten Kettelers leider nicht anführen, er habe aus Protest gegen die Unterdrückungspolitik und vor allem die antisemitischen Maßnahmen der deutschen Regierung seine Pläne gefasst. Auch eine ex-post-Legitimierung ist hier nicht sinnvoll, da moralische Entscheidungen immer nur auf Basis des zu diesem Zeitpunkt Bekannten getroffen werden können. Wäre Ketteler also legitimiert gewesen, Hitler zu erschießen?
Ketteler wurde vom SD ermordet, bevor er seine Pläne verwirklichen konnte. Aber so wünschenswert ein Erfolg seines Vorhabens aus heutiger Sicht gewesen wäre, legitime Gewalt wäre es wohl nicht gewesen. Die Beispiele zeigen, dass Gewalt nicht aus emotionalen Haltungen heraus als legitim oder illegitim bezeichnet werden kann, dass es aber auch wenig hilfreich ist, legitime Gewalt lediglich als Abwehr illegitimer Gewalt zu bezeichnen.
3.3. Ideologisierte Gewalt
Selbst legitime Gewalt, etwa zur Abwehr von Gewalt, wird von den meisten Menschen als illegitim bezeichnet, wenn sie ein diffuses Maß von Gewalt überschreitet. So würden die meisten Menschen es als legitim bezeichnen, einen Mann zu hindern, der eine ihm unbekannte Frau in der Fußgängerzone beschimpft und sich anschickt, ihr ins Gesicht zu schlagen. Aber wenn man zur Abwehr dieser Gewalt von hinten an den Mann herantritt und ihm ohne Warnung mit einer zufällig verfügbaren Axt beide Arme an den Schultern abhackt, würde man von einer überzogenen, also illegitimen Abwehr der Gewalt selbst dann sprechen, wenn der Mann dies überlebt. Das gilt zumeist sogar, wenn man keine andere Möglichkeit gehabt hätte, die Frau vor der ihr drohenden Gewalt bzw. der schon erfahrenen verbalen Gewalt zu schützen. Also muss die Anwendung von Gewalt nicht nur grundsätzlich durch eine moralische Regel gestattet, vielleicht sogar gefordert sein. Sie muss auch verhältnismäßig sein, was zusammen darauf hindeutet, dass die Legitimitätsforderung immer auch ein Versuch ist, das innergesellschaftliche Gesamtmaß von Gewalt auf möglichst niedriger Stufe zu halten.
Kann man dann als legitime Gewalt jede Gewalt bezeichnen, die ein beliebiges Übel beseitigen soll, sofern es durch keine andere Maßnahme überwunden werden kann? Offensichtlich nicht: In der Wahrnehmung vieler Menschen ist das laute Rasenmähen ihrer Nachbarn zweifellos ein Übel, vor dem sie kein Gesetz zu schützen vermag, wenn es nicht gerade nachts geschieht. Trotzdem ist es nicht legitim, Jagd auf Kleingärtner zu machen. Andererseits ist das Leben auf der Erde, der Fortbestand der Menschheit, erst rechts von Milliarden einzelner Menschen, unzähliger Tiere usw., aber auch von Errungenschaften der letzten zehntausend Jahre durch den Klimawandel akut gefährdet. Trotzdem gewinnen viele Menschen den Eindruck, dass weltweit fast nichts getan wird, um das zu stoppen, zu verlangsamen oder wenigstens in seinen Folgen weniger problematisch zu machen. Wäre es also legitim, auf Basis dieses Eindrucks Gewalt gegen Autokonzerne, Industriekomplexe, einflussreiche Strippenzieher aus Politik und Wirtschaft nicht nur zu propagieren, sondern durch gewaltsames Handeln Realität werden zu lassen?
Natürlich lassen sich leicht Beispiele finden, wo Menschen ihre Gewalt als höchst legitim ansahen, man aber dies heute zurückweisen würde. Unter den Mördergesellen der Nazi-Diktatur gab es natürlich Tausende, die sich sehr wohl bewusst waren, dass sie gegen jeden allgemeinmenschlichen Rechts- und Gerechtigkeitskonsens handelten, gegen diverse Passagen aktuell geltender Gesetze verstießen und letztlich aus den niedersten Beweggründen stahlen, versklavten, quälten, vergewaltigten und millionenfach mordeten. Aber es gab eben auch jene, die fest überzeugt waren, aus einer höheren Pflicht heraus gegenüber Gott, der Geschichte, ihrer Rasse, Nation, Vaterland usw. eine zwar vielleicht schreckliche, aber eben auch unabdingbare Aufgabe übernommen zu haben.
Die ideologischen Mörder haben durch die Jahrhunderte immer wieder Blutbäder im Namen höherer Ideen veranstaltet. Und nur weil man die Idee der Männer nicht teilt, die am 11. September 2001 ihre islamistischen Massenmordfantasien Realität werden ließen, kann man ihnen dennoch nicht absprechen, dass sie die Legitimität ihres Tuns vielleicht lang und intensiv bei sich und im Gespräch mit anderen erwogen haben.
Ideologien, Religionen, Überzeugungen basieren auf Annahmen und intellektuellen Prozessen. Sie sind damit stets in Gefahr, obsolet zu werden, sind kulturell, politisch, sozial usw. bedingt und mindestens potenziell falsch. Eine Gewissheit wohnt ihnen nicht inne. Der Tod anderer Menschen ist endgültig, unbedingt und faktisch. Dieses Ungleichgewicht verbietet eigentliche jegliche Gewalt, die nicht der unmittelbaren Bekämpfung illegitimer Gewalt dient.
Wer meint, man müsse dem Klimawandel mit Gewalt gegen Politik und Konzerne begegnen, muss sich mithin fragen, ob diese Gewalt verhältnismäßig und ob sie alternativlos ist. Er muss prüfen, wie weit er nur einer Ideologie nachrennt. Wie weit er eine Ideologie als Deckmantel seiner Gewaltfantasien heranzieht. Und er muss sich fragen, ob seine Gewalt die Situation tatsächlich zu verbessern vermag. Symbolhafte Anschläge werden das nicht erreichen, für eine großflächige Angriffswelle gibt es aber keinerlei Infrastruktur, und die entstehenden Effekte – ökologisch, soziologisch, politisch – lassen sich kaum abschätzen. Nur dass man dann für einen Haufen Toter verantwortlich wäre, kann man getrost vorhersagen.
3.4. Gewaltmaximen
Was sind nun die Maximen, in deren Interesse Staaten oder Individuen Gewalt ausüben können, die nicht der unmittelbaren Abwehr illegitimer Gewalt dient? Vergrößerung des Staatsgebiets, Eroberung von Rohstoffvorkommen, Dezimierung verhasster Völker, Bekämpfung einer heterogenen Weltanschauung, Religion, Ideologie usw. sind hierzu nicht geeignet. Damit sind aber z.B. fast alle von Staaten seit der Antike geführten Kriege illegitim gewesen.
Als Großbritannien und Frankreich in Reaktion auf den deutschen Überfall auf Polen 1939 Deutschland den Krieg erklärten, war dies legitim, da sie einer illegitimen Gewaltanwendung mit angemessener Gewalt entgegen traten, auch wenn sie selbst nicht Opfer dieser Gewalt waren – zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Aber Beispiele wie der September 1939 sind in der Weltgeschichte einigermaßen selten. Sie stellen zudem keinen Präzedenzfall für staatliches Handeln nach innen dar, weil hier der Regelungshorizont des positiven Rechts deutlich tiefer in die Freiheit der jeweiligen Willensgestaltung eingreift als der des Völkerrechts. Damit ist aber offen, wann ein Staat Gewalt gegen seine eigenen Bürger einsetzen darf, wenn dies nicht der unmittelbaren Abwehr illegitimer Gewalt dient.
Auch hier kann man zwischen legitimer direkter und legitimer indirekter Gewalt unterscheiden. Es ist das Grundprinzip jeder Demokratie, dass es keine legitime direkte Gewalt gegen die eigenen Bürger geben kann, sofern nicht zuvor – nicht nur potenziell – von diesen Bürgern illegitime Gewalt ausgegangen ist bzw. gerade ausgeht. Hierbei haben die Gewaltträger des Staates, also vor allem die Polizei, deutlich über die Rechte des Einzelnen hinausgehende Befugnisse. Einen Platzverweis zu erteilen und notfalls dessen Umsetzung auch zu erzwingen, steht einer Privatperson lediglich in den eigenen Räumlichkeiten zu, nicht im öffentlichen Raum. Dass allerdings Polizisten auf friedliche Demonstranten einschlagen, Tränengas verwenden, sie einkesseln oder mit Wasserwerfern zu vertreiben suchen, ist hierdurch nicht abgedeckt. Selbst wenn von den Demonstranten Gewalt ausgeht, hat die Reaktion der Polizei angemessen zu erfolgen. Man darf einen Demonstranten nicht erschießen, nur weil er gegen ein Einsatzfahrzeug getreten hat. Und die Legitimität oder auch nur Legalität von Vorbeugehaft oder auf Neudeutsch Unterbindungsgewahrsam ist mindestens als zweifelhaft zu bewerten, nachgerade in Bayern, wo seit 2017 zum Schutz eines „bedeutenden Rechtsguts“ Menschen unbefristet, durch bloßen richterlichen Beschluss, aber eben auch ohne Verfahren in Haft genommen werden konnten. Seit 2021 ist dies zwar auf zwei Monate begrenzt, aber es bleibt unverändert, dass Menschen ohne bereits erfolgte Straftat im Gefängnis landen können wegen einer vermuteten Absicht, eine Bank zu überfallen oder eine Bahntrasse unbrauchbar zu machen.
Die Legitimität indirekter Gewalt ist schon deswegen schwieriger einzuschätzen, weil häufig erst durch dadurch ausgelöste Folgeprozesse die Legitimität der Regelung in Frage gestellt wird. Dafür ist das fehlende durchgehende Tempolimit auf deutschen Autobahnen ein gutes Beispiel. Die meisten Menschen würden dies spontan eher als Beleg einer Abwesenheit von struktureller Gewalt anzusehen. Der Staat übt hier – jedenfalls in diversen Abschnitten der deutschen Autobahnen – keinen Zwang auf seine Bürger aus, mindestens nicht, soweit die Geschwindigkeit hiervon betroffen ist. Aber durch das Fehlen einer entsprechenden Regelung erhöht sich deutlich die Umweltbelastung, steigt die Tendenz, große, übermotorisierte Fahrzeuge zu erwerben, nimmt das Unfallrisiko zu und steigt bei vielen Fahrern die allgemeine Stressbelastung durch eine Autobahnfahrt erheblich. Übrigens auch bei denen, die selber eher mit gemäßigter Geschwindigkeit fahren. Anders gesagt, die lokale Abstinenz des Staats, hier strukturelle Gewalt anzuwenden, führt zu gewaltähnlichen, jedenfalls lebensschädigenden Auswirkungen auf unzählige Menschen in Europa, aber letztlich auch weltweit, da die auf deutschen Autobahnen in unsinnig großem Umfang produzierten Treibhausgase den grenzüberschreitenden Verkehr leider schon immer praktiziert haben. Daher handelt es sich bei der liberalen deutschen Geschwindigkeitsregelung um einen Akt illegitimer Gewalt, der politisch und juristisch nicht tolerabel ist. Hingegen wäre ein durchgehendes Tempolimit zwar ebenfalls als strukturelle Gewalt interpretierbar, aber hier eben als legitime Gewalt, da dies zum einen einer ganz unmittelbaren Gefahrenabwehr oder wenigstens Risikominderung durchaus dienlich wäre, zum anderen aber auch einen Beitrag zu einer mittelfristigen Risikominderung für praktisch die gesamte Weltbevölkerung darstellen würde.
Damit ist staatliche Gewalt gegenüber der eigenen Bevölkerung, ob nun direkt oder indirekt, immer dann legitim, wenn sie unter Beachtung allgemeiner Maximen alternativlos der Abwehr von Gewalt dient und der dadurch herbeigeführte Zustand sich nicht als negativer als der ursprüngliche Zustand erweist. Allerdings ist die Genauigkeit und die Belastbarkeit der entsprechenden Prognosen von entscheidender Bedeutung. Je vager und je risikobehafteter die jeweiligen Szenarien sind, umso schlechter lässt sich die Anwendung von Gewalt begründen. Da dies aber für fast alle Anwendungen von direkter wie indirekter Gewalt innerhalb von Staaten gilt, ist letztlich staatliche Gewalt fast immer illegitim, selbst wenn sie von einem breiten Konsens getragen wird.
3.5. Illegitime staatliche und legitime private Gewalt
Unbeschadet des zuvor Gesagten: Staatliche Gewalt ist erstaunlich oft höchstens schwach legitimiert und begründet. Aber es gibt Akte staatlicher Gewalt ebenso wie die Institutionalisierung von Gewalt durch Gesetze, die von jeder Legitimation noch deutlich weiter entfernt sind. Spätestens hier kommt daher auch das Widerstandsrecht des Einzelnen zum Tragen, das eine wesentliche Stütze jedes demokratischen Staats ist. Es ist zwar – beliebten Ansteckern der 1980er Jahre zum Trotz – nicht so, dass wo Unrecht zu Recht, Widerstand zur Pflicht wird. Der Satz stammt übrigens nicht von Goethe oder Brecht, wie gelegentlich behauptet wird, sondern wahrscheinlich von Petra Kelly. Sie bezog sich dabei allerdings auf Leo XIII., der aus einer Kollision des positiven mit dem göttlichen Recht eine Widerstandspflicht jedes Christenmenschen ableiten wollte. Aber eine Widerstandspflicht kann es nicht geben, weil man dann wieder im Sumpf übergeordneter, metaphysisch abgeleiteter Rechtsprinzipien sich befände. Es gibt in solchen Situationen daher keine Widerstandspflicht, sondern lediglich ein Widerstandsrecht, das sich allerdings, wie letztlich auch die staatlich verübte Gewalt, in angemessener Weise, also nach dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit auszuleben hat und vor allem zunächst alle konfliktärmeren Wege begangen haben muss. Wegen einer als Unrecht empfundenen Sonderbesteuerung des eigenen Haustiers stürmt man nun einmal keine Parlamente.
Es stellt sich aber noch eine andere Frage: Was ist, wenn eine Gewaltanwendung auf den ersten Blick zwar legitim erscheint, aber ihr Erfolg mindestens zweifelhaft ist? Insbesondere dort, wo die legitime Gewaltanwendung Nebeneffekte hat, also in der verharmlosenden Militärsprache unserer Tage Kollateralschäden erzeugt, wird durch die Unwahrscheinlichkeit des Erfolgs die Gewalt doch noch illegitim, selbst wenn sie formal legal ist. Denn die Kollateralschäden – vor allem, wenn es sich um unbeteiligte dritte Personen handelt – stellen eine eigene moralische Dimension dar, die umso schwerer wiegt, je geringer die Erfolgschancen der Gewalthandlung sind. Diese Abwägung ist vor allem im Falle so gewaltiger Kollateralschäden, wie Kriege sie verursachen, von zentraler Bedeutung. Schon am ersten Tag der deutschen Invasion, am 04.04.1940, kapitulierte Dänemark angesichts der Aussichtslosigkeit eines Abwehrkampfs und der zu erwartenden Schäden an Mensch und Land, wenn Dänemark zum Schlachtfeld gemacht würde. Hingegen hat in ähnlicher Situation die Ukraine im Februar 2022 einen solch mutigen Schritt nicht vollzogen, sondern sich auf einen Abnutzungskrieg eingelassen, dessen Ausgang ungewiss, aber dessen Kollateralschäden bereits jetzt immens sind. Am Vergleich dieser beiden Handlungen wird deutlich, wie schwierig angesichts der begrenzten Vorhersagbarkeit militärischer Verläufe eine Entscheidung über die Legitimität der einen oder anderen Option ist. Wenn hingegen deutsche Offiziere noch in der Endphase des Zweiten Weltkriegs ihre Soldaten in aussichtslose Schlachten schickten, um einen längst aussichtslos gewordenen Krieg weiter zu führen, der ohnehin vom ersten Tag an hochgradig illegitim war, dann bleibt als dürftige Ausrede höchstens, dass man weder die Illegitimität dieses Krieges noch die Aussichtslosigkeit seiner Fortsetzung zu dieser Zeit auch nur als Möglichkeit erwogen hätte. Das lässt dann aber nur die Entscheidung übrig, ob diese vielen tausend Offiziere, Generäle und Politiker aller Ebenen hochgradig dumm oder hochgradig moralfrei waren.
Die meisten Menschen empfinden Respekt, ja Ehrfurcht, wenn jemand eine moralischen gebotene Option umsetzt, selbst wenn dies offensichtlich ihm selbst abträglich ist und nur eine geringe oder sogar gar keine Hoffnung auf Erfolg besteht. Aber als Regierung oder als militärische Führung einem ganzen Volk derlei Heldentum quasi anzuordnen, ist nicht ehrfurchtgebietend, sondern amoralisch und arrogant.
Nun wird man sich schwertun, für einen Krieg ausreichend Soldaten zu rekrutieren, wenn der Gegner auf Wehrpflicht baut, man selbst hingegen nur über eine Freiwilligen-Armee verfügt und beide Staaten vergleichbare viele Menschen aufweisen. Aber eine Wehrpflicht ist bereits Zwang, also Gewalt, bevor die so Rekrutieren das erste Mal auch nur einen Fuß auf Kasernenboden gesetzt haben. Damit ist Wehrpflicht per se illegitim. Wenn aber der Gegner einen illegitimen Überfall durchführt, wird dann auch Wehrpflicht legitimiert? In einer binären Welt aus Ja und Nein, richtig und falsch bliebe sie illegitim. In der realen Welt allerdings ist diese Form von Gewalt vielleicht weniger illegitim, als dem Gegner das eigene Land widerstandslos zu überlassen, die eigene Bevölkerung einem hohen Risiko von Versklavung, Vertreibung und Genozid auszusetzen.
3.6. Ausblick
Im Verlauf dieser Tagung werden Sie mehrere Beiträge hören, die eindeutig und zweifelsfrei illegitimes, sogar illegales Handeln von Einzelpersonen, aber auch von ganzen Staaten dokumentieren. Diese im rückblickenden Studium des Historikers vielleicht offen zutage tretende Illegitimität sollte uns vor allem helfen, unsere heutigen, vielfältigen Anwendungen von Gewalt mit ähnlichem Blick zu studieren. Tut man das nicht, tritt das Recht des Stärkeren an die Stelle des um moralische Begründbarkeit ringenden Handelns. Es mag sein, dass die Forderung nach Legitimität im nationalen wie internationalen Rahmen meist ungehört verhallt. Bedeutungslos ist sie dennoch nicht. Und sie immer wieder zu erheben, ist genau das, was uns eigentlich von den Maschinen des Krieges unterscheidet.
Vielen Dank.
4. Susanne Pustner: Die Verteidigung des Völkerrechts als antifaktische Sollensbestimmung
Suanne Pustner, Spezialistin für mathematische Methoden in der Soziologie, hat mit einem kurzen, emotionalen Beitrag den vorherigen Beitrag von Pieter Skrait um eine wichtige Perspektive erweitert und viele Zuhörer geradezu aufgewühlt. In der Diskussion ihrer Rede wurde deutlich, wie groß inzwischen die Zweifel an der Wirksamkeit moralischer Normen bei vielen Menschen geworden sind. Was im Zwischenmenschlichen vielleicht noch funktioniert, scheint als Regulativ oder wenigstens Korrektiv in größeren Dimensionen so gänzlich ohne Einfluss, dass man derlei Konzepten vielleicht ganz entsagen sollte. Susanne Pustner hat dem am Beispiel des Völkerrechts eine Idee entgegengesetzt, die zwar einerseits tief in der Geistesgeschichte verwurzelt ist, aber andererseits oft genug ein Schattendasein gefristet hat.
Wir geben diesen Vortrag hier in der gehaltenen Form wieder. Die wenigen einschlägigen Verweise auf andere Autoren waren bereits Teil des mündlichen Vortrags und werden hier entsprechend wiedergegeben.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit Wattebäuschchen gewinnt man keine Kriege. Und wenn man nichts anderes hat, dann kapituliert man, ehe der erste Schuss gefallen ist.
4.1. Die Schwäche und die Notwendigkeit des Völkerrechts
Das Völkerrecht ist ein Wattebäuschchen. Und etwas anderes haben wir nicht. Nichts sonst, um es einer Ideologie von Macht-stiftet-Recht entgegenzusetzen. Nichts sonst, um ein Miteinander der Nationen zu gestalten.
Viele Menschen, auch viele Politiker sagen, das Völkerrecht sei nicht autorisiert, ihr Handeln zu bestimmen. Russland, die USA und Israel haben sich hier in den letzten Jahren besonders deutlich positioniert, aber vielen anderen Staaten kann man Ähnliches nachweisen. Man kann diese Haltung daher nicht einfach vom Tisch wischen. Natürlich hat man es hier mit meist mäßig verbrämter Machtpolitik zu tun. Aber vor allem in den USA hört man immer wieder auch ein anderes Argument: Die USA ist ein mühselig und vor allem durch den Unabhängigkeitskrieg, den Genozid an den indigenen Stämmen und den Bürgerkrieg auch in viel Blut und Leid zusammengewachsener Staat. Was er sich und seinen Bürgern an Normen und Gesetzen verordnet, ist in einem demokratischen Diskurs entwickelt und verabschiedet worden. Der Weltgemeinschaft, welche das Völkerrecht verabredet, geht auf weite Strecken diese demokratische Legitimation ab. Ein Beispiel: Wenn die UN-Vollversammlung einen ihrer mehr oder weniger unverbindlichen Beschlüsse fasst, dann gehören zu den Abstimmberechtigten zahlreiche Vertreter von Diktaturen, Failed States, islamistischen Regierungen. Dies sind Staaten, denen die demokratische Legitimation nach US-amerikanischem Verständnis fehlt. Wie kann eine Mehrheit dieser Stimmberechtigten dann legitimiert sein, Bürgern der USA Regeln zu geben? Regeln, die nicht nur zwischen Staaten, sondern z.B. im Fall eines Bürgerkriegs auch zwischen den beiden Bürgerkriegsparteien gelten, obgleich diese der gleichen Nation angehören und beide keine separatistischen Ambitionen hegen?
In der Tat ist das Völkerrecht ein konsensuales Recht mit geringer normativer Kraft. Die an seiner Entstehung beteiligt waren, sind mindestens aus heutiger Sicht durchweg kaum demokratisch legitimiert gewesen. Zudem bindet das Völkerrecht auch zahlreiche Staaten, die zum Zeitpunkt, als dieses Recht gestaltet wurde, noch gar nicht existierten.
Die unzureichende Legitimation ist eindeutig der größte Schwachpunkt des Völkerrechts. Aber die Fokussierung darauf suggeriert, alle Nationen wären einander grundsätzlich feindlich und können lediglich durch rigide Normen zu kurzzeitiger Kooperation gebracht werden. Diese Normen sind dann nur pragmatisch, aber so wenig moralisch legitim wie ihr gewalthaftes Gegenteil.
Viele Ideologen in der Nachfolge von Adam Smith und Nicolo Machiavelli predigen, alles sei Kampf und Konflikt. In Wahrheit ist fast alles Kooperation und Miteinander. Wer das vergisst, konzentriert sich auf einen winzigen Aspekt seiner Welt. Wer das vergisst, kümmert sich um fast nichts, das wichtig ist. Für ihn selbst. Für die Menschen, die ihm wichtig sind. Für alle.
4.2. Moralisches Handeln
Vor fast zehn Jahren hat die damals entfallene Akademietagung ein immerhin in gedruckter Form greifbares Konvolut von Beiträgen zur Bedeutung von kontrafaktischem Trotz und norddeutscher Sturheit in der heutigen Zeit herausgearbeitet.
Aber im Krieg oder wenn ein Krieg droht, ist dann Trotz genug? Nein. Sind Wattebäuschchen genug? Ganz sicher nicht.
Wenn der Klimawandel die ganze Welt zu verschlingen droht, ist dann Trotz genug? Kaum.
Also warum an moralischen Determinanten festhalten, wenn sie nur eine sehr begrenzte Aussicht auf erfolgreiche Umsetzung haben?
Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen, ich habe dort auch die ersten Semester studiert. Ich hätte also als junge Frau auch ganz einfache Gelegenheit gehabt, einmal ein paar Häuser weiter zu gehen und ein, zwei Vorlesungen der philosophischen Fakultät zu goutieren. Habe ich aber nicht gemacht.
Erst als ich in den 1990er Jahren für eine Weile in Chile in einem Forschungsprojekt der UNESCO tätig sein durfte, nutzte ich die Gelegenheit, diesen deutschen Philosophen, Ernst Tugendhat, kennenzulernen, von dem einige Kollegen mir berichtet hatten.
Tugendhats Werk umfasst mehrere Stationen, und ich bin nicht hinreichend qualifiziert, diese Ihnen darzulegen oder gar zu würdigen. Ich will Sie nur auf einen Aspekt hinweisen, nämlich auf seine Auseinandersetzung mit der Frage, warum wir eigentlich – wenn wir es denn tun – moralisch handeln.
Schon Freud hat etwas konstruiert, dass er das Über-Ich nannte, also den Ort, an dem sich die uns mitgegebenen moralischen Setzungen versammeln. Das sind Regeln, die wir von unseren Eltern, von Lehrern, aus der Religion, aus der Gesellschaft empfangen haben. Aber diese Setzungen sind nur Regeln, die nicht motivational besetzt sind. Neben anderen hat vor allem Jonathan Hare dargelegt, dass wir immer wieder diese Regeln, die wir zunächst mehr oder weniger kritiklos übernommen haben, in Frage stellen. Manche geben wir auf oder relativieren sie wenigstens und passen sie an, eh sie uns wirklich zu eigen sind. Aber auch das beantwortet nicht die Frage, warum wir überhaupt diesen Regeln folgen. Das ist eine andere Frage als die, warum wir ihnen folgen sollen. Wir sollen ihnen folgen, weil es gut für die Gesellschaft und uns selbst als Teil dieser Gesellschaft ist, der Maximierung des Gemeinnutzens dient, das menschliche Miteinander erleichtert oder Gott wohlgefällig ist. Aber das untermauert nur eine moralische Sollensgebung durch eine andere: Handele gemäß dieser moralischen Regel, weil man gemäß moralischer Regeln handeln soll. Das ist ein Imperativ, aber keine Motivation.
Ein Beispiel: Wir wissen, dass zu stehlen gegen diese Setzungen verstößt. Aber wenn wir uns fragen, warum wir gegen dieses Verbot zu stehlen nicht verstoßen sollen, so gibt es zum einen natürlich den zweckrationalen Grund, dass wir erwischt werden könnten und die mit begrenzter Wahrscheinlichkeit eintretenden Folgen so viel negativer wären als der zu erwartende Gewinn des Stehlens, dass wir darauf verzichten. Das gilt natürlich auch dann, wenn wir die Zeche erst im Jenseits bezahlen, jedenfalls dann, wenn wir an ein Jenseits und ein mit diesem verbundenes Strafgericht glauben.
Wir könnten uns auch der kantischen Frage zuwenden, was denn wäre, wenn sich alle nach unserem Vorbild verhielten. Dass dann nämlich niemand mehr etwas schaffen würde, da in einer Welt der Diebe die Schaffenden nicht sicher sein können, auch den Nutzen ihrer Mühsal zu sehen. Anders gesagt, eine Welt der Diebe müsste verhungern.
Aber es gibt noch ein anderes Motiv, moralisch zu handeln. Was wir für uns selbst sind, ist ein Konstrukt, oder eigentlich ein bis zum Tode unabgeschlossenes Bauprojekt. Hier wird etwas angebaut, da etwas weggerissen, manchmal ein Gebäudeteil neuen Zwecken zugeführt.
Dieses Gebäude bildet nicht unbedingt die Wirklichkeit punktgenau ab. Wir sehen uns manchmal dicker, als wir mathematisch betrachtet sind. Oder dünner. Klüger. Dümmer. Gesünder. Kranker. Sehen uns als Genies, wo wir bestenfalls Mittelmaß sind. Und umgekehrt. Sehen uns als Virtuosen, wo allen anderen längst die Ohren bluten.
Aber in jedem Fall liegt dieser Baustelle, die wir sind, ein Bauplan zugrunde. Oder eigentlich diverse Fetzen von Bauplänen, von denen wir unbegründet hoffen, dass sie mehr oder weniger gut zusammen passen. Diese Baupläne beschreiben das Ist, oder was wir dafür halten, und was diese Baustelle, dieses Bauwerk sein soll. Und das ist dann eben nicht nur die Länge unserer Haare, der Umfang unserer Taille, es ist auch das Wollen, so zu sein, wie unsere moralischen Maximen uns dies nahelegen. Dies Motiv kann stärker sein oder schwächer, es steht fast immer in Konkurrenz zu anderen Motiven. Dennoch ist durch unser ganzes Leben immer auch die Frage präsent, was für ein Mensch wir in moralischer Hinsicht sein wollen und wie weit es uns gelingt, dieser Mensch auch tatsächlich zu sein.
Wer Gelegenheit hat, einen Schritt zurückzutreten, sich selbst zu beobachten, was er, sie, was man jeden Tag oder vielleicht nur gerade in diesem einen Moment tut, kommt nicht immer, aber gewiss auch nicht selten zur Frage: Was mache ich da eigentlich? Was tue ich? Das, was ich da mache, macht das ein Mensch, der so ist wie der Mensch, der ich sein will?
Fast alle Menschen popeln beim Autofahren; ich auch. Aber nur, wenn ich allein im Auto bin. Nicht nur, weil ich vor anderen nicht als Nasenpoplerin dastehen will. Sondern auch, weil in Anwesenheit anderer ich mein eigenes Handeln deutlich stärker der Prüfung unterziehen muss, welche Art Mensch ich sein, aber auch, als welche Art Mensch ich gesehen werden will.
Wir wissen alle, dass das nicht immer funktioniert. Männer prügeln ihre Frauen halbtot, während die Kinder heulend in ihren Betten sitzen. Soldaten morden auch dort, wo es gar nicht befohlen war. Wir alle oder jedenfalls fast alle fahren Autos, fliegen mit dem Flugzeug, vergnügen uns auf Kreuzfahrtschiffen, obwohl wir um die Folgen wissen und eigentlich vor uns selbst und vor anderen nicht als jemand erscheinen wollen, dem die Zukunft unserer Kinder, der Menschheit, dieses Planeten komplett egal ist. Aber: Wir haben ein schlechtes Gewissen dabei.
Nun werden Sie sagen, ein schlechtes Gewissen ist ein billiges Opfer, wenn daraus keine Taten folgen. Wohl wahr. Aber es ist ein Anfang, aus dem etwas folgen kann. Und damit sind wir wieder beim Völkerrecht: Es ist nicht Teil unserer Erziehung, ein Mensch zu sein, der dem Völkerrecht dient. Oft genug meinen wir gar, wie schon die Zehn Gebote gelten die erlernten moralischen Setzungen nur innerhalb unseres Volks, aber nicht zwischen den Völkern.
4.3. Verbindlichkeit und Recht
Offensichtlich müssen wir uns fragen, wie weit die moralischen Setzungen, die wir für uns selbst als mehr oder weniger gültig und zwingend ansehen, auch für alle anderen Menschen gelten sollen. Und wenn sie gelten, gelten sie für alle gleichermaßen?
Das Völkerrecht funktioniert nur, wenn die Gleichheit aller Staaten und eine gleichartige Bewertung ihrer staatlichen Handlungen gilt. Mehr noch, in einem Jahrhundert, wo das traditionelle Staatenkonzept sich offensichtlich an vielen Stellen weiterentwickelt, müssen diese Regeln auch dort gelten, wo staatliche Strukturen aufgebaut, Rechte und Prärogativen beansprucht werden, obgleich ein Staat im eigentlichen Sinne nicht, allenfalls eine Organisation, eine Bewegung, im schlimmsten Fall eine Mafia, eine Triade vorliegt.
Dadurch bewegt das Völkerrecht sich bedauerlicherweise auf weite Strecken in einem eher diffusen Moralbereich. Das wird noch dadurch erschwert, dass die ihm zugrunde liegenden Setzungen im Wesentlichen im Europa des XX. Jahrhunderts entwickelt worden sind und nicht einmal von allen Staaten, geschweige denn allen Bewegungen, Organisationen usw. uneingeschränkt geteilt werden. Hinzu kommt auch, dass die verwendeten Begriffen einer genauen Nachfrage meist nicht standhalten.
Natürlich ist dies Nachfragen eine probate Strategie, um andere Leute zum Schweigen zu bringen. Die meisten Begriffe entziehen sich, das weiß man spätestens seit Wittgenstein, einer genauen Definition, einer Darlegung in einem Glossar, in einem Lexikon. Sokrates musste noch den Schierlingsbecher trinken, weil er die Leute furchtbar genervt hat mit der Frage, was genau sie eigentlich meinen, wenn sie „Gerechtigkeit“ sagen, „Mut“ oder „Freiheit“. Hätte er nach Wittgenstein gelebt, wäre er vielleicht noch am Leben, weil er seine Fragen gar nicht gestellt hätte.
Wenn ein Vertreter des Völkerrechts gefragt wird, was genau er denn unter „Frieden“ verstehe, unter „Genozid“, „Unverletzbarkeit der Grenzen“, „Prinzip der Nicht-Einmischung“, dann entspringt das der unlauteren Strategie, seine Position als in den verwendeten Begrifflichkeiten nicht hinreichend definiert zu diskreditieren. Das funktioniert grundsätzlich mit jeder Idee, aber auch jeder Theorie, und zwar um so besser, je ferner diese den exakten Wissenschaften, vor allem aber der Mathematik ist. Umgekehrt muss man fragen, wie lange wir denn auf diese involatile Definition der Begriffe des Völkerrechts in einem per definitionem volatilen Rechtsraum warten sollen, bevor wir legitimerweise die Setzungen des Völkerrechts einfordern dürfen? Hat man nicht selbst in der Mathematik über viele Jahrhunderte mit schlecht bis gar nicht definierten Begriffen operiert, ehe eine allgemeine Definition sich durchgesetzt hat? Die Null etwa wird spätestens seit dem 2. vorchristlichen Jahrhundert in Babylonien, aber anscheinend auch in Ägypten verwendet. Trotzdem gibt es eine Definition der Null als neutrales Element der Addition in einem kommutativen Monoid seit kaum hundert Jahren.
4.4. Entrüstung und Moral
Es ist umgekehrt aber so, dass jedes Einfordern von Rechtsnormen hinsichtlich des eigenen Verhaltens, aber auch hinsichtlich des Verhaltens anderer einer konkreten Nutzenerwartung oder ansonsten einer allgemeinen emotionalen Motivation bedarf. Tugendhat nennt hier das Gefühl der Entrüstung: Ohne genau zu sagen, was wir an einer bestimmten Handlung eines Anderen kritisieren oder gegen welche präzise formulierten und allgemein anerkannten Regeln gerade verstoßen worden ist, führt die Kenntnisnahme bestimmter Handlungen bei uns zu Unmut, Empörung, Aufbegehren, kurz zu Entrüstung.
Entrüstung kann dabei abgeschlossenen Handlungen gelten. Jemand hat etwas getan, was man mit Entrüstung zur Kenntnis nimmt. Dasselbe Gefühl kann aber auch einer fortgesetzten Handlung gelten, ja man kann sogar entrüstet sein, dass jemand vorhat, in der Zukunft eine entsprechende Handlung zu vollziehen.