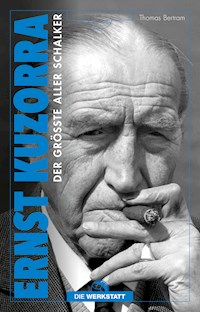9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
*** Das kleinste Buch über die großartigste Liga der Welt *** Fakten, Infos und Anekdoten aus über 50 Jahren Fußball-Bundesliga zum Mitnehmen und Mitreden über das Wichtigste am Wochenende. Wer schoss die meisten Tore, wer schoss die schönsten und wer schoss daneben? Welcher Klub holte die meisten Titel und wer sah dabei am besten aus? Warum ist im Fußball ein Viertel mehr als ein Drittel und gewinnen die Bayern wirklich immer? Titelrennen und Abstiegskämpfe, Triumphe und Tragödien, von Hamburg bis Paderborn, vom BVB bis zur Hertha – einfach alles, was Sie schon immer über die Fußball-Bundesliga wissen wollten, steht in diesem Buch. Mitreißend, legendär, kurios und passend zu jedem Trikot. »Dieses Buch ist ein echter Volltreffer!« Kult-Sportmoderator Frank Buschmann
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 256
Sammlungen
Ähnliche
Thomas Bertram
Die Bundesliga für die Hosentasche
FISCHER E-Books
Inhalt
Ein Tag ohne Fußball ist ein
verlorener Tag.
Ernst Happel
Anpfiff
Als am 28. Juli 1962 auf dem Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Dortmund die Gründung einer deutschen Profiliga beschlossen wurde, bezweifelten viele, dass dem Unternehmen großer Erfolg beschieden wäre. Zu sehr waren viele Funktionäre und Vereinspräsidenten noch dem Amateurgedanken verhaftet, zu groß war bei den Clubs noch die Anhänglichkeit an die alten Oberligen mit ihren regionalen Meisterschaften. Dass viele Spieler schon seit Jahrzehnten nur noch auf dem Papier Amateure waren, gehörte zu den liebsten Lebenslügen des deutschen Fußballs der Vor-Bundesligazeit.
16 Vereine sollten dem neuen Fußballoberhaus angehören, bis zum 1. Dezember 1962 waren 46 Bewerbungen beim DFB eingegangen. Das sich anschließende Auswahlverfahren nach einem zunächst geheim gehaltenen Bewertungsschlüssel, der sogenannten Zwölfjahreswertung, berücksichtigte neben dem sportlichen Erfolg auch die wirtschaftliche Situation der Vereine, schrieb eine bestimmte Stadiongröße und -ausstattung vor und hatte obendrein zu gewährleisten, dass jede Region angemessen berücksichtigt wurde. Hinzu kamen »weiche« Faktoren, wie die sportliche Tradition, über die von einer fünfköpfigen Kommission hinter verschlossenen Türen befunden wurde. Das ganze Verfahren spiegelte sehr schön den deutschen Hang nach Perfektion wider und bescherte dem DFB am Ende neben 16 Gewinnern 13 Beschwerden von Vereinen, während zwei der Ausgeschlossenen (Alemannia Aachen und Kickers Offenbach) gleich vor ein ordentliches Gericht zogen, wenn auch erfolglos.
Die neue Liga war von Beginn an ein voller Erfolg. Zu den acht Partien des Auftaktspieltages am 24. August 1963 kamen knapp 300000 Zuschauer. Sie zahlten im Schnitt 1,40 DM Eintritt und sahen dafür 22 Tore – das erste bereits nach 58 Sekunden, in der Partie Werder Bremen gegen Borussia Dortmund, erzielt durch den Dortmunder Timo Konietzka. Der übrigens zwei Jahre später für seinen neuen Klub TSV1860 München wiederholte, was nach ihm nie wieder einem Spieler gelang: am ersten Spieltag einer Saison gleich in der ersten Minute das erste Tor zu schießen. Am vierten Spieltag der jungen Liga gab es den ersten Platzverweis, der in der Partie Hertha BSC gegen Meidericher SV ausgerechnet Helmut Rahn, den Schützen des WM-Siegtreffers von 1954, ereilte, nachdem der gefoulte »Boss« in der 77. Minute die provokante Versöhnungsgeste seines Gegenspielers kurzerhand mit einer Kopfnuss quittiert hatte.
Insgesamt sahen 6626374 Zuschauer die 240 Partien der ersten Bundesligasaison, etwa halb so viele, wie 50 Jahre später zu den 306 Partien der Jubiläumssaison 2013/14 strömten. Die Torausbeute konnte sich dagegen schon im ersten Ligajahr sehen lassen. 857 Treffer standen am Ende zu Buche, 967 waren es ein halbes Jahrhundert später, die Trefferquote pro Spiel hat sich also nur unwesentlich verbessert, sie stieg von 3,16 auf 3,57.
Zwei Jahre nach ihrer Gründung wurde die neue Liga bunt: Mit dem Gladbacher Werner Waddey bestritt am 21. August 1965 erstmals ein Farbiger ein Bundesligaspiel, und farbig wurde noch einmal zwei Jahre später auch das Übertragungsmedium der Zukunft, das Fernsehen. Ende der Sechziger wurden die Haare länger, die Trikots knapper, ab Ende der Siebziger nahm die Schnauzbartdichte zu. Damit nicht genug, hatten linke Intellektuelle schon zu Beginn dieses Jahrzehnts die politische Sprengkraft langer Pässe aus der Tiefe des Raumes entdeckt, und mit Paul Breitners Wuschelkopf hielten die Revolution und Mao Einzug in die Bundesliga, ohne dass es irgendjemanden sonderlich gestört hätte. Immerhin wurden die Möchtegern-Revoluzzer 1972 Europa- und 1974 Weltmeister.
Um hartgesottene Funktionäre und Fans gleichermaßen aufzuschrecken, musste schon mehr passieren, und 1973 trat das Unerhörte ein: Mit Carmen Thomas moderierte im Februar jenes Jahres erstmals eine Frau die Männersendung schlechthin, das aktuelle sportstudio, und leistete sich in ihrer fünften Sendung am 21. Juli den historischen Versprecher »Schalke 05«, der die Männerwelt, zumindest die der Stammtische und Bild-Leser, gegen sie aufbrachte. Drei Monate zuvor war die Mannschaft von Eintracht Braunschweig erstmals mit einem Markenlogo auf dem Trikot aufgelaufen. Zwar noch verschämt getarnt als neues Vereinsemblem, ebnete der Jägermeister-Hirsch den Weg zu Sportlern als Werbeträgern. Weder Trikotwerbung noch Fußball kommentierende Frauen regen im 21. Jahrhundert noch irgendjemanden auf. Damals aber wähnten die Gralshüter der alten Ordnung den Untergang des Abendlandes oder zumindest Fußballdeutschlands nahe.
Der Bestechungsskandal der Saison 1971/72 hätte die Liga beinahe wieder untergehen lassen. Vereinspräsidenten, bei denen aus lauter Angst vor dem Abstieg aus der höchsten deutschen Fußballklasse die Nerven blank lagen, gekaufte Spiele, geschmierte Spieler, zwielichtige Geldboten, konspirative Treffen auf Parkplätzen und Funktionäre, die sich zu selbstgerechten Anklägern aufwarfen, erschütterten das Vertrauen in den Fußball. In der auf den Skandal folgenden Saison sank der Zuschauerschnitt auf den historischen Tiefstand von 17484 pro Spiel, um danach allmählich wieder zu steigen, bevor die Zuschauerzahlen ab Mitte der achtziger Jahre unter dem Eindruck zunehmender Gewalt in den Stadien abermals auf ein ähnliches Niveau abstürzten.
Die Fans daheim vor dem Fernseher bekamen auch noch im dritten Bundesligajahrzehnt vom samstäglichen Spieltag nicht mehr zu sehen als Zusammenfassungen von drei ausgewählten Spielen in der ARD-Sportschau und winzige Filmschnipsel im aktuellen sportstudio des ZDF. Vor noch nicht allzu langer Zeit hatten Vereinspräsidenten TV-Übertragungen gar mit der Begründung abgelehnt, für so etwas habe der Verein kein Geld!
Die kopernikanische Wende im Bundesligafußball kam mit der Einführung des Privatfernsehens. Die neuen Sender, die sich aus Werbeeinnahmen finanzierten, waren bereit, Millionen für die Übertragungsrechte hinzublättern, und plötzlich verfügten die Vereine über eine Kuh, die sie nach Belieben melken konnten. Mit Anpfiff (RTL, ab 1988) und ran (SAT.1, ab 1992) wurde aus Fußball mehr als bloß eine Ablenkung für Bier trinkende, prügelnde Rabauken: Schnelle Schnitte, Großaufnahmen, Superzeitlupen, endlose Wiederholungen, Interviews, Hintergrundberichte, Kabinengeflüster und Analysen machten auch noch den langweiligsten Samstagnachmittagskick zum aufregenden Event. Umgerechnet 330000 Euro hatten die 16 Bundesligavereine in der Saison 1964/65 von den Öffentlich-Rechtlichen für die Übertragungsrechte bekommen, 1968/69 waren es schon 860000 – Peanuts im Vergleich zu dem Füllhorn, das die Privaten bald über den Clubs ausschütten sollten. 1988 kosteten RTL die Übertragungsrechte für zwei Spielzeiten mehr als 61 Millionen Euro, SAT.1 musste 1992 für die kommende Saison schon gut 74 Millionen hinblättern. In der Saison 2000/01 wurden erstmals in der Liga-Geschichte sämtliche 306 Spiele live übertragen – der neue Bezahlsender Premiere ließ sich das zusammen mit SAT.1 rund 355 Millionen kosten. Mit dem Vertrag, den die Deutsche Fußball-Liga DFL am 17. April 2012 abschloss, fließen seitdem pro Saison im Schnitt 628 Millionen Euro für die Übertragungsrechte in die Kassen der Vereine der ersten und zweiten Liga.
Die quietschbunte Rummelplatzästhetik der Privaten machte die Bundesliga für Leute interessant, die sich gar nicht für Fußball interessierten. Seit der Saison 1989/90 stiegen die Zuschauerzahlen zwar langsam, aber stetig. Die Zeiten, als deutsche Teams sich in Ermangelung von Talenten wie Franz Beckenbauer oder Günter Netzer in den Achtzigern mit unattraktivem Kampf- und Krampffußball bis in WM-Endspiele vorwühlten und -foulten und das unzufriedene Fußballvolk mit unflätigem Benehmen vergraulten, neigten sich dem Ende zu. Auch wenn das »kaiserliche« Diktum nach dem WM-Sieg 1990 vom auf Jahrzehnte unschlagbaren deutschen Fußball sich als verfrüht erwies, woran der unverhoffte EM-Titel 1996 nichts änderte. Es bedurfte noch einiger Debakel bei internationalen Turnieren, bevor der deutsche Fußball sich mit Beginn des neuen Jahrtausends endgültig von seinem »Rumpelfußball«-Image verabschiedete und bereit war für Neuerungen wie Viererkette, Raumdeckung und Pressing. Solche fußballerischen Finessen, die in Ländern wie Spanien längst eine neue Spielkultur begründeten, hatte ein gewisser Ralf Rangnick den verblüfften Deutschen erstmals 1998 im aktuellen sportstudio auf einer Taktiktafel erklärt, wofür der Trainer des SSV Ulm sich als »Fußballprofessor« und »Besserwisser« titulieren lassen musste. Dafür hatten die Intellektuellen unter den Fans seit den Tagen eines Netzer endlich wieder etwas zu diskutieren.
Fußball ist heute ein Freizeitvergnügen für die ganze Familie. Die modernen Hochglanzarenen mit Verkaufskiosken, Videoschirmen und Rundumüberwachung haben mit dem verschwitzten, miefigen Turnhallenambiente der früheren Stadien nur noch das Rasenrechteck gemeinsam. Kein Bundesligaverein kann heute noch auf eine VIP-Lounge und Business-Seats verzichten, will er Sponsoren und Investoren ködern, um mit deren Geld attraktive Spieler einzukaufen und national wie international konkurrenzfähig zu bleiben.
Auf den folgenden Seiten werden Sie allem begegnen: legendären Spielern, unvergesslichen Partien, gewaltigen Dramen, herzzerreißenden Tragödien, großen Siegen und ebenso großen Niederlagen, aber auch Skurrilem und Kuriosem. Auf dass Ihnen in der VIP-Lounge, auf dem Stehplatz, in Ihrer Lieblingskneipe oder wo auch immer Sie den Ball verfolgen, nie der Gesprächsstoff ausgeht, wenn die Rede auf das Thema Nummer eins kommt – Fußball!
Thomas Bertram, im Sommer 2015
Wenn wir nicht 0:1 zurückliegen würden, könnten wir 1:0 führen.
Kuno Klötzer, früherer HSV-Trainer
Bundesligaspiele sind keine russischen Wahlen,
bei denen immer gewonnen wird.
Gyula Lóránt
Der erste Spieltag
Samstag, 24. August 1963, Anstoß: 17 Uhr
Eintrittspreise: ab 1,40 DM
Eingesetzte Spieler: 176
»Besondere Vorkommnisse«(kicker): Der Lauterer Walter Gawletta »schied in der 2. bis 10. Minute und dann noch einmal von der 13. bis 23. Minute aus«.
Spielerauswechselungen waren erst ab der Saison 1967/68 erlaubt (ein Spieler pro Mannschaft). In der Saison 1968/69 durften erstmals zwei Spieler ausgewechselt werden, und seit der Saison 1995/96 kann ein Trainer grundsätzlich drei Spieler austauschen. Erster Wechselspieler in der Bundesliga war am 19. August 1967 der Schalker Hermann Erlhoff, der in der Saisonauftaktpartie gegen Borussia Mönchengladbach in der Gelsenkirchener Glückauf-Kampfbahn in der 34. Minute für den verletzten Heinz Pliska eingewechselt wurde. Für den gelernten Maschinenschlosser war es der erste Bundesligaeinsatz, den der 22-Jährige in der 89. Minute mit einer Torvorlage für Friedel Rausch zum 3:4-Endstand krönte.
Ergebnisse des ersten Spieltages:
1860 München – Eintracht Braunschweig 1:1 (1:0)
Tore1:0 Brunnenmeier (17.), 1:1 Gerwien (72.)
Zuschauer34000 Schiedsrichter Fritz
Preußen Münster – Hamburger SV1:1 (0:0)
Tore1:0 Dörr (72.), 1:1 Dörfel (80.)
Zuschauer38000 Schiedsrichter Tschenscher
1. FC Saarbrücken – 1. FC Köln 0:2 (0:2)
Tore0:1 Overath (22.), 0:2 Ch. Müller (42.)
Zuschauer30000 Schiedsrichter Kreitlein
Karlsruher SC – Meidericher SV1:4 (0:3)
Tore0:1 Krämer (29.), 0:2 Cichy (33.), 0:3 Rahn (37.), 1:3 Metzger (84.), 1:4 Krämer (89.)
Zuschauer40000 Schiedsrichter Zimmermann
Eintracht Frankfurt – 1. FC Kaiserslautern 1:1 (1:1)
Tore0:1 Neumann (38., Foulelfmeter), 1:1 Schämer (40., Handelfmeter)
Zuschauer30000 Schiedsrichter Malka
Schalke 04 – VfB Stuttgart 2:0 (2:0)
Tore1:0 Koslowski (38.), 2:0 Gerhardt (43.)
Zuschauer28000 Schiedsrichter Schulenburg
Hertha BSC – 1. FC Nürnberg 1:1 (0:1)
Tore0:1 Morlock (41.), 1:1 Schimmöller (59., Handelfmeter)
Zuschauer52000 Schiedsrichter Seekamp
Werder Bremen – Borussia Dortmund 3:2 (1:1)
Tore0:1 Konietzka (1.), 1:1 Soya (34.), 2:1 Schütz (47.), 3:1 Klöckner (50.), 3:2 Konietzka (90.)
Zuschauer30000 Schiedsrichter Ott
Tabelle nach dem ersten (30.) Spieltag
1. FC Köln (1.)
FC Schalke 04 (8.)
Meidericher SV (2.)
Werder Bremen (10.)
Hertha BSC (14.)
Eintracht Braunschweig (11.)
Eintracht Frankfurt (3.)
Hamburger SV (6.)
1. FC Kaiserslautern (12.)
TSV1860 München (7.)
Preußen Münster (15.)
1. FC Nürnberg (9.)
Borussia Dortmund (4.)
Karlsruher SC (13.)
1. FC Saarbrücken (16.)
VfB Stuttgart (5.)
Was sonst noch geschah an diesem Tag …
New York Israel und Syrien werfen sich vor dem Weltsicherheitsrat gegenseitig Aggression vor und fordern jeweils die Verurteilung des Kontrahenten wegen Grenzverletzung.
Venedig Eröffnung der 24. Internationalen Filmfestspiele.
Caracas Mitglieder der regierungsfeindlichen Nationalen Befreiungsfront (FALN) entführen den Stürmerstar von Real Madrid, Alfredo di Stefano.
Mainz Eröffnung des 45. Deutschen Weinbauernkongresses.
Wenn der Ball im Tor ist,
war das immer eine gute Maßnahme.
Günter Netzer
Tore und Torjäger
Tore am Fließband
53 Vereine gehörten der Bundesliga von ihrer Gründung bis zur Saison 2014/15 an. Sie schossen in 52 Spielzeiten 48602 Tore, was pro Verein 917,01886 Tore macht. Den Minusrekord mit 15 Treffern hält bis heute die Tasmania aus Berlin, die dafür genau eine Spielzeit brauchte, bevor sie sich nach der Saison 1965/66 mit zehn Punkten aus 34 Spielen (nach der Drei-Punkte-Regel) auf Nimmerwiedersehen aus der höchsten deutschen Spielklasse verabschiedete. Zu den Eintagsfliegen der Ligageschichte zählt noch ein weiterer Berliner Klub: Blau-Weiss 90 Berlin, der es in seiner einzigen Bundesligasaison aber immerhin auf 21 Punkte und 36 Treffer brachte. Das dritte Berliner Schlusslicht, Tennis Borussia, brachte es in zwei Spielzeiten auf 49 Punkte und 85 Treffer und rangiert in der ewigen Tabelle auf Rang 45. Bei den Gegentreffern hält Lokalrivale Tasmania den Ligarekord mit 108 kassierten Treffern in einer einzigen Erstligaspielzeit, dicht gefolgt von den Offenbacher Kickers, die es in der Saison 1983/84 auf 106 Gegentreffer brachten, und Rot-Weiss Essen; in seiner letzten Erstligasaison 1976/77 musste der Klub von der Hafenstraße 103 Treffer hinnehmen. Kein anderer Bundesligaverein hat bislang in einer Saison mehr Gegentore kassiert als diese drei »Hunderter«.
Am entgegengesetzten Ende der ewigen Tabelle stehen am Ende der Saison 2014/153684 Treffer für den FC Bayern München zu Buche, erzielt in 1704 Begegnungen. Mit 101 Toren in der Saison 1971/72 haben die Bayern bislang auch die meisten Treffer in einer Spielzeit erzielt. Die 3355 Punkte aus ihren 990 gewonnenen Partien reichten den »Roten« für 24 Deutsche Meisterschaften in der Bundesliga – auch ein Ligarekord, diesmal ein positiver, zumindest aus Münchner Sicht. Die beliebteste Buchstabenkombination auf den Autokennzeichen der Münchner Erfolgskicker lautet denn auch RM – Rekordmeister. Natürlich führen die Bayern damit auch die ewige Tabelle der Liga unangefochten an; mit 709 Punkten Abstand folgt Werder Bremen auf Platz zwei, kann aber nur mit mickrigen vier deutschen Meisterschaften aufwarten, dahinter der Hamburger SV mit 723 Punkten Abstand und drei Meistertiteln. Mit anderen Worten, Bremer und Hamburger müssten »nur« 237- bzw. 242-mal in Folge gewinnen, um den Bayern die »ewige« Tabellenführung zu entreißen! Vorausgesetzt natürlich, die »Roten« würden fortan nur noch verlieren.
Punktespiele
Bei Punktgleichheit entscheidet in den Ligen des Deutschen Fußball-Bundes seit der Saison 1969/70 die Differenz zwischen geschossenen und kassierten Toren über die Platzierung in der Tabelle, bei gleicher Differenz zählen die erzielten Treffer. Bis dahin war bei Punktgleichheit der Torquotient, das heißt das Verhältnis von erzielten Toren zu Gegentoren, ausschlaggebend für den Tabellenplatz gewesen.
Über den Klassenerhalt entschied die neue Regelung erstmals in der Saison 1979/80: Der MSV Duisburg (14.), Bayer 05 Uerdingen (15.) und Hertha BSC (16.) hatten am 34. Spieltag jeweils ein Punktekonto von 29:39. Da die Berliner die schlechteste Tordifferenz der drei Kellerkinder aufwiesen (minus 20 gegenüber minus 18 bzw. minus 14), stiegen sie ab. In der Saison 1984/85 war es wieder soweit: Fortuna Düsseldorf (15.) und Arminia Bielefeld (16.) waren punktgleich (29:39), aber die Düsseldorfer hatten mit einer besseren Tordifferenz (minus 13 gegenüber minus 15) die Nase vorn und blieben erstklassig. In der Folgesaison das gleiche Bild: Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund belegten punktgleich (28:40) die Plätze 15 und 16, aber weil die Tordifferenz der Borussia um zwei Treffer schlechter war (minus 16 gegenüber minus 14), blieb das Gründungsmitglied der Bundesliga auf dem Abstiegsplatz und konnte sich den Klassenerhalt erst in der Relegation mit drei Siegen gegen Fortuna Köln (0:2, 3:1, 8:0) sichern. In der Saison 1988/89 hing einmal mehr das Schicksal des 1. FC Nürnberg am seidenen Faden: Drei Mannschaften konnte nach dem 33. Spieltag noch das Los des Tabellensechzehnten und damit des dritten Absteigers ereilen: neben dem Club auf Rang 14 noch den VfL Bochum und die Frankfurter Eintracht auf den Plätzen 15 und 16. Sie alle hatten 26:42 Punkte, so viel wie der sichere Absteiger Stuttgarter Kickers auf Rang 17. Am Ende erwischte es mal nicht die Nürnberger, sondern die Frankfurter Eintracht mit der schlechtesten Tordifferenz (minus 23 gegenüber minus 20 beim VfL und minus 18 beim Club).
Auch am entgegengesetzten Tabellenende konnte die Tordifferenz den entscheidenden Unterschied machen, und der war manchmal klitzeklein: Am Ende der Saison 1977/78 lagen der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach gleichauf mit 48:20 Punkten auf den Plätzen eins und zwei, aber drei kassierte Gegentore mehr vermasselten den Gladbachern den vierten Titel in Folge. Es war das erste Mal, dass eine Meisterschaft in der Bundesliga durch die Tordifferenz entschieden wurde. In der Saison 1991/92 passierte es wieder: Nach dem 34. Spieltag führten der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund beide mit 52:24 Punkten die Tabelle an. Aber die Schwaben hatten die Nase vorn, weil sie zwar vier Tore weniger erzielt hatten als die Dortmunder (62 gegenüber 66), dafür aber nur 32 Treffer zugelassen hatten, während die Westfalen 47 Gegentore kassiert hatten: Die Schale wanderte ins Ländle. Am Ende der Saison 1999/2000 herrschte abermals Punktegleichstand an der Spitze. Vorjahresmeister Bayern München und Vorjahresvize Bayer Leverkusen führten mit jeweils 73 Punkten die Tabelle an. Die Tordifferenz sprach für die Bayern: 73:28 war besser als 74:36. Für die Werkself um Michael Ballack war es die dritte Vizemeisterschaft seit der Saison 1995/96. Keine vierzehn Tage später wurde Leverkusen auch noch Vize-DFB-Pokalsieger und Vize-Champions-League-Sieger. »Vizekusen« at its best!
Den Rekord an Punktgleichständen hält übrigens die Saison 1977/78. Siebenmal wiesen jeweils zwei Mannschaften den gleichen Punktestand auf; in allen Fällen entschied die Tordifferenz über die Platzierung:
Tabellenplatz
Verein
Tore
Punkte
1.
1. FC Köln
86:41
48:20
2.
Borussia Mönchengladbach
86:44
48:20
4.
VfB Stuttgart
58:40
39:29
5.
Fortuna Düsseldorf
49:36
39:29
7.
Eintracht Frankfurt
59:52
36:32
8.
1. FC Kaiserslautern
64:63
36:32
9.
FC Schalke 04
47:52
34:34
10.
Hamburger SV
61:67
34:34
12.
Bayern München
62:64
32:36
13.
Eintracht Braunschweig
43:53
32:36
14.
VfL Bochum
49:51
31:37
15.
Werder Bremen
48:57
31:37
16.
TSV1860 München
41:60
22:46
17.
1. FC Saarbrücken
39:70
22:46
Einen anderen Rekord, was Punktestände betrifft, hält die Saison 1973/74, als bei gleich fünf Mannschaften wegen Punktgleichheit die Tordifferenz über den Tabellenplatz entscheiden musste:
Tabellenplatz
Verein
Tore
Punkte
9.
VfB Stuttgart
58:57
31:37
10.
Kickers Offenbach
56:62
31:37
11.
Werder Bremen
48:56
31:37
12.
Hamburger SV
53:62
31:37
13.
Rot-Weiss Essen
56:70
31:37
Den umgekehrten Rekord – 18 Teams mit 18 unterschiedlichen Punkteständen – halten die Spielzeiten 2008/09 und 2009/10.
Uns Uwe und das Kopfballungeheuer
Der erste Torschützenkönig der Bundesliga hieß 1964 Uwe Seeler. 30 der 69 Saisontreffer des Hamburger SV gingen auf das Konto des 27-jährigen Mittelstürmers. Mit 20 Toren weit abgeschlagen auf dem zweiten Platz landete der Schütze des ersten Bundesligatores überhaupt, Timo Konietzka vom BVB. »Uns Uwe« stammte aus einer alten Hamburger Fußballerfamilie. Schon Vater Erwin kickte für den HSV und meldete seine Söhne Uwe und Dieter kurzerhand ebenfalls bei seinem Klub an. Mit 137 Treffern, die er von 1963 bis 1972 in 239 Bundesligapartien für den HSV erzielte, rangiert Seeler in der ewigen Torschützenliste der Liga auf Rang 17, einen Zähler vor einem seiner »Nachfolger« bei den Hanseaten, Horst Hrubesch, der in 159 Partien für den HSV von 1978 bis 198396-mal einnetzte. Die restlichen 40 Treffer erzielte das »Kopfballungeheuer« bis 1985 für Rot-Weiss Essen (38) und Borussia Dortmund (2). Beide HSV-Mittelstürmer profitierten von ihren kongenialen Flankengebern: Seeler von Linksaußen Charly Dörfel (»Ich hab den Ball immer im Bogen auf den zweiten Pfosten gezogen, und da stand dann unser Leitbulle Uwe und hat ihn reingehauen«), Hrubesch von den legendären »Bananenflanken« des rechten Außenverteidigers Manfred Kaltz (»Manni Banane, ich Kopf – Tor«).
Kleines dickes Müller
Als Gerd Müller 1979 seine Karriere beendete, hatte er 365-mal für den FC Bayern eingenetzt, allein in der Saison 1971/72 erzielte er 40 von 101 Münchner Toren und trug damit entscheidend zum dritten Titelgewinn der Bayern bei. Insgesamt erzielte der »Bomber der Nation« zwischen 1965 und 1979 in 427 Ligaspielen 365 Tore für die Bayern – ein Rekord für die Ewigkeit. Der Ligazweite Klaus Fischer brauchte für seine 268 Ligatreffer 535 Spiele, die er zwischen 1968 und 1988 für vier verschiedene Klubs, den FC Schalke 04, den 1. FC Köln, den TSV1860 München und den VfL Bochum, bestritt.
Müllers Bundesligarekorde
Die meisten Tore
365
Die meisten Tore in einer Saison (1971/72)
40
Die meisten Tore in aufeinanderfolgenden Spielen (27.9.1969 bis 3.3.1970)
16
Rekordtorschützenkönig
7
Die meisten verschossenen Elfmeter
12
Alles Müller oder was?
Das hat selbst der »Bomber der Nation« in seinen besten Tagen nicht geschafft: sechs Treffer in einem Spiel. Ein anderer Müller schon: Beim 7:2-Sieg des 1. FC Köln über Werder Bremen am 17. August 1977 netzte Stürmer Dieter Müller sechsmal ein, davon allein dreimal zwischen der 12. und 32. Minute. Insgesamt erzielte »Müller Zwo« in 248 Spielen für die Kölner 159 Buden. Nomen est omen!
Weniger ist mehr
Gleich zweimal reichten Martin Max vom TSV1860 München 18 Treffer, um am Ende der Saison die Torjägerkanone des Sportmagazins kicker in Empfang zu nehmen – in den Spielzeiten 1999/00 und 2001/00. Noch weniger Treffer, nämlich 17, schafften nur die Torschützenkönige von 1988/89 (Klaus Allofs, 1. FC Köln), 1989/90 (Roland Wohlfahrt, FC Bayern) und 1995/96 (Fredi Bobic, VfB Stuttgart). Geiz ist geil!
Top Five der Torjäger
Rang
Spieler
Tore
Spiele
Quote
1.
Gerd Müller (FC Bayern)
365
427
0,85
2.
Klaus Fischer (TSV1860 München, FC Schalke 04, 1. FC Köln, VfL Bochum)
268
535
0,50
3.
Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach, Hannover 96)
220
369
0,60
4.
Manfred Burgsmüller (Rot-Weiss Essen, Borussia Dortmund, 1. FC Nürnberg, Werder Bremen)
213
447
0,48
5.
Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen)
182
350
0,52
Der Joker sticht
Wenn die elf auf dem Platz partout nicht treffen, schlägt die Stunde der Einwechselspieler. Torgefährlichster »Joker« in der Bundesliga ist Andreas Zickler, der bei seinen 102 Einwechselungen 18-mal für den FC Bayern traf. Sein Teamkollege Mehmet Scholl hält zwar den Einwechselrekord der Liga (123-mal), brachte es aber nur auf 14 Jokertore, womit er sich den zweiten Platz mit dem Kopfballspezialisten Hans-Jörg Criens teilt, der von 1981 bis 1993290 Spiele für die Gladbacher Borussia bestritt, mit der er in der Bundesligasaison 1983/84 Dritter wurde. Seine 14 Jokertore erzielte Criens bei 67 Einwechselungen. Nur ein Jokertor, aber eines, das in die Fußballgeschichte einging, erzielte ein Jahrzehnt früher ein anderer Gladbacher: Als es im DFB-Pokalfinale 1973 zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln nach 90 Minuten 1:1 stand, wechselte Gladbachs Star Günter Netzer, dessen Weggang zu Real Madrid zu diesem Zeitpunkt perfekt war und den Trainer Hennes Weisweiler deshalb auf der Bank schmoren ließ, sich nach einer Verletzung von Christian Kulik kurzerhand selbst ein. Netzers erste Aktion im Spiel schreibt Fußballgeschichte: »Netzer steht am Ball und schießt ein Tor. Das ist unglaublich!«, so der Kommentator. Der Siegtorschütze wird als erster Spieler überhaupt zum zweiten Mal in Folge zu Deutschlands »Fußballer des Jahres« gewählt.
Zwei Tage Schützenfest
Am 32. Spieltag der Saison 1983/84 blasen die Bundesligaklubs zum Halali. Schon im Freitagsspiel am 11. Mai fallen bei der Begegnung Kickers Offenbach gegen Werder Bremen zehn Tore. Bremen gewinnt 7:3 auf dem Bieberer Berg, und am Samstag lassen die anderen Teams sich nicht lumpen: Der HSV schlägt Nürnberg 6:1, die Begegnungen FC Bayern – 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Köln – Borussia Dortmund enden jeweils 5:2, die Gladbacher fertigen Bayer 05 Uerdingen mit 7:1 ab, nur die Bochumer (2:1 gegen Bayer Leverkusen) und die Bielefelder (2:0 gegen Waldhof Mannheim) geizen mit Toren, während Eintracht Braunschweig Fortuna Düsseldorf mit 4:1 nach Hause schickt. Der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt trennen sich unentschieden – nein, nicht 0:0, vier Treffer müssen es schon sein an diesem historischen Spieltag, der mit 53 Treffern der bis heute torreichste der Ligageschichte ist.
Mehr als zehn – kein Problem
Keine Mannschaft hat in der Liga so oft zweistellig gewonnen wie Borussia Mönchengladbach. Als erste dran glauben müssen 1967 die Schalker, die mit einem 0:11 im Gepäck die Heimreise antreten. Borussia Neunkirchen ergeht es im November desselben Jahres nicht anders. 0:10 heißt es am Ende am Bökelberg. Am 29. April 1978 schlägt für Borussia Dortmund im Düsseldorfer Rheinstadion die Stunde der Wahrheit. Nach der 0:12-Klatsche an seinem letzten Arbeitstag als BVB