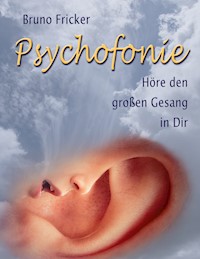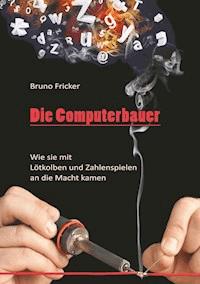
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Unter dem ungeheuren Druck des zweiten Weltkrieges wurden die Computer erfundenen und im kalten Krieg weiterentwickelt. Der Schweizer Physiker und Computerbauer Bruno Fricker beleuchtet in seinem neuesten Band die Entwicklung des Computerbaus aus diesen Anfängen bis in die heutige Zeit. Das Buch porträtiert bedeutende Pioniere und schildert damit die Geschichte der Informatik. Als Physiker, Elektroniker und selbst Computerbauer vollzog der Autor die ganze Entwicklung aktiv mit, seit den Anfängen bis auf den heutigen Tag. Das macht die Texte lebendig und authentisch. Das Buch ist aus einem schweizerischen Blickwinkel geschrieben. Auch in der vom Krieg verschonten Schweiz wurden wichtige Beiträge geleistet. Die Eidgenössische Technische Hochschule war immer ein Hort der Avantgarde. Sie verstand es, Pioniere hervorzubringen und anzuziehen. Man spürt beim Lesen, wie stark der Autor von seinen Figuren beeinflusst wurde und wie sehr sie sein eigenes Wirken inspiriert haben. Wer heute die Digitalisierung und das Informations-Schlaraffenland der Handys und Tablets verstehen möchte und sich fragt, wie es eigentlich so weit kommen konnte, liest das spannende Buch mit großem Gewinn.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Zukunft bietet wenig Hoffnung für diejenigen, die erwarten, dass unsere neuen elektronischen Sklaven uns eine Welt bieten, in der wir nicht mehr denken müssen.
Sie mögen uns helfen, aber auf Kosten von höchsten Anforderungen an unsere Moral und unsere Intelligenz. Die Welt der Zukunft wird ein immer anspruchsvollerer Kampf gegen die Begrenzung unserer Intelligenz sein, nicht eine bequeme Hängematte, in der wir uns, umsorgt von unseren Roboter-Sklaven, ausruhen können.
Norbert Wiener 1964
In den letzten Jahrzehnten gab es in Sachen Computerintelligenz ungeheure Fortschritte, doch was das Bewusstsein von Computern angeht, tat sich im Grunde nichts. Trotzdem stehen wir kurz vor einer folgenschweren Revolution. Menschen stehen in der Gefahr, ihren ökonomischen Wert zu verlieren, weil sich Intelligenz von Bewusstsein abkoppelt.
Yuval Noah Harari 2017
Inhaltsverzeichnis
Konrad Zuse
Alan Turing
John von Neumann
Norbert Wiener
Ambros P. Speiser
Heinz Rutishauser
Karl Steinbuch
Urs Hölzle
Traumpaar
Steve Jobs
Elon Musk
Jeff Bezos
Mark Zuckerberg
Das Twitter-Quartett
Homo Deus
Computer für Menschen
Anhang A: Keine Gravitationsanomalie
Anhang B: Bildergalerie
Vorwort
Als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, wurden viele helle Köpfe freigestellt, die vorher abgeschottet an der Entwicklung kriegsentscheidender Rechen- und Regeltechnik gearbeitet hatten. Elektronische Rechenmaschinen und Softwaretechnologien entstanden Schlag auf Schlag. Der Kalte Krieg trieb die Computertechnik voran. Das Buch porträtiert bedeutende Pioniere und schildert fragmentarisch die Geschichte der Informatik und der Digitalisierung.
Mir war es vergönnt, an diesen Neuerungen von Anfang an aktiv teilzuhaben, als jugendlicher Bastler, als Physiklaborant im ehrwürdigen Physikgebäude an der Gloriastrasse in Zürich, als ETH-Physiker und seit 1979 mit der eigenen Computer- und Messtechnikfirma. Zwar wurde ich nicht mächtig. Dennoch konnte ich als Elektroniker und selber Computerbauer wichtige Neuerungen vorwegnehmen oder nachvollziehen. Darauf gründet die Authentie dieser Zeitgeschichten.
Das Buch ist aus einem schweizerischen Blickwinkel geschrieben. Dabei zeigt sich, dass auch in der vom Krieg verschonten Schweiz wichtige Beiträge geleistet wurden. Die ETH war immer ein Hort der Avantgarde. Sie brachte Pioniere hervor, die uns nachhaltig prägten.
Bruno Fricker, März 2018
Bild 1: wikimedia.org
Konrad Zuse
Es wird Zeit, Konrad Zuse, geb. 1910 in Berlin, in die Walhalla bei Regensburg aufzunehmen. In der einem griechischen Tempel nachempfundenen Ruhmeshalle werden überragende Menschen deutscher Zunge geehrt. Da stehen die Büsten von Johann Sebastian Bach, Friedrich Gauss, Albert Einstein, Wilhelm Konrad Röntgen, Gregor Mendel, Sophie Scholl und andere; ja selbst die drei Männer auf dem Rütli schwören hier. Diese Geehrten haben bedeutende Spuren hinterlassen. Gewiss trifft dies auch auf Konrad Zuse zu, der 1995 in Hünfeld (Hessen) verstarb. Er hat die ersten programmierbaren und funktionstüchtigen Computer der Welt erschaffen. Am 12. Mai 1941 konnte Zuse die Z3, eine elektromechanische Rechenmaschine (wie man damals sagte) in Berlin einem zivilen Fachgremium der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt DVL vorführen. Sie verarbeitet Zahlen in binärer Gleitkommadarstellung, programmgesteuert, mit Rechenwerk und Speicher. Als Ein/Ausgabemedium dienten alte deutsche Filmstreifen, die gelocht wurden. Das war der von den Nazis unterschätzte, deshalb friedliche Startschuss ins Computerzeitalter, im Epizentrum des zweiten Weltkriegs. Was dann geschah, schildert Zuse drehbuchreif in seiner Biografie [1]. Die Z3 wurde verschiedenen Dienststellen der Wehrmacht vorgeführt, jedoch als nicht kriegswichtig eingestuft. Zuse wurde als Soldat an die Ostfront einberufen und musste seine Z3 ungeschützt in der elterlichen Stube zurücklassen, in der seit 1936 auch die rein mechanischen Computer Z1 und Z2 entstanden. Eine eigene Familie hatte er damals noch keine. Seine Eltern traten ihm zwei Zimmer ab und unterstützten den besessenen Erfinder finanziell. Die Z3 wurde auf dem grossen Stubentisch aufgebaut. Doch, o Wunder, mitten in diesem mörderischen Feldzug wurde der noch unverletzte Zuse „uk – unabkömmlich gestellt“. Der diplomierte Bauingenieur durfte in die Henschel Flugzeugwerke Berlin zurückkehren, um als Flugzeugstatiker weiterzuarbeiten, wo er bald eine Teilzeitbeschäftigung erwirkte, um zu Hause, mit Kollegen aus der Studentenverbindung, seinen Computer zu verbessern. So entstand die „Zuse Ingenieur Bureau und Apparatebau, Berlin“ und ein neuer Computer Z4, als der Bombenhagel einsetzte. Zuse entschloss sich, die schon leistungsfähige, tonnenschwere Z4 ins Allgäu zu retten, und dies gelang durch eine List: Ein befreundeter Physiker mit Beziehungen zur Wehrmacht schlug vor, die gewaltige Maschine offiziell mit „V4“ (Vergeltungswaffe 4) zu bezeichnen. V4 (Versuchsmodell 4) war der interne Deckname für die Zuse-Maschine. Bei diesen zwei Buchstaben standen die Parteibonzen stramm! Die Kontrollposten winkten den so beschrifteten Eisenbahn-Waggon überall durch. Man dachte an eine Weiterentwicklung von Wernher von Brauns legendärer und kriegswichtiger V2 Rakete, die England arg zusetzte. Dennoch dauerte die Fahrt Wochen, denn die Strecke war beschädigt und der Aufenthalt in Bahnhöfen war wegen Tieffliegern nicht ratsam. Wie durch ein Wunder erreichte der Tross schliesslich auf Lastwagen die bayrischen Alpen, wo die Maschine in einem Schuppen versteckt wurde. Sie fiel bei Kriegsende in die Zone der Amerikaner. Zuse verhandelte geschickt, die Z4 konnte wieder in Betrieb genommen werden. Das Gerücht über den deutschen Computerbauer wurde an der ETH ruchbar. 1949 fuhr eine Delegation aus Zürich vor. Die Professoren Eduard Stiefel (numerische Mathematik), K. Rutishauser (Programmsprachen) und Ambros P. Speiser (Hardware) suchten eine Möglichkeit, die Grand Dixence-Staumauer zu berechnen. Sie mieteten den Rechenautomaten, willkommenes Geld für Zuse, der sich und seiner Familie in den Bergen als Heimat-Kunstmaler das Brot verdienen musste. Bald nahm Zuse die geräuschvolle Z4 im ETH-Hauptgebäude in Zürich in Betrieb. Es war einer der ersten Computer an einer europäischen Universität. Dort leistete sie das Hundertfache im Vergleich mit einem Ingenieurbüro, das damals mit mechanischen Tischrechnern arbeiten musste. Die Z4 klapperte unter der ehrwürdigen Kuppel Tag und Nacht. Allerdings verweilte Zuse ab und zu in Zürich, um Störungen zu beheben, und auch Rutishauser hantierte ständig daran, fütterte die Maschine mit gelochten Zahlen und entnahm die Resultate. In diesen 5 Jahren entwickelte die ETH ihren eigenen Computer, die ERMETH. Sie besass einen 1.5 Tonnen schweren magnetischen Trommelspeicher und rechnete mit 1500 Elektronenröhren. Sie verarbeitete aber nur Dezimalzahlen, was ein Rückschritt war. Mit 30 Kilowatt Verbrauch war sie empfindlich auf Spannungsschwankungen, verursacht durch vorbeifahrende Trams. Die binäre Zahlenverarbeitung von Zuses Z4-Rechner war der Zeit weit voraus, trotz der kriegsbedingten primitiven Bauelemente, darunter Komponenten von abgeschossenen und ausgeschlachteten Bomberflugzeugen. Die Z4 nahm die Struktur der ersten Mikroprozessoren vorweg, mit welchen wir erst ab 1974 hantieren konnten. Sie war kein „Kind des Krieges“, sie entstand trotz des Krieges. Zuse war nie Mitglied der NSDAP. Das Genie des Computer-Erfinders Konrad Zuse setzte sich über alle Widrigkeiten hinweg.
Was war Konrad Zuse für ein Mensch? – Der junge Konrad war ein liebenswürdiger, einfallsreicher Eigenbrötler. In der Schule hatte er nur mit einem allseits gefürchteten Latein-Lehrer ein Problem, in den andern Fächern war er gut. Jedoch setzten ihm brutale Mitschüler zu, die dem jungen Genie abpassten. Konrad fand Mittel und Wege, seine Widersacher auszutricksen und ins Leere laufen zu lassen. Früh entwickelte sich so sein Wille zur Selbstbehauptung, was ihm im Krieg bei seiner Arbeit als Erfinder sehr zustatten kam. Pflichtbewusstsein und zähe Zielstrebigkeit lernte er von seinen preussischen Eltern. Die Freizeit verbrachte er mit dem über alles geliebten Metallbaukasten. Damit erwarb er sich früh mechanische Kenntnisse. Er gewann mit bemerkenswerten Konstruktionen die Wettbewerbe des Baukasten-Herstellers. Konrad, der Augenmensch, war künstlerisch begabt. Er zeichnete und malte hervorragend. Zwischen Künstler und Konstrukteur hin und hergerissen begann er folgerichtig ein Architekturstudium. Aber das normierte Zeichnen gefiel ihm nicht, er vermisste die Gestaltungsfreiheit. Auch Maschinenbau versuchte er, dort aber war von Kunst keine Spur. Schliesslich führte er ein Studium dazwischen, als Bauingenieur, zu Ende. Dieses Fach ist geprägt von umfangreichen Berechnungen für die Baustatik. Numerische Mathematik war damals eine Sache für Rechenknechte, die mit dem Rechenschieber und mit mechanischen Tischrechenmaschinen tagelang vorgegebene Rechenschemata abzuarbeiten hatten. Konstruktiver Einfallsreichtum war auch da nicht gefragt. Das ermüdete ihn sehr. Es müsste doch möglich sein, solche Berechnungen einer Maschine zu überlassen! Statt zu rechnen, sann er darüber nach, wie die Schemata und Rechengänge maschinell ausgeführt werden konnten. Das war die Motivation, die Werke früher Rechengenies wie Leibniz, Babbage und Ada Lovelace zu studieren. In der Tat wurde auf dem Papier ein derartiges Rechengerät bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts von Babbage konstruiert und von Ada Lovelace programmiert, allerdings weitgehend nur auf dem Papier. Zuse liess sich durch diese Quellen direkt zu eigenen Konstruktionen inspirieren. Er machte die Mathematikerin Ada Lovelace zu seiner Muse und heimlichen Geliebten, was er erst in hohem Alter preisgab. [2] Die Bedeutung dieser längst verstorbenen mathematischen „Femme inspiratrice“ kann im Fall des Agnostikers Zuse nicht konkret genug eingeschätzt werden. Das ist keineswegs abwegig, wenn man bedenkt, wie die heilige Barbara schwer arbeitenden Mineuren Kraft spendet oder die Muttergottes katholische Geistliche inspiriert. Mitten im Bombenhagel, im Januar 1945, heiratete Zuse eine Mitarbeiterin, die ihm fünf Kinder schenkte. Mit ihr und mit getreuen Mitarbeitern evakuierte er die Z4 aus dem umkämpften Berlin. In Hessen wuchs nach dem Krieg seine Firma Zuse KG zwischen 1949 und 1964 auf über 1000 Mitarbeiter. Zuse war ein umsichtiger Patron und ein zielstrebiger Erfinder zugleich. Doch trotz hervorragender Innovationen gab es keine Zuschüsse, und die staatlich geförderte Konkurrenz aus Übersee wurde übermächtig. Die Firma wurde schliesslich von Siemens geschluckt. Für Karl Zuse begann eine freiere Schaffensperiode. In den verbleibenden drei Jahrzehnten konnte er seine grundlegenden und zukunftsträchtigen Ideen und Erinnerungen publizieren und in zahlreichen Vorträgen weitervermitteln. Damit festigte er seine geschichtliche Bedeutung als Schöpfer des programmierbaren Computers, so wie dieser heute überall anzutreffen ist. In der akademischen Welt wurde Konrad Zuse mit zahlreichen Ehrendoktoraten ausgezeichnet.
[1] Konrad Zuse: Der Computer – Mein Lebenswerk. Springer-Verlag, 2010 (Auflage 5), 220 S.
[2] Friedrich Christian Delius: Die Frau, für die ich den Computer erfand. Rowohlt-Verlag, 2011, 283 S.
Bild 2: So lange hatte es gedauert, bis Alan Turing rehabilitiert wurde
Alan Turing
Während in Deutschland durch die Initiative des rechenfaulen Bauingenieurs Karl Zuse der Computer trotz des Krieges entstand, lief es in England ganz anders. Zwar gab es auch hier einen herausragenden Helden, doch wurden die Entwicklungsstufen durch die Notwendigkeiten der Kriegsgeschichte diktiert. Alan M. Turing erfand im Alter von 24 Jahren in seiner berühmten Publikation On Computable Numbers [1] 1936 die Funktionsweise eines universell programmierbaren Computers top-down, das heisst durch rein theoretische Erwägungen. Die Funktionsweise der so genannten Turing-Maschine wurde das Urbild des englischen Computers. Realisiert wurde dieser allerdings erst nach dem Krieg. England geriet durch Hitlers Wehrmacht in zunehmende Bedrängnis. Churchill, dem die Verteidigung anvertraut war, tickte aber anders: Nicht nur mit Gewalt, sondern mit List sollte dem Aggressor begegnet werden. Er zog die besten Mathematiker und Ingenieure zusammen, so auch A. M. Turing, und isolierte sie im Herrenhaus Bletchley Park (B.P.) auf der Landschaft, 70 km ausserhalb Londons, zwischen Oxford und Cambridge. Die Wissenschaftler dieser Universitäten konnten per Eisenbahn leicht anreisen. Dort entstand der kriegsentscheidende zentrale Nachrichtendienst. Die englischen Küstenstationen, die den Morse-Funkverkehr der Wehrmacht aushorchten, sandten die verschlüsselten Telegramme in die Hütten des Parks. In zahlreichen Baracken arbeiteten 1942 viertausend Frauen, Spezialisten und Mathematiker an den Teilaufgaben der Entschlüsselung in einer undurchschaubaren Organisation, deren Ziel es war, in Kenntnis der Befehle Hitlers und der Rückmeldungen durch Frontkommandos den Operationen der Wehrmacht zuvorzukommen. Diese geheime Strategie ging auf. Auf dem Höhepunkt des Krieges stand die Vernichtung des ganzen alliierten Nachschubs im Atlantik auf dem Spiel, als der Aggressor in U-Booten den Verschlüsselungscode verschärfte. Es schlug die Stunde von Professor Turing, der aus seiner Verbannung zurückgeholt wurde, die er wegen einer Liebesaffäre antreten musste. [2] Dummerweise wurden die „harmlosen“ Wettermeldungen aus dem Atlantik gleichzeitig mit einem leichter zu brechenden Code übermittelt, was Turing in B.P. als Einstieg diente, um den Enigma-Code gerade noch rechtzeitig zu entschlüsseln. So gelang es, den Totalverlust der amerikanischen Versorgungs-Armada abzuwenden.
Die vielen U-Boote von Grossadmiral und Hitler-Nachfolger Karl Dönitz wurden umfahren und mit Wasserbomben gezielt versenkt. Zur Quellenverschleierung liefen Nachrichten aus B.P. sogar über den Schweizer Nachrichtendienst, wodurch Stalin im Kursker Bogen die größte Panzerschlacht der Weltgeschichte gewinnen konnte, was die Wende im militärischen Kräfteverhältnis zu Gunsten Russlands einleitete. (Wen wundert’s, dass die geschichtsbewusste Bevölkerung der östlichen Ukraine noch heute nicht viel für den Westen übrig hat.) Auch in Nordafrika musste Feldmarschall Rommel dank vorauseilenden Informationen aus B.P. den Rückzug blasen. B.P. verkürzte das Kriegsgeschehen um zwei Jahre, wie ein Historiker schrieb. Ein unmilitärisch organisierter, fröhlicher, loyaler und patriotisch hoch motivierter Haufen Intelligenz, allen voran Alan Turing, verhalf den Alliierten zum Sieg. Das Personal von Bletchley Park – auf der Roll of Honour sind heute über 10‘000 Angestellte verzeichnet – wurde durch ein Kreuzworträtsel-Preisausschreiben im Daily Telegraph rekrutiert. Um sich einzufühlen, möge man den Film ENIGMA ansehen, der von Mick Jagger, Frontmann der Rolling Stones, produziert wurde. So also fühlt es sich an, wenn um Freiheit und Menschenwürde gekämpft wird!
Selbstredend entstanden in B.P. auch Computer, denn ohne schnelle Rechenautomaten wäre der Nachrichtenstrom aus der Wehrmacht nicht zu entschlüsseln gewesen. Doch es waren spezialisierte, nur für einen Zweck konstruierte Maschinen. Der frei programmierbare Denkapparat, die Turing-Maschine, und alle Spekulationen über künstliche Intelligenz blieben aussen vor. Tag und Nacht rechneten die „Turing-Bomben“ genannten Maschinen. Es waren mechanische Rechner mit Walzen, die den morsenden ENIGMA Codier-Geräten glichen. Ihr Zweck war es, alle Verschlüsselungs-Kombinationen nach einschränkenden Vorgaben blitzschnell durchzuarbeiten. So war man in der Lage, die täglich wechselnde Verschlüsselung innert 1-2 Stunden zu knacken. Das genügte, um den Aktionen an der Front zuvorzukommen. Hitler bemerkte die allwissenden Schachzüge des Gegners zwar auch, aber er vermutete Verräter in den eigenen Reihen und konnte sich als technisch Unkundiger nicht vorstellen, dass eine Maschine menschlichen Code-Brechern derart überlegen sein könnte. Auf das Argument, dass Zuses Computer möglicherweise zum Endsieg beitragen könnte, soll Hitler geantwortet haben, dazu brauche er keine Rechenmaschine, das mache er mit dem Mut seiner Soldaten.
In England entstand gegen Kriegsende „Colossus“, ein elektronischer Rechenautomat, aufbauend auf den Entwürfen Turings. Zehn Stück wurden für B.P. gebaut. Damit wurden Telex-Nachrichten der Lorenz-Schlüsselmaschine geknackt. Colossus gilt zwar als der erste speicherprogrammierbare Röhren-Computer, war jedoch fest an eine bestimmte Aufgabe angepasst und nicht im heutigen Sinn frei programmierbar. Alle Colossi wurden nach Kriegsende aus Geheimhaltungsgründen zerstört. Alan Turings Interessen waren von nun an nicht mehr an kriegswichtige Aufgaben gebunden. 1946 präsentierte er ein Papier über die Automatic Computing Engine (ACE), die Quintessenz seiner Erkenntnisse von 1936 und der Erfahrungen mit Colossus. ACE war ein Röhrenelektronischer speicherprogrammierbarer Rechenautomat. Unendliche Querelen durch missgünstige Besserwisserei und Beamten-Obstruktion verzögerten die Realisierung jahrelang, in einer Zeit, als die ETH bereits mit Zuses Z4 in Zürich die Grand-Dixence Staumauer berechnete. Schliesslich konnte im Mai 1950 eine verkleinerte Variante von ACE in Betrieb genommen werden. Turing nutzte die Zeit auf seine Weise und schuf auf dem Papier zahlreiche Subroutinen, Mikroprogramme, die es erlaubten, die ACE auf einer höheren Programmebene zu betreiben, um sie bedienbar zu machen. Das lief auf eine höhere strukturierte Programmiersprache hinaus. Ihm war klar, dass die Übersetzung in Steuerbefehle auf die Maschinenebene dereinst vom Computer selbst übernommen würde, was wir heute Compiler nennen. Rutishauser in Zürich befasste sich ebenfalls mit diesem Thema und erfand schliesslich das uns ETH-Absolventen wohlbekannte ALGOL. Schon 1953 ging dann die zweite mächtigere Version von ACE in Betrieb. Daran war Alan Turing, dem, im Gegensatz zu Zuse, jegliches kommerzielles Interesse fehlte, nicht mehr beteiligt.
Nach und nach wurde der englische Computer-Erfinder von allen Projekten zur Weiterentwicklung der Elektronengehirne ausgeschlossen. Als homosexueller Geheimnisträger galt er als unberechenbares Sicherheitsrisiko. Die Zeitgeschichte um 1950, zu Beginn des kalten Krieges, entwickelte sich in eine für den Freigeist fatale Richtung. Turing beschäftigte sich auch deshalb zunehmend mit theoretischer Biologie, schuf mathematische Modelle, die für biologische Musterbildung, embryonale Zellteilung und Selbstorganisation von Mikroorganismen grundlegend wurden. Aus heutiger Sicht war er ein Pionier der mathematischen Entwicklungsbiologie. Es entstanden Publikationen und er betreute Doktoranden, die Modelle durchrechneten. Die Manchester-Maschine wurde zum gefragten Werkzeug der Zellbiologie.
Turing war ein loyaler Staatsbürger. Jedoch wurde er unsinnig bestraft, weil seine Homosexualität polizeilich ruchbar wurde und sie ihn statt ins Gefängnis in eine Hormonkur schickten, bei der ihm Brüste wuchsen und die den Retter Englands körperlich und seelisch schliss. Dennoch war seine Lebenskraft ungebrochen. Alan Turing hatte vielerlei Projekte, als sein Todesjahr anbrach. Es gab keine Zeichen von Lebensmüdigkeit. Man fand ihn am 7. Juni 1954 tot auf seinem Bette liegend, neben ihm der angebissene Apfel, den er vor dem Einschlafen regelmässig verzehrte.
War der Apfel vergiftet? Dass dieses Beweisstück polizeilich nicht untersucht wurde, lässt vermuten, dass hier der Geheimnisträger eliminiert wurde. Es gibt kaum Belege für den von einzelnen Biografen überlieferten Freitod. Churchill beendete gleichzeitig die Kriegs-Memoiren und erwähnte, obgleich von Eisenhower dazu aufgefordert, seine stärkste Waffe, Alan Mathison Turing, darin mit keinem Wort! Es wurde rasch still um unseren Helden. Nur seine Mutter kämpfte um Anerkennung, mit einem eigenen Buch, in welchem sie den Tod als Unfall beim Experimentieren bezeichnete. Ehrungen und eine königliche Rehabilitierung wurden ihm erst heute zuteil. [3]
Ohne Turing entstand in rascher Folge die englische Computerindustrie. Für Turing wurde die Beamten-Mediokratie tödlich: Die britischen Behörden verhafteten Turing im Jahr 1952. Homosexuelle Handlungen waren in Großbritannien bis 1967 strafbar. Er wurde vor die Wahl gestellt: Entweder Gefängnis oder Umerziehung. Notgedrungen entschied er sich für Letzteres. Er musste sich einer Hormontherapie unterziehen und wurde chemisch kastriert. Sein Leben wurde zur Hölle gemacht, und am 7. Juni 1954 beging er, psychisch gebrochen, mit 42 Jahren Selbstmord. Ein vergifteter Apfel lag neben seinem Leichnam.