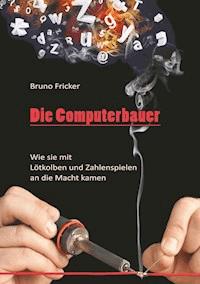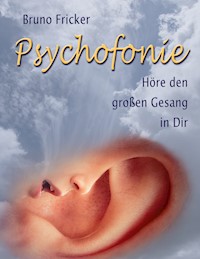
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Heilung beginnt im Kopf. Diese Binsenwahrheit ist auch in der westlichen Medizin angekommen. Yoga, Meditation, Hypnose, Biofeedback, Psychotherapie, Musiktherapie, progressive Muskelentspannung und verschiedene Aktivierungs- und Bewegungstherapien sind in aller Munde, wenn es gilt, chronische Leiden zu behandeln. All diese Kuren sind personalintensiv und sehr zeitraubend. Psychofonie hat von allen diesen Methoden etwas und ist doch grundlegend anders. Mit Psychofonie machst Du im Jahr 1000 Mini-Sitzungen, die sich perfekt in Dein Leben einbauen lassen, als kurze Besinnungspausen. Das ist an sich schon heilsam. Aber es sind Pausen in einem erweiterten Sinn, Du musst nichts tun - nur hören. Zehn Minuten mit Kopfhörer genügt. Das Bild auf der Vorderseite des Buches bringt es auf den Punkt: Du singst in diesen Pausen mit Dir selbst. Aber nicht auf der Ebene der Sprache, sondern auf der unbewusst vegetativen Ebene der Hirnfunktion. Die Störung, die Dich plagt und die wir mit Klängen zum Verschwinden bringen, sitzt in jedem Fall mitten in Deinem Gehirn. Im Thalamus befindet sich eine Art Orchester. Die chronischen Schmerzen und Leiden sind in diesem wunderbaren Klanggebilde als falsche Musikanten und Sänger repräsentiert. Es ist möglich, ihr Spiel mittels Elektroenzephalogramm hörbar zu machen. Das EEG ist der messbare dynamische Ausdruck Deiner momentanen Verfassung. Wir nehmen es außen am Kopf in einem Zustand des Wohlbefindens bei Dir einmal ab und wandeln es mathematisch in Klangfolgen um. Ab dann hast Du die Psychofonie als eine auf Dich abgestimmte persönliche Heilmusik immer dabei. Dieses Buch zeigt Dir, wie das funktioniert, wie es fachgerecht getestet wurde, wie man es anwendet und was man erwarten darf. Es zeigt den Nutzen bei Kopfschmerzen, Migräne, Schlafstörung, ADS, Tinnitus, Traumata und Stress. Und es macht Dir das enorme Heilpotenzial der Psychofonie durch zahlreiche Fallberichte eindrücklich klar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Danksagung
Chaos im Hirn – wie das Hirn arbeitet
Den kritischen Zustand überschreiten
Migräne
Formenschöpfung in der Hirnrinde
Evolution der Hirnanatomie
Das Sinfonieorchester im Kopf
Zwischen Körper und Psyche
Das Vegetativum
Sympathikus und Parasympathikus
Höhere vegetative Zentren
Stress und Trauma
Psychofonie – musikalische Neurotherapie und Datenmedizin
Was versteht man unter Neurotherapie?
Psychofonie, was ist das?
Das Gehör, ein neuropsychologisches Meisterwerk
Bewertung der Psychofonie
Anwendung der Psychofonie in der medizinischen Praxis
Die therapeutische Selbstbegegnung im Psychofonie-Hören
Psychofonie als Lerntherapie
Die Indikationen der Psychofonie
Der interessante Fall
Wann und weshalb versagt die ärztliche Kunst
Selbstregulation des Organismus
Psychofonie bei Tinnitus
Tinnitus – ein verbreitetes Leiden
Wie entsteht Alters-Tinnitus?
Wie kann Psychofonie bei Tinnitus helfen?
Psychofonie bei Schlafstörungen
Das neurobiologische Grundgesetz
Die Entstehung von Schlafrhythmen
Schlafstadien
Schlafstörungen sind Rhythmusstörungen
Schlafregulation mit Psychofonie
Patientinnen haben das Wort
Anhang: Langzeitstudie Ergebnisse
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.
Ich kreise um Gott, um den uralten Turm,
und ich kreise jahrtausendelang;
und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm
oder ein großer Gesang.
Rainer Maria Rilke
Was die Medikation nicht vermag, kann – es erscheint wie eine Gnade der Natur – die Musik erreichen ... Beide Patienten haben deutlich von der Norm abweichende EEGs, die sowohl stuporöse (verlangsamte) als auch konvulsive (erregte, krampfartige) Züge aufweisen. Auf eine wunderbar zu beobachtende Weise jedoch werden ihre EEGs und ihre klinischen Zustände völlig normal, wenn sie musizieren oder Musik hören ... Diese Normalisierung des EEGs findet sogar bei nur mentalem Abspielen der Musik statt ... man brauchte beispielsweise nur Opus 49 zu sagen, und sofort änderte sich ihr EEG, während die f-moll Fantasie vor ihrem inneren Ohr ertönte. Oliver Sacks 1
Einleitung
Wer für die Verbreitung der Psychofonie intensiv gearbeitet hat, sieht die Menschen und ihre Beschwerden in einem anderen Licht. Nicht ohne Zweifel begannen wir im Herbst 1995 Psychofonie-Tonbänder aus dem Elektroenzephalogramm (EEG) der ersten Klienten herzustellen. Es war zuweilen wie im Märchen «Des Kaisers neue Kleider». Wir wähnten wirkkräftige Heilklänge herzustellen. Oder war es nur wirkungslose Kakofonie? Lauthals sprach dies Wort eine junge Assistenzärztin aus, im Beisein ihres Chefs. Handelte sie wie das kleine Kind in Andersens Märchen, welches die Volksmenge überzeugte, dass der Kaiser gar keine Kleider trug? «Er hat ja gar nichts an!», sagte das lautere Kind seinem Vater, nachdem es genau hingeschaut hatte, im Widerspruch zu den offiziellen Verlautbarungen, ohne Hintergedanken. Die junge Ärztin aber äußerte es vor ihrem Chef aus Berechnung, um Punkte für sich zu buchen und um uns der Lächerlichkeit preiszugeben.
Sie hatte sich nicht die Mühe gemacht, genau hinzusehen, was wir tun, und sie hatte Psychofonie auch nicht selbst ausprobiert. Und also schloss sie messerscharf, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Es passte nicht in ihr Koordinatensystem. Dazu hatte sie die damalige Lehrmeinung der Schulneurologie auf ihrer Seite. Seit Hans Berger2, der erste gründliche Erforscher der Hirnwellen, vergeblich nach konkreten Inhalten gesucht hatte, glaubt man, es sei nichts Spezifisches im EEG. Berger, der akribische Psychiater, hatte gehofft, bei Schizophrenen Hinweise auf Wahnvorstellungen im EEG zu finden. Doch die Wahnvorstellungen prägten sich im EEG überhaupt nicht aus. Die EEG-Wellen bei Psychosen waren in seinen Protokollen enttäuschend normal.
Heute gibt es Literatur und Kongresse über EEG-Befunde, die man ausschließlich über den Computer erhoben hat, über Aspekte und Feinheiten, die im EEG als auf das Papier gekritzelte Linie niemals abgelesen werden können. Trotzdem fährt die Neurologie fort, das EEG zu unterschätzen, weil sie es noch kaum unternommen hat, sich dem EEG mit Analysesoftware zu nähern. Doch es hatte schon bei Berger viele Jahre gedauert, bis die Schulmedizin seine Resultate anerkannte und diagnostisch nutzte. Untersuchungen kognitiver Leistungen etwa mit der Kohärenzfunktion wurden erst in den 80er-Jahren wieder aufgenommen.3 In der neueren Zeit häufen sich interessante Entwicklungen in der Anwendung des quantitativen EEGs.4 Es werden sogar spezielle Tagungen über Hirnwellen in der Musik veranstaltet.5 Keine messtechnische Größe ist der Dynamik der zentralen Verarbeitungs- und Steuerungsprozesse näher als das EEG. Ein weiterer Vorteil: Ein weniger invasives Messverfahren als das EEG gibt es nicht. Kam mit der Jahrhundertwende auch die Wende in der Geringschätzung des therapeutischen Potenzials des Elektroenzephalogramms durch einseitig ausgebildete Ärzte? Zwei Erfahrungen haben geholfen, die Startschwierigkeiten mit unserer Psychofonie zu überwinden:
Die glaubwürdigen Zeugnisse von vielen Nutzerinnen und Nutzern der Psychofonie. Sie berichteten über phänomenale Erfolge.
Die wachsenden Einsichten über die Zusammenhänge zwischen Hirnfunktionen und Wahrnehmungen, genährt durch die Lektüre einschlägiger Fachliteratur und durch Gespräche mit Spezialisten an unsere Symposien.
Die tiefere Beschäftigung mit diesem Thema gleicht einer Kletterpartie im bizarren, nebelverhangenen und sturmumtosten Grenzgebirge zwischen Körper und Psyche. Da tun sich weglose Abgründe auf, zuweilen auch Panoramen. Und man weiß nie, wo man die Grenze überschreitet. Von den Stürmen können die Tinnitus-Geplagten erzählen, denn in ihren Köpfen braust, pfeift und hämmert es ohne Unterlass. Von den Nebeln berichten die klassischen Migränikerinnen,6 denn ihnen erscheint die Welt oft wie durch Nebelfetzen, die vorüberziehen, oder eigenartig verzerrt wie durch ein bizarres Kaleidoskop. Dann gibt es die rasenden primären Kopfschmerzen bis zur Bewusstlosigkeit, oder die Auren in den Schluchten der Eingeweide mit ihrer bis zum Erbrechen führenden Übelkeit. Doch manche Betroffene erfahren wie zum Trost auch das Wunder glasklarer Bewusstseinshelligkeit, oft bald nach dem Absturz in das vegetative Chaos. Wer sich mit einer neuen Therapie in dieses Gelände wagt, kann keinen Führer beanspruchen. Die Medizin ist ratlos, denn sie findet nichts, keine organische Erkrankung, doch das Leiden ist oft unerträglicher als bei schwerer körperlicher Krankheit. Auch die Psychologen finden nichts. Es gibt kaum einen Anhalt, dass diese Störungen und die damit verbundene Angst durch psychische Konflikte verursacht sind, es sei denn, die Kranken haben ihr Leiden so fest in ihre Lebensführung eingebaut, dass ihnen etwas fehlt, wenn man sie davon befreit. Zur Vorbereitung und Begleitung unserer Expedition dienen so unterschiedliche Fächer wie Neurologie, Elektroenzephalografie, Neurofeedback, Anatomie namentlich des Gehörorgans, Psychologie, Akustik, Musik, Elektronik, Informatik, Kybernetik, Chaostheorie und die Mathematik der neuronalen Netze und last, not least der digitalen Signalverarbeitung. Angesichts einer solchen Interdisziplinarität können wir viele Bezüge nur durch Literaturverweise andeuten. Die Tour führte uns geradewegs ins Zentrum der psychosomatischen Grundfrage, zum Problem der Natur des Bewusstseins. Denn Stress wird erst recht stressig, wenn wir uns seiner bewusst werden. Schmerzen sind kein Problem, wenn wir sie nicht bemerken. Emotionen wie Angst oder Panik belasten uns nur, wenn die dadurch ausgelösten Gefühle beginnen, unseren Geist zu beherrschen.
Ist die Frage nach dem Wesen des Bewusstseins letztlich zu einer philosophisch-religiösen Schicksalsfrage der Menschheit geworden? Das Dilemma, am Primat der Psyche festhalten zu wollen und gleichzeitig die materialistischen Resultate der Hirnwissenschaften anerkennen zu müssen, ist für den nach Wahrheit suchenden Menschen unerträglich. In der modernen Neurowissenschaft wird die Psyche langsam aber sicher abgeschafft. Dem Selbstbild eines durchschnittlichen Westmenschen wird damit der Boden entzogen. Glücklicherweise sind aber die eigenen Gefühle und Gedanken, Wahrnehmungen und Ideen gewisser als jedes Amen in der Wissenschaft.7
In einem Vortrag machte ich die Probe aufs Exempel: Ich klatschte ohne Vorwarnung laut in die Hände und fragte das Publikum, wer glaube, dass der das Klatschen verursachende Willensimpuls ausschließlich das Resultat neuronaler Berechnungen sei, möge die Hand erheben. Es zeigte sich, dass dieses an der Psychofonie interessierte Publikum fast ohne Ausnahme dazu neigt, von einem rein psychischen, freien Willensakt auszugehen. Mag sein, dass die hier Befragten sich des Dilemmas noch nicht bewusst waren. In der Wissenschaft8 jedenfalls ist das Verhältnis umgekehrt: Die mit einem immateriellen Selbst argumentierenden Forscher gehören zu einer kleinen Minderheit. Die Mehrheit behauptet, ohne den steuernden Geist auszukommen und das Gewissen an einem nicht mehr fernen Tag durch systemimmanente Mechanismen erklären zu können – Schuldscheinmaterialismus! Der Beliebigkeit von Bewusstseinsinhalten wird damit Tür und Tor geöffnet. Der Philosoph Thomas Metzinger9 bringt es mit einer provozierenden Frage auf den Punkt: Welches Bewusstsein hätten Sie denn gern? Das Bewusstsein wird in einer ungeahnten Weise formbar und beliebig. Fragt sich nur, wer oder was die Kontrolle ausübt. Die Gefahr eines beispiellosen ethischen Zerfalls zeichnet sich ab. – Oder geschieht womöglich das Gegenteil, wenn sich die Menschheit durch die Aufklärung der Naturwissenschaft von den allein selig machenden Religionen und ihren Kriegen emanzipiert? Auch die Ärzteschaft ist in zwei Lager gespalten, was, wie wir noch sehen werden, die Spaltung zwischen Schulmedizin und Komplementärmedizin erklärt. In der Regel sind Ärzte, die sich um beide Aspekte – Psychologie und Physiologie – kümmern, Anwender der Psychofonie geworden.
An dieser Stelle soll einem möglichen Missverständnis vorgebeugt werden: Weder die Psychofonie noch dieses Buch beinhalten irgendeine religiöse oder mentale Vereinnahmung. Wir begegnen dem Denken unserer Mitmenschen mit dem größten Respekt und verurteilen jede Form von Hirnwäsche. Wem würde es einfallen, jemandem die Kleidung oder den Haarschnitt vorzuschreiben? Wie viel mehr gilt es da Zurückhaltung zu üben, wo weltanschauliche oder spirituelle Überzeugungen ins Spiel kommen!
Leider ist dieser Anstand nicht in allen Heilverfahren selbstverständlich. Fragwürdig wird es zum Beispiel dann, wenn die kassenzulässige Schulmedizin – im Blick auf das offensichtliche Versagen einer medikamentösen Therapie – anfängt, hypnotische Übungen mit Denkschablonen zu praktizieren. Fachärzte finden sich bei Komplikationen unversehens in der Rolle von Psychotherapeuten, auf welche sie nicht vorbereitet sind. Gleichzeitig will man von den Erfolgen, die mit Biofeedback-Methoden10 seit langem erzielt wurden, hierzulande noch nichts wissen. Diese im westlichen Denken seit langem verankerten Regulationstherapien, welche direkt auf das Vegetativum wirken, verschmäht man und wendet sich statt dessen scharenweise fernöstlichen Therapien zu, die weder wissenschaftlich begründbar sind noch in unsere Kultur passen.
In den komplexen Heilungsprozessen der oben erwähnten Erkrankungen spielt die Selbstorganisation des Zentralnervensystems eine überragende Rolle. Eigentlich geht es darum, die Begegnung des Patienten mit sich selbst zu ermöglichen, um es psychologisch auszudrücken, oder anders gesagt, die physiologische Seite beleuchtend, gewisse Zonen in zentralen Hirnbereichen so zu reizen, dass im Rahmen des genetisch fixierten Spielraums neue Signalpfade entstehen, oder anders gesagt neue Fließgleichgewichte etabliert werden. Einzelne Autoren11 sprechen auch von Homöostase, wodurch funktionelle Krisen, wiederkehrende Schmerzen und Ähnliches gewissermaßen umschifft oder gar aufgelöst werden. Auf einer vegetativen, völlig unbewussten Seite ist «Re-Training»12 angesagt. Damit wird mental überhaupt nichts manipuliert. Es wird ein für spontane Heilprozesse günstiges Vigilanzmilieu geschaffen, das durch Vernebelungen, Missempfindungen und Schmerzen weniger belastet ist. Psychofonie als ein rhythmisiertes Vigilanztraining hat mit mentaler Fixierung oder gar Ideologie nichts am Hut. Die Bedeutung dieser rhythmischen Vigilanzregulation wird insbesondere auch bei Schlafstörungen sichtbar.
Dieses Buch behandelt die zahlreichen Fragen in Übereinstimmung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Es hält dort inne, wo die Weltanschauung beginnt. Es provoziert die Schulwissenschaft möglicherweise da, wo der überhandnehmende neurowissenschaftliche Physikalismus die Unmöglichkeit einer psychischen Verankerung des Hirns und damit von dessen Eigentümerin behauptet. Deshalb werden wir wissenschaftliche Sichtweisen bevorzugen, die den Riss zwischen alltäglichem Ich-Bewusstsein und dem Materialismus zu überwinden suchen. Man sollte von beiden Seiten her bohrend die Hoffnung auf einen Durchstich nicht so schnell aufgeben. (Die Schuldscheinmaterialisten freilich behaupten, dass es das Unendliche13 gar nicht gibt.) Wenn ein Patient mit Elektroden im Hirn und feinen Stromimpulsen gezielt zum lachen gereizt wird, behauptet, der Anblick der Neurophysiologen sei die Quelle seiner Heiterkeit, dann lässt sich daraus nicht generell schließen, das Bewusstsein sei bloße Begleitmusik. Das Bewusstsein hat, wie wir noch sehen werden, selbst eine komplexe Struktur. Letzten Endes ist Bewusstsein in seinem tiefsten Wesen Musik, was, wie dieses Buch zeigt, mehr als eine metaphorische Umschreibung ist.
Die Einsicht, dass sich derartige Fragen innerhalb des Dreiecks Medizin – Physik – Psychofonie in den Psychofonie-Kuren innigst berühren und dass eine fachübergreifende Darstellung für ein wissenschaftliches und klinisches Verständnis nötig ist, führte zum Wunsch, das Buch zu schreiben. Unsere nicht geringste Hoffnung ist, dass etwas von der Faszination, die uns bei der Beschäftigung mit der zerebralen Regularisierung durch Psychofonie tagtäglich begleitet, auf eine große Leserschaft überspringen möge.
Danksagung
Ein tief empfundenes Dankeschön gilt vor allem meiner Frau Ursula Fricker-Rüegger, die das Wagnis mit der Psychofonie von Anfang an befürwortete und bis zu ihrem Tod im November 2019 umsichtig und tatkräftig mittrug. Danken möchte ich ferner Dr. med. Klaus Tereh und Dr. med. Markus Fischer, denen ich viele Gedanken in diesem Buch verdanke, und allen anderen Psychofonie-Lizenznehmerinnen und Lizenznehmern in der Schweiz, die als solid ausgebildete, erfahrene medizinische Fachleute ihre Klientel mit Psychofonie versorgten. Soll man auch seinen unbarmherzigen Kritikern danken? Die heutige Zeit verlangt diesen Spagat. Das Buch dient auch einem Brücken bauenden Diskurs. Nur so kann sich ein gemeinsamer Code entwickeln, der für das ganze Gesundheitswesen gewinnbringend ist.
Bruno Fricker, Kilchberg bei Zürich, im Sommer 2020
1Die bioelektrischen Grundlagen des Erwachens. In Oliver Sacks: Awakenings. Rowohlt Taschenbuch-Verlag, Reinbeck bei Hamburg, 1997. Originalausgabe 1973. Sacks hat als einer der ersten großen Neurologen die Bedeutung von Rhythmus und Musik in der zerebralen Organisation und bei Heilprozessen erkannt, bei seinen Patienten – und an sich selbst. Siehe auch O. Sacks: Der Tag an dem meine Bein fortging. Rowohlt Taschenbuch-Verlag, Reinbeck bei Hamburg, 1991.
2 Berger in Jena publizierte 1929 die Abhandlung Über das Elektrenkephalogramm des Menschen, nach 5jährigem Zögern. Er vertiefte die Erkenntnisse über das EEG noch während 9 Jahren mit einfachsten Mitteln und machte viele grundlegende Beobachtungen an Gesunden und Kranken.
3 H. Petsche, H. Pockberger, P. Rappelsberger: EEG topography and mental performance. In: F.H. Duffy (Ed.): Topographic mapping of brain electrical activity. Butterworth, Boston, 1986, p.63-98. Und Petsche, Pockberger, Rappelsberger: Musikrezeption, EEG und musikalische Vorbildung. Z EEG-EMG 16: 183-190, 1985.
4 Siehe D. Lehmann: Brain electric states and microstates: towards the atoms of thought. In: M. Rother and U. Zwiener (Eds.) Quantitative EEG Analysis - Clinical Utility and New Methods. Universitatsverlag Jena, Germany, 1993, p.170-178, sowie RD Pascual-Marquis EEG-Kohärenz-Mapping Methode, siehe www.uzh.ch/keyinst/loreta.htm und der deutschen funktionellen Quellenanalyse-Software bei www.besa.de von Michael Scherg.
5 Tsutomu Nakada (Ed.): Integrated Human Brain Science: Theory, Method, Application (Music). Elsevier-Verlag, Amsterdam, 2000, 497 S.
6 Wir verwenden in diesem Buch abwechselnd beide Geschlechtsformen, um die leidigen Doppelnennungen zu umgehen; dabei können wir, wie im Fall der Migräne, teilweise mit berücksichtigen, welches Geschlecht davon mehr betroffen ist.
7 Colin McGinn: Wie kommt der Geist in die Materie? Das Rätsel des Bewusstseins. C.H. Beck, München, 2001.
8 Dass solche Fragen wissenschaftlich salonfähig geworden sind, beweisen:
- Pim van Lommel et al.: Near-death experience in survivors of cardiac arrest. The Lancet, Vol 358, 2001, p.2039-2045. Die Studie untersucht Nahtodeserlebnisse, die unausweichlich belegen, dass es einen vom Körper unabhängigen Geist gibt, der sogar Sinneswahrnehmungen machen kann. Dem widerspricht eine Studie aus Genf, die mit elektrischen Hirnreizungen derartige «Out-of-body»-Erlebnisse provozieren kann:
- Olaf Blanke et al.: Stimulating illusory own-body perceptions. Nature, 419, 2002, p.269-270. Schärfer könnten die kontroversen Argumente nicht aufeinanderprallen. Was im ersten Artikel positiv gewertet wird – die Autoren sprechen von nachhaltigen Persönlichkeitsveränderungen bzw. Reifungsprozessen nach Nahtodeserlebnissen – wird im zweiten Artikel als Störung in der Zentralintegration von Körperwahrnehmungen und Gleichgewichtssinn abgetan.
9 Metzinger im Tages-Anzeiger 18.10.1996; siehe auch www.philosophie.fb05.unimainz.de/arbeitsbereiche/theoretische/thmetzinger/
10 Hans Zeier: Biofeedback. Physiologische Grundlagen - Anwendungen in der Psychotherapie. 2. vollst. überarbeitete Aufl. Hans Huber Verlag Bern, 1997, 152 S.
11 Antonio R. Damasio: Ich fühle also bin ich. Die Entschlüsselung des Bewusstseins. List Verlag, München, 2000.
12 Zu verstehen im Sinne von
https://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-26948-7_29, www.tinnitus.org und P.J. Jastreboff, W.C. Gray, S.L. Gold: Neurophysiological approach to tinnitus patients. Am.J.Otology, 17, p.236-240, 1996.
Über das Hören im Alter:
https://drive.google.com/open?id=1zKoBmAtMms6J3M5FTm9Be7S7fySzcfeq
13 C.G. Jung (Zit.): Es ist, als ob der Individuationsprozess eine unendliche und stete Annäherung an ein fernes Ziel wäre, für den der Tod die letzte Grenze bedeutet. ... Wer nicht versteht und fühlt, dass man schon in diesem Leben an das Unendliche angeschlossen ist, hat das Leben vertan.
Chaos im Hirn – wie das Gehirn arbeitet
Das Gehirn zu beschreiben, ist eigentlich ganz unmöglich. Es ist, wie wenn ich Ihnen eine Großstadt erklären müsste. Dabei könnte man schon über eine Brücke ein Buch schreiben. Bei genauerem Hinsehen würde selbst ein Drahtseil an dieser Brücke Stoff für eine Abhandlung geben. Und so ist das auch im Hirn: Man kann den Blick hinwenden, wo man will, immer begegnen uns wunderbar komplexe Gebilde in einem unendlichen selbstähnlichen Regress, wie wenn Sie in einen Spiegel schauen, und hinter Ihnen hängt noch ein Spiegel, und Sie sehen Ihr Spiegelbild im Spiegelbild im Spiegelbild, usw. – Betrachten wir zunächst den Grundbaustein des Hirns, die Nervenzelle.
Abbildung 1 Nervenzelle (Neuron)
Sie besteht aus Dendriten, Zellkörper und Axon. Sie ist in der Lage, elektrische Impulse fortzuleiten, von den Dendriten zum Axon. Wenn Sie wissen wollen, warum dies möglich ist, gelangen Sie zu den Zellmembranen, die wie Isolatoren wirken, und zu dem Zellplasma, das wie ein Draht leitet. Sie gelangen zu den Ionenpumpen, welche wie kleine Batterien die Energie liefern, damit Nervenimpulse einen Meter oder mehr laufen und sich dabei nicht abschwächen. Am Ende jedes Axons aber stoppt die Leitung, obgleich in nächster Nähe eine Kontaktstelle eines andern Neurons den Impuls zum Überspringen einlädt. Dieser Ort, Synapse genannt, hat es in sich. Er verschafft der Impuls-Botschaft nur Einlass, wenn sich diese in chemische Transmitter-Moleküle verwandelt, die durch den Wasserspalt hinüberwandern.
Dies ist aber nicht ohne Weiteres möglich: Die Synapse ist ein überaus kritisch eingestelltes, vom Milieu abhängiges, lernfähiges Ventil. Die Aufklärung der Mikrostruktur der Synapse14, die maßgeblich auch in der Schweiz geleistet wurde, war die große Leistung der Neurobiologie vor 50 Jahren. Einer Arbeitsgruppe in der Universität Genf gelang 2000 eine großartige Dokumentation15 über das Sprießen und Rückbilden winziger Synapsenstrukturen. Dieses Werden und Vergehen der Synapsen ist die Grundlage der Lernfähigkeit von Neuronennetzwerken, der Konditionierungsvorgänge und des Langzeitgedächtnisses. Man hofft, über die Synapsenfunktion die Suchterkrankungen besser zu verstehen. Die Genfer Forscher sind hauptsächlich biochemisch orientiert.
Die Neuropharmakologie feierte auf solchen Grundlagen ihre großen Triumphe. Dank der chemischen Einflussnahme auf das Zellmilieu erhöht oder verringert sich die Leistungsfähigkeit der Synapsen. Man kann dadurch dämpfen oder anregen. Und weil es in verschiedenen Hirnbezirken ungleiche Transmitter-Substanzen16 gibt, kann man bestimmte Hirnbezirke dämpfen oder anregen. Mit andern Worten, man kann die chemische Einflussnahme einigermaßen zielen. Genau da liegen die Grenzen der Therapie mit Neuropharmaka. Die Zielsicherheit ist nicht sehr gut, und es gibt erhebliche Nebenwirkungen, umso mehr als diese Medikamente über das Blut im ganzen Hirn aber auch anderswo im Körper verteilt werden. Um es im Bild der Großstadt auszudrücken: Den Bahnhofplatz zu sperren, indem Sie überall in der Stadt Barrieren errichten und so an andern Orten Chaos verursachen, ist keine effiziente Verkehrsregelung. –
Abbildung 2 Links Schnittbild einer Synapse, Spalt 1/50000 mm. Rechts Zeichnung eines Zellkörpers, der von Synapsen übersät ist.
Beispiel: An der Entstehung der Migräne sind laut Sacks mindestens sieben Neurotransmitter17 beteiligt. Alle lassen sich durch jeweils verschiedene Medikamente beeinflussen. Man hat deshalb versucht, mehrere Medikamente zu kombinieren. Die «Kunst» der Migränespezialisten bestand darin, für jeden Patienten die richtige Mischung herauszufinden. Die Patienten waren die leidtragenden Versuchskaninchen. Dass eine solche «irrwitzige Polypharmazie» nicht zum Ziel führt, hat man inzwischen allseitig erkannt.
Das Hirn zu verstehen, scheint auch deshalb unmöglich, weil es uns so nah ist. So nah, dass man sagen könnte: Wir sind das Gehirn – mein Hirn, das bin ich selbst. Mit dem Apparat, der denken und fühlen kann, kann ich aber das Denken und Fühlen, also das Bewusstsein, schlecht oder überhaupt nicht erklären. Das Denken müsste ja das Denken – sich selbst erklären. Die Philosophie hat dies gar als prinzipiell unmöglich erklärt. Etwas mehr Hoffnung geben die zahlreichen Entdeckungen, die explosionsartig in den letzten Jahren in der Hirnforschung gemacht wurden. Es ist die Frage, ob eine Vereinigung des gesamten Wissens der Neurobiologie und Neuropsychologie und all ihrer Hilfswissenschaften schon genügt, um etwa den sich selbst bewussten Geist zu verstehen.
Abbildung 3 Drei (von 40 Mio.) Dendronen und ihre Psychonen (Apikal- Dendriten von Pyramidenzellen). Jedes Dendron umfasst 200 Neurone bzw. 100'000 Dornsynapsen. Der Kortex hat 10 Milliarden Neuronen.18
Um es mit einer Frage auf den Punkt zu bringen: Ist der Geist identisch mit den neurobiologischen Vorgängen? Oder hat er immaterielle Quellen, die sich der Naturwissenschaft für immer entziehen werden? Oder um einfacher zu fragen: Ist der Willensakt, eben jetzt in die Hände zu klatschen, primär ein Impuls des Geistes oder ein körperlicher Entschluss eines nervlichen Willenszentrums? Stimmen wir einmal ab: Wer ist dafür, dass ein geistiges Ich den Entschluss fasst zu klatschen? – Und wer ist der Meinung, dass die Nerven aus sich selbst heraus das Klatschen auslösen? – Diese Frage ist, zumindest bei Menschen, die sich überhaupt Fragen stellen, sehr umstritten. Es zieht sich ein Riss durch die Gesellschaft. Er verhindert teilweise auch ein Zusammengehen von Schulmedizin und Komplementärmedizin. Letztere ist offener gegenüber geistigen und spirituellen Dimensionen. Ärzte waren früher die Häretiker in der kirchentreuen Gesellschaft. Denken Sie etwa an Paracelsus. Heute sind die Komplementärmediziner die Häretiker der Schulmedizin, weil sie wieder mit dem Geist rechnen. Dieser Riss zeigt sich in der Forschung als ein gähnender Abgrund, und es hat Nobelpreisträger auf beiden Seiten, die sich unbarmherzig bekämpfen.
Freilich sind in der Naturforschung die Materialisten übermächtig. Das Grüppchen der Andersgläubigen, etwa um Sir John Eccles, ist sehr klein aber hartnäckig, und es kämpft keineswegs auf verlorenem Posten. Die Neurobiologie ist nicht zuletzt durch diesen Kampf alles andere als langweilig. Sie ist eine Schlüsselwissenschaft. Unglaublich, dass ihr Studienobjekt in zwei Händen Platz hat. Dieses grauweiße schwabbelige Ding – das Gehirn – ist das komplizierteste Forschungsobjekt überhaupt. Unser Denkorgang ist ein Kosmos – und dieser Neuro-Kosmos ist der Urquell der Lebensfreude, das Zentrum Ihrer und meiner Identität und damit das größte Mysterium. Das Hirn ist aber auch Hauptwohnsitz aller Schmerzen und Leiden. – Warum?
Chaos und Selbstorganisation
Das Hirn ist ein Kosmos. Das stimmt wortwörtlich. Unsere Milchstraße ist etwa eine Billion Sterne schwer. Das Hirn hat 100 Milliarden (~1011) Nervenzellen und ungefähr tausend Billionen (1015) Synapsen, denn jede Nervenzelle lässt bereits in der frühkindlichen Entwicklung tausend oder mehr Dendriten-Äste zu andern Nervenzellen sprießen.
Diese unvorstellbare Komplexität ist kaum erforscht. Die Nobelpreise sind bis ins Jahr 2000 nur für reduktionistische Spitzenleistungen vergeben worden, also für die Zergliederung zu immer kleineren Körperbausteinen. Ein Beispiel ist der Nobelpreis in Medizin von 1998 für Stickstoffmonoxid.
Das ist die Biologie von zwei einzigen Atomen. Es erweitert die Blutgefäße. Es hat dem Lifestyle-Medikament Viagra den (Irr-)Weg bereitet. Es mehren sich nun die Anzeichen für eine Umkehr der Blickrichtung. Die sogenannten systemischen Aspekte rücken in den Mittelpunkt, Zusammenhänge werden gefragt, man richtet den Blick vermehrt auf das Ganze. Während früher die immer feinere Spezialisierung19 typisch war, gibt es heute mehr Institute und Fachgebiete auf interdisziplinärer Grundlage. Ein fachübergreifendes Gebiet in der Medizin ist die Schmerzmedizin. Dass etwa Psychologen und Neurologen begonnen haben, einander zuzuhören, ist ein großer Fortschritt. Der Blick auf das Ganze wird Trumpf.
Abbildung 4 Nervenzellen sind wie Büsche von einem Zehntel Millimeter Durchmesser, die sich in einem chaotischen Dickicht kosmischer Größenordnungen durchdringen und im Hirn organisieren.
Ein interdisziplinäres Institut der Spitzenklasse ist das Santa Fe Institut in Neu Mexiko.20 Dort wurden früher die Atombomben entwickelt. Nun ist es eine Forschungsstätte, die für das Verständnis der makroskopischen Hirnfunktionen von großer Bedeutung sein könnte. Es wurde untersucht, wie mächtige Netze mit Millionen von Nervenzellen funktionieren.21 Das Grundmodell zum Verständnis dieser sich selbst organisierenden kritischen Systeme ist der Sandhaufen. Es ist typisch für die Physiker, dass sie sich für die Deutung der Natur von einfachsten Beobachtungen leiten lassen, die sie als spielende Kinder gemacht haben.
Was kann man am Sandhaufen beobachten? Wenn trockener Sand in der Mitte hinunter rieselt, entsteht ein Kegel mit einer bestimmten Steilheit. Wenn oben Sand dazukommt, wird der Haufen etwas steiler, aber es geht nicht lange, und eine Sandlawine fährt hinab und sorgt für Abflachung. Der Haufen wächst so gleichzeitig in die Höhe und in die Breite, und was von größter Bedeutung ist, die Wachstumsschübe sind ruckartig. Den Sandhaufen kann man nicht verstehen, wenn man ein einzelnes Sandkorn und seine Nachbarschaft untersucht. Offensichtlich ist der Sandberg ein komplexes System, der als vernetztes Ganzes betrachtet werden muss. Millionen gleichartiger Sandkörner geben Kräfte an ihre Nachbarkörner ab. Man kann die Kraftwirkungen als kleine Botschaften verstehen. Kein Korn weiß mehr über das Ganze, als es aus der engsten Umgebung erfährt.
Abbildung 5 Der Sandhaufen erreicht seine kritische Steilheit.22
Der Sandhaufen als Ganzes jedoch zeigt ein Verhalten, das man aus der Untersuchung eines einzelnen Sandkorns nie erahnt hätte. Sandlawinen gehen ab, wenn eine kritische Steilheit erreicht ist. Dann aber genügt ein einziges zusätzliches Korn, um den Abgang großer Sandmengen an einer ganz anderen Stelle auszulösen. Der kritisch angehäufte Sand ist, so gesehen, ein komplex zusammenhängender Organismus, ein Netzwerk.
Abbildung 6 Anfallstypen hinsichtlich ihrer Zeitdauer und ihrer neuralen Verarbeitungsebene zwischen Hirnrinde und Rückenmark. 23
Abbildung 7 Schmerzverarbeitung und Schmerzhemmung im zentralen Nervenvensystem. Der Begriff der neuralen Verarbeitungsebenen ist in Bezug auf Schmerzimpulse dargestellt. 24
Den kritischen Zustand überschreiten
Anfallsleiden