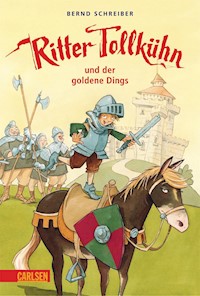6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Hunger macht erfinderisch. Müde schlendert Florian mit seinem Eis um die Ecke des Supermarktes und traut seinen Augen nicht: Ein Mädchen durchwühlt ganz offensichtlich den Müllcontainer. Tage später beobachtet Florian das gleiche Mädchen zufällig beim Klauen. Und dann steht sie plötzlich vor ihm: mit seinem Rucksack, den er versehentlich irgendwo liegen gelassen hatte. Ihre Ehrlichkeit irritiert Florian und macht ihn gleichzeitig neugierig. Nach und nach kommt er Svenja näher und hinter ihr Geheimnis: ihre alleinerziehende Mutter lebt von Sozialhilfe und am Monatsende ist die Kasse grundsätzlich leer - und damit auch der Kühlschrank. In der Not entwickelt Svenja eine clevere Geschäftsidee ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Bernd Schreiber
Die Container-Füchse
Deutscher Taschenbuch Verlag
Originalausgabe
© 2009Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital– die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
eBook ISBN 978-3-423-41222-3 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-71371-9
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website
www.dtv.de/ebooks
Eine sonderbare Begegnung
Essen aus dem Müllcontainer
Diebstahl im Gartencenter
Die ehrliche Finderin
Primaballerina
Pizza mit Gammeltrauben
Bruno
Das wahre Gesicht
Die Löwenbändigerin
Erste Hilfe
Auf dem Flohmarkt
Karaoke
In der Klemme
Die Abmachung
Eiertanz
Ein unerwarteter Vorschlag
Ein Hauch von Romantik
Alles oder nichts
Caspar und Co
Krankenbesuch
Alte Freunde
Eine gelungene Überraschung
Die zündende Idee
Ein bisschen Spaß muss sein
Am Ziel
[Informationen zum Buch]
[Informationen zum Autor]
Eine sonderbare Begegnung
Die Ampel zeigte Rot.
Ich fühlte mich schlapp wie lange nicht mehr und spürte kaum noch meine Arme. Obwohl ich tapfer dagegen ankämpfte, musste ich gähnen.
»Na, müde?«, fragte mich Opa. Er saß am Steuer seines Transporters, einem zehn Jahre alten Kastenwagen, und grinste mich an.
Im Wagen roch es nach Harz.
»Nicht die Spur«, behauptete ich. Opa sollte nicht denken, ich hätte mich verausgabt. Womöglich nahm er mich dann nicht mehr mit in den Wald, denn da kamen wir gerade her. Wir hatten eine Fichte gefällt, sie mit der Motorsäge in grobe Stücke zersägt und die schweren Klötze in den Transporter geladen. Die Arbeit war hart gewesen. Trotzdem war ich gern mit Opa im Wald.
Das Holz war für Opas Kamin bestimmt. Der Wald gehörte ihm. Na ja, nicht wirklich. Er hatte den Wald bloß gepachtet, das heißt einen Teil davon. Als Pächter war er verpflichtet, den Wald zu pflegen. Und zur Pflege wiederum gehörte es, Bäume zu fällen, damit die anderen Bäume genug Platz zum Wachsen hatten.
Die Ampel sprang auf Grün. Opa gab Gas, als der Transporter auf einmal in voller Fahrt zu ruckeln begann.
»Nö, komm, das kannst du mir nicht antun«, beschwor Opa den alten Kastenwagen. »Ich fahre mit dir auch durch die Waschstraße, wenn es das ist, was du willst. Aber lass mich nicht im Stich! Nicht jetzt!« Während Opa auf den Wagen einredete, strich er fast zärtlich über das Armaturenbrett, als wäre die fahrbare Kiste ein Pudel.
Wie immer hatte der Transporter seinen eigenen Kopf. Das Ruckeln wurde stärker.
»Kauf dir endlich ein vernünftiges Auto«, lachte ich.
»Du kannst gern zu Fuß laufen, wenn du möchtest«, warnte mich Opa.
»Wetten, dass ich dann schneller zu Hause bin?«
Opa schaffte es gerade noch, den stotternden Wagen auf den Parkplatz des Supermarkts zu lenken, wo der Transporter endgültig seinen Geist aufgab.
»Das war nun wirklich nicht nötig«, murmelte Opa, stieg aus dem Wagen und öffnete die Motorklappe. Auf den ersten Blick konnte er nichts erkennen. Und auch nicht auf den zweiten.
»Vielleicht hat er ja keinen Sprit mehr«, sagte ich.
»Das würde mich wundern, ich habe gestern getankt.«
»Dann ist es bestimmt der Vergaser.« Ich hatte Opa schon oft beim Reparieren zugeguckt und wusste daher ein wenig Bescheid.
»Ich habe erst letzte Woche einen neuen eingebaut.«
Stimmt. Das hatte ich ganz vergessen.
»Es könnte aber auch ein Kolbenfresser sein«, gab ich zu bedenken.
»Sag mal, wieso gehst du nicht einfach in den Supermarkt und kaufst dir ein Eis?« Es schien ganz so, als wollte mich Opa loswerden. Statt sich über meine fachlichen Tipps zu freuen.
»Würde ich ja«, antwortete ich. »Aber ich bin blank. Taschengeld gibt’s erst morgen.«
Großzügig, wie er war, überließ mir Opa sein letztes Kleingeld. Mit fünfundneunzig Cent in der Hand betrat ich den Supermarkt und steuerte geradewegs auf die Eistruhe zu. Nach einigem Suchen entdeckte ich ein Sieht-aus-wie-ein-Magnum-Eis-ist-aber-kein-Magnum-Eis für günstige siebzig Cent. Mit dem Eis in der einen und dem Restgeld in der anderen Hand ging ich nach draußen, wo ich sogleich vor ein verzwicktes Problem gestellt wurde: Wie entfernt man das Papier von einem Sieht-aus-wie-ein-Magnum-Eis-ist-aber-kein-Magnum-Eis, wenn man keine Hand dafür frei hat, weil in der anderen noch das Restgeld ist? Die Lösung war verblüffend einfach: Ich brauchte das Geld nur in die Hosentasche zu stecken, was ich dann auch tat. Das heißt, so ganz glückte mir das Vorhaben nicht. Eine Münze, die wohl etwas dagegen hatte, einen Teil ihrer Zukunft in einem dunklen Baumwoll-Loch zu verbringen, fiel einfach auf die Erde und kullerte auf ihrem schmalen Rand davon. Doch das Geldstück hatte die Rechnung ohne seinen Besitzer gemacht. Ich nahm sofort die Verfolgung auf und schwupp, hatte ich meinen Fuß auf die Münze gestellt, der Rest war reine Routine. Jetzt hätte eigentlich der vergnügliche Teil beginnen sollen, als ich eine höchst seltsame Beobachtung machte. Unnötigerweise war die Münze um die Ecke des Supermarkts gerollt, wo sich der Müllcontainer befand. Das wäre an sich nicht weiter erwähnenswert, wäre da nicht das Mädchen gewesen, das halb im Container hing– die Füße gut einen Meter über dem Boden baumelnd– und, wie es aussah, den Müll durchsuchte. Ich stand da und wusste nicht genau, ob ich lachen sollte oder einfach nur staunen. Ich war gespannt, wie die Geschichte weiterging. Lange brauchte ich nicht zu warten, denn das Mädchen schien gefunden zu haben, wonach es gesucht hatte, und ließ sich geschickt vom Container herunter. Es hielt eine Packung in der Hand, die es in eine Plastiktüte steckte. Wenn mich nicht alles täuschte, war es ein Kuchen. Als mich die Containerwühlerin sah, zögerte sie kurz, schnappte die Tüte und kam mit feindseligem Blick direkt auf mich zu.
»Ich sag’s nur einmal!«, zischte die unbekannte Tütenträgerin und baute sich vor mir auf. »Lass die Finger vom Container! Das ist mein Revier! Oder ich hetze dir meine Brüder auf den Hals!« Und schon war sie an mir vorbei.
Ich schaute ihr verblüfft hinterher. War das nicht gerade eine Drohung? Ich schluckte. Was hatte ich mit diesem blöden Container zu tun? Und mit ihren Brüdern? Als Miss Ungemütlich aus meinem Sichtfeld verschwunden war, hatte die Lust auf das Eis spürbar nachgelassen. Gleichgültig entfernte ich die Verpackung und tappte zu Opa. Der hatte inzwischen den Fehler gefunden. Die Benzinleitung hatte sich gelöst.
»Geht’s dir nicht gut?«, erkundigte sich Opa, als wir wieder im Transporter saßen.
»Wieso?«, fragte ich zurück.
»Du siehst aus, als wäre dir ein Geist begegnet.«
Essen aus dem Müllcontainer
Opa setzte mich zu Hause ab. »Grüß deine Eltern von mir«, sagte er. »Ich schaue ein andermal bei ihnen vorbei.«
»Okay«, entgegnete ich und schlug die Tür zu.
Als Opa losfuhr, gab es einen mächtigen Knall. Der Transporter hatte mal wieder eine Fehlzündung.
Zu Hause machte niemand auf. Damit auch der Letzte merkte, dass ich angekommen war, klingelte ich Sturm. Es nützte nichts– wahrscheinlich waren meine Eltern im Garten. Also ging ich ums Haus herum.
Auch im Garten war niemand anzutreffen, dafür stand die Terrassentür offen. Toller Empfang, dachte ich.
»Flori, Süßer, wie war’s?«
Ich zuckte zusammen. War meine Mutter wahnsinnig, mich so zu erschrecken? Ich drehte mich um, da entdeckte ich sie in ihrer Hängematte, die zwischen zwei Birken gespannt war.
»Ich heiße Florian«, wies ich sie zum hunderttausendstenmal auf die Richtigkeit meines Vornamens hin. »Und ich bin auch nicht süß.«
Ich ging in die Küche, nahm ein Glas, schenkte mir von dem fruchtigen Multi-trink-dich-fit-Saft ein und trank das Glas in einem Zug aus.
»Wann gibt’s Abendbrot?«, fragte ich meine Mutter, die ihre frühabendliche Faultierstunde beendet hatte und die Küche betrat. »Ich habe Hunger.« Was nach der schweren Waldarbeit auch kein Wunder war. Ich hätte zwei Schüsseln voll Pommes auf einmal verdrücken können und dazu noch das ein oder andere Brathähnchen.
»Ich wollte gerade den Tisch auf der Terrasse decken«, antwortete meine Mutter. »Hilfst du mir?«
»Ich darf dich daran erinnern, dass ich mit Opa im Wald war und schwer gearbeitet habe«, antwortete ich. »Oder glaubst du, so ein Baum fällt von alleine um?«
»Nein, tut er das nicht?«, fragte meine Mutter spöttisch.
Ich half ihr trotzdem, den Terrassentisch zu decken.
Da klingelte drinnen das Handy meiner Mutter und sie verschwand erst einmal in ihrem Büro. Das Gespräch dauerte aber nicht lange.
»Wieder nichts«, sagte sie enttäuscht, als sie zurückkam. Meine Mutter war Maklerin. Wollte jemand sein Haus verkaufen, wandte er sich an sie, damit sie sich um einen Käufer bemühte. Es war jetzt bereits der fünfte Interessent, dem das Haus, das sie vermittelte, zu teuer war.
Kaum waren wir mit den letzten Vorbereitungen für das Essen fertig, kam Papa von der Arbeit. Er wusch sich die Hände und setzte sich zu uns an den gedeckten Tisch.
»Wisst ihr, was ich eben im Radio gehört habe?«, fing er auf einmal an.
Typisch Papa. Immer musste er uns gleich auf die Nase binden, was es Neues an Nachrichten gab.
»Dass ein Kind heutzutage im Durchschnitt pro Jahr über ein Vermögen von tausend Euro verfügt.«
Ich dachte, ich hätte einen Hörschaden. »Tausend Euro?«, wiederholte ich ungläubig. »Davon habe ich aber noch nichts gemerkt.«
»Das ist doch verrückt«, meinte meine Mutter.
Ich weiß auch nicht, warum, aber plötzlich musste ich an die Containerwühlerin denken und dann erzählte ich meinen Eltern von der eigenartigen Beobachtung, die ich beim Supermarkt gemacht hatte. Dass Miss Ungemütlich mir mit ihren Brüdern gedroht hatte, erwähnte ich lieber nicht. Ich wollte nicht unnötig die Pferde scheu machen.
»Interessant«, sagte mein Vater, nachdem ich mit meiner Schilderung fertig war. »Das erinnert mich an einen Bericht, den ich neulich gelesen habe. Darin stand, dass immer mehr Studenten in den Müllcontainern der Supermärkte und Bäckereien nach abgelaufenen Lebensmitteln suchen und sich davon ernähren.«
»Iiih«, quietschte meine Mutter und verzog das Gesicht, als hätte sie in eine Scheibe schimmeliges Brot gebissen.
»Die Lebensmittel sind ja nicht verdorben«, meinte mein Vater gelassen. »Bei ihnen ist lediglich das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen. Deswegen werfen die Geschäfte die Waren in den Container.«
»Sind die Studenten so arm oder warum wühlen sie in den Müllcontainern?«, fragte ich ihn.
»Na ja, so ein Studium ist sehr teuer«, antwortete er. »Und die meisten Studenten haben gar nicht die Zeit oder die Möglichkeit, nebenher noch zu arbeiten, um genügend Geld hinzuzuverdienen. Daher halten sie sich mit abgelaufenen Lebensmitteln über Wasser. Ich halte das für eine pfiffige Idee.«
»Also, ich weiß nicht«, warf meine Mutter ein.
»Aber dass nun auch schon Kinder sich aus Müllcontainern ernähren müssen, finde ich äußerst bedenklich«, sagte mein Vater.
Das fand ich dann auch.
Diebstahl im Gartencenter
Opa brauchte einen neuen Rasenmäher. Sein alter hatte nach dreißig Jahren endgültig seinen Dienst versagt. Da Ferien waren und ich nichts Besseres zu tun hatte– meine Freunde waren noch in alle Winde verstreut–, begleitete ich Opa in die Stadt, wo sich gleich hinter dem Marktplatz ein Gartencenter befand. Dort gab es einen Rasenmäher im Sonderangebot, den sich Opa etwas näher anschauen wollte.
Das Gute am Gartencenter war, dass sie auch eine Kleintierabteilung hatten. Dann würde ich endlich wieder einmal die Vogelspinnen und Skorpione sehen. Kaum hatten wir das Gartencenter betreten, trennte ich mich von Opa und machte mich auf den Weg zu den Tieren. Ich hatte vielleicht die halbe Strecke zurückgelegt, da entdeckte ich sie: Miss Ungemütlich, die Containerwühlerin. Sie hielt sich vor einem Warenständer mit Saatgut auf. Die Auswahl an grünen Tüten war riesengroß– es müssen Hunderte gewesen sein. Plötzlich war ich neugierig. Was wollte sie wohl hier?
Ich blieb stehen und tat so, als hätte ich mein Augenmerk den Spaten und Forken geschenkt, tatsächlich aber schielte ich immer wieder zu ihr rüber. Endlich schien sie gefunden zu haben, was sie suchte. Mit einigen Tütchen in der Hand entfernte sie sich. Ich heftete mich an ihre Fersen, bewahrte aber genügend Abstand.
Ihr Ziel war die Kleintierabteilung, was ganz praktisch war, weil ich sowieso dorthin wollte. Vor dem Gehege mit den Meerschweinchen und Kaninchen machte sie halt. Ich stand genau neben dem Regal mit den Leckerlis für Hunde. Das Zeug stank so entsetzlich, dass mir fast schlecht wurde. Ich musste mich zusammenreißen, dass ich mich nicht übergab. Während ich tapfer gegen die Übelkeit ankämpfte, ließ ich das Mädchen keine Sekunde aus den Augen. Trotzdem kam es mir zunächst wie eine Einbildung vor, als die Tüten mit dem Saatgut urplötzlich in der Jacke des Mädchens verschwanden. Ich dachte wirklich, ich hätte mich verguckt, aber ich konnte es drehen und wenden, wie ich wollte– das Mädchen hatte die Tüten eingesteckt. Ich konnte es nicht fassen. Die Sache wurde jetzt richtig kriminell. Natürlich wollte ich wissen, was als Nächstes folgte, und so behielt ich das Mädchen im Auge, das noch immer vor dem Gehege mit den Kaninchen stand. Dort blieb es aber nicht mehr lange, wofür ich ihm ganz dankbar war, denn der Gestank der Hundesnacks war kaum noch zu ertragen. Zielstrebig marschierte Miss Langfinger auf die Kassen zu. Ich blieb ein gutes Stück hinter ihr. Ich war gespannt, ob sie tatsächlich so unverfroren war, sich an der Kasse vorbeizumogeln. Es hört sich vielleicht komisch an, aber ich hatte richtiges Herzklopfen – als hätte ich selbst die Tüten geklaut. Ich hätte auch gar nicht sagen können, welches Ende mir lieber gewesen wäre: dass sie geschnappt wurde oder dass sie ungeschoren davonkam. Jedenfalls ging sie an der Kasse vorbei, als wäre es das Normalste von der Welt. Und niemand stellte sich ihr in den Weg und führte sie ab. Ich stand da und dachte, das gibt’s doch nicht.
Plötzlich legte mir jemand die Hand auf die Schulter. »Hab ich dich endlich!«
So nah an einem Herzinfarkt war ich noch nie. Im ersten Augenblick dachte ich, es wäre der Hausdetektiv, aber es war bloß Opa.
Es war schon komisch, aber irgendwie fühlte ich mich, als wäre ich an dem Diebstahl mitschuldig. Das war auch der Grund, weshalb ich Opa nichts von dem Zwischenfall erzählte.
»Hast du den Rasenmäher schon gekauft?«, erkundigte ich mich stattdessen.
Opa schüttelte den Kopf. Der Rasenmäher hatte ihn nicht überzeugt.
»Schade«, sagte ich. Eine Frage aber ließ mich nicht mehr los: Warum hatte die Containerwühlerin ausgerechnet Tüten mit Saatgut gestohlen? Was wollte sie damit?
Die ehrliche Finderin
Manchmal, wenn ich mich langweilte, packte ich meine Inliner in meinen Rucksack und zog los. Ganz in der Nähe war ein Kaufhaus, das vor einigen Monaten dichtgemacht hatte. Der Parkplatz, auf dem jetzt keine Autos mehr standen, eignete sich hervorragend zum Trainieren. Fast immer war einer da, den ich kannte und mit dem ich dann gemeinsam die Zeit verbrachte. Aber in den Ferien war wenig los. Ich war der Einzige, der an diesem Tag Inliner fuhr. Es machte überhaupt keinen Spaß. Mir fehlten die Leute, die sahen, wie gut ich auf den Gummirädern war.
Nach einer halben Stunde packte ich enttäuscht die Inliner ein und machte mich auf den Heimweg. Unterwegs kaufte ich mir im Getränkemarkt um die Ecke einen kühl gelagerten Durstlöscher. Ich setzte mich damit draußen auf die Stufe eines Brunnens. Den Rucksack legte ich neben mich. Ich saß da, löschte meinen Durst und sah mir zwischendurch die Leute an. Einer hatte einen langen schwarzen Ledermantel an und sah auch sonst etwas gruselig aus. Ich hätte schwören können, dass es ein Grufti war. Ich war erst elf und hatte noch keinerlei Vorstellung, was einmal aus mir werden sollte, aber eins war gewiss– wie jemand, vor dem die Leute sich gruseln, wollte ich auf keinen Fall herumlaufen– für keinen Klumpen Gold auf der Welt.
Ich trank die Flasche aus und setzte meinen Fußmarsch fort. Ich befand mich gerade in Höhe des Reisebüros, da hörte ich, wie jemand hinter mir »He, du!« rief. Nun hieß ich nicht Hedu und hatte auch sonst keinen Grund, stehen zu bleiben.
»Bist du taub?« Ich war auch nicht taub, daher konnte ich unmöglich gemeint sein. Trotzdem war ich neugierig geworden. Ich warf einen Blick über meine linke Schulter. Was ich bei der Gelegenheit sah, brachte mich für einen Moment aus der Fassung. Ich nahm zwei Dinge auf einmal wahr: meinen Rucksack und das Mädchen, das ihn in der Hand hielt.
»Kann es sein, dass das deiner ist?«, erkundigte sich mein Gegenüber schnippisch. Jetzt erkannte ich sie wieder. Ja, doch, das war sie: die Containerwühlerin. Miss Langfinger. Ich stand da und glotzte sie nur an.
»Das ist doch dein Rucksack, oder?« Außer meinem Rucksack hatte das Mädchen noch zwei gefüllte Plastiktüten in der Hand. »Es wäre besser, du redest mit mir. Sonst muss ich ihn zum Fundbüro bringen, was mir überhaupt nicht passen würde, weil ich schon genug an den Tüten zu schleppen habe. Außerdem liegt es in einer ganz anderen Richtung. Also, was ist?«
»Ja, doch, klar, das ist mein Rucksack«, fand ich schließlich meine Sprache wieder. »Ich habe ihn beim Brunnen liegen lassen.«
»Siehst du, sprechen ist gar nicht so schwer«, sagte das Mädchen und händigte mir den Rucksack aus.