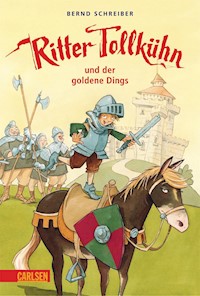Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Sommer 1974: Zwei 22-jährige Berliner fahren recht unbedarft mit einem alten VW-Transporter auf dem "Hippie-Trail" nach Indien. Ratzfatz schreibt einer der beiden bereits 45 Jahre später die Reiseerlebnisse auf und der andere gibt seinen Senf dazu. Warum soll eine derartige Geschichte aus dem letzten Jahrtausend lesenswert sein? Weil die Jüngeren erfahren, dass ein 6-monatiger Auslandstrip ohne Internet, Smartphone und Selfies möglich ist. Weil die Älteren sich dabei vielleicht nostalgisch an: "Ja, ja, die alten Zeiten" erinnern und weil Menschen dazwischen möglicherweise Spaß am Lesen einer sehr persönlichen Reiseerzählung haben. Würde den Autor und seinen Senfgeber freuen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für
Marion
und
Hannelore
Inhaltsverzeichnis
0. Vorwort
1. Vorspiel
2. Planung
3. Der Countdown läuft
4. Vom Abendland zum Morgenland
5. Auf dem Hippie-Trail bis Delhi
6. Endlich Indien
7. Mit Zelt und Rucksack nach Nepal
8. 7000 Kilometer durch Indien
9. Nach Hause: die eisige Rückfahrt
10. Nachspiel
11. Blick zurück
0. Vorwort
Jetzt, im güldenen Herbst meines Lebens, wollte ich vor Wintereinbruch endlich Kurzgeschichten schreiben. Z.B. über mein Leben, also Dinge, die eigentlich niemanden weiter interessieren. Dann kam diese Weltreise dazwischen, über die ich mit meiner Frau Marion ein Buch geschrieben habe. Ich setze die Produktplatzierung („Schleichwerbung“ für die Älteren) gleich hier demonstrativ an den Anfang, dann habe ich es hinter mir und Sie auch. Es heißt: „Mal aus der Reihe tanzen“ und ist als Print- und E-Book-Version käuflich zu erwerben.
Anschließend hatte ich Zeit, mich mit den Kurzgeschichten zu befassen. Die Stoffsammlung ergab, dass auffällig viele Geschichten und Anekdoten wieder mit einer Reise zusammenhingen, einer Reise aus dem letzten Jahrtausend. Nein, nicht auf Eseln oder Elefanten, sondern mit Benno und unserem Bulli, einem alten VW-Transporter. Benno und ich hatten die verrückte Idee, mit dem Bulli für ein halbes Jahr nach Indien, in Indien herum und zurück zu fahren. Und haben’s auch getan. 1974, wir waren 22 Jahre jung, Berlin – oder genauer gesagt – West-Berlin war der Nabel unserer Welt. Außerhalb des Nabels kannten wir nicht allzu viel, waren aber offen für Neues und alles Überraschende. Und das kam derart zu Hauf während dieser Reise, dass ich die Erlebnisse und Begebenheiten im Folgenden erzählen möchte. Danach mache ich mich aber gleich an die Kurzgeschichten.
Who the fuck is Benno? Benno ist zwar nicht der sprichwörtliche Sandkastenkumpel, aber mein Freund, seit er Buddeleimer und Schippchen beiseitegelegt hat und mit mir in dieselbe Klasse uffem Gymnasium zusammengewürfelt wurde. Die Verbindung hielt, wir konnten inzwischen Goldenen Freundschaftsbund feiern und sie lässt sich selbst mit dem Buch noch aufrechterhalten. Bei unserem Umgang miteinander erschließt sich einem Außenstehenden (z.B. Leser) vordergründig nicht, dass es sich zwischen uns um eine Art Freundschaft handeln könnte. Die Anzahl gegenseitig positiver, wohlgemeinter Äußerungen dürfte insgesamt an zehn Fingern abzuzählen sein. Trüge einer von uns beiden z.B. eine neue Weste, würde dem anderen nie etwas wie „Schicke neue Weste hast Du an“ über die Lippen kommen, eher ein: „Warum trägst Du denn eine wattierte Weste, es ist doch gar nicht kalt?“ Der Andere etwas empört: „Die ist überhaupt nicht wattiert, was soll der Quatsch?“ „Ach soooo, es ist gar nicht die Weste, die so aufträgt!“ So oder ähnlich ist die normale Gesprächseröffnung. Der gegenseitig im Ton etwas herabwürdigende Umgang miteinander hängt eng mit Bennos Lebensphilosophie – frei nach Oskar Wilde – zusammen: „Lieber einen guten Freund verlieren, als eine gute Pointe ungenutzt vorüberziehen lassen.“ Und das beherzigt er jetzt seit weit über 50 Jahren mir und vielen anderen gegenüber. Meine Ex-Schwiegereltern (ich schweife oft ab!) spielten gerne Doppelkopf, wie wir auch. Als sie Benno zum ersten Mal begegneten, suchten sie gemeinsame Gesprächsthemen. Nach dem Wetter kam Doppelkopf. Beim Doppelkopf sollte vorher vereinbart werden, ob mit bestimmten Zusatzregeln gespielt wird, wie z.B. mit oder ohne Dullen, Füchsen, Charlie oder Neunen. Deshalb war die Frage meiner Ex-Schwiegermutter völlig legitim: „Ach, wie spielen Sie denn Doppelkopf?“ Benno: „Gut!“ Das brachte den sonst reichlich fließenden rheinischen Frohsinn der beiden kurz zum Stocken und sie hatten seitdem im Gespräch mit Benno immer ein wenig hab Acht Haltung, was da wohl kommen würde.
Benno und mich verbinden aber auch Eigenschaften, wie z.B. die gemeinsame Freude an einem schönen Weizenbier oder an…, tja warten Sie mal…, da war doch noch…, da müsste doch…, nö, eigentlich fällt mir nichts weiter außer gemeinsamen sportlichen Aktivitäten ein. Früher war das Squash, jetzt altersgerecht Boule. Aber selbst dabei agieren wir unterschiedlich. Während ich vom Ehrgeiz zerfressen immer gewinnen will, will Benno meist noch nicht mal um Punkte spielen. Mich beschäftigen viele Themen, ich suche nach der besten Lösung und bin dabei oft aufgeregt wie der Kasper. Benno bevorzugt einfache, manchmal irritierende Lösungen. In unserem Teenageralter hatten viele Jugendliche natürlich auch damals mit Schuppen zu kämpfen, ich besonders. Ich probierte alle Haarwaschmittel, oft oder wenig angewendet, nichts half. Ich fragte Benno, was er dagegen macht: „Weiße Pullis anziehen!“ Wenn während unserer Indienfahrt vom Motor, den Achsen oder Rädern her irgendwas klapperte, wollte ich durch Leisesein und Konzentration die Quelle ermitteln, während Benno die Musik des Kassettenspielers laut drehte, um das Problem zu lösen.
Warum Benno Benno heißt, weiß ich nicht mehr, aber er bekam den Namen ganz sicher während unserer Schulzeit und das war nötig. Er heißt Bernd, ich heiße Bernd und in der Spitze brachten wir es in der Klasse auf fünf Bernds, da mussten Spitznamen zur Unterscheidung her. Bernd war der Hype-Name der Fünfziger, später verschwand er langsam. Ich glaube, der letzte, der den Namen erhielt, war „Bernd das Brot“.
Diese Kurzbeschreibung der handelnden Hauptfiguren soll den charakterlichen Spagat zeigen, unter dem die Reise stattfand. Dieser wird an einigen Stellen des Buches zu Tage treten, insbesondere bei Bennos Kommentaren. Manche meiner Ausführungen wollte er nicht unkommentiert lassen, andere musste er erzählen, weil ich nicht dabei war oder seine Sicht den Sachverhalt erleuchtet, na sagen wir mal versuchsweise erhellt oder doch eher nur sporadisch anglimmt. Benno hat aber nicht nur die Kommentare beigetragen, sondern vor allem sein Tagebuch. Ich habe zwar auch eins geschrieben, meins aber verbummelt. Sein Tagebuch war natürlich eine wunderbar authentische und damit auch objektive Leitschnur von Fakten und Daten auf der Zeitachse, an der ich mich entlanghangeln konnte. Die nicht objektiven Bemerkungen über mich habe ich weggelassen. Im Folgenden sind die Tagebuchauszüge oder Kommentare von Benno kursiv dargestellt.
Auch wenn ich es mir manchmal einreden wollte. Die Reise hatte keinen tieferen Hintergrund und kein höheres Ziel als mal raus zu wollen, mal etwas Neues zu erleben und zu sehen. Eine Art Ersatzwehrdienst, denn wir West-Berliner „durften“ ja nicht zur Bundeswehr. Mit unserem Weg, durch die Reise vielleicht sozial etwas reifer zu werden, haben wir zwar nichts zur Landesverteidigung beigetragen, aber wir waren immerhin am Hindukusch, auch wenn wir dort nicht die deutschen Interessen vertreten haben.
Wir waren keine Hippies, aber quasi Trittbrettfahrer der damaligen Strömung in den 70er Jahren. Unbewusst bereisten wir genau die Route, die noch heute unter dem Begriff Hippie-Trail bekannt ist. Was uns mit welchem Lebensgefühl währenddessen passierte, ist die Handlung der folgenden Erzählung. Ethnische, politische, kunst- oder kulturhistorische Beschreibungen der einzelnen Länder sind äußerst rar gesät, auf Deutsch: Es ist kein Reiseführer! Es geht um die Erlebnisse zweier junger Männer, die in den Hippiezeiten eine Reise „tun“ und nun was erzählen können. Zwischen jetzt erzählen und erlebt haben, liegen 45 Jahre, da verblassen und verzerren Einzelheiten schon mal. Bennos Tagebuch und die zwischen uns intensiver aufflammenden Gespräche über die Reise waren ein Korrekturfaktor, falls ich der Wahrheit zu enteilen drohte. Trotzdem weiß ich, dass die lange Zeit dazwischen einiges unscharf werden ließ, was vornehm ausgedrückt ist und nur bedeutet, dass verschiedene Erinnerungen in kleinen nicht mehr zugänglichen Kalkklümpchen verschlossen sind. Dazu Benno in aufbauender Weise: „Mach Dir nichts draus, warte einfach noch ein paar Jahre, dann fällt Dir immer mehr von früher wieder ein, auch wie Deine Schultüte aussah, selbst wenn Du nicht mehr weißt, ob Du heute gefrühstückt hast, geschweige denn was?“ Bei einigen Erlebnissen weiß ich wirklich nicht mehr, für welche Zugstrecke die Platzreservierungen doppelt vergeben wurden, wo unsere Zehen zu erfrieren drohten oder in welches Krankenhaus ich eingeliefert wurde, aber das ist vielleicht auch nicht relevant, für die Anekdote selbst verbürge ich mich. Für die lange Zeit dazwischen, das falsche Verorten von Erlebnissen und eine insgesamt geschmeidigere Darstellung von zwangsweise manchmal spröden Tagebucheinträgen setze ich einen maximalen Flunkerfaktor von 20 Prozent an. Mehr nicht, ehrlich!
Englisch war natürlich die Reisesprache unterwegs. Ich versuche es zu vermeiden, Begebenheiten mit Bezug in Englisch zu erzählen, aber an einigen Stellen gehörte es einfach zum richtigen Verständnis der Situation. Meistens habe ich den Sinn in Deutsch zusätzlich angegeben.
Die Bezeichnung der Orte war ebenfalls nicht ganz unproblematisch. Oft gibt es unterschiedliche neue, alte, deutsche, englische, landessprachliche Bezeichnungen für dieselbe Stadt. Ich habe mich für die Namen entschieden, unter denen wir die Städte damals bereisten. So haben wir Bombay und nicht Mumbai, Madras und nicht Chennai gesehen.
Bei den Fotos bitte ich um Nachsicht, jedenfalls bei meinen. Ich habe während der Reise Schnappschüsse gemacht, mit einer einfachen Kamera ohne jeglichen Filter und ohne jeglichen Gedanken an Motiv und Qualität. Wenn ich meinte, es wäre wieder Zeit für ein Foto oder ich sah zufällig die Kamera, knipste ich. Aber es gibt auch ganz schlechte Aufnahmen von meinen Urgroßeltern und die heb‘ ich ja auch auf. Also sehen Sie es als authentische Zeitdokumente. Außerdem – und herzlichen Dank für die Freigabe – sind auch bessere Fotos von Suzanne und Wilson McOrist dabei.
Manches Erzählte soll durch die Fotos erläutert werden, manches durch die Illustrationen von Marion. Lieben Dank dafür.
Ach ja, und ich gucke nicht, sondern kucke, weil niemand guckt, sondern alle kucken. Diesen Lapsus leiste ich mir.
Besonderer Dank gilt auch meinem Freund und Klassenkameraden Rainer Gerlach, der freundlicherweise das Buch redigiert hat. Weiterhin danke ich allen im Buch erwähnten Personen, die der Veröffentlichung des Textes zugestimmt haben.
Der größte Dank überhaupt gilt natürlich Benno, denn ohne ihn hätte ich das alles nicht erlebt, wäre die Reise nicht zustande gekommen und würde ich nicht heute noch davon zehren.
Ich hätte das Buch „Einmal Indien und zurück“ betiteln können, aber das überzeugte mich nicht. „Der unvollendete Baum“ fand ich viel interessanter und warum es so heißt, werden Sie schnell merken.
Auf geht’s.
Storkow (Mark), im Juni 2019
Na, ein bisschen mehr hättest Du mich ja noch belobhudeln können!
1. Vorspiel
Ich soll nicht immer vom Thema abweichen. Wenn ich aber gleich zu Beginn des Buches mit etwas ganz anderem anfange, dann bin ich nicht vom Thema weg, weil ich mit dem Thema überhaupt noch nicht begonnen habe. Schlau, was? Ich mache das auch, bevor Benno mir dazwischen quatscht.
Mach mal, ich komm‘ schon noch!
Ich erzähle dem Leser zunächst von einer Charaktereigenschaft, die mir selbst erst kurz nach dem Abi bewusst wurde und von der ich das Gefühl habe, dass sie mit verantwortlich für Anlass, Planung und Durchführung der Indienreise war.
Es war einmal…1972, ich hielt mein Abitur in den Händen, in Form eines Zeugnisses und wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Schule war definitiv vorbei und ich ahnte, dass jetzt richtig Veränderungen anstehen würden, verbunden mit einem völlig neuen Lebensabschnitt. Schade eigentlich, denn ich ging gerne zur Schule. Es waren lockere Zeiten, die Oberstufenzeit von 1969-72 mit neuen Freiheiten ausgestattet, die wahrscheinlich noch keine Schülergeneration in der Menschheitsgeschichte so vorher erlebt hat. Man war einfach etwas links, wir hatten Glück mit jungen, teilweise auch fortschrittlichen Lehrern. Es gab schon die Pille, aber noch kein Aids.
Nun stand ich von der Schule ausgestoßen plötzlich da, glotzte auf meine weitgehend ausgeglichenen Zensuren und stellte fest, dass nichts herausstach, was meine Berufswahl bestimmen könnte. Ich hätte gern Mathematik oder Philosophie studiert, wusste aber nicht genau warum. Vielleicht, weil ich in Mathe ganz gut war und mit dem Lehrer zurechtkam. Letzteres ist wahrscheinlich ein Hauptgrund für viel Studienentscheidungen: Ich konnte den Lehrer gut leiden. Philosophie interessierte mich, weil ich Hesse und Nietzsche gelesen sowie Yogakurse an der Volkshochschule belegt hatte (bitte Wolldecke mitbringen). Die Turnübungen beim Yoga hatten zwar nichts mit Philosophie zu tun, aber ich fand alles Fernöstliche schick. In den weit entlegenen Gebieten meines Bewusstseins, dort wo nur noch dünn besiedelte Regionen des vagen Ahnens an das Niemandsland zum Unterbewussten grenzen, kam eine Idee herauf, warum ich ausgerechnet diese beiden Fächer studieren wollte. Sie waren so schön theoretisch, nix mit Praxis, nix Angewandtes. Ich bin nämlich Linkshänder, und zwar an beiden Händen. Nicht, dass ich Handwerkliches überhaupt nicht mag, ich versuche mich schon daran, aber es wird nie richtig. Ich habe nie das richtige Werkzeug und wenn doch, dann finde ich den 13 5/8 Zoll Winkel-Inbus-Schlüssel genau in dem Moment nicht, wo ich ihn brauche. Meine handwerklichen Ergebnisse zeitigen immer was Provisorisches, Hilfslösungen mit kurzer „Halb- und Haltwertzeit“. Am besten verdeckt man sie mit einer Blende oder setzt ein Rohr davor.
Niemand half mir bei der Studienwahl. Meine Eltern waren weit weg von dem Thema, die Kumpels hatten genauso wenig Ahnung wie ich und so vertrauensvoll waren wir mit den Lehrern nun auch wieder nicht. Einzig der beste Freund meines Vaters wollte mir wohl helfen. Als ich ihm von meinem Wunsch erzählte, Mathe oder Philosophie zu studieren, baute er mich mit einem „ist beides brotlose Kunst“ nur bedingt auf, gab mir aber einen wichtigen Zusatzhinweis. „Was Du auch immer machst, mach‘ zusätzlich noch etwas Kaufmännisches, womit Du Geld verdienen kannst, wie Betriebswirtschafts- oder Volkswirtschaftslehre.“ Diese gutgemeinte Saat würde noch aufgehen.
Bis zur Immatrikulation – worin auch immer – blieben mir noch vier Wochen und bis Semesterbeginn noch gut drei Monate. Also ging ich erst mal jobben und dazu zum Jobcenter, das hieß damals noch schlicht Arbeitsamt. Dieser Gang brachte zwei Überraschungen. Eine ergab sich aus dem Gespräch mit dem Sachbearbeiter, der fragte, was ich denn in den drei Monaten übergangsweise machen will: Bau, Handwerksfirma oder Büro? Büro, auf jeden Fall Büro, weil ich an meine zwei Linken dachte. Da schlug er mir vor, ob ich nicht direkt bei ihnen selbst in der Verwaltung des Arbeitsamtes anfangen wollte. Ich sollte AOK-Meldungen bearbeiten. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutete, fühlte mich aber gebauchpinselt, dass gerade ich unter den vielen Hiwi-Job-Suchenden auserkoren wurde und sagte zu. Die zweite Überraschung war, dass er mir von einem Eignungstest erzählte, den man auf Kosten des Arbeitsamtes machen konnte, um herauszufinden, wofür man geeignet war. Na, das war‘s doch, das wollte ich machen.
Also absolvierte ich den Amthauer Intelligenz-Struktur-Test. Ich musste alle möglichen Aufgaben unter Zeitdruck lösen und das Ganze dauerte fast drei Stunden. Anschließend gab es ein längeres Abschlussgespräch mit einer Psychologin, die die Ergebnisse auswertete. Warum erzähle ich Ihnen das eigentlich alles? Nicht wegen des ermittelten Intelligenzquotienten, der Sie gar nichts angeht (ich will ja auch niemanden deprimieren).
Ich kann‘s kaum glauben, dass das IQ-Ergebnis dreistellig gewesen sein soll.
Sondern wegen der Klärung meiner Eignungsstrukturen. Die erbrachte: „Wenn ich mir so Ihre Ergebnisse ansehe, können Sie sowohl in die mathematisch-naturwissenschaftliche als auch sprachlich-geisteswissenschaftliche Richtung gehen.“ Na toll, und dafür habe ich mich hier stundenlang konzentriert und geschwitzt. Soweit war es eigentlich ganz positiv verlaufen, aber dann kam noch ein kleiner Nackenschlag.
Eine Übung war, auf ein leeres Din-A4-Blatt einen Baum zu zeichnen, einfach einen beliebigen Baum. Das fand ich blöd, weil ich weiß, dass ich nicht zeichnen kann und deshalb dieser Übung keinerlei Bedeutung beimaß. Sie aber zottelte meinen Baum zwischen den Unterlagen hervor und zeigte ihn mir. Ja, mir war klar, dass er doof aussah, als ob ein Vierjähriger sowas zeichnet, und selbst der könnte es wahrscheinlich besser. Ich sagte ihr, dass ich schließlich nicht Malerei studieren wollte und auch nicht verstand, was das mit meiner Intelligenzstruktur zu tun hätte. Allenfalls, ob in mir ein Rembrandt schlummert. „Nein“, meinte sie, „darum geht es nicht. Es ist egal, wie gut oder realistisch Sie ihn gezeichnet haben, es geht um die Struktur Ihres Baumes. Sehen Sie sich ihn an! Die Proportionen stimmen nicht bzw. der Baum passt nicht ins Bild. Es scheint, dass Sie sorgfältig mit dem Wurzel- und Stammbereich angefangen haben, ohne das Gesamtbild im Auge zu behalten, ob auch die Krone noch proportional ins Bild passt.“ Schiet-Psychologie, ich wusste sofort, Sie hatte recht. Der Stamm war zu dick für die Krone, ein paar Äste endeten wie abgehackt am Bildrand und andere liefen plötzlich wegen Platzmangels wie gut angespitzte Bleistifte auf ein abruptes Ende zu. Ich versuchte es mit einem kleinlauten: „Der Baum hat einen frischen Herbstschnitt hinter sich“, erntete aber außer einem freundlichen Lächeln nichts. „Diese eine Zeichnung muss nichts zu bedeuten haben, aber es könnte sein, dass Sie zu lösende Aufgaben nicht ganzheitlich betrachten und zunächst einordnen, sondern in einer lokalen Umgebung beginnen und sich schrittweise ‚von unten nach oben‘ (‚Bottom-up‘) zur Lösung vorarbeiten. Das ist wertfrei, es gibt halt unterschiedliche Typen, die einen gehen so vor, den anderen liegt der ‚Top-Down‘ Ansatz vom Ganzen zu den Einzelheiten.“
Mein Unvollendeter (Rekonstrukt)
Ich ging nach Hause und wollte nicht der ‚Bottom-up‘-Typ sein, das klang so kleinkariert, so detailverliebt. Also nahm ich mir vor, jeden Baum nur noch von der äußersten Blattspitze der äußersten Verästelung her zu zeichnen, obwohl ich ahnte, dass diese Bäume unten alle kein Stammende haben würden.
Zu diesem Ereignis von damals habe ich heute, über 45 Jahre später, eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, dass ich – soweit ich mich erinnere – nie wieder einen kompletten Baum auf ein Din-A4-Blatt bringen musste. Die schlechte ist, dass die Dame wohl recht hatte. Jedenfalls begegnete ich dem Charakterzug bei meiner Lebensplanung und -gestaltung immer wieder.
So auch bei der Indienreise, aber vor Indien standen noch die AOK-Meldungen plus Studienfrage. Ich begann meinen Aushilfsjob beim Arbeitsamt pünktlich morgens mit dem Stechen der Stechuhr. Ich hatte einen eigenen Schreibtisch und meinem gegenüber stand einer mit einer – für meine 19 Jahre – uralten Mitarbeiterin dahinter, die wahrscheinlich so gegen Ende dreißig war. Sie zeigte mir einen Karteikasten, voll mit blässlich gefärbten Durchschlägen von Originalen, mit denen wohl Arbeitgeber ihre Mitarbeiter bei der AOK anmeldeten. Die Durchschläge landeten hier, um wahrscheinlich sicherzustellen, dass Krankenkassenbeiträge nicht länger vom Arbeitsamt übernommen würden. Oder dass Arbeitnehmer nicht weiterhin Arbeitslosengeld beziehen würden. Oder es war ganz anders, jedenfalls musste ich den Zettel mit einer Karteikarte abgleichen und einen Eintrag vornehmen. Sie wissen, wie handausgefüllte Durchschläge von Formularen aussehen? Genau, in der Regel unleserlich. Aber ich war jung und mit frischem Mut und Schwung machte ich mich an die unbekannte, neue Tätigkeit. Das war so gegen 8.30 Uhr. Gegen 14.45 Uhr am selben Tag waren das Feuer und das Kribbeln des Neuen völlig erloschen. Es wich einer zunehmend einkehrenden Tristesse. Bis mittags dachte ich noch, das kriegst Du mit dem Kasten hin, aber unvorsichtig neugierigerweise öffnete ich die Schubladen meines Schreibtisches. AOK-Meldungen, soweit das Auge reichte. Unheil ahnend, fragte ich meine neue Kollegin zaghaft, ob das jetzt durchgehend meine Aufgabe wäre. „Ja“, meinte sie und es wären noch größere Bestände im Keller, sie wären monatelang im Rückstand.
Dieser Umstand beflügelte mich zu einer beschleunigten Studienentscheidung. In West-Berlin – nicht Westberlin (den Unterschied werden viele nicht mehr kennen und das ist gut so!) – gab’s mehrere Universitäten, die beiden großen auf Westseite waren die Technische und die Freie Universität (und sind es heute noch zusammen mit der Humboldt-Universität).
Ich entschied mich, zunächst die TU Berlin zu erkunden, weil sie näher zu meiner Wohnung als die FU lag. Ich werde den Moment nie vergessen, als ich den riesigen Eingangsbereich des Hauptgebäudes in der Straße des 17. Juni betrat. Ich war von der Größe, dem Betrieb und der Anonymität derart erschlagen, dass mich ein unbekanntes Kälte- und Einsamkeitsgefühl beschlich. Ich ging vorsichtig ein wenig umher, man ließ mich in Ruhe, und ich kam an einen Hörsaal, der ausgerechnet das Audimax war. Ich hatte so einen Raum noch nie gesehen und überlegte, wie oft unsere – für mich große – Schulaula hier wohl reingehen würde. Es schien keiner zu kommen, um Bernd in die neue Klasse 14b (ich war immer b-Klasse, also in der Zuordnung, aber gefühlt eigentlich immer A-Klasse) zu holen oder ihm einen Stundenplan mit Raumangaben zu geben. Kurz sehnte ich mich nach den einfachen, aber in der Vertrautheit wärmenden AOK-Meldungen. Ich besorgte mir ein Vorlesungsverzeichnis und ging mit einem beklemmenden Gefühl nach Hause.
Ich blätterte durch das Verzeichnis, verstand quasi nichts, nur eine entscheidende Passage beim Mathe-Studium bot mir Licht am Ende des Tunnels: Man musste keine Klausuren schreiben! Wahnsinn, das hatte ich noch nie gehört! Das gesamte Mathe-Studium bestand nur aus zwei mündlichen Prüfungen, einmal zum Vordiplom und einmal zum Hauptdiplom: Plus einer Diplomarbeit am Ende als einzige schriftliche Äußerung. Und: Man musste irgendein Nebenfach wählen, Mathe solo ging nicht. Die meisten belegten Physik (war nicht meins, der Lehrer und ich hatten nicht dieselbe Chemie, obwohl‘s Physik war), also erinnerte ich mich an meines Vater Freundes Rat und wählte Betriebswirtschaft. Es fügte sich sozusagen und ich trug mich für Mathematik ein. Was meine Mutter fundiert unterstützte: „Mach das Junge, Du kannst Dir doch so gut Telefonnummern merken!“
Die Hilfsjobzeit endete. An einem der letzten Tage rief mich der Direktor des Arbeitsamtes zu sich. Er bot mir eine Festanstellung im gehobenen Dienst an, mit Aussicht auf ein paralleles Fachverwaltungsstudium, so dass ich anschließend auch in den höheren Beamtendienst avancieren könnte. Ich war perplex und irgendwie gerührt. Wahrscheinlich war ich der einzige Idiot, der jemals drei Monate durchgehalten hatte, AOK-Meldungen nachträglich zuzuordnen. Das bedeutete wohl unbeabsichtigt die Beamtenqualifikation. Kurz zögerte ich, denn das Gehalt war für einen Berufsanfänger und Unvermögenden verlockend, aber ich sah mich sehr plastisch im Alter von 65 Jahren immer noch blässlich gefärbte Durchschläge von AOK-Meldungen zuordnen. So schlimm konnte das einsam anonyme Mathestudium nicht sein. Ich sagte ab.
Ich studierte und merkte bald, dass die Psycho-Tante wohl wieder richtig lag. Ich hatte mir die Problematik nicht ganzheitlich vergegenwärtigt. Vordergründig war es ganz toll, keine Klausuren oder andere schriftliche Prüfungen absolvieren zu müssen, aber ich hatte nicht über die Konsequenzen nachgedacht. Der Stoff aller vier Semester zum Vordiplom musste für die mündlichen Prüfungen in einem begrenzten Zeitraum von vier Wochen parat gehalten werden. Das war gar nichts für mich. Ich liebe es, ein Thema direkt nach der Behandlung abzuschließen, weil ich ein Meister in der Kunst des schnellen Vergessens bin.
Also stand mit den Prüfungen eine riesige Hürde vor mir. Und danach wollte ich mir etwas gönnen, falls ich bestehen würde. Hier ergriff mich in Baum-unvollendeter Weise die unausgereifte, in den Konsequenzen völlig unüberlegte Idee einer Reise nach Indien. Ich hatte keine Ahnung, woher diese Idee kam, wo Indien eigentlich liegt, ob so etwas machbar wäre, was das kosten und woher das Geld kommen würde. Wahrscheinlich war der Zeitgeist der Auslöser. Die Beatles machten Meditationskurse beim Yogi Maharishi Mahesh (und ich bei der Volkshochschule), George Harrison spielte die Sitar. Dazu hatte ihn der Inder Ravi Shankar beeinflusst, der als berühmter Sitarspieler 1969 in Woodstock aufgetreten war. Im emsigen Fußgängergewimmel auf dem Ku’damm und anderswo in der Stadt tanzten und sangen Hare Krishna Jünger in Mönchsklamotten mittenmang, grell orange umhüllt aus religiösen Gründen oder damit es einfach unheimlich auffiel. Die Feten hatten häufig zusätzliche ausländische Gäste wie einen Schwarzen Afghanen, Roten Libanesen oder Grünen Türken, beliebt die Losung: „Haste Haschisch in den Taschen, haste immer was zu naschen!“ Das alles zog mich an und begeisterte mich. Bitte aber keine „meine Verurteilung“ vorab, zu dem Thema Rauschgift komme ich später. Der Wunsch, nach Indien zu fahren, verfestigte sich immer mehr, und ich wusste, dass ich es wollte und genauso wichtig, dass Benno bestimmt dabei sein würde.
Ich wusste noch nicht, dass ich nach Indien fahren wollte, hielt aber das Abi genauso ahnungslos in den Händen und wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Ich hatte meine langjährige, fest zementierte Betonfünf in Mathe bis zum Abitur glamourös verteidigt (bin in Mathe quasi eine Komplementärbegabung zu Bernd), konnte aber in anderen Fächern glänzen oder zumindest durch Stillhalteabkommen sowie ähnliche Absprachen mit den Lehrern in einer friedlichen Koexistenz leben, die mir ein problemloses und ungefährdetes Abitur ermöglichte. Aber auch mir bot sich nichts in natürlicher Weise an, zumal mir der Gedanke an eine geordnete, regelmäßige Tätigkeit von acht Stunden pro Tag als Bedrohung erschien. Dieser Bedrohung zu entgehen, gab es für mich nur einen Ausweg:
Glücklicherweise muss man nicht studieren, tagein tagaus von achte bis um vieren!Das wollte ich probieren!
Eins war klar: Es durfte nichts Mathematisches oder gar Technisches sein, denn meine technische Nichtbegabung verband ich bereits mit frühkindlichen Erinnerungen. Z.B. an Tante Liselotte. Sie war die Kindergartenchefin und legte meiner Mutter nahe, mir bei meinen Schuhen die Kunst des Schleifebindens nahezubringen. Das müsse man mit fünf Jahren als Kulturtechnik draufhaben und sie könnten sich nicht sooo lange mit einem Kind beschäftigen. Meine Eltern versuchten auch, mich mit einem Stabilbaukasten zu begeistern. Bei dem späteren Erweiterungsteil II achtete ich darauf, dass das Verpackungssiegel unversehrt blieb. Selbst Lego – wofür die meisten Jungs Feuer und Flamme sind – ging nicht so an mich. Meine schönste Erinnerung mit Lego war nicht der perfekte Nachbau von Schloss Neuschwanstein, sondern eigentlich mein Vater, der nachts barfuß zur Toilette ging und meinen verlorenen Viererstein wiederfand.
Ich schrieb mich – anders als andere hier Erwähnte – ohne einen IQ-Test nötig zu haben, am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin für Politologie ein. Aber auch ohne zu wissen, was ich tat! Für alle, die das OSI von damals kennen, wissen, dass die Zustände dort der Inbegriff von Chaos waren. Jedenfalls für einen ordentlichen Abiturienten von einem ordentlichen Gymnasium. Als SPD-Sympathisant stand man in den Augen der Kommilitonen aus heutiger Sicht so zwischen CSU und AfD. Das war nix für mich.
Aber was tun? Da ergab es sich, dass ich aus irgendeinem Grunde zwei Nachhilfeschüler aus dem aufstiegsorientierten Teil der Nachbarschaft bekam. Ich half ihnen nach, gern auch mit unkonventionellen Mitteln, in Deutsch, Geschichte, Englisch sowie Französisch und ein bisschen Hochstapelei war auch dabei.
Tatsächlich verbesserte sich die Deutschnote eines Schülers. Von dem anderen kannte ich die Klassenlehrerin ganz gut, eine mitleidige, verständnisvolle Seele, die an das Gute im Menschen glaubte oder es wenigstens für die Zukunft nicht ausschloss. In einem Gespräch mit ihr über Lernbedingungen, häusliche Verhältnisse und Ungerechtigkeiten seitens der ignoranten Schulverwaltung bis hinauf zum Senator wies ich darauf hin, dass eine falsche Realschulempfehlung mitunter die Weichen fürs ganze Leben stellen kann, wie ich schließlich aus eigener Erfahrung wisse. Das entbehrte zwar jeder Grundlage, aber es half.
Die Eltern meiner Zöglinge kamen zu der Erkenntnis, dass eine Prämie fällig sei. Ich erkannte, dass ich zum Lehrer befähigt war, Lehrer von Hause aus wohl gute Menschen seien und außerdem auch in den langen Ferien bezahlt werden.
So stand mein Entschluss fest. Ich studierte an der Pädagogischen Hochschule weiter. Als allseits geschätzter und verlässlicher Kommilitone. Man suchte gerne meine Nähe und bat mich um kompetente Hilfe. Zum Beispiel kam jemand mitten in der Vorlesung herein, setzte sich leise schleichend zu mir und sagte, ich müsste unbedingt helfen. Sie säßen gerade in der Mensa und ihnen wäre der vierte Mann zum Doppelkopf ausgefallen. Mir war klar, das war ein Notfall und ich musste handeln. Nach kurzer Abwägung zwischen einer weiterhin sehr theoretischen Linguistik-Vorlesung und der Möglichkeit, mit ein paar Dullen ein paar Füchse zu fangen, verließ ich – ebenfalls leicht geduckt hinter dem Doppelkopfler herschleichend – den Hörsaal.
In meinem Studium gab es kein Vordiplom, aber für ein ‚Time-out‘ besonderer Art würde ich bestimmt jederzeit eine – hoffentlich auch für meine Eltern – plausible Begründung finden.
Ein Jahr später, im Sommer 1973, waren wir uns einig: Jetzt waren wir zwei, die nach Indien wollten, ohne zu wissen warum, die keine Ahnung hatten, wo genau Indien liegt, wie man dahin kommt, was das kosten und woher das Geld kommen würde. Es gab einen Zeitpunkt, von dem wir beide nicht mehr wissen, wann er genau war, aber von genau da ab waren wir uns sicher, dass wir dieses Abenteuer machen würden.
Zunächst war alles geheime Kommandosache, absolutes Stillschweigen war angesagt. Wir wollten durch einen vorzeitigen Rückzieher kein großes Gelächter und keine langwierige Blamage riskieren. Wir würden es der Öffentlichkeit, die aus Eltern, Freundinnen und Kumpels bestand, erst kundtun, wenn die Planungen und Vorbereitungen weitgehend in trockenen Tüchern waren.
2. Planung
Wir trafen uns „heimlich“ einmal wöchentlich bei mir zur konspirativen Sitzung: „Expedition Indien“. Bei mir, das war im 4. Stock eines Hauses in der Dubliner Str. im Bezirk Wedding. Benno wohnte nur gut einen Kilometer weg in der Aroser Allee, aber im Bezirk Reinickendorf, worauf er großen Wert legte und was ein lebenslanger Disput zwischen uns bleibt.
Als Reinickendorfer wohnte ich in einem Villenvorort und nicht im „roten“ Wedding, dem Prolo- und Arbeiterbezirk.
Benno kam jeden Dienstag nach dem Abendessen zu mir, niemals ohne ein neues, volles Exemplar unseres liebgewordenen Begleiters bei der Reiseplanung: eine Flasche Cognac oder besser gesagt Weinbrand, auch keine wirklich große, nur eine 0,5er und auch nicht die teuerste (eine Sorte, bei der es beim Kauf von drei Flaschen einen Blindenhund dazugibt). Die nahm Benno aus dem Regal seiner Eltern, zusammen mit einer Packung Roth-Händle, Gauloises oder Gitanes, auf jeden Fall ohne Filter. Bennos Eltern hatten einen kleinen Tabakwarenladen mit einem Spirituosen-Regal, das war perfekt für ihn. Wenn ich ihn abholte, ging beim Verlassen des Geschäftes meist noch ein Päckchen Zigaretten von „hinterm Tresen“ mit. Ich fragte ihn mal, ob er das auch bezahlen würde oder wie er das mit seinen Eltern vereinbart hätte.
Ich habe diese Entnahmen aus dem elterlichen Geschäft mir gegenüber als vorgezogenes Erbe verortet. Da meine Eltern wussten, dass ich rauche, und dass ich mir die Zigaretten wohl kaum woanders kaufen würde, konnten sie im logischen Schluss folgern, wo sich meine Quelle befand. Man redete nicht drüber, außer einem gelegentlichen „Rauch nicht so viel!“, aber das sagen alle Eltern ihren Kindern.
Wir setzten uns an den Planungstisch. Benno zündete sich eine Zigarette an, ich mir ein frisch gestopftes Pfeifchen (ich rauchte Zigaretten nur in der Not, wenn der Tabak alle war), wir schenkten uns zwei Kurze ein, und, weil man das Zeug trocken so schlecht runterkriegt, gab’s noch ein Bierchen dazu. Dann ging’s los.
Das Wichtigste war, einen verlässlich detaillieren Zeitplan zu erarbeiten, einmal die Zeit bis zu einem noch zu bestimmenden Starttermin und dann natürlich die Reiselänge selbst. Dazu galt es, die mögliche Route festzulegen und das geeignete Verkehrsmittel zu wählen.
Das mit dem Verkehrsmittel ging am schnellsten. Flugzeug und Schiff fielen schon aus monetären Gründen aus. Außerdem wollten wir ja Land und Leute kennenlernen. Da wäre trampen am ehesten geeignet, eine Fortbewegungsart, die uns durchaus vertraut war (damals war trampen sehr verbreitet, gehörte quasi zu den ureigensten Fähigkeiten eines „richtigen“ Studenten). Aber es gab zwei Hindernisse. Erstens mein Bangesein: in Mitteleuropa war das kein Problem für mich, aber so unbekannter Weise irgendwo im fremden Asien? Hier hatte mein Mut ein Ende. Zweitens waren wir zu zweit: Zwei Männer, dann noch mit großen Rucksäcken, das ging nicht. Trampers Erfahrung ist: Am besten alleine und wenn schon zu zweit, dann muss mindestens ein weibliches Wesen dabei sein. Und das sollte auch nur alleine lasziv am Straßenrand winken (wie immer das geht) und er versteckt sich erstmal. Wenn dann einer hält und zugestimmt hat, sagt sie: „Oh, danke, da freut sich auch mein Freund“ und der springt in dem Moment hinter dem Stein oder zweiten Rucksack hervor. Ja, so geht’s, alte Trampertricks. Auf uns übertragen hieß das, Benno oder ich müsste sich jeweils am besten im Miniröckchen mit blonder Langhaar-Perücke an den Straßenrand stellen. Wir verwarfen die Idee mit dem Trampen. Bahn und Bus gingen vielleicht, aber irgendwie war man damit von den Möglichkeiten her fremdbestimmt und inflexibel auf die Örtlichkeiten, zu denen man wollte. Also blieb nur das Auto. Wir waren uns schnell einig, dass das die beste Variante wäre. Wir würden damit bewegungs- und übernachtungsmäßig autark sein. Das Wichtigste aber war, mir vermittelte ein Auto das Gefühl eines immer möglichen Refugiums, sich ins Vertraute zurückzuziehen, wenn mir das Neue, Unbekannte zu viel werden würde. Auf den Punkt gebracht: Ich brauchte ein Zuhause in der Fremde.
Die Autoentscheidung gab mir Sicherheit. Gut, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass es eine Unvollendeter-Baum-Entscheidung war, denn mir war nicht klar, dass wir Indien und Nepal monatelang ohne Auto, aber mit Rucksack und Zelt per Bahn, Bus und zu Fuß durchqueren würden.
Danach stellte sich die Frage: Wo bitte geht’s nach Indien? Meine Lösung war: Ich würde in den ADAC eintreten. Das wäre sowieso unerlässlich, falls wir eine Panne hätten und außerdem meinte ich, dass man als ADAC-Mitglied sehr gutes Karten- und Informationsmaterial umsonst bekommt, wenn man denen sein Reiseziel nennt. So würden wir Routenvorschläge erhalten und könnten dann entscheiden.
Das mit dem Kartenmaterial vom ADAC nach Indien kam mir von Anfang an suspekt vor, aber ich sagte nichts, weil Bernd häufig euphorisch Dinge als selbstverständlich gelöst und problemlos abtut.
Für mich auch!
Für mich wäre also selbst mit Prüfungen spätestens Mitte Juli Schicht im Unischacht. Schließlich noch vier Wochen für die ganz konkreten Vorbereitungen eingeplant, könnte es Mitte August losgehen. Es war klar, dass das anschließende Semester dran glauben musste. Das hieße, wir hätten bis Februar 1975 ein halbes Jahr Zeit und könnten bequem im April 1975 zum Sommersemester wieder ins Studienleben einsteigen. Genügte ein halbes Jahr für eine solche Reise? Wir teilten das Vorhaben in drei Abschnitte: Hinfahrt, Indien selbst und die Rückfahrt. Und aus welchem Grunde auch immer, fanden wir 1 ½ Monate hin, 3 Monate durch Indien und 1 ½ Monate wieder zurück, gut proportioniert. Wie weit ist das eigentlich bis Indien? Es gab kein Google Maps, aber wir hatten ein 30 cm langes Holzlineal und unseren Diercke Weltatlas noch von der Schule her. Eine Seite zeigte Europa und eine Doppelseite Vorderasien/Indien zusammenhängend. Beide Kontinente waren aber ein bisschen gebogen dargestellt. Das hing wohl irgendwie mit den Breitengraden zusammen, es stand jedenfalls „azimutaler Entwurf“ am Rand. Was immer das bedeutete, wussten wir nicht, denn wir hatten Erdkunde bei „Tropentoni“, dessen Ausführungen man im Allgemeinen nicht voll konzentriert folgte. Wir maßen einfach mit dem Lineal die Entfernung zwischen Berlin und Delhi, addierten eine grobgeschätzte Abweichung von der Luftlinie hinzu, gaben noch einen großzügigen Azimutalaufschlag oben drauf und kamen auf runde 10.000 Kilometer. Das hieße bei 45 Tagen Hinreise so gut 200 Kilometer pro Tag. Das klang machbar, selbst bei nur 70 km/h wäre die Tagesration in drei Stunden geschafft. Also stand der Zeitplan: 6 Wochen nach Indien, 3 Monate durch Indien und vielleicht Nepal sowie 6 Wochen oder ein bisschen mehr für eine möglichst andere Route zurück.
Diese Eckpunkte wurden in den Dienstagabend-Sitzungen erarbeitet. Die Geheimhaltung war kein Problem, weil eigentlich keiner stören konnte. Außer Oma. Ich wohnte mit meiner Großmutter zusammen. Jeder hatte sein Zimmer (ich glücklicherweise das größere), ansonsten bewohnten wir die insgesamt 60 qm große Wohnung gemeinsam. Mit meinem 20. Lebensjahr zogen meine Eltern aus (so rum fand ich’s richtig) und überließen mir die Wohnung, setzten mir aber Oma rein, um mein eben noch gepriesenes Studentenleben nicht völlig aus den Bahnen geraten zu lassen. Das hatte natürlich auch den monetären Vorteil, dass wir uns die Kosten teilten, wobei mein Beitrag manchmal die kleinere Hälfte war. Das Zusammenleben funktionierte sehr gut, sie klopfte immer an meine Tür, bevor sie hereinkam (wenn meine Freundin da war, klopfte sie sogar lauter und zweimal, fand ich süß, hatte aber vorher sowieso vorsorglich abgeschlossen). Oma konnte schon mal Dienstagabends hereinschauen, das war aber ungefährlich, sie konnte unser Tun nicht zuordnen. Vielleicht dachte sie sogar, wir studieren, womit sie wohl einzigartig auf der Welt gewesen wäre. Meistens sagte sie: „Mein Gott, ihr seid ja kaum zu sehen!“, was nicht an ihren Augen, sondern an den Rauchschwaden im Zimmer lag. Ich sagte dann: „Hast recht, ich mach‘s Fenster auf!“.
Einmal hätte es „gefährlich“ werden können, als alles Mögliche zur Reise auf dem Tisch ausgebreitet lag und jemand am Hauseingang klingelte. Wir beschlossen, nicht zu öffnen, weil wir keine Lust hatten, alles zu verstecken. Es klingelte wieder. Länger. Oma war keine Gefahr, sie sah Fernsehen. D.h. genauer, sie sah Fernsehen und alle darunter-, darüber- und danebenwohnenden fernhörten ihr dabei zu. Sie war für ihr Alter topfit, nur halt schwerhörig, was uns hier zupasskam, weil sie das Klingeln nie mitbekommen würde. Ich lugte hinter der Gardine hervor und sah den neuen, schönen Ford Escort am Straßenrand. Es war Bud.
Es konnte nur Bud sein, unser Klassenkamerad, der immer die neusten Autos hatte. Warum er den Spitznamen Bud bekam, eröffnet sich (auch heute noch) jedem, der ihn sieht. Denen, die diese Möglichkeit nicht haben, sage ich mal assoziativ: Bud Spencer. Wenn er dabei war, hatten wir nie Probleme zu nächtlicher Stunde in finsteren Kneipen. Ich weiß, ich schweif‘ schon wieder furchtbar ab, aber ich muss es loswerden. Wir waren in der „Afri“, unserer Stammkneipe im Wedding. Offiziell hieß sie „Großdestillation zum Bierdeckel“, die Gardinen waren immer gelb, in der Vitrine lagen kalte, fettige Bouletten, Soleier und ein nierenförmiges Stück Sülze. Das Wesen hinter dem Tresen hieß „die Qualle“ und ich schwöre, es war keine Beleidigung, denn jeder Gast hätte es als die treffendste Bezeichnung mitunterschrieben (phänotypisch hätte die Qualle in jedem Edgar-Wallace-Krimi der 60er Jahre glaubhaft auf der bösen Seite mitspielen können, im Innern war er ein herzensguter Mensch, aber man musste schon ein dauerhafter Kneipengänger sein, bis sich einem dies erschloss). Hinter der Qualle stand in einem Glas- und Schnapsregal ein riesiger Bowlebehälter. Er enthielt eine Flüssigkeit, deren Farbton keiner RAL-Farbeinteilung oder sonstigen DIN-Norm zuordenbar war und der wahrscheinlich bis heute unbekannt ist. In den Behälter kamen die Neigen aus allen fast leeren Schnapsflaschen, vom Pfefferminzlikör bis zum 80%igen Strohrum. Das Gemisch hieß Lumumba und war wegen des völlig unbekannten, wandelbaren Geschmacks und ebensolcher Wirkung nur den ganz Mutigen vorbehalten oder zu später Stunde als Absacker in LMAA-Stimmung geeignet. Einer davon kostete auch nur 30 Pfennig oder so. Sie können sich jetzt den Liebreiz unseres Stammlokals vorstellen?
Hier spielten wir eines Nachts wieder Skat (oder Doppelkopf) an unserem Stammtisch in einer Ecke und Bud war dabei. Auf dem Weg zur Qualle, um Bier nachzubestellen, kam ich an einem Stehtisch mit drei Typen vorbei, von denen einer wie frisch geölt aus der Muckibude aussah. Nicht aggressiv, aber mit dem offensiven Tonfall eines leicht Angetüterten fragte er mich, ob ich mit ihm nicht Armdrücken will. Um `ne Runde! Ich und Armdrücken. Ich würde ja sogar gegen mich selbst verlieren, wenn meine Arme gegeneinander antreten würden. Ich hatte für solche Fälle aber `ne gute Ausrede parat: „Rechtshänder?“ fragte ich. Ja, war er, Glück gehabt. „Leider bin ich Linkshänder, rechts habe ich keine Chance gegen Dich und links ist nicht Deins.“ Das sah er ein. Nochmal Glück gehabt, denn das Schlimmste wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, dass er es auch mit links gegen mich probieren würde. Dann hätte es wahrscheinlich einmal „Flupp“ gemacht und ich hätte den dreien eine Runde bezahlt. Aber ich konnte ihm die Chance noch retten. „Ich hab‘ am Tisch `nen Kumpel, der ist Rechtshänder, der versucht das bestimmt“, bot ich ihm an. Dankend nahm er an. Ich ging zu unserem Tisch, schickte Bud nach vorne, der kam kurzfristig zurück, setzte sich, nahm seine Karten wieder auf und sagte, dass der Herr da vorne bei der Qualle `ne Runde Bier für uns bestellt hätte.
Bud stieg unverrichteter Dinge in seinen Ford und fuhr… unverrichteter Dinge nicht ab, sondern blieb einfach in seinem Auto sitzen. Okay, sagten wir uns, setzten uns wieder an den Tisch und machten weiter, trauten uns aber nicht, das Licht anzumachen. So quatschten wir einfach nur so vor uns hin, bis es an der Tür klopfte. Oma war’s: „Mein Gott, ihr seid ja nicht mehr zu sehen! Warum macht ihr denn kein Licht…“. „Nein“, unterbrach ich sie „ist schon in Ordnung, unsere Augen haben sich an die Dunkelheit gewöhnt, das Licht würde uns nur blenden.“ Sie beließ es dabei und wir hörten das Klacken der Tür. Wir arbeiteten bereits an einem Fluchtplan für Benno über den Hinterhof, als Bud wegfuhr und alles geheim blieb.
Das in den ADAC eintreten erschien mir von den offenen Punkten am Einfachsten, und mit dem Kartenmaterial würden wir auch endlich unsere Route besser planen können. Also fuhr ich zum ADAC in der Bundesallee (der sitzt noch heute dort!) und trat gleich zweimal ein, erst in die Geschäftsstelle und dann in den Automobilclub. Nachdem ich ordentliches Mitglied war, fragte ich, ob es kostenloses Infomaterial für Reisen gäbe. „Ja, klar“, bestätigte mir der ADAC-Berater, „wo soll es denn in diesem Sommer hingehen?“ „Nach Indien!“ Es entstand eine Pause, bei der sein Gesichtsausdruck von serviceorientiert auf unorientiert wechselte. „Mit dem Auto?“, fragte er schließlich, seine Sprachfähigkeit wiedergewinnend. „Ja“, antwortete ich. Sein folgendes „Ich schau‘ mal“ intonierte er mit solch erwarteter Erfolglosigkeit, dass ich sicher war, er würde nichts in den unzähligen Fächern in dem riesigen Regalschrank hinter sich finden. So war es auch. Nein, in Asien wäre der ADAC eigentlich nicht präsent, alles Kartenmaterial würde sich auf Europa beziehen. Ich wollte schon fragen, ob ich wieder austreten kann, weil ich mir ja hauptsächlich das mit dem Pannendienst so schön vorgestellt hatte, aber er sagte, er könne mir bis Istanbul helfen, weiter halt nicht. Na, okay, immerhin etwas, also nahm ich die Informationen für den europäischen Teil unserer Reise.
Das mit dem ADAC hatte ich doch gleich geahnt. Außerdem machte es nur Sinn, über mögliche Routen und nötige Pannendienste nachzudenken, wenn man überhaupt ein Auto besitzt und noch besser: einen Führerschein. Ich hatte nämlich keinen. Und ich hätte wahrscheinlich bis heute keinen, wäre diese Reise nicht gewesen. Aber Bernd bestand darauf und mir war ebenso klar, dass das sein musste. Aber es bedeutete einen größeren zeitlichen Vorlauf, vor allem für mich, denn in Anbetracht meiner technischen Hochbegabung und fehlendem Spaß am Autofahren konnte es durchaus sein, dass ich zu einem zweiten Prüfungstermin vorgeladen würde. Zu den anstehenden finanziellen Engpässen durch die Reise kämen die Kosten für den Führerschein noch verengend hinzu. Ein weiterer, vorgezogener Erbteil könnte hier Milderung schaffen, auf Deutsch: Meine Eltern sollten den Führerschein bezahlen. Dazu musste ich ihnen aber reinen Wein einschenken und eine gewisse Notwendigkeit erzeugen. Also beschlossen Bernd und ich, nach einem Uhrenabgleich die Betroffenen zum selben Zeitpunkt – früher als geplant – zu informieren. Bei meinen Eltern klappte es. Vor irgendwelchen Fragen oder Bedenken reagierte mein Vater reflexartig wie eine Flipperkugel zwischen den Bumpern: „Da musst Du aber den Führerschein machen!“.
Als ich meinen Eltern die Nachricht überbrachte, reagierte mein Vater auch reflexartig wie eine Flipperkugel, aber auf seine Weise: „Wo willst Du denn das Geld herkriegen?“ Beide Väter waren besorgt um ihre Söhne, aber auf unterschiedliche Weise. Während Benno von seinen Eltern gleich den Führerschein finanziert bekam, waren meine daran interessiert, wie ich das notwendige Geld wohl zusammenkriegen würde. Ich hatte immer ein durchaus herzliches Verhältnis zu ihnen, aber auch ein bisschen ein geschäftsmäßiges. Sie haben mich immer unterstützt: mental. Sie nahmen es mit meiner Volljährigkeit ernst, hatten sie doch für die Aufzucht gesorgt und mich bis zum Abitur durchgefüttert, seitdem war ich selbständig. Dass ich studierte, fanden sie ganz toll, aber wer studieren will, muss sich das auch finanzieren können. Bei mir war nichts mit vorgezogenem Erbteil, ich musste anders als Benno warten, aber im Nachhinein muss ich sagen, dass ich darauf gerne noch viel viel länger gewartet hätte. Wie es überhaupt okay war, dass ich mich um meine Dinge selbst kümmern musste. Außerdem muss ich zugeben, dass ich zwar nie direkt, aber oft indirekt von meinem Vater unterstützt wurde. Er verhalf mir zu Jobs (z.B. in der Firma, in der er arbeitete), trieb von Anderen Geld auf (Bafög, weil sein Einkommen gering genug war) und vermittelte mir jemanden, der mich mit unterstützte: Oma! Also alles okay!
In jedem Fall musste zusätzliches Geld her. Ich erhöhte meinen Einsatz im Geschäft von Wolfgang Mauser. Die Mausers hatten einen Allerleiladen für Schreibwaren, Spielzeug, Zeitungen, Zigarren, Zigaretten und Lottoannahme. Da half ich aus. Ich übernahm noch zusätzlich die Sonntagsschicht. Mausers wollten einmal in der Woche ausschlafen und ich hatte die verantwortungsvolle Aufgabe, sonntags für ein paar Stunden das Geschäft alleine zu führen. Das war nicht ohne, es war viel Betrieb, man musste flink sein, immer aufpassen, dass keiner was klaut, dass man richtig rechnete und das Wechselgeld richtig rausgab.
Ich nahm einen zweiten Nebenjob in der Firma an, in der mein Vater arbeitete. Oder besser gesagt, in der mein Vater gearbeitet hatte, als es sie noch gab. Die Firma befand sich in Abwicklung. Sie war zusammen mit einem ganzen Konglomerat von Firmen geschlossen in die Pleite gegangen, damals ein heftiger Finanzskandal in Berlin. Und mein Vater war wieder mal nicht schuld daran, was kaum glaubhaft schien. Er hatte ein, sagen wir mal vorsichtig, unstetes Berufsleben, und ich kann mich nicht erinnern, dass er eine Anstellung länger als drei oder vier Jahre hatte. Dass es zur Kündigung kam, war in der Hälfte der Fälle sein Zutun, in der anderen Hälfte lösten sich die Firmen nach seinem Eintritt aus unterschiedlichsten Gründen anschließend auf. Meinen Vater einzustellen, war ein riskantes Unterfangen, bedeutete es doch häufig das Ende der betreffenden Firma. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ich wurde gefragt, ob ich nicht die Buchhaltung für drei der Pleite gegangenen Firmen machen wollte, weil ich doch BWL studierte. Hach, hier zeigte sich bereits kurz nach Studienbeginn der Vorteil der genialen Wahlkombination Mathe/BWL. Ironie des Schicksals war, dass ich übrigens genau von dem Freund meines Vaters (er hatte mit dem Firmengeflecht zu tun) gefragt wurde, der mir den Studienrat (keinen Lehrer, sondern im Sinne von Studientipp) gegeben hatte. Irre, wenn man aus heutiger Sicht bedenkt, was man damals so locker gemacht hat. Ich hatte gerade mal ein Semester Buchführung hinter mir, aber mit erfolgreichem Klausurabschluss. Deshalb befand ich wohl, dass mich diese erste Einführung in die doppelte Buchführung befähigte, die Buchhaltung von Firmen zu übernehmen, die noch Gegenstand staatsanwaltlicher Untersuchungen waren. Ich fand die doppelte Buchführung wunderbar, da konnte man nichts falsch machen. Mathematischer Stumpfsinn befähigt einen, monoton endlos immer wieder dieselbe Regel auszuführen. Wenn man links im Soll 100 DM bucht, muss man auf einem anderen Konto rechts 100 DM im Haben buchen. Man kann das falsche Konto bebuchen, aber Soll und Haben stimmt mit dem Verfahren zum Schluss immer überein. Mir war schleierhaft, wie man etwas übrigbehalten konnte. Ein Kommilitone schaffte das. Er studierte BWL und fiel mehrmals durch die Buchführungsprüfung. Er hatte am Ende der Klausur immer einen Betrag übrig. Ich empfahl ihm, bei der nächsten Prüfung ein Konto „Dubiose Reste“ zu eröffnen und mögliche Unstimmigkeiten dort auf immer und ewig wegzubuchen.
Ich erinnere mich gerne an meine Buchhaltertätigkeit. Ich hatte mir die Erstausstattung für den „kleinen Buchhalter“ besorgt, einen Karteikasten mit vielen bunten Karteikarten, die den Kontenrahmen darstellten und darin buchte ich munter von „Soll an Haben“. Meine Arbeitsstätte war eine zum Büro umgewandelte Wohnung im Souterrain einer schönen Villa und ich teilte sie mir mit einer ebenso schönen, aus dem Firmenverbund übriggebliebenen Sekretärin. Zuerst zeigte sie noch etwas das arrogante Verhalten einer Vorstandssekretärin, dann aber wurde sie zum ganz normalen, liebenswerten Menschen und in den freien Minuten, ohne Telefonate für sie und ohne „Soll an Haben“ für mich, spielten wir „Stadt, Land, Fluss“, was sie fast immer gewann und meinen Sympathiewert für sie wieder sinken ließ, weil ich nicht verlieren kann. Wobei ich den Verdacht nie los wurde, dass sie schnell „Stopp“ sagte und soviel Übung hatte, dass sie sich erst beim langsamen Vorlesen Lösungen mit dem Buchstaben überlegte. Sie saß weit weg, es war nicht zu sehen, wieviel sie wirklich schrieb. Na, egal, war trotzdem ´ne Leistung.
Ich bin ein wenig weg vom Thema: „Wir erzählen zeitgleich unserer Umgebung von unserem Vorhaben“. Nach unseren Eltern galt es, die Freunde zu informieren.
Den Freunden war es natürlich leicht zu sagen: Hey, wir Outlaws, wir wirklichen Hippies fahren mal eben mit dem Auto nach Indien. Das machte Eindruck. Dachten wir. Aber eigentlich verblieb die Reaktion zwischen Unverständnis, Ungläubigkeit und Achselzucken. Nur Yogi sprang an. Er wollte sofort eine Wette, aber das war klar.
Yogi (war kein hinduistisch philosophischer Gelehrter, sondern hieß einfach Jürgen, was aber im Laufe der Jahre zu Yogi sublimiert war) wettete mit jedem zu jeder Möglichkeit. Manchmal, ohne dass am Horizont irgendein Wettwölkchen erkennbar war, wie z.B. in der Currywurstbude, in der wir Samstag nachmittags immer Vesperzwischenstation machten, bevor wir in die „Afri“ gingen. Wir standen, warteten auf unsere Currywurst und glotzen vor uns hin. Es gab unheimlich scharfe Peperoni, aber nur portionsweise, was zu heftig schien, obwohl eine davon – mit Bedacht gegessen – nicht übel und zu verkraften war. Yogi aus dem Nichts: „Wetten, dass ich zwei komplette Portionen von den Peperoni esse!“. Na, da waren Benno und ich doch sofort dabei, das versprach in jedem Fall hohen Unterhaltungswert, selbst wenn wir die Runde Bier oder um was es auch immer ging, verlieren würden. Der Chef hinter dem Wursttresen hatte die Wette mitbekommen und war sofort bereit, an diesem quasi wissenschaftlichen Versuch extremer Geschmacksnervenbelastung teilzunehmen. Bestimmt hatte noch nie jemand zwei Portionen von seinen Peperoni bestellt, um sie vor Ort vor seinen Augen zu essen. Yogi war sich sicher, auch gut vorzubereitet zu sein. Er erklärte uns, dass, wenn es scharf wird, trinken nichts nützt, sondern Brot würde helfen, nur Brot. Wortlos gab der Wurstmann ihm einen Teller mit Brot und die beiden Portionen. Das Brot wohl inklusive als sein unentgeltlicher Beitrag zu dem Versuch. Yogi begann, Peperoni nach Peperoni zu essen und er schaffte zu meiner Verwunderung und Hochachtung die Hälfte. Teller zwei machte ihm dann offensichtlich zu schaffen. Er lief knallrot an, das Wasser schoss ihm aus allen Poren und seine Brille beschlug. Er sah nichts mehr. Der Wurstmann war fasziniert, hatte aber alle Hände voll mit Nachschub von Brot zu tun. Ich glaube, Yogi aß seinen gesamten Tagesvorrat auf. Ich weiß auch nach so langer Zeit nicht mehr, ob er wirklich alle aufgegessen hat oder vorher aufgab, d.h. ob wir verloren oder gewonnen haben. Es ist auch egal, ich meine aber, mich noch erinnern zu können, dass nachfolgende Kunden der Imbissbude bei Yogis Anblick in Erwägung zogen, woanders etwas zu sich zu nehmen, und dass er den ganzen Abend über in der „Afri“ beim Kartenspiel wenig sprach und nicht mehr richtig zu sich kam.
Yogi wollte mit uns wetten, dass wir die Indienreise nicht schaffen. Wenn doch, sollten wir in Kalkutta, an einem der entferntesten Punkte unserer Tour ins Grand Hotel einkehren (ein Grand Hotel gibt’s bestimmt in allen Riesenstädten) und dort einen Manhattan trinken, also das berühmte Gemisch aus Whisky, rotem Vermouth mit einer Cocktailkirsche drin. Und über diesen Verzehr sollten wir als Beweis eine Rechnung mitbringen. Dann würde er eine große Wiedersehensfete bei sich organisieren und bezahlen, andernfalls müssten wir das tun. Das war eigentlich die aufregendste Reaktion auf die Bekanntgabe unserer Reise. Wir nahmen die Wette an.
Aber der heikelste Punkt der Bekanntgabe war, es unseren Freundinnen beizubringen, sofern man es nicht zum Anlass nehmen wollte, den Trennungsvorgang elegant einzuleiten.
Karin war meine Freundin zu jener Zeit, und das hing eng mit meinem Studium zusammen. Das Lehrerstudium wird zeitlich durch die schulpraktische Phase, das sogenannte Didaktikum, in zwei Teile getrennt. Ein halbes Semester dilettiert man angeleitet oder auch selbständig an einer Schule und weiß dann, ob man diesen Beruf als Beamter auf Lebenszeit ausüben will. Heute, nach 35 Berufsjahren in Gesamtschulen, weiß ich, dass das Quatsch ist.
Für Lehrerstudenten mit zwei Wahlfächern hält die Studienordnung noch die Gemeinheit eines Praktikums bereit, abzuleisten in den Ferien nach dem Didaktikum. Das wären die Sommerferien 1974 gewesen. Die wollte ich aber als Reiseleiter in Frankreich oder als Abenteurer in Indien verbringen und bestimmt nicht mit der Beseitigung des Bildungsnotstandes in Berlin. War es meine Penetranz, ein Fehler der Univerwaltung oder weil es dem Didaktiker besser in den Kram passte, jedenfalls bekam ich vorher einen Stellungsbefehl für ein Praktikum im Fach Deutsch bereits für Februar 74 an einer Realschule im Wedding.
Der Schulleiter war kein Freund langer Vorreden. Er grüßte knapp und fragte 10a oder 10b? Ich meinte, 10b wäre ganz okay (wegen, weil immer b-Klasse, Sie verstehen schon). Gut, also dann 10a, Lehrerzimmer im ersten Stock. Er war Deutschtümler und mochte mein „okay“ wohl nicht.