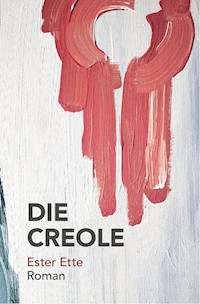
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Menschen wie du und ich treffen aufeinander. Ihre Geheimnisse und Lügengebilde kreuzen sich und lösen Katastrophen aus. Susanne, nach einer furchtbaren Enttäuschung auf der Flucht nach Goa, verheimlicht, wer der Vater ihrer Tochter ist. Martina, Susannes ältere Schwester, vertreibt Susanne aus ihrem portugiesischen Paradies und initiiert damit eine Kettenreaktion von Schicksalsschlägen. Marko, der sich auf der Suche nach "Kicks" in einem exklusiven Doppelleben zwischen Portugal und England eingerichtet hat, betrügt nicht nur seine Ehefrau. Jakob, der im Strudel der Wiedervereinigung seine Karriere auf einem Betrug aufbaut, verliebt sich in seine Patientin Martina. Die spannende Geschichte spielt in Südafrika, Portugal, Indien, England, Berlin. Sie beschreibt das Leben seiner Protagonisten aus heutiger Sicht mit Rückblicken bis in die deutsche Nachkriegszeit. Die Zukunft gehört den Kindern Olga, Manuel und Zoe, die mit dem Vermächtnis der Erwachsenen zurecht kommen müssen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIE CREOLE
von ESTER ETTE
„Eine Lüge ist, ganz gleich, wie gut sie auch gemeint sein mag, immer schlechter als die bescheidenste Wahrheit.“
Ernesto Rafael Guevara de la Serna, genannt Che Guevara
In dem Augenblick, in dem wir leiden, scheint der menschliche Schmerz unendlich zu sein. Doch weder ist der menschliche Schmerz unendlich, noch ist unser Schmerz mehr wert als eben ein Schmerz, den
wir ertragen müssen.“
Fernando Pessoa
Der Mensch ist ein Abgrund. Wenn man hinabschaut,
schwindelt es einen.
Georg Büchner
Es gibt keine dummen Fragen, – nur dumme Antworten.
Frau Münch, Deutschlehrerin
***
Inspiriert von wahren Begebenheiten, sind doch alle Charaktere und deren Lebenswege der Phantasie entsprungen.
***
Prolog OLGA
Ich liebe Indien, das Land meiner Geburt. Auch wenn ich hier immer eine Fremde sein werde.
Ich liebe Goa, meinen Mann Gopal und meinen Sohn Merlin.
Gopal möchte eines Tages zurück in das Land seiner Ahnen nach Nepal. Ich möchte nicht zurück in das Land meiner Ahnen – Deutschland – und auch nicht zurück in das Sehnsuchtsland meiner Mütter und Väter. Portugal. Nicht dorthin, wo es sie wie magisch immer wieder hinzog, wo die Dinge ihren Lauf nahmen und ich hineingeschleudert wurde in eine Welt voller Geheimnisse, Lügen und Intrigen, aber auch Unwägbarkeiten und Zufälle, wenn man an Zufälle glauben mag. An Kismet, an Bestimmung, Vorsehung oder höhere Gewalt. An göttliche Macht, – all das, worauf der Mensch keinen Einfluss zu haben scheint. Oder ist es Karma, wie es die Hindus und Buddhisten sehen, das Prinzip von Aktion und Reaktion. Diese ganze vertrackte Mischung – Schicksal eben, wie Ur-Großmutti Sara Barbosa es gesehen hätte, vielleicht auch Oma Lotti auf ihre Weise.
Wie auch immer, ich liebe diesen Ort, an dem ich unter Palmen geboren wurde, als behütetes, vaterloses Mädchen am Strand von Candolim, da, wo mich José, Gopal und dieser Hippikautz Winni mit seiner Vorliebe für Pumpernickel und junge Männer vor den wilden Gottheiten beschützt haben. An jenem Ort, an dem José nicht glücklich werden konnte und an den meine Mutter geflüchtet war, um den Verletzungen ihrer großen Liebe und der ewigen Dominanz ihrer Schwester zu entgehen.
Nun freue ich mich auf den Besuch meiner kleinen Schwester Zoe, auch wenn er mich zurückwirft in die Tragödie meiner Teenager-Zeit und konfrontiert mit all den Verwirrungen meiner Familie.
Sieben mal ist seit dem der Monsun über das Land gezogen. Eine Ewigkeit manchmal, und doch erscheint es mir wie heute.
HEUTE_Verrückt
Wer am Anfang schon ans Ende denkt.
Wie es Martina, Marko und Susanne derzeit geht.
LIVROBRANCO März 2013
MARTINA
Zuerst ist es nur so ein diffuses Gefühl, eine leichte Verwirrtheit, Unstimmigkeit – als wenn die Wahrnehmung geringfügig verschoben oder auch nur verwackelt ist, ein Duplex entsteht. Du schiebst es zur Seite wie einen leichten Vorhang, und alles ist wieder scharf und klar.
Nur ganz hinten oder eher unten galoppiert einer deiner vielen Pulse zu schnell, liegt ein leichter Druck auf deinem inneren Auge, zwischen den Oberschenkeln zieht es ein wenig. Und dann ist es auch schon wieder vorbei.
Beim nächsten Mal dachte sie laut: „Komisch. Irgendetwas stimmt doch nicht. Habe ich einen Aussetzer? Ich hatte die Vase doch auf den Tisch gestellt, oder? Der Terrassenschirm am Pool war hochgestellt als wir gingen. Ich weiß es genau, weil ich noch dachte, ob er dem leichten Wind vom Meer standhält? Und wie schnell frischt der Wind auf.“
Ebenso die Vase mit der leuchtend roten Geranie, die sich so grandios von der frisch gekalkten Hauswand abhob, auf die die Februar-Sonne derart knallte, dass man sich fast geblendet abwenden musste. Gerade diesen grellen Farbtupfer hatte Martina beim Fortgehen bewundert.
Von ihren Einkäufen zurückgekehrt, stand die Vase auf dem Fenstersims und der Schirm war zugeklappt. Menschenleere. Das Haus stand fern ab des Weges, keine Nachbarn in einem Umkreis von 300 Metern.
Sie war irritiert.
„Marko? Hast du auf der Terrasse den Schirm zugemacht als wir gegangen sind?“
„Wie? Keine Ahnung. Mag sein, vielleicht. Ein Reflex. Wieso? Sollte ich nicht?“
„Nein, nein, schon gut.“ Selbst, wenn er den Schirm zugemacht hätte… was war mit der Vase? „Und hast du die Vase auf das Fenstersims gestellt?“
„Wie?“, schallte es etwas ungeduldig aus dem Bad. „Die Vase? Was für eine Vase?“
„Hier vorne auf der Terrasse!“
„Nicht, dass ich wüsste. Warum auch. Ich verstelle niemals Vasen, das weißt du doch.“
Dann sah sie, dass das Grillgitter, welches sie gewiss vor die Haustür zum Trocknen gestellt hatte, im Flur an der Wand lehnte. Soweit sie sich erinnerte, hatte sie es nicht dort deponiert.
„Marko, was ist mit dem Grillgitter, hast du es ins Haus geholt?“ „Grillgitter? Sag mal, was willst du eigentlich von mir? Kontrollierst du mich, oder hab ich was falsch gemacht?“
Mein schöner Marko war genervt.
„Nein, nein. Mir ist nur so als wäre hier alles ein wenig verschoben worden. Keine Ahnung. Ich wollte nur wissen, ob ich irgendwie nicht richtig ticke, oder was. Wenn du die Sachen nämlich verstellt hättest, wäre das die einfachste Erklärung, meine ich.“
„Was denn“, rief er aus dem Bad, „der Grill, die Vase, der Schirm. Ist was geklaut oder beschädigt?“
„Nein, nichts dergleichen. Es sind ja auch nur Zentimeter eigentlich. Schwamm drüber. Soll ich uns einen Tee machen?“
***
Am dritten Tag hatte Martina sich beruhigt. Die Dinge standen am richtigen Platz. Sie scannte ihre Positionen, merkte sich das Gesamtbild und verlor kein weiteres Wort darüber.
Am vierten Tag stand plötzlich ein gepflücktes Grasbüschel in einem ihrer Wassergläser auf dem Tisch der Hinterhaus-Terrasse, mit Wasser drin. Das Gartenregal war vom Abstellplatz um die Ecke vor den Außenkamin gewandert und die Polsterauflage des Liegestuhls stand sorgfältig drapiert an der Wand. Sie packte alles wieder dorthin, wo es hingehörte, setzte sich auf den Liegestuhl, schaute auf den Pool und ihren Büro-Anbau, auf den sie recht stolz war, atmete zehnmal achtsam aus und ein – so wie sie es beim Pilates gelernt hatte – und behielt alles für sich. Ein Rest Unsicherheit blieb.
Die Veränderungen waren nicht massiver Natur, nur gerade so, dass sie es wahrnahm. Marko bemerkte nichts.
Als sie beide eines späten Nachmittags vom Strand aus Fuzeta kamen und der Tontopf mit der Nelke, die Marko tags zu vor noch wegen ihrer zarten Farben eine Erwähnung Wert war, was sie verwundert hatte, da er ansonsten selten etwas zu ihren Blumen sagte, als also dieser Tontopf nicht mehr auf der Blumenbank, sondern an der Grundstücksmauer stand, war für Martina klar, jemand schleicht um das Haus und verrückt die Dinge – geradeso als wolle er oder sie sagen: „Sieh her. Ich war wieder da!“ Und nun?
Sie sagte zu Marko: „Da, der Tontopf… Siehst du? Ich spinne nicht. Er steht nicht mehr auf der Bank wie heute morgen. Er steht jetzt an der Mauer.“
„Ach, Liebes“, sagte er leicht von oben herab: „lass es gut sein. Wahrscheinlich hast du ihn selbst aus der Sonne in den Schatten gestellt. Da steht er ja auch viel besser. Du machst mich nervös mit deinen Bemerkungen. Hast du zu viel getrunken? Was ist los mit dir?“
Sie wurde ärgerlich. Wieso mit ihr? Warum bemerkte er die Veränderungen nicht? Warum unterstellte er ihr, dass sie nicht mehr wusste, was sie getan oder gelassen hatte?
Am folgenden Tag fotografierte sie mit dem Smartphone sowohl die vordere als auch die hintere Terrasse und den Bereich rund um den Pool, in dem um die Jahreszeit noch kein Wasser stand, um einen Vergleich zu haben, falls sie wieder eine Veränderung bemerken sollte.
Martina hatte die ganze Nacht kaum ein Auge zugetan, jedes Geräusch hielt sie wach, ihr Puls raste. Sie trank ein, zwei Brandy zur Beruhigung. Wer schlich ums Haus und beobachtete sie und aus welchem Grund? Warum glaubte Marko ihr nicht und unterstellte ihr, dass sie nicht ganz bei Sinnen war? Hatte er vielleicht recht? Vergaß sie im Laufe des Tages, was sie morgens hin und her geschoben hatte? Die verschobenen Dinge machten ja Sinn: heruntergelassene Sonnenschirme, sichergestellte Blumenvasen, dekorierte Tische, verstauter Grillrost, in den Schatten gestellte Nelken. Das musste niemanden beunruhigen. Das alles trug sogar ihre Handschrift – da sie immer für Ordnung sorgte – es ihnen schön machen wollte – alles in Sicherheit brachte.
Ihr Mann sagte oft, sie solle doch mal alle Fünfe gerade sein lassen, entspannen, umso mehr, wenn sie sich ein paar freie Tage gönnten. Das geschah selten genug, wenn er nicht auf Messen und Tagungen unterwegs war zu seinen Kunden oder um Ankäufe zu tätigen in London, Lissabon oder Berlin. Martina graute vor nächster Woche, wenn er sie wieder alleine lassen würde, hier auf dem portugiesischen Land – allein mit einem Geist, der die Dinge verschob.
„Langsam mache ich mir Sorgen“, sagte Marko, kniff die Brauen über seinen wasserblauen Augen zusammen und bewegte seine Sorgenfalten auf der Stirn. Sie hatte ihn gerade betont locker und beiläufig gefragt, ob er ihre Gartenschere gesehen habe. Sie war sich ganz sicher, sie hatte sie auf die verschobene Gartenbank am Außenkamin abgelegt. Dort lag sie nun nicht mehr. Sie konnte sie nicht finden. Alles, was anders lag als sie es erinnerte oder einen neuen Platz eingenommen hatte, versetzte sie inzwischen in leichte Panik.
„Die Gartenschere“, sagte Marko in einem Ton, mit dem man gewöhnlich zu kleinen Kindern oder Demenzkranken spricht, „habe ich gestern Abend von der Gartenbank genommen als es anfing zu regnen und in den Geräteschuppen gelegt – dort wo sie hingehört. Was ist dabei?“
„Nichts. Nichts“, erwiderte sie hastig. „Ich meine ja nur.“
„Glaubst du noch immer, hier streunt jemand umher und verschiebt deine Sachen?“, fragte er und verzog sein Gesicht zu einem schrägen Grinsen. „Ist das der Grund, warum du wie ein aufgescheuchtes Huhn hin und her rennst, andauernd Fotos machst, bevor du das Haus verlässt, alles ordnest und sortierst, nachts unruhig schläfst und mit dunklen Schatten unter den Augen herumläufst?“
Immerhin – er hatte es bemerkt. „Ich denke mir das ja nicht aus“, versuchte sie ihr Verhalten zu erklären. Es klang ihr selbst jämmerlich.
„Haben denn deine Fotobeweise etwas ergeben?“, fragte er durchaus interessiert.
Martina mochte darauf nicht antworten, wollte sich nicht verteidigen. Sie hatten nichts ergeben. Sie konnte ja nicht vor jedem Einkauf, nach jedem Pilates-Kurs oder Besuch bei Freunden alle Ecken und Winkel durch fotografieren. Ihr Eindruck war ohnehin, dass sich merkwürdigerweise immer jene Dinge verschoben, die sie vorher nicht dokumentiert hatte.
Auf der Eingangsmauer waren die am Strand gesammelten Steine und Muscheln in neuer Reihenfolge, nun nach Größe sortiert, zusammengestellt. Unter dem Johannisbrotbaum am Carport links von der ehemaligen Scheune war das alte Surfbrett von Marko umgedreht worden. Das seit langem lockere Schild mit ihrer Hausnummer stand auf dem Kopf – von 66 auf 99. Der Blechnapf mit dem Futter für die Katze war umgedreht, der Wasserschlauch, den sie abends eingerollt hatte, lag ausgebreitet über dem Gartenweg. Ihr T-Shirt war von der Wäscheleine genommen und fein säuberlich zusammengefaltet auf die Grundstücksmauer gelegt worden. Tausend Nettigkeiten immer dort, wo sie gerade nicht fotografiert hatte.
Das alles schien kein Zufall zu sein und zeigte ihr, dass sie ständig beobachtet wurden. Konnte sie sich Marko anvertrauen? Wohl kaum. Er nahm sie nicht ernst. Er würde ihr nicht glauben und sich nur lustig machen. Sie hatte das Gefühl, dass sie ihm nicht sagen konnte, wie es um sie stand. Ja, sie gewann die Überzeugung, er hielt sie langsam für verrückt oder betrunken oder beides. Und irgendwo konnte sie es ihm nicht einmal verdenken.
„Nun sag schon. Hat das Fotografieren was gebracht?“
„Ja“, sagte sie mutig.
„Ach ja? Und was genau?“
Wollte er es wirklich wissen? Oder wollte er nur eine Bestätigung ihrer Dämlichkeit? Martina atmete tief ein und blähte ihren Brustkorb auf.
„Da sich immer dort etwas verändert hat, wo ich nicht fotografiert habe, ziehe ich den Schluss, dass uns jemand durchgängig beobachtet und gerade die Stelle verändert, die nicht dokumentiert ist.“
Er schob sein markantes Kinn schräg nach vorn und guckte sie ungläubig an: „Du willst mir sagen, auf den Fotos sind keine Veränderungen sichtbar und das sei der Beweis dafür, das etwas verändert wurde?“
„Richtig“, antwortete sie, alles Selbstbewusstsein zusammenkratzend, das ihr noch zur Verfügung stand. Er wollte sie nicht verstehen, obwohl sie zugeben musste, dass die Schlussfolgerung selbst in ihren Ohren etwas absurd klang.
„Weißt du was?“, sagte er genervt – Tendenz ärgerlich. „Ich hatte dir etwas mehr Logik zugetraut. Ich packe jetzt meine Sachen für morgen, schmiere mir ein Brötchen mit Käse, trinke ein Glas Bier und lege mich ins Bett. Ich muss morgen früh los. Der Flieger geht um kurz nach acht.“
„Soll ich dich nach Faro bringen?“ fragte sie vorsichtig. Das tat sie eigentlich immer um die Zeit. Sie tranken dann noch ein Glas Galão in der Flughafenhalle, und sie verabschiedete ihn in die große weite Kunst-Welt.
„Ich nehme ein Taxi“, sagte er kurz angebunden. „Du kannst ja sicher nicht weg, weil sonst wieder was verrückt ist, wenn du zurückkommst.“
„Du bist gemein“, die Tränen standen ihr in den Augen und sie ärgerte sich über sich selbst. „Warum sagst du so etwas? Ich bin etwas verunsichert. Mir graut gerade davor, allein im Haus zu sein. Wie lange bist du denn unterwegs?“
Er stöhnte laut und schaute seine Frau unverwandt an. „Mindestens eine Woche, du weißt doch, wie lange die Messe in London immer dauert und dass ich rundherum viel zu tun hab. Das Halbjahresgeschäft. Ich lasse dich in diesem Zustand auch ungern allein. Frag doch deine Schwester, ob sie dir für ein paar Tage Gesellschaft leistet. Na ja, vielleicht besser nicht...“ Der Vorschlag war ihm wohl nur so herausgerutscht. Er wusste ja am besten, wie schwierig das Verhältnis der beiden Schwestern war.
„Es würde mir schon helfen, wenn du mir einfach glauben würdest und etwas aufmerksamer wärst. Dieser jenige will uns ja offenbar nichts Böses, sonst hätte er oder sie sich wohl anders oder gar nicht bemerkbar gemacht. Oder?“
„Martina, hör endlich auf damit. Hier ist niemand. Du steigerst dich da in etwas hinein. Vielleicht solltest du mal zu einem Arzt oder Psychologen gehen. Beruhigungstabletten, Entspannungstees oder ein, zwei Brandys weniger oder so was. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Du bist ja kaum wiederzuerkennen. Seit Tagen können wir kein normales Wort mehr miteinander reden. Du schleichst durch die Gegend, als leidest du unter Verfolgungswahn. Und jetzt willst du nicht alleine sein. Was sollen wir denn machen? Ich kann doch nicht meinen Job aufgeben“, er lachte hysterisch und lief rot an. „Weißt du was, ich bitte Hannes mal wieder, nach dir zu sehen. Er passt rund um das Haus auf. Und nächstes Wochenende bin ich wieder da, dann sehen wir weiter. Und selbst wenn hier jemand herum läuft und Sachen verschiebt, so ist es ein harmloser Depp mit einem Tick. Oder Oma Soares, du weißt, sie schleicht hier manchmal übers Gelände und sucht ihr altes Haus. Ich muss jetzt wirklich was essen und dann ins Bett.“
Einerseits tat ihm Martina leid, andererseits lag er in Gedanken schon im Londoner Rubens.
***
SUSANNE
Susannes 37. Geburtstag begann gänzlich unspektakulär, um nicht zu sagen: traurig. Saudade. Sie erwartete zum Kaffeetrinken ein paar Gäste in Bias do Sul. Sie vermisste ihren Mann. Den gemeinsamen Tee am Morgen, das flüchtige Gespräch über Manuels Schulleistungen, den Kuss beim Zubettgehen.
Vier quälende Monate waren schon vergangen. Er hatte einfach dagelegen, am Fuße der Treppe. Ende. So schnell sprangen alle Zeiger auf Null. José – langgestreckt vor ihr in seinem Blut, mitten in der Küche auf den kalten Kacheln, das Gesicht aufgeschlagen, gefällt wie ein Baum.
Nie würde sie diesen Anblick vergessen. Er verfolgte sie in ihren Träumen und noch jedes Mal, wenn sie vom Esszimmer in die Küche trat, sah sie ihn dort liegen, roch sie das gerinnende Blut. Am Ende bestand ein Leben aus einem Haufen blutenden Fleisches. Plötzlich war da nichts mehr. Kein Atem, keine Bewegung. Kein Licht in den Augen. Keine Wärme.
Sie hatte sich ein Ende anders vorgestellt. Sprach man nicht immer auch von Erlösung? Die Bilder verschwanden einfach nicht aus ihrem Kopf. Auch heute nicht, heute erst recht nicht.
Aber so sehr sie der Anblick des leblosen Körpers von José auch verfolgte, so ungenau erinnerte sie sich an die Sekunden davor. Sie hatten sich kurz zuvor gestritten, soweit sie sich erinnerte. Wo war Manuel?
Seither vergrub sie sich schweigend in diffuse Schuldgefühle.
Ihr Jüngster gratulierte ihr im Vorbeigehen mit unbewegter Miene. Seit dem Tod seines Vaters hatte er es jeden Morgen sehr eilig, in die Schule zu kommen. Manuel verschwand aus ihrem Blickfeld mit den Worten, er habe heute Nachmittag ein wichtiges Fußballspiel in Olhão. Maura würde ihn nach der Schule mitnehmen und danach auch wieder zurückbringen. Das mit dem Kaffeetrinken heute Nachmittag würde also etwas später.
„Fangt ruhig schon mal ohne uns an!“
Draußen hupte Maura. Ihre portugiesische Nachbarin in Bias do Sul winkte heftig, was wohl ein schneller Geburtstagsgruß sein sollte. Auch Maura und ihr Sohn Carlos waren zum Kaffeetrinken eingeladen und würden dann vermutlich alle etwas später kommen. Maura war diese Woche an der Reihe, die beiden Jungen in die Schule nach Moncarapacho zu bringen. Sie teilten sich den Transfer der Kinder. Was für ein Glück, dass Manuel und Carlos Freunde waren und auch gemeinsam in der Fußballmannschaft spielten. Eigentlich war es sogar so, dass Manuel seit dem Tod seines Vater mehr bei Carlos und seiner Familie lebte als bei ihr. Sie schickte ihm fortwährend online-Botschaften, versuchte ihn anzurufen. Er antwortete selten.
Zwischen ihnen herrschte trauriges Schweigen. Susanne fehlte die Kraft der Worte und der Mut, Manuel in die Arme zu nehmen. Das hatte noch nie funktioniert. Manuel hatte sehr an seinem Paizinho gehangen. Sie spürte seine Ablehnung körperlich, sein verzweifeltes Leiden. Und sie versteinerte bei seinem Anblick, weil sie die Ähnlichkeit zu seinem Vater nicht ertrug und die Gewissheit, dass er ihr vollends entglitten war.
Sie hielt ihn nicht und war über die enge Verbindung zu Carlos Familie sogar erleichtert. Sie war schon lange keine gute Mutter mehr für ihre Kinder – und dass nicht erst seit dem plötzlichen Tod ihres Mannes. Keine gute Mutter… was ist eigentlich eine gute Mutter? Sie blieb an ihren Gedanken hängen wie die Fliegen am Honigklebeband des Lampenschirms. Wer legt den Maßstab an? Würde Gott sie strafen, weil sie die Kraft verlassen hatte, sich angemessen um ihre Familie zu kümmern? Hatte sie sich jemals um ihre Familie gut genug gekümmert?
Auch ihre Tochter ließ nach dem Tod ihres Vaters kaum noch etwas von sich hören. Olga war fast volljährig und ging längst ihre eigenen Wege.
Wie stolz Olga darauf gewesen war, dass sie in Alter do Chão das Reitinternat besuchen durfte. Sicher – auch Olga war tief getroffen von Josés Tod. Sie hatte aber nicht diese abgöttische Bindung zu ihrem Ziehvater wie Manuel. Sie war am Strand von Goa aufgewachsen, frei und ungezwungen. Susanne hatte immer dieses unbestimmte Gefühl gehabt, dass ihre Älteste niemandem gehörte außer sich selbst, dass sie einem Vögelchen glich, das schnell sein Nest verlassen hatte und neugierig von Ast zu Ast flog. War sie vielleicht nun ganz davon geflogen?
Siedend heiß fiel Susanne ein, dass sie die Rechnung für den Unterhalt ihrer Tochter und den Stall von Joelle immer noch nicht bezahlt hatte. Die Schule selbst war zwar kostenlos, aber mitsamt der Reitlehrerin musste sie gute 1.000 Euro im Monat für Olga aufbringen. Ihre Konten waren leer. Die Unklarheit, ob José ihr genügend Geld hinterlassen hatte, versetzte sie regelmäßig in Panik.
Olga war, wie es ihr schien, glücklich an der Schule, hatte eine Freundin gefunden, wohl auch einen Freund und konnte ihren Pferde-Traum leben. José hatte ihr vor Jahren Joelle geschenkt, weil sie so traurig war, Goa verlassen zu müssen. Schon damals folgte Olga ihrem untrüglichen Instinkt, das für sie Richtige zu tun. Sie war unbestechlich und kompromisslos in dem, was sie wollte. Susanne fragte sich oft, von wem sie diese Eindeutigkeit hatte. Vage erinnerte sie sich an eine Zeit, in der sie sich in völliger Gewissheit, das Richtige zu tun, aufgemacht hatte in eine andere Welt. Die Vorstellung, an diese Klarheit und Kraft wieder anzuknüpfen, erschien ihr heute aussichtslos. Sie war etwas neidisch auf ihre Tochter.
Olga konnte zu Susannes Geburtstag nicht kommen. Vier bis fünf Busstunden, um die Schule zu unterbrechen und kurz der Mutter zu gratulieren, dazu die Fahrtkosten. Da hatte sie bei einem ihrer raren Telefonate gesagt:
„Schatz, bleib in Alter do Chão. Ich nehm’s dir sicher nicht übel. Ich freu’ mich, wenn du in den Sommerferien kommst.“ Dabei merkte sie, wie Olga herumdruckste und auf Nachfrage, was denn los sei, ankündigte, dass sie mit ein paar Freunden gerne in den Sommerferien nach Spanien wolle, Barcelona und so, und deswegen erst ganz zum Ende der Ferien nach Bias käme. Spanien – das wäre so toll. Und dann werde sie ja auch schon bald 18. Aber sie wolle das schon mal ankündigen.
Susanne überschlug in Gedanken die Monate, schluckte und sagte, es sei noch reichlich Zeit bis dahin. „Wir können ja nochmal drüber sprechen. Und deinen Geburtstag – den wollten wir ja zusammen groß feiern. Es ist immerhin dein 18.!“
„Ja, das können wir dann ja nochmal bequatschen. Lass uns skypen. Ich weiß noch nicht, ob mir nach dem Tod von Vati zum Feiern ist. Ich hab da sowieso noch eine dringende Frage an dich.“
Susanne wollte gerade nachhaken, um was es denn genau ginge. Da fiel ihr Olga ins Wort.
„Ich muss jetzt aufhören. Die Voltigierstunde fängt gleich an. Und du weißt ja, wie mich das stresst, Handstand auf dem Pferd und so weiter, dieser ganze akrobatische Blödsinn... Und Mutti – feier’ recht schön. Kommen Tante Martina und Marko noch vorbei?“
„Marko ist meines Wissens in London. Martina vermutlich schon.“
Die Frage nach Martina und Marko löste bei Susanne innere Verkrampfungen aus.
***
MARTINA
Martinas Tagesablauf war heute vorgegeben. Der Vormittag gehörte der Pilates-Gruppe, am Nachmittag würde sie zum Geburtstag von Susanne gehen – ein besonderes Ereignis, denn erst zum zweiten Mal, seit Susanne wieder an der Ostalgarve wohnte, war sie in ihr Haus nach Bias eingeladen.
Beim ersten Treffen hatten sie alle Abschied von Susannes Ehemann José nehmen müssen. Ein trauriger Anlass für ein erstes Wiedersehen nach all den Jahren, kaum geeignet miteinander zu sprechen, zumal Susanne kaum ein Wort über die Lippen brachte. Verständlich in der Situation. Sie war mit 36 Jahren Witwe geworden. Martina wünschte, José wäre noch am Leben und sie wären ein glückliches Paar. Sie hatte José zwar nicht kennen gelernt, aber sie war sich sicher, dass die Zukunft für sie alle einfacher wäre, wenn José noch leben würde; denn um so besser es ihrer kleinen Schwester ginge, je weniger Ängste und Schuldgefühle hätte sie selbst haben müssen. Sie ärgerte sich über ihre egoistischen Gedankengänge, aber sie konnte sich nicht dagegen wehren. Da war sie mit sich selbst ehrlich genug.
Im Anschluss an den Pilates-Kurs in Luz de Tavira traf sie sich turnusmäßig mit ihren Freundinnen im Café Rainha in Pedras d’el Rei zum „Damenkränzchen“, wie sie es selbstironisch nannten.
Martina rutschte gleich zu Anfang heraus, dass es ihr zunehmend mehr zu schaffen mache, dass Marko so selten zuhause sei und sie sich alleine in der großen Anlage nicht wirklich wohl und dazu noch beobachtet fühle.
Schon als es ihr über die Lippen gekommen war, bereute sie, ihre Emotionen in die Runde getragen zu haben. Sofort entspann sich eine heiße Debatte zum Thema Männer und Beziehungen. Ausgangspunkt waren leider sie und Marko.
„Ich versteh dich gut“, Ingrid fiel sofort mit der Tür ins Haus „Du hast Angst, Marko könnte fremd gehen auf all seinen Geschäftsreisen. Ich meine, das ist schon merkwürdig, wie oft er weg ist. Und so wie er aussieht, kann er doch jede haben. Oder?“
„Besten Dank auch, Ingrid, dass du mich so aufmunterst. Ich sprach davon, dass ich mich allein in der großen Anlage unwohl fühle. Und nicht davon, dass ich Angst habe, dass Marko mich betrügt. Eigentlich habe ich etwas Unterstützung von dir erwartet.“ Jede wusste, das Ingrids Mann seine Frau wegen einer Stammkundin aus ihrer Gärtnerei verlassen hatte und mit selbiger nach Deutschland zurückgegangen und umgehend Vater eines kleinen Jungen geworden war. Niemand sprach darüber.
„Der meinige“, fiel Heidi sofort ins Wort, “ist so hässlich, da muss ich mir gar keine Sorgen machen, dass er fremd geht. Der Preis ist halt, dass du Ewigkeiten mit einem zwar netten, aber unattraktiven Mann zusammen bist. Ich hab mich halt dran gewöhnt. Er ist ja auch ein Lieber. Aber willst du das, Martina?“ Heidi war selbst auch keine Schönheit, aber so drastisch hatte sie sich bezüglich der Attraktivität ihres Gatten noch nie ausgedrückt. War da etwa was im Busche?
Ingrid, die mit ihrem gelben Lieferwagen von Markt zu Markt fuhr und ihre Pflanzen aus der eigenen Gärtnerei verkaufte, stöhnte. „Seid froh, dass ihr überhaupt einen habt. Ich stehe mit der Gärtnerei ganz alleine da und weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Pilates ist das einzige Freizeit-Vergnügen, das ich mir gönne. Ansonsten nur Arbeit, Arbeit, Arbeit.“
Da meldete sich Barbara zu Wort, mit 56 die älteste unter ihnen und die für gewöhnlich Schweigsamste, hielt sie sich doch aus fast allen Beziehungsgesprächen heraus. Heute aber mischte sie sich unverhofft ein. „Ihr tut so, als gäbe es immer nur Mann-Frau Geschichten. Vielleicht hat Marko ja einen Freund in London.“
Martina starrte Barbara entgeistert an. Melissa entwich ein Spontanes: „Das wüsste ich aber!“, worauf Martina auch sie anstarrte. Melissa bemühte sich umgehend, ihre schnelle Zunge im Zaum zu halten. „Ja, wer glaubt denn bei Marko an so was. Das müsste Martina ja wohl schon gemerkt haben.“
„Wieso“, entgegnete Barbara trocken. „Es gibt ja auch Menschen, die bi sind. Und manchmal ist alles anders als man denkt.“
„Si, das stimmt“, warf Antonia dazwischen. Die Brasilianerin war in zweiter Ehe mit einem deutschen Physiker verheiratet. Zusammen hatten sie fünf Kinder, die in der ganzen Welt verstreut lebten und wiederum Kinder bekamen – in England, in Thailand, in Brasilien, in der Ukraine und in Deutschland. „Es ist meist anders als man denkt“, wiederholte sie nachdenklich in ihrem portugiesisch gefärbten Deutsch. Sie war ständig damit beschäftigt, durch die Weltgeschichte zu düsen, um eines ihrer Enkelkinder aus dem Bauch der jeweiligen Mutter zu holen. Ihr Mann hatte das Bedürfnis nicht. Er schrieb unablässig an seinem Lebenswerk: „Der Klimawandel und die Selbstüberschätzung der Menschheit“ und war derzeit bei Kapitel 2 angelangt, während Antonia auf Koh Samui gerade noch ihrer Schwiegertochter Melina bei der Entbindung ihres sechsten Enkelkindes geholfen hatte. Erlebnisse, die sie der lockeren Pilates-Runde nicht zumuten wollte.
Barbara blieb bei ihrer Einschätzung. „Ich sage ja nicht, dass er bi oder schwul ist. Ich sage ja nur, es könnte eine Option sein. Ich finde es interessant, dass ihr so etwas gar nicht in Erwägung zieht.“ Barbara war seit 14 Jahren mit John liiert. Sie hatte sich eine florierende Agentur für Ferienhaus-Vermietungen aufgebaut. John war ein Säufer und neigte im betrunkenen Zustand zu Gewalttätigkeiten, von denen er am anderen Tag angeblich nichts mehr wusste. Und sie zog ihn seit Jahren mit durch. Das verstand niemand.
Barbara kannte Marko am längsten – noch aus den Anfängen in Portugal, wo sie sich ständig auf einer der angesagten Kiffer-Partys der Residenzler begegnet waren. Sie hatten auch zwei-, dreimal miteinander geschlafen, wie das so üblich war, damals, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Lange her. Martina wusste davon nichts. Dazu schwieg Barbara beharrlich, zumal ihr das damalige Motto „Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment“, heute eher peinlich war. Außerdem war ihr der Sponti-Spruch viel zu machomäßig; denn er bezog sich ja offenbar nur auf Männer, die mit Frauen schlafen – und nicht etwa umgekehrt. Wenn sie jemand fragen würde, mit wie vielen Männern sie denn geschlafen hätte, könnte sie beim besten Willen keine wahrheitsgemäße Antwort geben. Sie wusste es einfach nicht. Waren es 30, 40 oder 100? Heute hielt sich ihr sexuelles Verlangen nach Männern in übersichtlichen Grenzen. Mit John lief schon ewig nichts mehr. Sie fütterte ihn aus Mitleid mit durch und ertrug seine Ausraster, weil sie sich alleine langweilte.
Aktuell aber wendete sich das Blatt schlagartig. Barbara hatte sich in eine ihrer Mitarbeiterinnen verliebt. Zunächst war sie gar nicht darauf gekommen, dass es sich bei ihren Anwandlungen um Verliebtheitsgefühle handeln könnte – wohl, weil ihr das im Leben noch nicht passiert war. Sie hatte Sarah im Cantaloupe in Olhão kennengelernt und konnte den Blick nicht von ihrem sportlichen Körper lassen, der mit allerlei Tattoos Aufsehen erregte. Wie sie sich mit dem Tablett über dem Kopf durch die Reihen des Clubs schlängelte und mit ihrem kleinen Hintern wackelte.
Barbara hatte sie vom Fleck weg für einen horrenden Stundenlohn engagiert und ließ sich allerlei Marotten von ihr gefallen. Sarah kam zu spät, hatte den Schlüssel einer zu betreuenden Anlage verloren, flirtete mit Johns Tochter Casey und fütterte den Hund von Lady Heath wochenlang mit Katzenfutter, was dazu führte, dass diese wichtige Kundin die halbe englische Community gegen Barbaras Firma aufhetzte. Barbara blieb ruhig und erfreute sich daran, dass Sarah „Schwung in die Bude“ brachte. Als sie bemerkte, dass sie sich darüber hinaus in die smarte Lesbe verguckt hatte, war es zu spät.
Ihrem Damenkränzchen würde sie diese Wendung niemals anvertrauen. Da hätte sie sich gleich in Moncarapacho auf den Kirchplatz stellen und es lauthals heraus posaunen können.
„Das ist doch Quatsch“, sagte Melissa, mit 36 die jüngste in der Runde, kinderlos, derzeit ohne feste Beziehung, ein Dauerzustand, den sie ständig zu beenden suchte. Sie arbeitete im Sommer am Strand von Barril und massierte Badegäste unter einem weißen Baldachin. Sie war erst kürzlich dem Charme eines Portugiesen von der Life Guard Station erlegen, der sie dann aber umgehend mit einer hübschen Schwedin austauschte, der dann eine etwas ältere, aber gutbetuchte Dame aus England folgte. Dabei war Ronaldo mit seinen 38 Jahren auch nicht mehr der Jüngste und neigte zum Bauchansatz. Dennoch hatten diese braungebrannten Lebensretter immer einen Schlag bei den Mädels. Melissa würde sich eher die Zunge abbeißen, als diese Schmach ins Gespräch zu bringen. Und schon gar nicht würde sie offenbaren, dass sie vor Jahren ein Verhältnis mit Marko hatte. Zweimal war sie mit ihm in London gewesen und hatte sich binnen Kurzem dort gelangweilt. Eine oberflächliche und schmerzlose Angelegenheit.
„Wenn ich ehrlich bin“, und so begannen viele ihrer Statements, was dazu beitrug, ihr generell eher Unehrlichkeit zu unterstellen: „Ich würde Marko auch nicht von der Bettkante werfen. Ich meine, einen wie Marko, natürlich, nicht Marko jetzt, versteht mich nicht falsch, ich meine… so einen Typ wie… also, du weißt schon, was ich meine…!“
Martina stand auf. „Nein, weiß ich nicht!“, erwiderte sie genervt. „Ich geh jetzt lieber, sonst lass ich mich gleich scheiden!“
Als Martina von ihrer Pilates-Gruppe zurückkam, stand alles wie gewohnt an seinem Platz. Sie war einerseits erleichtert, andererseits kam ihr der Gedanke, ob das etwas mit der Abwesenheit von Marko zu tun haben könnte. Konnte es sein, dass Marko selbst...? Nein, sie verwarf den Gedanken sofort wieder.
Das verwirrende Gespräch mit ihren sogenannten Freundinnen hing ihr noch nach, während sie den Teig für Susannes Geburtstagskuchen knetete. Sie beschlich das Gefühl, dass einige der Mädels aus ihren Gefühlen eine Mördergrube machten. Jedenfalls waren sie alle derart heftig auf ihr Problem mit Marko angesprungen, dass sich dahinter mehr verbergen musste als Mitgefühl oder Neugier. Vor allem Barbaras Einwand zum Thema Bisexualität machte sie stutzig. Und Melissa, diese hinterhältige Ziege, konnte ihr künftig gestohlen bleiben.
Ihre Gedanken wanderten vom Damenkränzchen zu Marko und weiter zu Susanne, während sie die Mandeln im Mörser zerstieß und die Zitronenschale abrieb.
Erst seit dem Tod von Susannes Mann hatten sie sich wieder angenähert. Und auch dies nur ganz vorsichtig, um keine alten Wunden aufzureißen. Sofern die Ereignisse der Vergangenheit überhaupt zu kitten waren. Martina empfand die räumliche Nähe zu ihrer Schwester als beunruhigend. Jetzt, wo Marko verreist war, gab es vielleicht eine unverfänglichere Möglichkeit, ihrer Schwester zu begegnen. Vielleicht würde sie sie ja auch einmal in ihrem Haus besuchen. Das hatte Susanne bisher abgelehnt.
Und auch Martina war auf Distanz. Sie wusste um ihren Anteil an dem Zerwürfnis. Sie ging noch nach Jahren die Ereignisse von damals immer wieder in Gedanken durch.
Als sie den Kuchen aus dem Backofen holte und auf einem Kuchenteller umstülpte überlegte sie einmal mehr, ob es allein ihre Schuld war, dass es zu diesen ganzen furchtbaren Zerrüttungen zwischen ihr und ihrer Schwester gekommen war.
Hatte Susanne ihr eigentlich verziehen, dass sie ihr vor 18 Jahren den Mann ihres Lebens ausgespannt hatte?
***
LONDON
MARKO
Das Taxi am frühen Morgen war fast zu spät gekommen, weil es die Abfahrt von der Rue National nach Livrobranco verpasst hatte und erst im zweiten Anlauf in den Caminho do Salomé einbog. Dort verbarg sich hinter Canas- und Palmenhainen – etwas zurückgesetzt – ihre Quinta, früher ein alter, heruntergekommener Bauernhof, heute ein gepflegtes Anwesen mit Hauptgebäude und Nebenhäusern, Carport und einem großen Pool.
Im Taxi huschte noch schnell ein Gedanke an seine Frau durch seine Gehirnwindungen. Vermutlich hatte sie sich inzwischen aufgerappelt und einen ersten Espresso auf der Terrasse getrunken. Er verabschiedete sich innerlich von seinem Leben mit ihr und in Livrobranco und wechselte in die andere Welt. Seinen Flieger nach London erwischte er in letzter Minute.
Im Flugzeug spürte er wieder diesen Druck auf seiner Brust und bemühte sich, regelmäßig zu atmen. Den Flug verbrachte er in einem leicht nebulösen Zustand. Er konnte nicht schlafen, aber auch keinen klaren Gedanken fassen. So war es immer, wenn er sich in der Metamorphose, wie er es nannte, von hier nach dort befand. In der Umwandlung vom sortierten, kastrierten Ehemann im Larvenstadium zum lustvollen, selbstbestimmten Freigänger-Kater. Der Wechsel fiel ihm immer schwerer.
Marko stieg in Heathrow in die Bahn nach South Kensington, wo er wie üblich im teuren und sehr renommierten Hotel Rubens abstieg – und wie jedes Jahr auch nun wieder zur Map Fair, die in den Räumen der ehrwürdigen Royal Geographical Society stattfand. Die Messeräumlichkeiten befanden sich just around the corner in der Exhibition Road, hinter dem ungeheuer großen, ebenso altehrwürdigen Naturkundemuseum. Immer, wenn er hier war, besuchte er die nahe gelegene wunderbare Royal Albert Hall und gleich gegenüber den Kensington Garden mit dem in maßloses Gold getünchten Prinz Albert Memorial. Victoria möge ihm verzeihen – aber dieses übergroße Ehrenmal für ihren Gatten fand er furchtbar kitschig, ja geradezu lächerlich überhöht und er fragte sich, inwieweit tiefe Liebe zu solch überaus furchtbaren Ergebnissen führen konnte und ob dies zwangsläufig der Fall sein musste. Für ihn hatte diese Form der Liebe etwas Pathologisches.
Er genoss diese unverschämt teure Gegend mit ihrem blaublütigen Charme und dem überheblichen Prunk einerseits und dem jungen, internationalen Leben rund um die Metro-Station andererseits.
Er freute sich auf die Kollegen aus aller Herren Länder, schräge Vögel zum Teil, die mit ihren Karten, Grafiken und sonstigen Kunstwerken die heiligen Hallen füllten. Er freute sich auf die zu erwartenden Umsätze; denn er hatte ein paar sehr schöne Blätter im Gepäck, für die sich interessierte Käufer aus Übersee angemeldet hatten. Dennoch war er heute nicht allerbester Laune, als er in London ankam.
Das frühe Aufstehen, das ihm sonst keine Mühe machte, war ihm heute morgen nach dem Streit mit seiner Frau und einer unruhigen Nacht vergällt. Sie hatte sich schlafend gestellt als er das warme Bett verließ. Kein Abschiedskuss, keine Umarmung. Nicht, dass er darauf in letzter Zeit viel Wert gelegt hätte, aber Martinas Zuneigung und diese Rituale verschafften ihm eine gewisse Beruhigung, damit er, nun ja, seinen Interessen unbehelligt nachgehen konnte. Seine Geschäftstermine außerhalb dieses verschlafenen Nestes Livrobranco und weit weg von seiner ihn langweilenden Beziehung zu Martina waren längst die Leuchttürme in seinem Leben. Nichtsdestotrotz tat Martina ihm leid, und er hatte ein schlechtes Gewissen. Er hasste dieses diffuse Unwohlsein.
Vom Hotel aus rief er seine Frau an, um die Wogen zu glätten. Auch spürte er ein gewisses Unbehagen. Würde Susanne ihr kleines Geheimnis verraten? Noch ehe er unverfänglich danach fragen konnte, ob sie eine Begegnung mit ihrer Schwester plane, sprudelte es aus ihr heraus: „Es tut mir leid. Es war so ein blöder Abschied.“
Er sagte: „Ja, ganz blöd.“
„Wenn du nächste Woche nach Hause kommst“, lenkte sie ein, „hast du gute Geschäfte gemacht, und wir genießen das Wochenende. Ich bereite eine Caldeirada de Lulas, wir trinken einen gut gekühlten Vinho verde. Alles wie immer!“ Es klang etwas angestrengt in seinen Ohren.
Alles wie immer! Marko hatte das ungute Gefühl, dass es sich hier eher um einen frommen Wunsch handeln könnte. Alles wie immer! war keineswegs eine erstrebenswerte Perspektive für ihn. Er wollte nicht daran denken und schaltete vollständig um auf London.
Im Rubens war es düster, dunkle Wandvertäfelungen, Kopien alter Meister. „Herakles erlegt den nemeischen Löwen“, nach einem Rubens-Gemälde – eine dieser kraftstrotzenden, kreatürlichen Darbietungen, die er seit fast zwei Jahrzehnten neben alten Landkarten und seinen Karikaturen handelte und deren Ansicht er gleichermaßen liebte und hasste.
Niemals würde er sich so ein brachiales, pathetisches Meisterwerk an die eigenen vier Wände hängen – egal, ob als Kopie, Grafikdruck oder in Öl. Und schon gar nicht in sein Haus in Portugal. Es schauderte ihn bei dem Gedanken, dieses halbnackte symbolträchtige Muskelspiel im Kampf mit der wilden Natur und zur Erbauung der Götter täglich anschauen zu müssen. Schon im Vorbeigehen spürte er den Atem der Vergangenheit, fast der Verwesung. Von schweren, reich verzierten, goldenen Rahmen gehalten, die alle Inhalte zerschlagen und das eigene Erleben begrenzen. Diese Art Meisterwerke hängen an unpersönlichen Orten, die nur dazu dienen, das dick aufgetragene Öl zu verehren oder Besucher einzuschüchtern. Öl-Schinken. Wieso eigentlich Schinken?
Gleichzeitig war er sich seiner Ablehnung nicht sicher; natürlich konnte man die alten Meister nicht als unbedeutende Öl-Schinken abtun. Nicht zuletzt, weil er unter anderem damit sein bemerkenswertes Vermögen aufgebaut hatte. Aber rechtfertigten sie alles, was dem Original folgte? All die schlechten Kopien, gedruckten Plakate, Nachahmer-Werke, all den Schindluder, der mit ihnen getrieben, all die Verbrechen, die ihretwegen begangen wurden?
Beim Durchschreiten der Hotellobby und im Angesicht der zur Schau gestellten Männlichkeit – sowohl was den Halbgott als auch den Löwen betraf – erfasste ihn aber auch immer wieder ein leichtes Kribbeln an den Innenseiten seiner Oberschenkel. Und er beantwortete seine eigenen Fragen mit einem verschmitzten: „Ja!“ Das Rubens war schon immer Ort seiner wildesten Phantasien gewesen. Und bei Bedarf lebte er sie auch aus.
An der Rezeption begrüßte man ihn außerordentlich freundlich. „Welcome, Mr Kleinschmidt.“ Versehen mit diesem britischen Akzent klang sein, von ihm als unangenehm Deutsch empfundener Name geradezu weltmännisch. Schnell ging er weiter, fuhr mit dem Fahrstuhl in den 3. Stock und legte sich in voller Montur auf das Doppelbett seiner Suite. Sie war noch nicht da. Gott sei Dank. Er war komplett erschöpft, sein linker Arm schmerzte. Er fühlte sich den kommenden Anforderungen nur bedingt gewachsen. Gleichzeitig fieberte er seinen Phantasien entgegen und verfiel in unruhige Träume.
GESTERN_Vergessen
Wer die Geschichten hinter der Geschichte liebt.
Wie Marko, Susanne und Martina in Portugal landen.
BERLIN 1973
MARKO
Als er sein Zuhause verließ und über die Transitstrecke Richtung Hannover trampte, links und rechts die beunruhigende Ödnis der Deutschen Demokratischen Republik, durfte ihn niemand erwischen. Mit seinen 16 Jahren war er noch lange nicht volljährig. West-Berlin war Geschichte, lag schon weit hinter ihm, als er die Zonengrenze in Marienborn in den Westen nach Helmstedt passierte. Er wollte nur weg – weg von seiner Mutter, die er hasste, weil sie ihn hasste, so wie sie alle Männer hasste, inklusive seines Vaters, der sich im Kalten Krieg über die Mauer in den Osten von dannen gemacht hatte und wohl drüben gestorben war.
Viel mehr hatte sie ihm nicht über seinen Vater erzählt, nur noch, dass er Siegfried, kurz Siggi, geheißen hatte und ein „Sozi“ war. Er sei wie sein Vater – ein Hallodri. Das behauptete zumindest seine Mutter.
„Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!“, verkündete die zittrige Stimme eines alten Mannes an einem schönen Juni-Tag des Jahres 1961, als Siggi und Lotti mit ihrem kleinen Marko das erste Deutsch-Amerikanische Volksfest besuchten. Zwei Monate später trennte die Berliner Mauer Ost und West.
Kurz nach Ulbrichts Lüge und dem Mauerbau, der aus einer Stadt zwei machte, war Siggi Kleinschmidt weg, ohne ein Wort. Lotti Kleinschmidt, geborene Kürmann, schwieg beharrlich. Marko erinnerte sich nicht. Kein Geruch, keine Geste. Und doch hatte er ein gutes Gefühl, wenn er an diesen Mann dachte.
Lotti verdiente ihrer beider Unterhalt als Fotografin im Berliner Zoo, wo sie Kinder mit Löwenbabies auf dem Schoß porträtierte. Löwenbabies, die sie für 1000 Ostmark vom Leipziger Zoo kaufte und nach einem halben Jahr gegen 1000 Ostmark wieder in ein jüngeres tauschte. Und weil die Tierpfleger im Berliner Zoo kein gutes Händchen für Löwenbabies hatten, die friedlich und niedlich auf Kinderschößen Platz nehmen sollten, nahm Lotti die Babys hin und wieder mit nach Hause, setzte sie in den Laufstall von Marko und päppelte sie hoch. Marko wuchs in einer Wohnung auf, in der es beharrlich nach Löwenpisse stank. Als er klein war, schleppte sie ihn täglich mit in den Zoo. Und was andere Kinder ersehnten, verbreitete in ihm gähnende Langeweile. Lieber wäre er auf den Bolzplatz am Fehrbelliner gegangen oder zum Herumstreunen im Volkspark, anstatt seine Mutter in den Zoo zu begleiten, wo sie fremde Kinder und ihre Löwenbabys ablichtete, während er seine Hausaufgaben im stinkenden Raubtierhaus machen musste. Er hatte das Gefühl, die Löwenbabys waren ihr wichtiger als er.
Seine Mutter war eine fleißige Kirchgängerin, Gott weiß, warum. Er saß im Kindergottesdienst und hörte, wie der Pfarrer sonntags verkündete: „Herr, ich werde eingehen unter deinem Dach!“ Warum sagt der so was Blödes. Wer will schon eingehen. Er hörte sich das ein paar Mal an und ging dann nie wieder in die Kirche.
Seine Mutter zeigte ihm keine Gefühle. Manchmal schlug sie ihn. Sie schimpfte ihn spöttisch einen Versager, wenn er schlechte Noten nach Hause brachte. Sie nannte ihn verächtlich einen Bruder Leichtfuß, wenn er mit seinen Kumpels um die Häuser zog, die Nächte durchmachte und ihn die Polizei aufgriff, weil er erst 13 Jahre alt war.
Einmal kramte er heimlich in einer ihrer Foto-Schatullen. Er entdeckte ein Foto, wie er als kleiner Steppke an einem alten VW-Käfer lehnte, an seiner Seite ein Mann mit Schiebermütze und Bollerhose. Sein Vater Siggi. Er steckte das Foto ein.
Er fand ein anderes Schwarz-Weiß-Foto zwischen zahllosen Trümmermotiven. Ein nacktes Baby bäuchlings auf einem Schaffell, das in die Kamera strahlte. Auf der Rückseite stand gekritzelt: „Da liegt es, das Schwein!“ War er auf dem Foto zu sehen? Marko zerknüllte das Bild und warf es in den Müll.
Sie verweigerte ihm das ohnehin magere Taschengeld, verhängte Hausarrest und konnte ihn doch nicht halten. Er war nun stärker als sie und hatte keinen Respekt. Er rächte sich an ihr mit Missachtung. Schon mit 13 kam und ging er, wann er wollte und verdiente sich sein Geld mit kleinen Haschisch-Deals, fing das Zocken in Hinterzimmern am Stuttgarter Platz an und klaute hier und da eine Geldbörse, wenn es sich ergab. Erwischt wurde er nie.
Seiner Mutter aber stahl er nie Geld. Das war die einzige Anerkennung, die er ihr zollte; denn er akzeptierte, dass sie allein und selbstständig das Geld für ihrer beider Leben verdiente. Immerhin hatte er in der Schöneberger Altbauwohnung sein eigenes Zimmer. Sie wohnten Parterre, halbe Treppe links. Er konnte nachts bequem aus dem Fenster in den Hinterhof klettern und mit seinen Kumpels durch die Westcity ziehen. Berlin – Stadt ohne Sperrstunde. Bahnhof Zoo war Treffpunkt, lange bevor die Kinder vom Bahnhof Zoo seltsame Berühmtheit erlangten. Er kannte die Typen alle, gehörte aber nicht wirklich dazu. Er war kein Stricher, kein Junkie und auch nicht wirklich ein Dealer oder ein Dieb. Er hörte RIAS Berlin und sah die letzten Ausgaben vom Beat Club mit den Kinks und Johnny Cash. David Bowie, Led Zeppelin und Pink Floyd waren seine Helden.
Für all die vielen jungen Westbürger, die in den Siebzigern nach Westberlin kamen, weil sie in der fest umschlossenen Mauerstadt die Freiheit witterten, weil sie die Bundeswehr ablehnten oder weil sie die Emanzipation und den Aufstand gegen das Establishment feiern wollten, hatte er nur Verachtung übrig. „Ton, Steine Scherben“ und „Keine Macht für niemand!“ verstand er erst Jahre später. Ihn beschäftigte der gegenteilige Gedanke: Bloß weg hier, weg aus dem Dreck, aus dem Schöneberger Kiez, aus der Mauerstadt, raus aus der Umzingelung von Amis, Engländern, Franzosen und Russen. Und vor allem: weg von seiner Mutter und all dem Mief, der sie umgab. Endlich frei sein! School is over!
Er trampte von Dreilinden. Transitautobahn nach Helmstedt. Dann Hamburg. Ein heißer Tipp brachte ihn nach Altona, in die berüchtigte Villa Blanke Neese, Umschlagplatz für Drogen jeder Art, alle Etagen belegt mit Hippies, Freaks, Kommunarden, Linken. Männern wie Frauen. Freie Liebe vom Keller, wo die Drogisten hockten und er bei Jens und Winni wohnen durfte, bis hin zum Dachgeschoss, wo die gutbetuchten Hanseaten-Söhne und -Töchter eine Koks-Party nach der anderen feierten. Ein Paradies, in das Marko freundlich aufgenommen wurde, weil er leidlich Gitarre spielte und sich als Drogenkurier Verdienste erwarb. Alte Schule West-Berlin. Leider wurden Jens, Winni und die Kollegen bei einer Razzia mit einem Kilo Rohopium erwischt, die Koksnasen aus den oberen Etagen waren rechtzeitig gewarnt worden und die Mittelschicht hatte nur Haschisch und Pillen zum Eigenbedarf dabei.
Als Marko im Morgengrauen von seinem Kurierdienst zurückkam, konnte er nicht einmal mehr sein spärliches Hab und Gut retten. Die Villa Blanke Neese war von Polizisten umzingelt. Er verschwand mitsamt der lukrativen nächtlichen Einnahmen Richtung Mittagssonne
***
Nach einer Irrfahrt durch Südeuropa – immer am Rande der Gesellschaft und der Legalität unterwegs, mit schwulen Männern, die heimlich und illegal Begleitung suchten, mit zugedröhnten Jungs, die auf dem Weg nach Marokko in Italien hängen geblieben waren, mit lauten Emanzen und besorgten Sozialarbeiterpärchen – landete er eines schönen Tages in Lissabon am Bahnhof Santa Apolónia am Tejo.
Eigentlich war er die ganze Zeit auf der Flucht gewesen, auch weil er noch immer nicht volljährig war, sich mit kleinen kriminellen Aktionen über Wasser halten musste und stets auf der Suche nach einem Schlafplatz war. In Rimini bei einem schwulen Hotelbesitzer auf dem Sofa, auf der französischen Nudisten-Insel Ile du Levant im geliehenen Zelt, im Hauptbahnhof in Marseille in einem übergroßen Schließfach und in Barcelona im Schlafsack am Strand.
Lisboa dann – das war seine Stadt! Er liebte die Portugiesen vom Tag seiner Ankunft an. Denen war es gerade gelungen, sich von alten Fesseln zu befreien und die Revolution zu besingen. Musik! Das war Seins. Man stelle sich vor: Der portugiesische Beitrag zum Eurovision Song Contest war das erste verabredete Geheimsignal an die aufständischen Truppen zum Beginn des Staatsstreichs! Der portugiesische Rundfunk hatte ein Liebeslied von Paulo de Carvallo gesendet: „Du kamst in Blumen gekleidet, ich habe dich entblättert.“ Einfach genial! Westeuropas älteste Diktatur gestürzt! Eine bessere Welt schien sich hier aufzutun – mit viel Wein, Weib und Gesang und natürlich einer Nelke im Knopfloch und der Revolution im Schritt. Und einer Menge junger Menschen, die von überall her in die Stadt strömten, sehr gerne kifften und immer neuen Nachschub brauchten.
Da lernte er Paul kennen, den Engländer. Marko gab ihm den Spitznamen Epi-Paul, so wie er es aus dem Zocker-Milieu in Berlin kannte. Da hatten alle rotlichtigen Gestalten Spitznamen, je nach dem, was sie besonders kennzeichnete. Epi-Paul war Epileptiker. Das wussten alle. Man munkelte, er könne keinen richtigen Sex haben, weil er dann Gefahr liefe, einen Anfall zu bekommen. Marko war das egal. Epi-Paul führte ihn in die Musik-Szene im Bairro Alto ein. Das allein zählte.
Marko fragte sich, warum die Deutschen das Ende ihrer Nazi-Diktatur eigentlich nicht ebenso gefeiert hatten, wie die Portugiesen das Ende ihrer Diktatur – einmal abgesehen davon, dass er sich nicht vorstellen konnte, dass seine Mutter irgendetwas jemals hätte feiern können. Nicht einmal seine Geburtstage hatte er dies bezüglich in Erinnerung. Meistens waren sie nach einer Curry-Wurst am Ku’damm im Kino gelandet. Er wollte das Ganze mit Epi-Paul besprechen.
„What a question!“ Epi-Paul schüttelte seine spärlichen Fransen und kämmte sie mit gespreizten Fingern über den Kopf, wobei er selbigen bedeutend in den Nacken warf. „You are really too young. Nazi-Deutschland hat einen Vernichtungskrieg gegen uns geführt. Und verloren. Your fucking Nazi-Volk ist nicht aufgestanden gegen seine Diktatur. Wir haben Nazi-Deutschland besiegt und euch befreit. Das solltest du eigentlich wissen, you stripling. Befreit, verstehst du? Ich glaube, die meisten Deutschen haben gar nicht mal gemerkt, dass wir sie von dem schlimmsten Diktator aller Zeiten befreit haben – und das, nachdem sie Tausende von uns umgebracht haben. Sei froh, Bürschchen, dass ich überhaupt mit dir rede!“
So einen Schwall an Worten war er von Epi-Paul nicht gewohnt, und er hatte nicht alles verstanden. Aber eins war klar: Das war kein gutes Thema. Marko hielt fortan den Mund in dieser Angelegenheit. Er hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass das sein Krieg und sein Verschulden gewesen war. Epi-Paul sah das offenbar anders. Er gehörte ja auch zu den Gewinnern. Marko wollte mit Nazis, Adenauer und Wirtschaftswunder nichts zu tun haben. Das war die Welt seiner Mutter.
Er widmete sich wieder der Musik-Szene in Lissabon.
Marko begeisterte sich für die Live-Musik in den Bars, vergötterte die Guitarristas – nicht die, die den traditionellen klagenden Fado begleiteten, sondern jene, die dem Rock Unsterblichkeit verliehen, die, die Neil Young und Hendrix, die Doors und die Stones spielten, manchmal besser als die Originale. Aber auch die, die die Songs von Leonard Cohen, Cat Stevens und vor allem Dylan, dessen Protestsongs so gut in die Stimmung passten, durch die verrauchten Kneipen trugen. Die Stadt kochte, alles roch noch nach Nelken. Die Sozialisten verhießen einen fantastischen Neuanfang. Die linke Jugend Europas tanzte in den engen Gassen der von den Faschisten befreiten, überfüllten Hafenstadt.
Einer von denen, die Marko verehrte, war Domingo, ein begnadeter Gitarrist und Sänger mit einer Stimme, die Robert Plant von Led Zeppelin alle Ehre machte, und einer Gitarre, die an Eric Clapton erinnerte. Domingo hatte eine Frau, Glory. Glory war eine Sensation. Sie, gut 20 Jahre älter als Marko, war eine Schönheit aus Mozambique. Marko traute seinen Augen nicht. Trug sie wirklich ein aus großen bunten Blumen gehäkeltes, sehr grobmaschiges Kleid mit nichts als einem Slip darunter?
Glory sah sofort, dass der blonde, wasserblauäugige, dürre Kerl aus Alemanha noch Jungfrau und ein herrliches Spielzeug war, von dem keinerlei Gefahr ausging, mit dem sie aber umso mehr Spaß haben würde. Er behauptete, er sei jetzt volljährig. Sie lachte nur. Ta bom. Não faz mal!
Glory flirtete mit dem jungen Fan ihres Mannes vom ersten Moment an, machte sich lustig über ihn, seine Skrupel, Domingo anzusprechen. Und foppte ihn wegen seiner sexuellen Unschuld und seiner Unerfahrenheit im Umgang mit Frauen. Marko zog es jeden Abend magisch zu Glory und Domingo und er wusste nicht, wen er nach dem Genuss eines Joints mehr anstarrte. Er hatte noch nie mit einer Frau geschlafen, hatte nur am Bahnhof Zoo oder auf seiner Reise an irgendwelchen Männern herumgefingert, die ihm dafür ein paar Mark, Franc, Lire, Peseten oder eine Unterkunft gegeben hatten. Er selbst empfand dabei nichts, es war ihm eher zuwider.
Glory hingegen war die verbotene Frucht, deren Geruch ihn schwindelig machte. Er musste sie nur anschauen, ihre braune, schimmernde Haut, die vollen Lippen, die prallen Brüste und ihren gigantischen Hintern, dann bekam er einen Ständer, den er nur mit Mühe und unter Zuhilfenahme eines Tischtuches, seines Palästinenserschals oder irgendwelcher anderer Gegenstände verbergen konnte. Heiliger Strohsack! Was für Wallungen, welche Begierde. Er war dauerbekifft und begeistert. Nur einmal, Glory. Lass mich nur einmal ran und spüren, ob dein Anblick hält, was er verspricht. Mir ist alles egal, und wenn mich Domingo danach auch mit seiner tiefen E-Seite stranguliert oder mir mit dem Mikro-Ständer den Schwanz abhaut. Glory, Glory, ich will nur dich, in dir versinken, dich stoßen, mich auflösen und dann sterben!
Und so war es dann auch. Glory ließ keinen Wunsch offen. Es störte ihn nicht einmal, als er plötzlich ihre schwarze Lockenperücke in seinen Händen hielt und Glorys krauses, fransiges Kurzhaar über ihm erschien. Sie schrie auf, riss ihm das Teil aus den Händen und setzte es sich wieder auf, während sie weiter rhythmisch auf ihm herum ritt. Und als ihr Mann auf der Bühne „No woman, no cry“ intonierte, stöhnte Glory in den höchsten Tönen und erlöste Marko von seiner schmerzhaften Begierde – kurzfristig. Denn am nächsten Abend stand er wieder breitbeinig und hungrig vor ihr und konnte kaum erwarten, dass Glory ihn auf ihr Bett zerrte, zu den Klängen von Domingos Band, die Parterre in der Rua do Rosa „Love Like a Man“ von Ten Years After spielte.
So hatte sich Marko die Freiheit vorgestellt. Genau so!
***
1982 - 1993
SUSANNE
Susanne hatte schon als kleines Mädchen von Piraten und Seefahrern, vom weiten Meer und Delphinen, von hohen Wellen und sich blähenden Segeln geträumt. Auf dem Weg zur Schule und zurück nach Hause war sie glücklich, wenn sie alleine gehen konnte, niemand sie begleitete. Sie schwamm in einem Meer von Geschichten, spürte salziges Wasser auf ihrer Haut und tanzte durch den Regen bis sie klitschnass zu Hause ankam, wo sie von ihrer Schwester beschimpft wurde, weil alle mit dem Mittagessen auf sie warteten.
Niemand aus ihrer schwäbischen Familie hatte je etwas mit dem Meer zu tun gehabt und keiner wusste von ihrer Sehnsucht, außer natürlich Fräulein Hof aus der Schulbücherei. Die mochte das blonde Mädchen mit den braunen Kulleraugen. Alle Bibliothekare mögen Kinder, die in den Büchern nicht nur lesen, sondern auch in ihnen verschwinden. Die etwas pummelige Susanne war so eins. Fräulein Hof hielt oft einen Leckerbissen aus dem Genre der Seefahrt für sie bereit und lernte dabei selbst auch eine Menge über ihr Steckenpferd, den afrikanischen Kontinent.
Als kleines Mädchen schon liebte Susanne die Meerjungfrau Sursulapitschi, die im Barbarischen Meer Jim Knopf und Lukas den Lokomotivführer bat, das Meeresleuchten zu reparieren. Jim war ein schwarzer Junge, vielleicht kam er aus Afrika. Ein tapferer kleiner Held mit einem großen starken Freund, die die gefährlichen Meere und die Wilde 13 nicht scheuten, um den Schwachen zu helfen.
Später durchlebte sie mit Robinson Crusoe dessen Schiffbruch und segelte mit Thor Heyerdal auf seinem Floß Kon-Tiki von Lima aus über den Pazifik. Sie kannte alle Filme und Geschichten, die sich um Sir Francis Drake, den Piraten der englischen Königin, drehten und lag im karibischen Meer anstelle von Consuelo in den Armen des Piraten Vallo in „Der rote Korsar“. Die armselige Geschichte der Seeräuber-Jenny überzeugte sie nicht. Als Dienstmagd, die nur davon träumte, von Piraten gerettet zu werden, wollte sie auf gar keinen Fall enden.
Mit 15 mühte sie sich durch den Wälzer von Stefan Zweig „Der Magellan“. Und auch, wenn ihr seine Sprache schwer verständlich erschien, so schraubte sich die Seefahrergeschichte in ihre Phantasiewelt. Sie segelte mit Fernão de Magalhães und erlitt alle Leiden dieses eigentümlichen Portugiesen, der für den spanischen König auf Reisen ging, weil ihn sein portugiesischer Herrscher abgewiesen hatte und der – nachdem er als erster Mensch die Welt umsegelt hatte – völlig unspektakulär von seinen Feinden niedergestreckt wurde. Susanne war entsetzt. Wie konnte dieser Held einfach so sterben, sich aus ihrer Geschichte davon stehlen, ohne ein ruhmreiches Ende gefunden zu haben. Er hatte nicht einmal mehr selbst erlebt, dass die von ihm entdeckte Meeres-Durchfahrt nach ihm benannt wurde. Sir Francis Drake versuchte sich an jener Stelle ein halbes Jahrhundert später und ging von dort aus auf Plünderungsfahrt – da schloss sich der Kreis ihrer Helden, mit denen Susanne auf Kaperfahrt ging. Jan und Claas und Hein und Pit Pit Pit...
Aber niemand konnte in Susannes Welt einer einzigen Seefahrerin das Wasser reichen: Anne Bonny. Susanne erfuhr von dieser jungen Frau auf verschlungenen Pfaden. Fräulein Hof empfahl dem jungen Mädchen, das so oft in ihrer Bücherei saß, während ihre Mitschüler über Rechenaufgaben brüteten oder den Erlkönig auswendig lernten, ein schmales Büchlein mit echten Piratengeschichten. Es enthielt ein Kapitel über Anne Bonny, in das sich Susanne vertiefte. Das war ihr Idol! My Bonny is over the ocean... das Mädchen, das um 1690 in Irland geboren und wohl nur 30 Jahre alt wurde. Sie war eine echte Piratin in der Karibik. Ihr Leben war weit tragischer und aufregender als das der hübschen Gespielinnen von Filmpiraten.
Susanne und sie verband ein geheimes Schicksal.
ANNE
Anne war das uneheliche Kind von William Cormac, einem angesehenen, verheirateten Juristen und seiner Dienstmagd Mary. Ein uneheliches Kind war eine schwere Sünde. Deshalb steckte Annes Vater seine Tochter in Jungenkleider und gab sie als entfernten Verwandten aus. Seine Frau aber roch den Braten und obwohl sie sich damit ins eigene Fleisch schnitt, verkündete sie überall, dass ihr Mann ein uneheliches Kind hatte. Damit nahm seine Karriere in Irland ein ruhmloses Ende. Die Familie mitsamt Anne schiffte in die britischen Kolonien Amerikas. In North Carolina brachte es der Vater als Plantagenbesitzer wieder zu einigem Reichtum.
Anne zog es an den nahe gelegenen Hafen in Charleston. Sie lernte den Abenteurer und Seemann James Bonny kennen und heiratete ihn. Zum Zeichen ihrer Liebe ließen sich beide eine Creole ins rechte Ohr stechen, in die ihre Namen und das Datum ihrer Hochzeit eingraviert waren.
Ihr Vater verstieß Anne wegen der Liaison, weswegen sie angeblich seine Plantage niederbrannte. Susanne jubelte innerlich bei der Vorstellung. Welch eine grandiose Tat! Besser konnte sie sich kaum an ihrem Vater rächen, der sie verleugnet und verraten hatte, anstatt sie zu lieben und zu unterstützen. Susanne wünschte, sie wäre auch so mutig.
Mit ihrem Mann schiffte sich Anne nach New Providence, das heutige Nassau, ein, der Hauptstadt der Piraten, wo sie ihren Mann für den Piraten Calica Jack Rackham verließ und mit ihm auf Charles Vanes Schiff anheuerte, auf dem Rackham Steuermann war. Weil Frauen an Bord von Piratenschiffen nicht gern gesehen waren, verkleidete sie sich wieder als Mann. Sie kämpfte geschickt, doch sie wurde entdeckt.
In New Providence heuerte ein neuer Mann, Mark Read, auf dem Schiff an, das inzwischen Anne und Rackham gehörte, denn die beiden hatten Charles Vane erst ab- und dann ausgesetzt. Anne warf ein Auge auf den feschen Piraten. Bei näherer Betrachtung stellte sich jedoch heraus, dass es sich ebenfalls um eine Frau handelte: Mary Read. Zu dritt segelten die beiden Frauen und Calico Jack nun kapernd, plündernd und mordend durch die Karibik und waren als Team berüchtigt und gefürchtet.
Zwischenzeitlich wurde Anne von Calico Jack schwanger. Sie bekam das Kind auf Kuba und ließ es dort zurück. Später wurde Rackhams Schiff, die Revenge, von einem englischen Kriegsschiff angegriffen. Die Schiffsbesatzung – abgesehen von den beiden Frauen – war betrunken und versteckte sich unter Deck. Anne Bonny und Mary Read kämpften alleine. Sie wurden überwältigt.
Das Urteil für Jack, Anne, Mary und die Crew lautete: Tod durch den Strang. Am Tage der Hinrichtung wollte Rackham Anne noch einmal sehen. Sie antwortete: “I’m sorry to see you here, Jack, but if you’d fought like a man, you wouldn’t need to hang like a dog.”
Die Hinrichtung der beiden Frauen wurde aufgeschoben, da beide schwanger waren. Mary Read starb an einem Fieber, über Anne Bonnys weiteres Leben konnte Susanne nicht einmal mit der Hilfe von Fräulein Hof etwas in Erfahrung bringen.
Susanne schlüpfte in die Haut ihrer Heldin, verzichtete nun einige Zeit auf die drei ersten Buchstaben in ihrem Namen und nannte sich Anne. Vielleicht war sie kein uneheliches Kind, wer weiß, aber nicht dazugehörig fühlte sie sich allemal. War es nicht seit ihrer Geburt so gewesen, dass eine Art Fluch auf ihr lastete? Trug sie nicht die Schuld an der Krankheit ihrer Mutter, von der alle sagten, sie sei „lebensmüde“. War nicht immer dieser stumme Vorwurf an Susanne spürbar? Und hatten nicht auch alle anderen Familienmitglieder ein viel schlimmeres Leben seit ihrer Geburt? Der Vater, der wegen ihr nun keine richtige Frau mehr hatte und deshalb oft zu Susanne ins Bett kam, damit sie ihn trösten solle? Martina, die an Mutters statt nun die Verantwortung für die ganze Familie übernehmen musste? Ihr Bruder Dirk, dem die ordnende Hand der Mutter fehlte, der dagegen die Hand des Vater oft zu spüren bekam? Dirk, der ihr deshalb nachstellte und die kleinere Susanne „hässliches Entlein“ schimpfte?
Nein, Susanne war ihrer Familie nur eine Last und wünschte sich in ihren Träumen weit, weit weg. Over the sea and far away. Sie sah ihr Elternhaus in Flammen aufgehen, aus den Fenstern schrien verlorene Seelen um Hilfe.





























