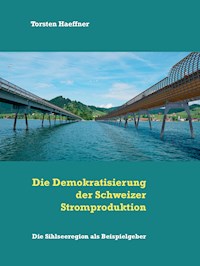
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Strom ist der «Sauerstoff» der Wirtschaft, der allgemeinen Infrastrukturen und des Lebens schlechthin. Umso wichtiger ist eine hohe Stromversorgungssicherheit. Doch diese ist in Gefahr. Alpiq-Chef Jens Alder in Anbetracht der volatilen Versorgungslage: «Als Staatsbürger kann man nicht ruhig schlafen ...» Woher kommt der Strom, wenn in Europa zusehends alle Kernkraft- und Kohlekraftwerke abgeschaltet und Energiewenden übers Knie gebrochen werden? Das vorliegende, spannend und leicht zu lesende Buch beschreibt anhand der Sihlseeregion: Schon seit jeher nahmen die Bewohner dieses Hochtals die Energieversorgung selbst in die Hand. Diese urdemokratische Tradition und neueste technologische Entwicklungen erweisen sich auch heute als hochinnovativer Königsweg. Einmal mehr zeigt sich: Die Unabhängigkeit der Schweizer Stromversorgung und die eigene Versorgungssicherheit sollte jedem Bürger am Herzen liegen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Die Demokratisierung der Schweizer Stromproduktion
DankAlpen-TraumGrossrisiko – und eine kurze Reise in den SenegalVorteil SenegalRisikofaktor EnergiewendeBlackout – Was ist zu tun?BürgerkraftwerkeBraunes GoldBlaues GlückEin neuer StreitDezentralisierung«Wer hat, der gibt. Wer braucht, der bezieht.»ImpressumDank
Das vorliegende Buch ist Resultat des Forschungsprojektes «Our Energy Challenge» des Lehrstuhls für Informationsarchitektur an der ETH Zürich. Das von Prof. Dr. Gerhard Schmitt geleitete Projekt wurde u.a. von der Irène und Max Gsell Stiftung, Bern, gefördert. Allen an diesem Projekt Beteiligten, Prof. Dr. Gerhard Schmitt und den Stiftern sei auf diesem Wege ganz herzlich gedankt.
Torsten Haeffner, im März 2020
Alpen-Traum
Der Stillstand der Welt kommt aus heiterem Himmel und zu unpassendster Zeit. Es ist Samstag. Im Hochwinter. Mitten im Februar. Ferienzeit. Strahlendes Wetter und Eiseskälte herrschen auf dem Kitzsteinhorn-Gletscher. Der «Bettenwechsel» steht in der nahe Salzburg gelegenen Tourismusregion Pinzgau an. Will heissen: Tausende Touristen reisen an diesem Tag ab, und wiederum Tausende Erholungshungrige treffen ein. Das führt oft zu kilometerlangen Staus, die hart an den Nerven der ab- wie anreisenden Gäste zehren. Auf den weitläufigen und malerisch gelegenen Pisten der Region vergnügen sich derweil wiederum etliche Skifahrer, vor allem auf dem Kitzsteinhorn-Gletscher, einem der schönsten Skigebiete Österreichs. Es sind Tagestouristen, Einheimische zumeist. Auch Angestellte der umliegenden Hotels und Gaststättenbetriebe sind darunter. Sie geniessen es, an diesem etwas ruhigeren Wintertag auf den weitläufigen Pisten ihrem Lieblingssport zu frönen, ohne lange Wartezeiten an den Liften und Seilbahnen in Kauf nehmen zu müssen. Auch in den an anderen Tagen oft überbelegten Bergrestaurants ist die Lage entspannt. Das Bedienpersonal zeigt sich noch freundlicher als sonst und meist ist schnell ein freier Tisch zu finden.
Wer von der Gipfelstation des Kapruner Kitzsteinhorns auf 3029 Metern Höhe startet und bis zum Langwiedboden (1976 Meter) mit den Skiern hinabfährt, erlebt auf dieser 5,6 Kilometer langen Abfahrt einen unglaublichen Freiheitsrausch! Siebeneinhalb Minuten braucht für diese Strecke, wer es eilig oder gerne schnell hat. Aber vielleicht nimmt man es auch etwas gemütlicher, hält mal hier, mal dort am Pistenrand, um sich am Schönen zu erfreuen, an diesem unglaublichen Ausblick auf ein Bergparadies, das seinesgleichen sucht. Bei «Kaiserwetter» kann man schliesslich bis zu zweihundert Kilometer weit sehen. Und weit, weit weg vom Alltag ist man auch hier oben. Der Blick auf die umliegenden Beinahe-Viertausender, diese sagenhafte Bergwelt in staubfreier Höhe, lassen einen alles vergessen: die daheim gelassenen Sorgen ebenso wie den demnächst wieder zu erwartenden Ärger am Arbeitsplatz. Täuscht der Eindruck, oder stimmt es wirklich, dass der Mensch in diesen Höhen, in diesem scheinbar grenzenlosen Schneeparadies ein anderer wird?
Natürlich, es gibt die Pistenrowdys, die es – rücksichtslos – allen zeigen müssen, und es gibt die Gedankenlosen, die ohne umzuschauen mitten auf der Piste abrupte Richtungswechsel vornehmen. Aber die Mehrheit der Skifahrer ist entspannt, fröhlich, unbesorgt und nimmt Rücksicht auch auf die vielleicht unerfahrenen oder unsicheren Wintersportler. An einem Tag wie diesem kann man es auf dieser Traumpiste jedoch auch einmal so richtig laufen lassen, in weiten Bögen den Hang hinabgleiten. Herrlich. Oder gar Schuss fahren! Die Masse verteilt sich, und die Piste ist streckenweise breiter als eine vierspurige Autobahn. Steht doch einmal eine kleine Gruppe mitten auf der Piste, kann man sie weiträumig umfahren, ohne das Tempo drosseln zu müssen. Unvorsichtig oder gar leichtsinnig sollte man aber auch nicht werden. Es gibt auf dieser als mittelschwer gekennzeichneten Abfahrt auch heikle Stellen, die Konzentration, Umsicht und Kondition erfordern.
Wem diese Traumstrecke nicht anspruchsvoll genug ist, der wechselt auf die «Black Mamba». Auf der gerade mal eintausend Meter langen Abfahrt «vernichtet» man 290 Höhenmeter in sagenhaften zweieinhalb Minuten. Ein Adrenalin-Zauber pur. Bis zu 63 Prozent beträgt die Steigung. Ja, die schwarze Piste 14 ist ein richtig giftiger Hang, nur eben ein leider etwas kurzes Vergnügen. Aber der Tag ist ja lang, und niemand hindert einen daran, der «Black Mamba» in mehreren Abfahrten den Schrecken zu nehmen. Zwischendrin eine meditative Erholungspause: Bei einer Inversionswetterlage ist die Freiheit hier oben tatsächlich grenzenlos. Man ist über den Wolken, wähnt sich vom Glück getragen. Dieses Weisse und Weite, dieses Reine und Makellose: So muss das Paradies sein!
Freilich, kalt ist es schon hier oben. Passiert man im Schatten liegende Stellen, die von der Vormittagssonne noch nicht erreicht werden, herrscht augenblicklich klirrende Kälte. Minus 11 Grad; und das am späten Vormittag. Man mag sich nicht ausdenken, welche Temperaturen hier in der Nacht herrschen, und in manch ängstlicher Natur mögen Geschichten und Bilder aufsteigen, von gehörten Ereignissen: Ein schon betagter Skisportler, so war vor etlichen Jahren zu lesen, soll abseits der Piste wegen einer plötzlichen Herzschwäche unglücklich gestürzt sein. Er blieb den Tag über unbemerkt, aber am Leben dank der wärmenden Sonne; nachts dann erfror er bei minus 32 Grad. Gut, das ist Jahre her und zu der Zeit gab’s noch keine Mobiltelefone. Heute schon. Ausserdem kann hier oben nichts passieren; es sind genügend andere Skifahrer unterwegs, zudem werden die Pisten permanent überwacht.
Noch eine Abfahrt, dann geht’s zum Mittagessen auf die Häuslalm. Pinzgauer Spezialitäten gibt es dort und angeblich den besten Kaiserschmarrn Österreichs. Den könnte man auch draussen auf der sonnenbeschienenen Terrasse zu sich nehmen, dazu einen Kaffee, anschliessend eine viertel Stunde Sonnenbad und dann noch ein, zwei Abfahrten, um schliesslich gegen halb vier ins Tal aufzubrechen. Dann hat’s in der Kabinenbahn nicht so viele Leute. Die Sonne ist schon recht kräftig im Februar. Zumindest hier oben. Und dieser Himmel! So ein Blau hat’s im Tal nie und in der Stadt schon gar nicht. So etwas sollte man sich öfters gönnen.
Wäre diese Schilderung für ein Drehbuch gedacht, für einen vielleicht etwas kitschigen, in jedem Fall aber bezaubernden Film über diese wunderbare Welt der Berge, dann würde der Autor jetzt eine kurze Regieanweisung schreiben: «Musikalische Untermalung – ‹Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung› von James Last», würde da stehen. Diese Musik passt, weil sie – wie diese zauberhafte Hochgebirgslandschaft – etwas Versöhnliches hat, etwas absolut Friedfertiges, ein längst verloren gegangenes Urvertrauen wieder wachwerden und ein Gefühl der Geborgenheit aufkommen lässt, wie man es im Alltag nur selten verspürt. Doch dies ist kein Drehbuch für einen bezaubernden Film, weswegen zu den bald eintretenden Ereignissen auch eher die Themenmelodie von «Der weisse Hai» passt. Der kurz gestrichenen Kontrabässe wegen, die in mehreren Sequenzen immer nur zwei Töne spielen, scharf getaktet, mit harten Akzenten, das bevorstehende Unheil gnadenlos ankündigen. Ganz ohne jedes Legato. Denn unser sonnengeflutetes Bergidyll wird gleich jäh gestört.
Wie gesagt: Wegen des Bettenwechsels sind an diesem Tag weniger Skifahrer als sonst auf dem Kitzsteinhorn-Gletscher unterwegs. Aber bis elf Uhr vormittags wurden immerhin 10200 Liftkarten verkauft, weitere 500 bis 800 Skifahrer, so die Schätzung der erfahrenen Lift- und Bahnbetreiber, dürften am frühen Nachmittag noch hinzukommen. Das heisst: Hier ist eine Kleinstadt unterwegs. Und die Bürger dieser imaginären Kleinstadt werden nun etwas erleben, was sie sich in ihren schlimmsten Vorstellungen nie auszumalen wagten.
Punkt drei Uhr nachmittags bricht das Stromnetz im Pinzgau zusammen. Ein Blackout. Niemand ahnt: Die Tage werden schrecklich sein, bis die Stromversorgung wieder halbwegs hergestellt werden kann. Vom Ausfall betroffen sind zunächst nur jene Skitouristen, die in Seilbahnen und auf Skiliften unterwegs sind. Doch die reagieren gelassen. Dass Bahnen oder Skilifte stehenbleiben, kommt jeden Tag vor. Kurze Pannen sind alltäglich. Manchmal dauern die Stopps nur einige Sekunden oder Minuten, selten länger. Dann fährt die jeweilige Bahn wieder an, ohne dass jemand ein Wort darüber verliert. Und so denkt in diesen ersten Minuten des Blackouts zunächst auch keiner der Skifahrer und Liftbetreiber an ein grösseres Ereignis. Die Angestellten der Bahnen suchen routiniert nach den Ursachen des Stillstandes, während mancher Sesselbahnfahrer in luftiger Höhe die Aussicht auf das überwältigende Bergpanorama geniesst. Nach gut zehn Minuten aber wird es den ersten Festsitzenden ein wenig mulmig, und auch die Techniker der Bahnen werden langsam nervös. Unweigerlich kommen Erinnerungen auf: Am 11. November 2000 – ebenfalls an einem Samstag – war es in der Gletscherbahn Kaprun 2 gegen neun Uhr morgens zu einem verheerenden Brand gekommen, in dessen Folge 155 Menschen starben. Jeder der festsitzenden Touristen kann sich an dieses schreckliche Ereignis erinnern, an die Bilder aus den Fernsehnachrichten, und aus der bis soeben herrschenden Unbekümmertheit wird nun langsam Beklemmung. Keiner sagt mehr: «Na, wird schon nichts Ernstes sein.» Die zuvor lustig und laut miteinander plaudernden Touristen sprechen zusehends leiser, werden wortkarger oder schweigen.
Andernorts – genauer: im Tal – gibt es bereits konkrete Schäden zu beklagen. Sämtliche Ampeln sind ausgefallen. In der Folge kommt es zu Verkehrsunfällen mit Sach- und Personenschäden. Auf den Hauptrouten des ohnehin überlasteten Strassennetzes, aber auch in der Bezirkshauptstadt Zell am See bricht bald einmal der Verkehr zusammen. Polizei, Feuerwehr und Sanität sind nun pausenlos im Einsatz. Einzig diese Rettungskräfte sind jetzt noch in der Lage, miteinander zu kommunizieren, da sie über ein separates Funknetz verfügen, das sich in Notzeiten mit Batterien und Notstromaggregaten betreiben lässt. Diese Stromgeneratoren fahren notabene jetzt auch in der Tauernklinik automatisch hoch. Strom ist dort lebenswichtig. Käme es im Spital auch nur zu einem kurzen Ausfall, wären etliche Menschenleben in Gefahr.
Auch bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) ist der Verkehr zusammengebrochen. Einzig die mit Diesel betriebene Pinzgauer Lokalbahn verkehrt noch zwischen Zell am See und der 54 Kilometer entfernten Gemeinde Krimml. Allerdings muss der Lokführer das Reisetempo massiv reduzieren, weil sämtliche Signal- und Steuerungsanlagen ausgefallen sind. Die in den stromgetriebenen Zügen wartenden Passagiere sitzen derweil im wörtlichen Sinne fest. Immerhin werden die Reisenden durch die jeweiligen Schaffner informiert, die eilig, wenngleich unwissend durch die Wagons laufen.
Zum Nichtstun und Abwarten verdammt sind auch die Einwohner des Pinzgaus – so sie zu Hause sind: TV-Schirme, Computer, Kühlschränke und andere Haushaltsgeräte, aber auch Heizungen, Türsprechanlagen oder Lüftungen stellen punkt drei Uhr nachmittags ihre Dienste ein. Wer sich im Keller oder in einer Tiefgarage aufhält, sucht tapsend nach dem Ausgang. Weit prekärer ist die Lage für jene, die in Aufzügen festsitzen. Sie können nur hoffen, dass ihr Klopfen und Rufen bald erhört wird und anschliessend Hilfe kommt. Wer jemals in einem Aufzug feststeckte, weiss, dass auch beten hilft. Egal ob man gläubig ist oder nicht: beten beruhigt. Und das kann in so einer Gefahrenlage lebensrettend sein.
Wenn man nur wüsste, was passiert ist und wie lange der Ausfall noch dauern wird! Selbst über das Autoradio lässt sich nichts in Erfahrung bringen. Die Sender – so sie noch in Betrieb sind – haben keine verbreitbaren Informationen über den Vorfall. Und dennoch: Gut hat’s jetzt, wer in den eigenen vier Wänden hockt, wenngleich die ungewohnte Stille schnell einmal drückend wird. Man kennt das ja: Gibt ein Kühlschrank ab und zu unorthodoxe Geräusche von sich, ist das vielleicht irritierend. Schweigt er aber unvermittelt, der Kühlschrank, dann fehlt etwas. Man spürt dieses Fehlen. Es ist beunruhigend.
Oben am Kitzsteinhorn herrschen jetzt keine paradiesischen Zustände mehr. Seit über einer Viertelstunde ist der Strom «weg». Als die Skifahrer auf den Pisten merken, dass sämtliche Lifte und Bahnen stillstehen und keine Auffahrten mehr möglich sind, fahren sie auf ihren Skiern zum nächstgelegenen Restaurant oder zu einer der Hütten. Aus sicherer Distanz betrachtet, möchte man meinen, dass die drei grossen Bergrestaurants, das auf 2500 Meter gelegene Bundessport- und Freizeitzentrum, die Krefelder Hütte (2300 Meter) und die Jausenstation Häuslalm (1955 Meter) ausreichend gross sein müssten, um allen Tagestouristen Unterschlupf bieten zu können. Doch diese Hoffnung erweist sich schnell als Illusion. Vor den Eingängen sämtlicher Gasthäuser drängeln sich die Touristen bereits. Noch herrscht keine allgemeine Panik. Doch vor allem Eltern mit Kindern sind zunehmend gereizt. Immer mehr Skitouristen kommen bei den Verpflegungsstätten an. Einige regen sich auf. Zunehmend kritisch hingegen ist die Stimmung bei vielen der festsitzenden Lift- und Gondelpassagiere. Bei einigen von ihnen verselbständigt sich eine Horrorvision: Sie fürchten noch Stunden in der langsam aufkommenden Kälte und im schwankenden Sessellift verbringen zu müssen. Kinder weinen. Eltern versuchen sie zu beruhigen. Paare geraten in Streit. Die Enge in den Gondelkabinen, aber auch der Aufenthalt hoch über dem Pistengrund lösen selbst bei sonst stabilen Personen mit der Zeit bisher nicht gekannte Ängste aus.
Die Betriebstechniker der verschiedenen Bahnen wissen alle um die gefährliche Gefühlsdynamik, die sich in solchen Situationen entwickeln kann. Wenn sich nur einer der Passagiere zu einer unüberlegten Handlung hinreissen lässt – auf gut Deutsch: ausflippt –, kann dies unter den Mitanwesenden eine verheerende Kettenreaktion auslösen. Fieberhaft suchen die Bergbahnangestellten nach den Ursachen des Stromausfalls. Ihnen läuft buchstäblich die Zeit davon. Um halb vier Uhr, also eine halbe Stunde nach dem Totalausfall, müssen sie kapitulieren: Sie nehmen die Bahnen vom ohnehin toten Netz und schalten den Notstrombetrieb auf. Wenngleich die Passagiere der Kitzsteinhorn-Bahnen nun endlich Hoffnung schöpfen können, ist diese Notmassnahme keineswegs unproblematisch. Die Eingesperrten und Festsitzenden können nämlich nur langsam – weil im Stop-and-Go-Betrieb – befreit werden. Immer wieder kommt es zu kürzeren oder längeren Stopps. Die führen bei den Betroffenen zu wahren Gefühlswechselbädern. Und doch sind sie glücklich und dankbar, als sie schliesslich festen Boden unter den Füssen haben. Von den Strapazen erschöpft, gehen sie zu einem der Restaurationsbetriebe – und stossen dort auf die nächste Katastrophe: So viele Touristen vor den längst verstopften Eingängen der Gaststätten hätten sie nicht erwartet. Es herrscht eine irres und aggressives Gedränge. Die Menschenmenge ist kaum mehr überschaubar.
Wenn man jetzt ins Tal abfahren könnte. Auf den Skiern. Doch das geht nicht. Die Piste reicht nur bis gut 1800 Höhenmeter, dann muss man entweder die Panoramabahn oder den Gletscherjet 1 ins Tal nehmen. Aber die stehen still. Nun, wenn man schon draussen warten muss, wirft man mal einen Blick durchs Fenster in den Innenraum des Restaurants: Dort verschlechtert sich die Stimmung mit jeder Minute. Die unbeleuchteten Gaststuben sind heillos überfüllt. Auf den Gängen, in Nischen, in Waschräumen und WC-Anlagen drängeln sich die Gäste. Durch die selbstredend geschlossenen Fenster – sonst könnte man ja eine Abkürzung nehmen – vernimmt man den Lärm aus dem Innern des Gebäudes. Die Menschen reden nicht miteinander, sie schreien. Nicht auszumalen, was passieren würde, käme es zu einem Brand. Aber immerhin: Rund 5000 Personen sind an der Wärme, während noch immer 4500 Menschen draussen ausharren.
Ach, schau dir das an! Muss das sein? Die ersten Wintersportler verrichten einfach ihre Notdurft im Freien. Gut, was wollen sie machen? Die Toilettenanlagen sind völlig überlastet. Und dann: Manche irren ziellos in der Gegend umher, suchen Freunde oder Angehörige. Eine immer wieder verzweifelt «Karin …, Michael …» rufende Frau vermisst offenbar ihre Kinder. Das ist beunruhigend. In der Haut dieser Frau möchte man jetzt nicht stecken. Wie verloren die Masse – und darin jeder Einzelne – angesichts des erst anlaufenden Ausnahmezustands scheint. Diese Hilflosigkeit zeigt sich in den Gesichtern der Menschen! Wieder und wieder zücken sie ihre Mobiltelefone. Sie können nicht verstehen, dass es bei einem allgemeinen Stromausfall keine Netzverbindung mehr gibt, weil die Notstromversorgung der einzelnen Sendemasten nur für kurze Zeit ausreicht. Sie wollen einfach nicht wahrhaben, dass die Mobilfunknetze tot sind, man keine Gespräche mehr führen und keine Nachrichten oder Bilder mehr in alle Welt verschicken kann. Das empört die Menschen. Denn langsam reift in ihnen die bitter schmeckende Erkenntnis, dass mit dem Stromausfall ihre Nabelschnur zur Welt durchtrennt wurde. Diese Unerreichbarkeit schwächt sie, macht sie angreifbar, verletzlich.
Als sich nach und nach die letzten Sonnenstrahlen von den längst frierenden und mittlerweile auch müden und reizbaren Tagestouristen verabschieden, zündet die nächste Eskalationsstufe. Bald kommt es zu aggressiven Wortgefechten und Rangeleien, weil einzelne Schutzsuchende sich vordrängeln oder die Nerven verlieren. Mitarbeiter des Restaurants, die zur Aufrechterhaltung der Ordnung nach draussen abkommandiert wurden, werden rüde angepöbelt, mitunter auch bedroht. Vielleicht sollte man ein bisschen Abstand halten von dieser Gruppe, die sich so unangenehm lautstark gebärdet. Am Ende kommt es noch zu einer Schlägerei. Und dann wäre es nicht gut, wenn man mittendrin stünde. Andererseits: Ein Rückzug hiesse auch, dass man noch länger warten müsste, wenn doch noch Leute ins Gebäudeinnere gelassen würden. Die Aussentemperatur beträgt mittlerweile minus 11 Grad Celsius. Tendenz fallend. Im gleichen Masse wächst die Verzweiflung unter den noch immer draussen Wartenden.
In den Gaststuben und vor allem in den sanitären Bereichen herrscht zusehends «dicke Luft». Natürlich ist auch die Wasserversorgung wegen der stillstehenden Pumpwerke zusammengebrochen. Die Zustände in den Wasch- und Toilettenräumen sind ekelerregend. Viele Menschen fürchten sich vor der einbrechenden Dunkelheit. Sie wissen nicht, wie sie es später in der Gesellschaft tausender im Finstern aushalten sollen.
Jetzt ein Königreich für ein Gedicht. Denn wie hatte der Vater früher oft gesagt? Genau: «Kinder lernt Gedichte», weil diese einem helfen könnten durchzuhalten, wenn man mal in einer Not wäre. Wie dumm man doch gewesen war, diesen Rat einfach lachend in den Wind zu schlagen. Das einzige Gedicht, das einem jetzt einfällt, ist ausgerechnet «Der Erlkönig» von Goethe. «Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? – Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kron’ und Schweif? – Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.» Da taucht der Erlkönig zum ersten Mal auf. Gruselig.
Und die letzte Strophe? Die konnte doch jeder Schüler «blind» aufsagen! Und wer sie rezitierte, trug sie mit überdramatischem Gestus vor. Ah, so schlecht aufgepasst hat man dann doch nicht im Deutschunterricht. Also: «Dem Vater grauset’s; er reitet geschwind, er hält in den Armen das ächzende Kind, erreicht den Hof mit Müh und Not; in seinen Armen das Kind war tot.» Schrecklich. Das Kind war tot.





























