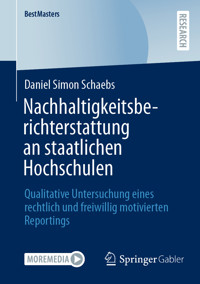44,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Steuerverwaltung in Deutschland ist aus historischen Gründen dezentral organisiert. Mit insgesamt 17 grundsätzlich unabhängigen Steuerverwaltungen nimmt Deutschland in Europa eine Sonderrolle ein, die im Kontext der Digitalisierung zu großen Herausforderungen führt. So bedurften föderale Kooperationsmodelle im Bereich der Steuer-IT in der Vergangenheit schon erheblicher finanzieller Ressourcen. Auch künftig ist mit einem hohen Finanzierungs- und Abstimmungsbedarf zu rechnen. Der Bundesrechnungshof äußerte in seinen Berichten mehrfach Kritik zum aktuellen KONSENS-Vorhaben. Die Auswertung einer gleichartigen Befragung von 11 Landesfinanzministerien mit 15 Kernfragen zu diversen Digitalisierungsbemühungen der einzelnen Bundesländer offenbart die nur schleppenden Fortschritte bei der digitalen Transformation der Steuerverwaltung. Vor diesem Hintergrund werden drängende Reformbedürfnisse aufgezeigt und mit entsprechenden Handlungsempfehlungen verbunden. Hierzu zählen die Bündelung der Digitalkompetenz auf Bundesebene, eine Reform der Qualifizierung von Bediensteten sowie die Einrichtung agiler Finanzämter mit optimierten Strukturen und digitalen Besteuerungs- bzw. Verwaltungsverfahren. Zusätzlich wird der Aufbau einer Steuerdatenforschung und ausgeprägten Steuerverwaltungswissenschaft erörtert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die digitale Transformation der deutschen Steuerverwaltung
Eine Analyse der bisherigen Fortschritte, Reformbedürfnisse und -ansätze
von
Daniel Simon Schaebs
Diplom - Finanzwirt (FH), B.A., MSc
Deutschsprachige Version der Dissertationsschrift mit Publikationserlaubnis der Pegaso International zur Erlangung des akademischen Grades
Doctor of Philosophy (Ph.D.)
in Law, Education and Development
©2022 Daniel Simon Schaebs
ISBN Hardcover: 978-3-347-68553-6
ISBN E-Book: 978-3-347-68554-3
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung „Impressumservice“, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Vorwort und Danksagung
Die Idee zur Erstellung dieser Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestagsbüro von Katja Hessel MdB, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen. Ihr gilt mein besonderer Dank für das große Interesse an der Fortentwicklung der Steuerverwaltung und die Möglichkeit, dass ich sie bei der parlamentarischen Arbeit unterstützen durfte. An dieser Stelle möchte ich auch den Mitarbeitern und Finanzpolitikern in den Landtagen danken, die gemeinsam die gleichartige Befragung zur digitalen Transformation der deutschen Steuerverwaltung über das Fragerecht der Abgeordneten auf Landesebene umgesetzt haben.
Ich bedanke mich an erster Stelle auch bei meinem Doktorvater und Supervisor der Pegaso International Malta, Herrn Prof. Dr. Dino André Schubert, der mein Forschungsvorhaben von Beginn an begleitet und die Erstellung dieser Arbeit bis zum Ende wissenschaftlich betreut hat.
Herrn Dr. Benjamin Peuthert und Herrn Prof. Dr. Rodney Leitner gilt mein ganz persönlicher Dank für die zahlreichen fachlichen und methodischen Ratschläge und Diskussionen, aus denen verschiedene Publikationen hervorgingen und die Umsetzung von Ideen erst gelingen konnte. Herzlichen Dank dafür!
Bei Familie und Freunden, vor allem aber bei meinem Ehemann, bedanke ich mich für die unermüdliche Geduld und moralische Unterstützung, die motivierenden Momente, aber auch für kritische Nachfragen und viele hilfreiche Tipps.
Teile dieser Dissertationsschrift wurden bereits gleichlautend, ähnlich oder in englischer Sprache als Einzelbeiträge veröffentlicht und werden nunmehr kumulativ zusammengefasst. Auf die Übernahme wird zu Beginn der jeweiligen Kapitel hingewiesen. Eine Gesamtliste der Publikationen einschließlich des Publikationsanteils befindet sich am Ende dieser Arbeit (Anhang D).
Berlin, im Juni 2022 Daniel Simon Schaebs
Inhaltsverzeichnis
Vorwort und Danksagung
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
1.2 Aufbau der Arbeit
1.3 Methodik
2 Formale Zustandsbeschreibung der Steuerverwaltung
2.1 Struktur der Steuerverwaltung
2.1.1 Zentralisierte und dezentralisierte Steuerverwaltungen
2.1.2 Historische Entwicklung der Steuerverwaltung in Deutschland
2.1.3 Verfassungsrechtliche Vorgaben
2.2 Kooperationen der Länder bei der Entwicklung von IT-Lösungen
2.2.1 Programmierverbünde IABV, FISCUS und EOSS
2.2.2 Der KONSENS-Verbund
2.2.2.1 Entwicklungsfortschritte und deren Finanzierungsbedarf
2.2.2.2 KONSENS-Verfahren und weitere Projekte
2.2.3 Kritik an der Zusammenarbeit der Länder
2.2.3.1 E-Government-Leistungen
2.2.3.2 IT-Verfahren der Steuerverwaltung
2.3 Deutschland im europäischen Kontext
3 Stand der Digitalisierung der Landessteuerverwaltungen
3.1 Empirische Erhebung
3.1.1 Untersuchungsdesign
3.1.2 Methodische Auswertung
3.1.3 Darstellung der Ergebnisse
3.2 Ergebnisse zur Organisationsstruktur
3.2.1 Bewertung föderaler Aufbau und europäischer Vergleich
3.2.2 Strategische Implementierung / Meilensteine
3.2.3 Stabstellen für Digitalisierung / Einbeziehung Bürgererwartung
3.3 Ergebnisse zu Entwicklungsbedarfen
3.3.1 Umstellung von analog auf digitale Prozesse
3.3.2 Leistungen der Steuerverwaltung nach dem OZG
3.3.3 Anpassungsbedarf im Steuerrecht und bei IT-und Arbeitsprozessen
3.4 Ergebnisse zu KONSENS
3.4.1 Beiträge zum KONSENS-Verbund
3.4.2 Digitale Steuererklärungen und -bescheide
3.4.3 Förderung der Inanspruchnahme digitaler Leistungen
3.5 Ergebnisse mit Bezug zum Landespersonal
3.5.1 Telearbeit und mobiles Arbeiten
3.5.2 Neueinstellung von IT-Kräften
3.5.3 Aus- und Fortbildungsbedarf
3.6 Ergebnisse zu IT-Aspekten
3.6.1 Einsatz moderner IT-Verfahren
3.6.2 Qualitätssicherungsverfahren für die Automation
3.6.3 Barrierefreiheit, Bürgerorientierung und-freundlichkeit
4 Reformbedürfnisse und -ansätze für die Prozess strukturen
4.1 Bündelung der Digitalkompetenz auf Bundesebene
4.2 Änderungen der äußeren Organisationsstruktur
4.2.1 Neuorganisation der Finanzämter
4.2.1.1 Agile Organisationsstrukturen
4.2.1.2 Teilung in Front- und Backoffices
4.2.1.3 Optimierung des Versorgungsgrades
4.2.2 Elektronische Verwaltungsleistungen (e-Government-Services)
4.2.2.1 Ausbau von ELSTER
4.2.2.2 Online-Bürgerservices
4.2.2.3 Smartphone-App der Steuerverwaltung
4.3 Änderung der inneren Organisationsstruktur
4.3.1 Digitale Finanzämter
4.3.1.1 Digitales Besteuerungsverfahren
4.3.1.2 Standardisierung von Schnittstellen
4.3.1.3 Automatisierung
4.3.2 Weitere Einzelaspekte
4.3.2.1 Digitale Verwaltungsabläufe
4.3.2.2 Risikomanagementsysteme und Fallauswahl
4.3.2.3 Einsatz von Blockchain und Künstlicher Intelligenz (KI)
5 Reformbedürfnisse und -ansätze zur Personalqualifizierung
5.1 Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen
5.2 Kompetenzorientierte Entwicklungsperspektiven
5.2.1 Vermittlung von Digital- und Zukunftskompetenzen
5.2.2 Wissenschaftlichkeit der Aus- und Fortbildung
5.3 Konsekutive und modulare Qualifizierung
5.3.1 Personalmanagement im konsekutiven Bildungsaufbau
5.3.2 Modularisierung der Qualifizierung
6 Steuerdatenforschung und Steuerverwaltungswissenschaft
6.1 Notwendigkeit einer ausgeprägten Steuerdatenforschung
6.2 Rechtliche Voraussetzungen und Möglichkeiten für Forschungen mit Steuerdaten
6.2.1 Rechtliche Voraussetzungen
6.2.1.1 Datenzugang
6.2.1.2 Bereitstellung der Daten für die Allgemeinheit
6.2.2 Zentrale vs. dezentrale Forschungskonzentration
6.2.2.1 Forschung auf Bundes- oder Landesebene
6.2.2.2 Forschung in Bund-Länder-Modellen
6.3 Begründung einer Steuerverwaltungswissenschaft
6.3.1 Forschungsansätze im Kontext Steuerpflichtiger und Staat
6.3.2 Forschungsansätze im Kontext interner Verwaltungsprozesse
7 Zusammenfassende Beantwortung und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
A Materialien zur Befragung „Digitalisierung in der Finanzverwaltung“
A.1 Quellenübersicht
A.2 Antworten der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen
A.3 Antworten der Landesregierung von Schleswig-Holstein
B Rohdaten der DESI-Analyse
C Codebuch
D Publikationen
Abbildungsverzeichnis
2.1 Aufbau der Finanzverwaltung nach dem FVG
2.2 Einordnung der Länder der EU
2.3 Flächen als Produkt aus BIP und a-DESI
2.4 Vergleich von Deutschland und Estland
2.5 Relative Digitalisierungs-Effizienz
3.1 Bewertungen zum föderalen Aufbau
3.2 Europäischer Vergleich
3.3 Strategische Implementierung / Meilensteine
3.4 Digitalisierungsfortschritt
3.5 Umsetzung der OZG-Leistungen
3.6 Werbung über KONSENS
3.7 Eigene Initiativen der Bundesländer
3.8 Homeoffice-Möglichkeiten der Steuerverwaltungen
3.9 Neueinstellungen von IT-Kräften seit 2017
3.10 Einsatz moderner IT-Verfahren
4.1 Koordinierung der Digitalisierungsprozesse durch das BZSt
4.2 Veränderungspotenzial bei Finanzämtern
4.3 Versorgungslage je Fläche und Einwohner von 2006 bis 2021
4.4 Minimum-Relationskurve mit Fläche und Bevölkerungsdichte
4.5 Prognose der Automatikfälle bis 2030
5.1 Qualifizierungsstufen I
5.2 Qualifizierungsstufen II
6.1 Disziplinen der Steuerwissenschaft
Tabellenverzeichnis
2.1 Ausgaben für KONSENS ab 2014
2.2 Budget- und Finanzplanung für KONSENS bis 2024
2.3 KONSENS-Verfahren zur Automatisierung
2.4 Steuerverwaltungen in der EU
2.5 Leistungsindikatoren für den DESI 2020
3.1 Grundfragen an die Landesfinanzministerien
4.1 Versorgungslage der Steuerverwaltungen in 2006 und 2021
A. 1 Quellenübersicht zur Befragung
B. 1 Rohdaten der DESI-Analyse
C. 1 Codierungen zur Grundfrage 1
C.2 Codierungen zur Grundfrage 2
C.3 Codierungen zur Grundfrage 3
C.4 Codierungen zur Grundfrage 4
C.5 Codierungen zur Grundfrage 5
C.6 Codierungen zur Grundfrage 6
C.7 Codierungen zur Grundfrage 7
C.8 Codierungen zur Grundfrage 8
C.9 Codierungen zur Grundfrage 9
C.10 Codierungen zur Grundfrage 10
C.11 Codierungen zur Grundfrage 11
C.12 Codierungen zur Grundfrage 12
C.13 Codierungen zur Grundfrage 13
C.14 Codierungen zur Grundfrage 14
C. 15 Codierungen zur Grundfrage 15
Abkürzungsverzeichnis
Abkürzung
Bedeutung
a.a.O.
an anderem Ort
a-DESI
angepasster Digital European Society Index
AO
Abgabenordnung
BA
Bundesagentur für Arbeit
BB
Brandenburg
BDSG
Bundesdatenschutzgesetz
BE
Berlin
BFA
Bundesfinanzakademie
BfF
Bundesamt für Finanzen
BGBl.
Bundesgesetzblatt
BHO
Bundeshaushaltsordnung
BIENE
Bundeseinheitliche integrierte evolutionäre Neuentwicklung der Erhebung
BIP
Bruttoinlandsprodukt
BITV
Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung
BMBF
Bundesministerium für Bildung und Forschung
BMF
Bundesministerium der Finanzen
BMfF
Bundesministerium für Finanzen (Republik Österreich)
BMJV
Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz
BMWi
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
BRH
Bundesrechnungshof
BSI
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
BuStra
Bußgeld, Strafsachen, Steuerfahndung
BT
Bundestag
BVerfGE
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BW
Baden-Württemberg
BY
Bayern
BZSt
Bundeszentralamt für Steuern
bzw.
beziehungsweise
DAME
Data Warehouse, Auswertungen und Business-Intelligence-Methoden
DESI
Digital European Society Index / Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft
DIVA
Digitaler Verwaltungsakt
DLS
Digitale Lohnschnittstelle
Drs.
Drucksache
DSFinV-K
Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme
DSGVO
Datenschutzgrundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679 vom 27.04.2016)
ELFE
Einheitliche länderübergreifende Festsetzung
ELIAS
Elektronischer Informationsassistent
ELSTER
Elektronische Steuererklärung
EOSS
Evolutionär orientierte Steuersoftware
EQR
Europäischer Qualifikationsrahmen
EU
Europäische Union
FA
Finanzamt
FAGO
Geschäftsordnung der Finanzämter
FDP
Freie Demokratische Partei
FHF
Fachhochschule für Finanzen
FISCUS
Föderales Integriertes Standardisiertes Computer-Unterstütztes Steuersystem
FITKO
Föderale IT-Kooperation
FiZ
Finanzamt der Zukunft
FMK
Finanzministerkonferenz
Fn.
Fußnote
FVG
Gesetz über die Finanzverwaltung
GDA
Gesamtdokumentenarchivierung
GeCo
Gesamtfalladministration / VGP-Controller
gem.
gemäß
GG
Grundgesetz
ggü.
gegenüber
GINSTER
Grundinformationsdienst Steuer
HB
Bremen
HE
Hessen
HH
Hamburg
HRK
Hochschulrektorenkonferenz
IABV
Integriertes automatisiertes Besteuerungsverfahren
ID
Identifikationsnummer
IDSt
Institut für Digitalisierung im Steuerrecht
IfeSt
Institut für empirische Steuerforschung
IFG
Informationsfreiheitsgesetz
InKA
Informations- und Kommunikationsaustausch mit dem Ausland
i.S.d.
im Sinne der/im Sinne des
IT
Informationstechnologie
i.V.m.
in Verbindung mit
KapESt
Kapitalertragsteuer
KDialog
KONSENS-Dialog
KI
Künstliche Intelligenz
KMK
Kultusministerkonferenz
KONSENS
Koordinierte neue Softwareentwicklung für die Steuerverwaltung
KONSENS-G
Gesetz über die Koordinierung der Entwicklung und des Einsatzes neuer Software der Steuerverwaltung
KOSIT
Koordinierungsstelle für IT-Standards
LAVENDEL
Lohnsteuerabzugsverfahren der Länder
LT
Landtag
MdB
Mitglied des Bundestages
ML
Machine Learning
MUS
Monetary Unit Sampling
MüSt
Maschinelle Überwachung der Steuerfälle
MV
Mecklenburg-Vorpommern
NESSI
Nachweisplattform ELSTER Self-Souvereign Identities
NI
Niedersachsen
NKR
Nationaler Normenkontrollrat
NLP
Natural Language Processing
NW
Nordrhein-Westfalen
OECD
Organization for Economic Cooperation and Development / Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OFD
Oberfinanzdirektion
o.J.
ohne Jahr
OZG
Onlinezugangsgesetz
PPP
Public Private Partnership
RDE
Relative Digitalisierungs-Effizienz
RMS
Risikomanagementsystem
Rn.
Randnummer
RP
Rheinland-Pfalz
RPA
Robotic Process Automation
Rz.
Randziffer
SA
Sachsen-Anhalt
SAF-T
Standard Audit File - Tax
SESAM
Steuererklärungen scannen, archivieren und maschinell bearbeiten
SH
Schleswig-Holstein
SL
Saarland
SN
Sachsen
SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
StBAG
Steuerbeamtenausbildungsgesetz
StBAPO
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Steuerbeamtinnen und Steuerbeamten
StStatG
Gesetz über Steuerstatistiken
StundE
Stundung und Erlass
TADAT
Tax Administration Diagnostic Assessment Tool
TH
Thüringen
TüV
Technischer Überwachungsverein
Tz.
Textziffer
u.a.
unter anderem
UN
United Nations / Vereinte Nationen
vgl.
vergleiche
VO
Vollstreckungssystem
VwVfG
Verwaltungsverfahrensgesetz
W.B. BMF
Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen
WD
Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages
ZANS
Arbeitnehmer-Sparzulage und Wohnungsbauprämie
z.B.
zum Beispiel
ZendiB
Zentraler digitaler Bürgerservice in Finanzämtern
Kapitel 1
Einleitung
Die Steuerverwaltung1 in Deutschland nimmt in Europa eine untersuchungswerte Sonderrolle ein. Die Vorgaben im Grundgesetz (GG) bedingen 16 Landesfinanzverwaltungen und eine weitere auf Bundesebene. Sämtliche Beschlüsse und Vorgehensweisen müssen nicht nur als Reaktion auf nationale oder globale steuerliche Herausforderungen im Sinne eines kooperativen Föderalismus unter den Entscheidungsträgern2 aufwendig abgestimmt werden. Die Einführung der elektronischen Steuererklärung ließ den Fiskus einst zum Vorreiter unter den Verwaltungen werden. Unlängst beeinflusst die Digitalisierung jedoch sämtliche Prozesse unserer gesamten Arbeits- und Lebenswelt. Dies verändert auch das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern sowie Unternehmen - mithin die Art und Weise, wie die Steuerverwaltung mit den Steuerpflichtigen in Zukunft interagieren wird.
Als eine der größten Volkswirtschaften der Welt scheidet Deutschland bei der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen in regelmäßigen Erhebungen vergleichsweise schlecht ab, so zum Beispiel beim Digital European Society Index (DESI) 2020 oder dem UN E-Government Survey (EGDI) 2020. Was Deutschland jetzt dringend braucht, ist ein digitaler Aufbruch, der weit über die bloße Umsetzung der Maßnahmen nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) bis zum Ende des Jahres 2022 und die IT-Kooperation der Länder im Vorhaben „Koordinierte Neue Software-Entwicklung der Steuerverwaltung (KONSENS)“ hinausgeht. Letzteres steht für die Zusammenarbeit ab dem Jahr 2004 im Bereich der IT-Prozesse unter den Ländern und geht auf das KONSENS-Gesetz vom 14.08.2017 zurück. Hierdurch werden die einheitliche Entwicklung und der Einsatz der Software bzw. IT-Verfahren im Bereich der Steuerverwaltung geregelt. Denn die Umstellung von analogen Strukturen auf digitale Kanäle allein führt nicht zur Lösung von allen Problemen. Vielmehr bedarf es eines echten digitalen Wandels in der gesamten Steuerverwaltung in Deutschland. Diese digitale Transformation betrifft nämlich nicht nur Veränderungsprozesse in Unternehmen der Privatwirtschaft. Digitale Technologien verändern auch staatliche und behördliche Prozesse grundlegend. Dies umfasst die organisatorische, prozessuale und technologische Veränderung der Verwaltung aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung. Damit einhergehend müssen alle Bereiche auf den Prüfstand gestellt werden; angefangen bei der Ausbildung und Qualifizierung bzw. der Strukturorganisation der Verwaltung bis hin zum täglichen Verwaltungshandeln mit seinen vielen Fachverfahren und dem Selbstverständnis der Steuerverwaltung im Verhältnis zu den Steuerbürgern und Unternehmen.
Nach Ansicht der OECD stehen die Steuerverwaltungen vor der Herausforderung, mit zunehmend reduzierten Budgets zurechtkommen und gleichzeitig den technologischen Wandel erfolgreich bewältigen zu müssen [OECD, 2019, S. 121]. Zudem wird der digitale Wandel als eine der größten Herausforderungen für die Regierungen nach der COVID-Pandemie angesehen [OECD, 2020b, S. 5]. In den vergangenen Legislaturperioden des Deutschen Bundestages und denen von verschiedenen Landtagen haben bereits zahlreiche Abgeordnete Anfragen mit digitalen Schwerpunkten zur Steuerverwaltung an die Bundes- bzw. Landesregierung gerichtet.3 Die gesamte Digitalisierungsthematik und der hierzu bestehende Anpassungsdruck wurden sichtbarer denn je.
Am 25.03.2021 nahm das Institut für Digitalisierung im Steuerrecht (IDSt) seine Arbeit auf und fokussiert seither „die steuerwissenschaftliche Fachdiskussion, insbesondere zwischen politischen Funktionsträgern, Steuerjuristen, Angehörigen der steuerberatenden Berufe, Richterschaft, Verwaltung, [und den] in Forschung und Lehre tätigen Personen […]“ [IDSt, o.J.]. Die dort eingerichteten Fachausschüsse bestätigen die Breite der Handlungsfelder und Ansatzpunkte für die digitale Transformation. Ein eigener Fachausschuss, der die sehr speziellen Bedürfnisse und Herausforderungen der Steuerverwaltung aufgreift, fehlt allerdings und so warten Wissenschafts- und Forschungsinitiativen wohl auf die verwaltungsinternen Akteure. Gleichwohl fordert die CDU/CSU-Fraktion im neugewählten Deutschen Bundestag bereits die Einbindung des IDSt bei allen gesetzlichen Digitalisierungsinitiativen [Deutscher Bundestag, 2022, S. 2].
Noch deutlicher zeigt der aktuelle Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90 / Die Grünen und der FDP, welche dringenden Weichenstellungen aus politischer Sicht nötig erscheinen. Zunächst gesteht sich die Regierung dabei ein, dass „Deutschland nur auf der Höhe der Zeit agieren könne[]“, sofern der „Staat selbst modernisier[t]“ [SPD, 2021, S. 4] werde. Dabei sind die „umfassende Digitalisierung der Verwaltung“ und die bessere Nutzung ihrer Potenziale bereits in der Präambel verankert. Es bedürfe einer „agilere[n] und digitalere[n] Verwaltung“, die „unkompliziert[]“, „schnell[]“, „proaktiv“, „antragslos“ und „automatisiert“ handelt, und deren Führungskräfte eine „moderne Führungs- und Verwaltungskultur“ leben und „für digitale Lösungen sorgen“. Der Staat müsse bei „digitalen Arbeitsbedingungen Vorbild sein“ und die „Digitalisierung [solle] zu einem allgemeinen und behördenübergreifenden Kernbestandteil der Ausbildung“ werden. Gesetze müssten einem „Digitalcheck“ [ebd., S. 8 f.] unterzogen und „Digitalisierungshemmnisse“ über Generalklauseln und Vereinheitlichungen abgebaut werden [ebd., S. 13]. Hinsichtlich des Föderalismus wolle man in einen Dialog „zur transparenteren und effizienteren Verteilung der Aufgaben […] zur Nutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung“ [ebd., S. 9] eintreten.
Bezogen auf die Steuerverwaltung will die neue Bundesregierung die „Digitalisierung und Entbürokratisierung“ beschleunigen [SPD, 2021, S. 130]. Dazu enthält der Unterabschnitt „Vollzug, Vereinfachung und Digitalisierung“ die konkreten Schritte. Mit der „Digitalisierung des Besteuerungsverfahrens“, „volldigitalisierte[n] Verfahren“ und der „vorausgefüllte[n] Steuererklärung“ könnte die „gesamte Interaktion zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung digital möglich“ werden. „Verbesserte Schnittstellen“, eine „Standardisierung und der […] Einsatz neuer Technologien“ sollen helfen, „die Anschlussfähigkeit der Steuerverwaltung an den digitalen Wandel“ herzustellen. Einem zu gründenden Institut für Steuerforschung wird ein besonderer Stellenwert beigemessen, um so mit einer „aktuelle[n] und bessere[n] Datenlage“ eine „Evaluierung“ erhalten und „evidenzbasierte[re] Gesetzgebung“ vornehmen zu können [ebd., S. 132].
Insgesamt zieht sich das Digitalisierungsverlangen wie ein roter Faden durch die Kapitel des Koalitionsvertrages und beweist damit, welche Brisanz der digitalen Transformation in allen Bereichen zukommt. Diese Arbeit setzt hier an, indem sie die für die deutsche Steuerverwaltung bestehenden Determinanten umfassend beleuchtet.
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
Die Finanzverwaltung unterhält keine eigenen Universitäten mit entsprechenden Professuren, die kontinuierlich an der Fortentwicklung bzw. Verbesserung ihrer Prozesse und Strukturen arbeiten könnten. Elf Fachhochschulen für Finanzen in Trägerschaft eines oder mehrerer Länder sind überwiegend als nicht rechtsfähige Einrichtungen in den Geschäftsbereich des jeweiligen Finanzministeriums eingliedert und übernehmen vorrangig die Ausbildung von Bediensteten in der Steuerverwaltung. Oftmals werden Auswirkungen auf die Steuerverwaltung nur im Kontext von externen Wissenschaftsansätzen tangiert und so allenfalls mituntersucht. Es mangelt an einer zielgerichteten und vor allem kontinuierlichen Forschung für die Steuerverwaltung, mithin einer ausgeprägten Steuerverwaltungswissenschaft (siehe hierzu Kapitel 6.3, S. 186). Gleichzeitig fehlt es in internationalen Vergleichen an konkreten Daten zum Sachstand der Digitalisierung der deutschen Steuerverwaltung, z.B. innerhalb der Inventory of Tax Technology Initiatives [OECD, 2022] oder der Performance Assessment Reports [TADAT, o.J.].
Senger stellte bereits im Jahr 2009 fest, dass die deutsche Steuerverwaltung international „zu den teuersten“ gehöre und „zudem als langsam“ empfunden werde. Zugleich verschärfen seiner Meinung nach die „föderalen Unterschiede z.B. bei Personal und Ausstattung […] diese Problematik“ und eine „Reform der deutschen Finanzverwaltung [gelte] nach herrschender Meinung als notwendig […]“ [Senger, 2009, S. 23]. Im Mittelpunkt seiner damaligen Betrachtungen standen die „Effektivität, Effizienz und Akzeptanz der Steuerverwaltung“. Dies sind Maßstäbe, die auch in der digitalisierten Welt uneingeschränkte Gültigkeit behalten müssen.
Nach mehr als einem Jahrzehnt knüpft diese Arbeit an die von Senger skizzierten Herausforderungen an und analysiert den Ist-Zustand in den Landesfinanzverwaltungen in Bezug auf bisherige Digitalisierungsbemühungen. Zugleich sollen die Reformbedürfnisse eruiert, mit den Zielen des Koalitionsvertrages und der Haltung der Regierungen in Verbindung gebracht und konkrete Optimierungsansätze aufgezeigt werden. In diesem Rahmen werden insbesondere die Fähigkeit der deutschen Steuerverwaltung, sich für den digitalen Wandel zu transformieren, und die diesbezüglichen Fortschritte bewertet.
Im Vordergrund stehen dabei folgende Forschungsfragen:
1. Welche geschichtlichen und rechtlichen Besonderheiten ergeben sich für die deutsche Steuerverwaltung und wie steht Deutschland im europäischen Kontext da? (Kapitel 2, ab S. 11)
2. Welche Fortschritte bei der digitalen Transformation sind in den Ländern zu verzeichnen? (Kapitel 3, ab S. 49)
3. Welche Reformbedürfnisse bestehen und welche weiteren Ansätze würden die digitale Transformation der deutschen Steuerverwaltung begünstigen? (Kapitel 4-6, ab S. 85)
1.2 Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel. Im Einleitungsteil werden zunächst die Herausforderungen und die Problemstellung aufgezeigt, um anhand der Forschungsfragen die Zielsetzung zu verdeutlichen. Hier werden zudem der Aufbau und die verwendete Methodik beschrieben.
Das zweite Kapitel widmet sich einer Zustandsbeschreibung und der Beantwortung der ersten Forschungsfrage. So wird die Struktur der Steuerverwaltung anhand ihrer geschichtlichen Entwicklung und der rechtlichen Vorgaben betrachtet. Im Weiteren wird ausführlich auf die Zusammenarbeit der Länder im Bereich der Informationstechnik eingegangen. Anschließend wird der Versuch unternommen, die deutsche Steuerverwaltung - wegen der steuerrechtlichen und föderalen Besonderheiten lediglich in groben Zügen - in einen europäischen Kontext einzuordnen.
Im Rahmen dieser Arbeit werden in Kapitel 3 (S. 49) die Ergebnisse einer gleichartigen Befragung von Landesfinanzministerien im Zusammenhang mit der digitalen Transformation präsentiert. Diese Erhebung befasste sich unter anderem mit der Bewertung des föderalen Aufbaus, mit digitalen Kompetenzzentren und der strategischen Implementierung der digitalen Transformation, mit den Leistungen der Steuerverwaltung nach dem OZG sowie dem Anpassungsbedarf im Steuerrecht bzw. bei IT- und Arbeitsprozessen. Zugleich sollen hier die Haltung der Länder zu ihren Beiträgen im KONSENS-Verbund, die Fortschritte bei digitalen Steuererklärungen und -bescheiden bzw. die Förderung deren Inanspruchnahme, mobile Arbeitsmethoden, die Neueinstellung von IT-Kräften, der Aus- und Fortbildungsbedarf sowie der Einsatz moderner IT-Verfahren verglichen werden. Die Ergebnisse werden in fünf unterschiedlichen Kategorien ausführlich dargestellt.
Innerhalb der Kapitel 4 bis 6 (ab S. 85) sollen unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Kapiteln 2 und 3 (ab S. 11) Reformbedürfnisse aufgezeigt und mit weiteren möglichen Optimierungsansätzen in Verbindung gebracht werden. Im Sinne einer vollumfänglichen Transformation werden in Kapitel 4 (S. 85) Maßnahmen für Änderungen der äußeren Organisationsstruktur wie die Neuorganisation der Finanzämter und Anpassungen bei den elektronischen Verwaltungsleistungen (e-Government-Services) sowie für Änderungen der inneren Organisationsstruktur wie die Einrichtung von „Digitalen Finanzämtern“ mit digitalen Besteuerungsverfahren und einer weitgehenden Automatisierung dargestellt. Ebenso wird auf digitale Verwaltungsabläufe, Risikomanagementsysteme (RMS) und Einsatzmöglichkeiten für Blockchain und Künstliche Intelligenz (KI) Bezug genommen. Unter anderem werden für den Gesetzgeber normative und für die Verwaltung praktische Handlungsempfehlungen gegeben.
In Kapitel 5 (S. 139) werden die Rahmenbedingungen und Vorteile einer kompetenzorientierten, konsekutiven und modularen Personalqualifizierung aufgezeigt, bei der die Vermittlung von Digital- und Zukunftskompetenzen neben der Wissenschaftlichkeit der Aus- und Fortbildung in den Mittelpunkt gestellt wird. Ausgehend von der traditionellen Steuerbeamtenausbildung wird ein Aus- und Fortbildungsmodell detailliert beschrieben, welches mithilfe einer gestreckten persönlichen Lernkurve sowie Transfermöglichkeiten zwischen Staat und Privatwirtschaft die Strukturen insgesamt zukunftsfähiger und marktorientierter werden lässt.
Kapitel 6 (S. 167) befasst sich mit den Notwendigkeiten und rechtlichen Voraussetzungen einer Forschung an Steuerdaten und analysiert verschiedene Möglichkeiten hierzu. Des Weiteren wird die Etablierung einer Steuerverwaltungswissenschaft beleuchtet, die in Abgrenzung zu den Steuerrechts- und Steuerwirtschaftswissenschaften die besonderen Belange der Steuerverwaltung fokussieren soll. Dahingehend werden auch Forschungsansätze vorgestellt.
Das Kapitel 7 (S. 193) schließt mit einer Schlussbetrachtung ab, welche eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Arbeit, eine kritische Reflektion und einen Ausblick auf weitere, zukünftige Forschungsvorhaben und Anknüpfungspunkte enthält.
1.3 Methodik
Die zuvor beschriebenen Aufgabenstellungen und Zielsetzungen bedürfen einer Kombination verschiedener wissenschaftlicher Methoden. Für die deskriptive Darstellung der Struktur der Steuerverwaltung und Kooperationen der Länder bei der Entwicklung von IT-Lösungen konnte auf vorhandene Primär- und Sekundärliteratur zurückgegriffen werden. Zur Einordnung in einen europäischen Kontext wurde eine statistische Modellierung des DESI vorgenommen. Für die beabsichtigte Analyse des Digitalisierungsstands in verschiedenen Landessteuerverwaltungen mussten die notwendigen Daten erst empirisch erhoben werden, weil entsprechende Primärdaten nicht verfügbar waren. Das Erkenntnisziel und die Befragungsergebnisse erforderten eine qualitative Auswertung.
Eine ausführliche Analyse der vorhandenen Literatur sowie die Verdichtung dieser mit dem Ziel neuer Erkenntnisgewinne waren insbesondere für den Themenkomplex zu den Reformbedürfnissen und -ansätzen (Kapitel 4 bis 6, ab S. 85) erforderlich. In Kapitel 4.1 (S. 87) wird ein Modell zur Bündelung der Digitalkompetenzen auf Bundesebene vorgestellt, bei dem abseits von KONSENS und der bisherigen Debatte zu einer Bundesssteuerverwaltung, ein alternativer Weg zur Beschleunigung der Digitalisierungsvorhaben in der Steuerverwaltung aufgezeigt wird. Außerdem wird zur Optimierung der Versorgungssituation ein Berechnungsverfahren herangezogen und weiterentwickelt. Ein konsekutives, modulares Konzept zur Aus- und Fortbildung wurde für die Umstellung auf eine zukunftsfähige Personalqualifizierung in der Steuerverwaltung in Kapitel 5.3 (S. 148) erarbeitet.
1 Im Rahmen dieser Arbeit wird die Steuerverwaltung als Gesamtheit aus 16 Landessteuerverwaltungen und der Bundessteuerverwaltung verstanden. Die Begriffe Steuerverwaltung und Finanzverwaltung werden synonym gebraucht. Andere Bereiche der Finanzverwaltung, z.B. die Zollverwaltung als Teil der Bundesfinanzverwaltung, sind nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit.
2 Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung verzichtet. Die Verwendung des generischen Maskulinums als neutrale grammatikalische Ausdrucksweise beinhaltet keine Wertung und umfasst im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich alle Geschlechter.
3 So z.B. zum Sachstand der Digitalisierung der Steuerverwaltung BT-Drs. 19/19733, zur Einführung von einheitlichen Schnittstellen BT-Drs. 19/21296, zur Reform der Ausbildung der Steuerbeamten BT-Drs. 19/23217, zu Digitalen Finanzämtern BT-Drs. 19/21383, zu automationsfreundlichen und digitaltauglichen Steuergesetzen BT-Drs. 19/28391, zur Künstlichen Intelligenz in der Finanzverwaltung BT-Drs. 19/29429 oder auf Landesebene z.B. Große Anfrage zur Lage und Entwicklung der schleswigholsteinischen Steuerverwaltung - LT SH Drs. 16/824, Große Anfrage zur Situation der Steuerverwaltung in Baden-Württemberg - LT BW Drs. 16/5889, Kleine Anfrage zu flexiblen und digitalen Arbeitsformen in der Steuerverwaltung - LT Hessen Drs. 20/5307.
Kapitel 2
Formale Zustandsbeschreibung der Steuerverwaltung4
2.1 Struktur der Steuerverwaltung
Die Steuerverwaltungen weltweit unterscheiden sich hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Strukturen. Zentralisierte Varianten verfügen über eine autonome Steuerverwaltungseinheit mit eventuellen Untergliederungen; dezentralisierte über mehrere autonome Steuerverwaltungseinheiten mit möglichen Untergliederungen. Nachfolgend sollen die Auswirkungen der jeweiligen Organisationsform auf Entscheidungsfindungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung umrissen werden, bevor auf die historischen und rechtlichen Besonderheiten der deutschen Steuerverwaltung eingegangen wird.
2.1.1 Zentralisierte und dezentralisierte Steuerverwaltungen
Martinez-Vazquez und Timofeev differenzieren noch detaillierter in Formen mit einer einzigen zentralisierten Steuerbehörde, unabhängige Steuerbehörden auf verschiedenen Regierungsebenen, gemischte Modelle der Steuerverwaltung sowie vollständig dezentralisierte Steuerbehörden [Martinez-Vazquez & Timofeev, 2005, S. 4]. Eine zentrale Steuerverwaltung bündelt die Verantwortung für die Administration und Durchsetzung aller Steuern auf staatlicher Ebene (zentralisierte Steuerverwaltung). Ämter existieren meist auf regionaler und lokaler Ebene [Vehorn & Ahmad, 1997, S. 112]. Als vorteilhaft für die digitale Transformation könnten sich folgende Attribute erweisen: die einheitliche Organisationsstruktur, eine klare Kompetenzverteilung, einheitliche Verfahren und Datenverarbeitungen sowie einheitliche Schulungen und Arbeitsabläufe [Senger, 2009, S. 102]. Senger geht allerdings von einer geringeren Innovationsfähigkeit zentralisierter Steuerverwaltungen aus, wobei dies angesichts der Erfolge anderer zentralisierter Behörden (u.a. Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Rentenversicherung Bund) zu hinterfragen sein dürfte. Martinez-Vazquez und Timofeev sehen hier eine stärkere Spezialisierung des Personals und eine optimierte Ressourcennutzung durch Skaleneffekte, insbesondere im Hinblick auf den Einsatz von Computertechnik und IT-Experten [Martinez-Vazquez & Timofeev, 2005, S. 5 f.].
Den Formen dezentraler Steuerverwaltungen ist gemein, dass Steuern und steuerrechtliche Kompetenzen aufgeteilt sind. Grundsätzlich kann die Tatsache, dass jede staatliche Ebene Steuern erheben kann, als charakteristisches Merkmal angesehen werden. Senger sieht hierbei unter anderem Vorteile einer größeren Flexibilität der Verwaltung und einer größeren Freiheit, lokalen Präferenzen zu folgen. Er hebt aber auch die Nachteile hervor, die sich aus einem möglichen Verlust an Effektivität aufgrund mangelnder Zusammenarbeit zwischen den Behörden und den unterschiedlichen Verfahren, Gesetzen und Formularen für die Steuerzahler ergeben. Bezogen auf die Herausforderungen der digitalen Transformation könnte sich dieser Umstand, bei dem viele Ansprechpartner zu einem Konsens gebracht werden müssen, als nachteilig erweisen. Darüber hinaus gelten die Verwaltungskosten solch einer Steuerverwaltung insgesamt als höher [OECD, 2006, S. 107]. Überdies dürfte die Gleichmäßigkeit der Besteuerung überregional schwieriger sicherzustellen sein.
2.1.2 Historische Entwicklung der Steuerverwaltung in Deutschland
Die deutsche Steuerverwaltung wies in ihrer Geschichte verschiedene der zuvor beschriebenen Formen auf. Bis 1919, mithin vor Ende des ersten Weltkriegs, war die Verwaltung dezentral organisiert, wodurch die Erhebung und Verwaltung der Steuern weitgehend den einzelnen Ländern auf ihrem Gebiet oblagen [Langenberg, 1948, S. 13]. Ab 1919 bis zum Ende des zweiten Weltkriegs wurde die Struktur der Steuerverwaltung zentralisiert. Alle Befugnisse und Zuständigkeiten wurden von den Gliedstaaten auf die Weimarer Republik bzw. später das Deutsche Reich übertragen. Während des Nationalsozialismus kamen der Zentralverwaltung eine erhebliche Macht und weitreichende Eingriffsrechte zu, welche letztlich auch entscheidenden Anteil an der Ausplünderung und Enteignung der jüdischen Bevölkerung hatten [Friedensberger, 2002, S. 11]. Insoweit kann nachvollzogen werden, weshalb die komplexe und übermächtige Reichsfinanzverwaltung von den Alliierten grundsätzlich kritisch gesehen wurde.
Vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland (BRD) wurde die Reichsfinanzverwaltung zerschlagen und die Westalliierten übertrugen die ihnen vertrauten Steuerverwaltungssysteme in ihre jeweiligen Besatzungszonen. Es entstand eine Mischung aus zentralen und dezentralen Steuerverwaltungen. Die amerikanische und britische Besatzungsmacht bevorzugte jeweils die zentrale, die französische Besatzungsmacht hingegen die dezentrale Steuerverwaltung. Diese geschichtliche Entwicklung und den Aufbau der Finanzverwaltungen hat Senger mit Verweisen auf weiterführende Literatur beschrieben [Senger, 2009, S. 38 ff.].
Obwohl der Parlamentarische Rat im Jahr 1949 bei der Verabschiedung des Grundgesetzes eine zentrale Steuerverwaltung zunächst favorisierte, lehnten die Alliierten dies in letzter Minute ab, da die Verhandlungen sonst zu scheitern drohten [Senger, 2009, S. 47]. Bis heute ist die dezentrale und gemeinsame Steuerverwaltung für die BRD in Artikel 108 GG verfassungsrechtlich festgeschrieben, wodurch für etwaige Änderungsund Anpassungsbestrebungen formale und hinsichtlich der Zustimmungserfordernisse im Parlament höhere Grenzen bestehen. Die heutige Dezentralisierung führt sowohl zu Vor- als auch zu Nachteilen. Erstere ergeben sich beispielsweise, weil die Beschäftigten mehr Verantwortung übernehmen können, die politischen und verfassungsrechtlichen Festlegungen besser repräsentiert oder bestimmte Steuerarten (z.B. Objektsteuern) näher an der Quelle verwaltet werden. Die Nachteile sind in einer möglichen Doppelbesteuerung, der potenziell ungleichen Behandlung von Steuersubjekten und der Missbrauchsgefahr von Steuerpolitik als Standortpolitik zu sehen [WD, 2010, S. 5]. Hinsichtlich der Planung, Steuerung und Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben stellt sich der erhöhte Koordinationsund Abstimmungsaufwand nachteilig dar.
2.1.3 Verfassungsrechtliche Vorgaben
Die Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und Ertragskompetenzen sind für Bund und Länder im Grundgesetz in Form einer Finanzverfassung (Artikel 104a bis 108 GG) geregelt. Für die Konkretisierung der Verfassungsbestimmungen wurde das Gesetz über die Finanzverwaltung (FVG) erlassen, in welchem auch die Organisation bzw. Definition von Bundes- und Landesfinanzbehörden zu finden sind. Die deutsche Steuerverwaltung gliedert sich entsprechend der Abbildung 2.1 in eine Bundessteuerverwaltung und 16 weitere Landessteuerverwaltungen.
Als Bundesoberbehörde nimmt das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) mit ca. 2.400 Beschäftigten im Jahr 2021 die steuerlichen Interessen des Bundes wahr und übt mehr als 80 Aufgaben mit nationalen oder internationalen Bezügen aus [BZSt, 2022]. Solche Aufgaben sind u.a. in § 5 FVG festgelegt. Die Behörde ist aus der Vorgängerbehörde Bundesamt für Finanzen (BfF) im Jahr 2006 hervorgegangen und unterhält Steuerabteilungen (nationale Steuern und Umsatzsteuer), Sondereinheiten zum Kapitalmarkt und zum internationalen Informationsaustausch sowie die Bundesbetriebsprüfung.
Abbildung 2.1: Aufbau der Finanzverwaltung nach dem FVG [BMF, 2018]
Die Landessteuerverwaltungen nehmen ihre steuerlichen Kernaufgaben mithilfe der obersten Landesbehörden, der Finanzämter als örtliche Behörden sowie der Landesoberbehörden (auch Landesmittelbehörden) wahr. Zu letzteren zählen auch die in einigen Bundesländern noch vorhandenen Oberfinanzdirektionen (OFD). Rechenzentren der Länder bzw. Technische Finanzämter existieren als örtliche oder mittlere Landesbehörden, als Teil der Verwaltung oder wurden an Servicedienstleister ausgelagert [Heller, 2022, S. 29].
Das Grundgesetz unterscheidet gezielt die Verwaltung von Bundesund Landessteuern. Bundessteuern sind die in Artikel 108 Absatz 1 GG der Bundesfinanzverwaltung zugewiesenen Steuern. Nach Artikel 108 Absatz 3 Satz 1 GG werden die Landesfinanzbehörden insoweit im Auftrag des Bundes tätig (Bundesauftragsverwaltung). Die Länder verwalten darüber hinaus alle „übrigen Steuern“ entsprechend Artikel 83 i.V.m. 108 Absatz 2 Satz 1 GG in eigener Angelegenheit. Diese strikte Trennung schließt Mitplanungs-, Mitverwaltungs- und Mitentscheidungsbefugnisse des Bundes aus, sofern nichts anderes ausdrücklich durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrats (Artikel 108 Absatz 2 Satz 2 GG) geregelt ist [WD, 2020b, S. 5]. Der Steuervollzug obliegt damit den Ländern. Eine Mischverwaltung ist nur in den vom Grundgesetz ausdrücklich und präzise beschriebenen Fallgestaltungen zulässig (etwa Artikel 108 Absatz 4 und 4a GG). Eine Kooperation der verschiedenen Gebietskörperschaften ist also stets daraufhin zu überprüfen, ob diese einer unzulässigen Mischverwaltung gleichkommt. Allerdings bedeutet das nicht, dass Kompetenzverschiebungen mithilfe von Grundgesetz-Änderungen unmöglich und durch die „Ewigkeitsgarantie“ des Artikel 79 Absatz 3 GG ausgeschlossen wären [Perschau, 1998, S. 2]. Vielmehr bedarf es realistischer Kompensationen, wobei den Ländern prinzipiell die Organisationshoheit über ihre Verwaltungsbehörden und Verwaltungsbeschäftigten sowie ein Mitwirkungsrecht an der Bundesgesetzgebung verbleiben muss [Bernhardt, 2018, S. 10].
2.2 Kooperationen der Länder bei der Entwicklung von IT-Lösungen
Seit den 1960er Jahren arbeiten die Bundesländer im Bereich der Steuerverwaltung auf dem Gebiet der Informationstechnik zusammen. Viele der bisherigen Projekte kamen jedoch an ihre Grenzen. Im Folgenden sollen die frühere, besonders aber die aktuelle Kooperation der Steuerverwaltungen bei der Entwicklung von IT-Lösungen betrachtet werden.
2.2.1 Programmierverbünde IABV, FISCUS und EOSS
Beim „Integrierten Automatisierten Besteuerungs-Verfahren (IABV)“ unterstützten sich die Länder im Bereich der Steuererhebung. Diese Zusammenarbeit wurde bereits als „große[r] Programmierverbund“ [WD, 2020a, S. 5] bezeichnet. Die Länder Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schleswig-Holstein waren an der Mitarbeit nicht interessiert und so kam es zu Parallellösungen [ebd., S. 5]. Abgesehen vom IABV unterhielten folgende Länder letztlich eigene Programmierverbünde für den Festsetzungsbereich: Bayern gemeinsam mit dem Saarland, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein [Senger, 2009, S. 144].
Das „Föderale Integrierte Standardisierte computerunterstützte Steuersystem (FISCUS)“ sollte ab 1991 bis zum Jahr 2006 einheitliche Systeme in allen Bundesländern zum Einsatz bringen. Die FISCUS GmbH wurde als IT-Dienstleister für die Steuerverwaltungen geschaffen. Personalprobleme, Entwicklungsrückstände, Mängel im Projektmanagement und die Verweigerung der Unterstützung durch einige Länder brachten FISCUS als Gesamtvorhaben zum Scheitern [Senger, 2009, S. 144 f.]. Die Kosten explodierten von ursprünglichen 168,7 Mio. Euro auf ca. 400 Mio. Euro [BRH, 2006, S. 148].
In Deutschland gab es zwischenzeitlich sogar sechs parallele Programmierverbünde der Steuerverwaltungen. Die ursprünglichen Planungen und die bestehenden Unterschiede hat Senger bis zum Jahr 2009 ausführlich untersucht [Senger, 2009, S. 147 ff.]. Bayern gemeinsam mit dem Saarland schlugen mit dem Verbund der „Evolutionär Orientierten SteuerSoftware (EOSS)“ im Jahr 2002 einen alternativen Weg ein und konnten die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zur Mitarbeit überzeugen. Die Bundesländer Berlin, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein übernahmen die EOSS-Verfahren als „Zwischenschritt auf dem Weg zu KONSENS“ [Senatsverwaltung für Finanzen, 2005, S. 24]. Weitere Bundesländer schlossen sich den EOSS-Verfahren im Laufe der Zeit an, unter anderem aber das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen nicht.
Die Brüche innerhalb des Besteuerungsverfahrens beim Wechsel von Zuständigkeiten im Bundesgebiet, inkompatible Landesfachverfahren und Kommunikationsdefizite sowie Doppelstrukturen in der Entwicklungs- und Programmierarbeit konnten so noch immer nicht beseitigt werden. Das Ziel deutschlandweiter, einheitlicher IT-Verfahren für die Steuerverwaltungen war zu diesem Zeitpunkt noch zu stark den landesspezifischen Vorbehalten und Überlegungen ausgesetzt. Daher musste das Zusammenwirken erneut auf den Prüfstand gestellt werden.
2.2.2 Der KONSENS-Verbund
Erst im Rahmen des „Koordinierten Neuen Software-Entwicklung der Steuerverwaltung (KONSENS)“ konnte die in die Kritik geratene Zusammenarbeit im Bereich der Informationstechnologie (IT) wiederbelebt werden. Nach einem Beschluss der Finanzministerkonferenz vom 09.07.2004 sollte die Entwicklung, die Beschaffung und der Einsatz der Software für das Besteuerungsverfahren gemeinsam nach einem abgestimmten Verfahren erfolgen [Senatsverwaltung für Finanzen, 2005, S. 3]. Vereinbart wurden eine neue Organisationsstruktur und die Einrichtung von Steuerungsgremien. Die Finanzministerkonferenz beschloss daraufhin am 23.06.2005, dass sich die Länder zu ihrer Verantwortung für die Softwareentwicklung bekennen, das Vorhaben KONSENS einschließlich ELSTER vorantreiben und die Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen für den Einsatz dieser Software unterstützen werden. Die föderale Zusammenarbeit wurde somit angepasst und die bisherige Arbeit der Fiscus GmbH obsolet. Die Finanzminister regten zugleich den Entwurf eines Verwaltungsabkommens KONSENS zum 31.03.2006 an, welches durch eine fortgeschriebene Finanzplanung und einen Vorschlag für ein effektives Finanzcontrolling ergänzt wurde [ebd., 15 f.]. Das Verwaltungsabkommen trat am 01.01.2007 in Kraft und basiert auf der Grundlage von Artikel 108 Absatz 4 GG in Verbindung mit § 20 FVG. Die bisherigen Vereinbarungen des Abkommens zur Regelung der Zusammenarbeit bei der Nutzung der Informationstechnik im Besteuerungsverfahren (Projekt FISCUS) vom 03.12.2002 sowie der EOSS-Kooperationsvertrag wurden aufgelöst.
Das Gesamtvorhaben KONSENS soll der „Vereinheitlichung und Modernisierung der IT-Unterstützung in den Finanzämtern sowie der Verbesserung der Services für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Steuerberaterschaft“ dienen und zugleich der „Markenname der Steuer-Software zur Realisierung digitaler Verwaltungsleistungen in der Steuerverwaltung“ sein [KONSENS, 2021b, S. 3]. Die vorherige Bundesregierung sah „[d]as Vorhaben KONSENS [als] Ausfluss der föderalen Struktur in der Steuerverwaltung“ mit dem Ziel, „die IT-Kooperation von Bund und Ländern zu vertiefen, die IT-Landschaft auch zukünftig zu modernisieren und für die Herausforderungen durch eine zunehmende Digitalisierung in der Steuerverwaltung weiter vorzubereiten“ [Deutscher Bundestag, 2021d, S. 8].
Das Gesetz über die Koordinierung der Entwicklung und des Einsatzes neuer Software der Steuerverwaltung (KONSENS-Gesetz - KONSENSG) vom 14.08.2017 (BGBl. I S. 3122, 3129) ergänzt seit dem 01.01.2019 das Verwaltungsabkommen und regelt die Entwicklung und den Einsatz einheitlicher Software im Bereich der Steuerverwaltung. Als Bundesgesetz kann sich das Gesetz nur auf Steuern beziehen, die die Länder im Auftrag des Bundes verwalten. Insoweit gilt für die originären Landessteuern lediglich das Verwaltungsabkommen, wobei die Regelungsinhalte des Gesetzes hier sinngemäß Anwendung finden [KONSENS, 2021b, S. 7]. Sowohl das Verwaltungsabkommen als auch das KONSENS-G gelten nicht für ausschließlich durch den Bund verwaltete Steuern [Heller, 2022, S. 78].
KONSENS fokussiert eine „Vereinheitlichung und dauerhafte Weiterentwicklung sowie Modernisierung der in den Ländern und beim Bund eingesetzten IT des Besteuerungsverfahrens“ sowie „die schrittweise Ablösung der bestehenden heterogenen IT-Strukturen der Länder“ [KONSENS, 2021b, S. 7]. Diesem Gesamtziel wird „aufgrund der finanzielle[n] Beteiligung des Bundes“ und „[a]ngesichts der […] zunehmenden Digitalisierung des Besteuerungsverfahrens“ eine zentrale Rolle zur Gewährung der Funktionsfähigkeit der Steuerverwaltung“ [Deutscher Bundestag, 2021h, S. 1] beigemessen. Mehr noch gilt KONSENS gemeinsam mit der IT der Steuerverwaltung als „Garant für die Sicherung unseres Gemeinwohls, indem Steuern termingerecht und korrekt festgesetzt und erhoben werden“ [KONSENS, 2021a]. Die Bezeichnung als KONSENS-Vorhaben erscheint dabei durchaus berechtigt, weil sich die Vereinheitlichung der in den Steuerverwaltungen der Länder eingesetzten IT nicht wie ein einzelnes Projekt abschließen und damit ein Zielzustand erreichen lässt, sondern aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung ständig fortzuentwickeln bzw. weiterzudenken ist [Deutscher Bundestag, 2021h, S. 2]. Das Vorhaben wird damit zur „Daueraufgabe“ [KONSENS, 2021b, S. 8].
Nach dem KONSENS-G bestimmt sich u.a. auch die Organisation des Verbundes. Eine wichtige Unterscheidung im Rahmen dieser Arbeit ist jene in die Rolle als Auftraggeber bzw. Auftragnehmer. Die Auftraggeber sind alle Bundesländer und der Bund. Dieses Gremium befasst sich mit den Grundsätzen der Zusammenarbeit und stellt die oberste Entscheidungsebene aus Referatsleitungen Automation (Steuer) bzw. Organisation von allen Bundesländern und Vertretern des Bundes dar. Auftragnehmer sind die Länder Baden-Württemberg (BW), Bayern (BY), Hessen (HE), Niedersachen (NI), Nordrhein-Westfalen (NW) und der Bund. Gemeinsam bilden sie unter Vorsitz des Bundes die Steuerungsgruppe IT, welche als Generalauftragnehmer bezeichnet wird und für Fragen zur Strategie und Architektur zuständig ist. Ergänzend kommt eine Steuerungsgruppe Organisation für aufbau- und ablauforganisatorische Beschlüsse zusammen [KONSENS, 2021b, S. 11 f.].
Daneben bestehen weitere Einrichtungen wie die Geschäftsstelle IT beim BZSt, die Gesamtleitung, die Zentralen Organisationseinheiten sowie die KONSENS-Arbeitsgruppen. Letztere sind insoweit wichtig, weil hier zum Beispiel Fragen zum Marketing vom Verfahren ELSTER (Elektronische Steuererklärung), einer der ersten, bekanntesten und erfolgreichsten e-Government-Anwendungen Deutschlands, oder zum Finanzmanagement von KONSENS erörtert werden.
2.2.2.1 Entwicklungsfortschritte und deren Finanzierungsbedarf
Im Vergleich zu den vorhergehenden Kooperationen kann KONSENS auf viele erfolgreiche Verfahrenseinführungen [KONSENS, 2021b, S. 23 f.] und die Errungenschaften im Zusammenhang mit ELSTER verweisen [KONSENS, 2021a, S. 4 f.]. In seinem Jahresbericht verwies der Nationale Normenkontrollrat (NKR) im Jahr 2018 positiv darauf, dass die Steuerverwaltung mit Angeboten wie ELSTER oder der vorausgefüllten Steuererklärung kontinuierlich an der Digitalisierung ihrer internen Verfahren und externen Angebote arbeite [NKR, 2018, S. 36]. Insbesondere sei KONSENS ein Beispiel für eine erfolgreiche gemeinsame Bund-Länder-Zusammenarbeit bei großen IT-Projekten. Maßgeblich für den Erfolg sei, dass sich Länder und Bund in einem mehr als 10 Jahre alten Verwaltungsabkommen dazu verpflichtet hätten, sich organisatorisch aneinander anzupassen und die Programmierung fünf Ländern übertragen worden sei. Ende 2017 seien bereits 159 einheitliche Produkte in allen Ländern im Einsatz gewesen und in den Finanzämtern werde „fast jede Tätigkeit IT-unterstützt durchgeführt und über querschnittliche Verfahren verbunden“. Das Ziel sei erreicht worden, in allen 16 Ländern identische, leistungsfähige Software einzusetzen, einheitliche Benutzeroberflächen zu verwenden und beim Austausch mit anderen Behörden nach dem „Once-Only-Prinzip“5 Daten auszutauschen. Insgesamt würden dadurch Bürokratiekosten für die Finanzämter, für die Bürger und die Unternehmen reduziert.
Die vorherige Bundesregierung ging davon aus, dass sie angemessen im Vorhaben KONSENS an der Verwirklichung der weiteren Digitalisierung beteiligt gewesen sei und die Digitalisierung der steuerlich relevanten Prozesse entschlossen vorangetrieben werde [Deutscher Bundestag, 2020g, S. 2]. Insbesondere scheint die neue Gesamtleitung von KONSENS „als Ansprechpartner für die Politik“ [KONSENS, 2020, S. 7] die Erwartungen zu erfüllen, weil hierüber eine Beschleunigung durch die zentrale Steuerung möglich ist. Der Stresstest in Form kurzfristiger politischer Entscheidungen und deren Umsetzung im Bereich der IT in der Steuerverwaltung wurde in der Corona-Pandemie deutlich, zum Beispiel bei den Corona-Hilfspaketen, der Senkung des Umsatzsteuersatzes, der Einführung der Grundrente oder der Erhöhung von Freibeträgen. In diesem Kontext wird davon ausgegangen, dass „die neuen Strukturen KONSENS nach außen stärken“ und die Abstimmungsprozesse verschlankt werden [ebd., 7].
Die Finanzierung von KONSENS erfolgt durch Bund und Länder gemeinsam. Hierzu sind Beiträge der Länder nach dem Königsteiner Schlüssel vorgesehen. Das bedeutet, dass jedes Land an gemeinsamen Finanzierungsaufgaben nach einem bestimmten Anteil beteiligt wird. Dieser richtet sich zu zwei Dritteln nach dem Steueraufkommen und zu einem Drittel nach der Bevölkerungszahl des jeweiligen Landes. Der Bund beteiligt sich ebenfalls am Aufwand und stellt jährlich einen erfolgsabhängigen Zuschuss zur Verfügung. Die Gesamtausgaben von Bund und Ländern sind kontinuierlich gewachsen und lassen sich der Tabelle 2.1 entnehmen.
Tabelle 2.1: Ausgaben für KONSENS ab 2014 [Deutscher Bundestag, 2021h]
Ungefähr ein Drittel der Kosten entfällt auf die Entwicklung der Software, wobei die Softwarepflege-, Betriebs- und Verwaltungskosten den höheren Anteil bilden [Deutscher Bundestag, 2021h, S. 2 f.]. Die größten Ausgabenzuwächse entfallen auf die Jahre 2017 und 2018, also auf die Zeit unmittelbar vor Inkrafttreten des KONSENS-G, in der jedoch schon konkrete Planungen bestanden und Umsetzungsarbeiten stattfanden. Bei Angabe der Gesamtausgaben für das Jahr 2020 war allerdings das Budgetjahr noch nicht abgeschlossen [ebd., 3].
Tabelle 2.2: Budget- und Finanzplanung für KONSENS bis 2024 [Deutscher Bundestag, 2021h])
Darüber hinaus besteht nach Schätzung der vorherigen Bundesregierung für KONSENS bis zum Jahr 2024 die in der Tabelle 2.2 dargestellte Budget- und Finanzplanung. Diese entspricht damit dem Beschluss der Finanzminister vom 12.11.2020, die Gesamtausgaben um jährlich 5% zu erhöhen. Inwieweit die Länder allerdings bereit wären, zur Schaffung einer echten digitalen Steuerverwaltung ihre (finanziellen) Beiträge über den Beschluss der Finanzministerkonferenz hinaus verbindlich zu erhöhen, blieb bisher fraglich. Eine Tendenz hierzu wird im Rahmen dieser Arbeit (Kapitel 3.4.1, S. 66) veranschaulicht. Gleichwohl zeigte sich die letzte Bundesregierung nicht aufgeschlossen und verwies darauf, dass sich das „Verfahren und die festgelegten Finanzierungsanteile […] bewährt [hätten] und […] beibehalten“ werden sollten [Deutscher Bundestag, 2020g, S. 4]. Trotz der kontinuierlich gestiegenen Gesamtausgaben hat der Bund bisher Anreize zur Beschleunigung der Digitalisierung in KONSENS stets über Erhöhungen seines erfolgsabhängigen Bundeszuschusses setzen müssen. Es bleibt zu vermuten, dass dies auch in Zukunft das gängige Prozedere sein wird.
2.2.2.2 KONSENS-Verfahren und weitere Projekte