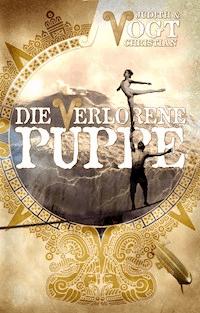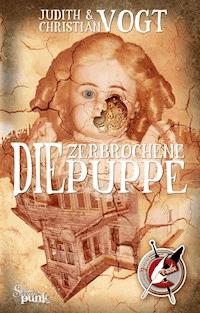9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Geheimnis der Zeichen
- Sprache: Deutsch
Der Stadtstaat Sygna, bekannt für seine einzigartige Magie, befindet sich im Krieg mit dem Kaiserreich Aquintien. Ein Kampf klein gegen groß, aber dank ihrer Zeichenmagie schafft es die Rebellenarmee von Sygna, sich zu behaupten. Bei dem Versuch, das Kriegsglück zu wenden, haben aquinzische Zauberkundige jedoch einen unkontrollierbaren Riss ins mythische Schattenreich geöffnet, der nun droht, nicht nur Sygna zu verschlingen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 884
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autoren
Titel
Impressum
Karte
Widmung
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Dank
Über das Buch
Der Stadtstaat Sygna, bekannt für seine einzigartige Magie, befindet sich im Krieg mit dem Kaiserreich Aquintien. Ein Kampf klein gegen groß, aber dank ihrer Zeichenmagie schafft es die Rebellenarmee von Sygna, sich zu behaupten. Bei dem Versuch, das Kriegsglück zu wenden, haben aquinzische Zauberkundige jedoch einen unkontrollierbaren Riss ins mythische Schattenreich geöffnet, der nun droht, nicht nur Sygna zu verschlingen …
Über die Autoren
Judith C. Vogt wurde 1981 geboren und wuchs im HeinrichBöll-Ort Langenbroich auf. Sie ist gelernte Buchhändlerin. Christian Vogt, geboren 1979, stammt aus Kommern, studierte in Aachen und ist Physiker. Gemeinsam haben sie zahlreiche Romane veröffentlicht, darunter auch den Steampunk-Roman Die zerbrochene Puppe, für den sie 2013 den DEUTSCHEN PHANTASTIK PREIS in der Kategorie »Bester deutschsprachiger Roman« erhielten. 2014 gewannen sie nochmals den DEUTSCHEN PHANTASTIK PREIS, diesmal für die beste Anthologie. Das Ehepaar wohnt mit seinen Kindern in Aachen.
Judith & Christian Vogt
Die 13 Gezeichneten
Der Krumme Mann der Tiefe
ROMAN
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch Castle Gate Agency, Literarische Agentur Harald Kiesel, 69198 Schriesheim (www.castlegate-agency.com)
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Hanka Leò, BerlinKartenillustration: © Hannah Möllmann, KölnTitelillustration: © Christof GrobelskiUmschlaggestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.deE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-7835-1
www.luebbe.dewww.lesejury.de
Wir widmen dieses Buch Melli und Tobi, trotz des fehlenden »Kaffee-Redemption-Arcs«. Es ist außerdem für Frank, nicht nur aus dem offensichtlichen Grund, sondern auch aus allen anderen Gründen.
Kapitel I
»Klarschiff zum Rammmanöver!«, hallte der Schrei über das Deck. »Segel einholen. Ruder hart Steuerbord. Dreht sie in den Wind!«
»Aye!«, brüllte Lidia Vierweg zurück und reagierte sofort. Auch ihr Herzschlag reagierte sofort. Hatte er zuvor mit aller Gewalt in ihrem Brustkorb gewütet, so pumpte er mit dem Blut nun auch Nervosität und Todesangst durch ihre Adern – und das überwältigende Gefühl, die Lage im Griff zu haben.
Sie zerrte mit aller Kraft am Steuerrad, während Matrosen in die Wanten der Brigg strömten wie Ameisen über ein Stück Kuchen, um dort mit oft geübten Handgriffen die Segel zu raffen.
Schräg hinter Lidia überwachte die Lachende Ye die Ausführung ihrer Anweisungen, wie immer kerzengerade in ihrer fremdländischen Uniform, die Arme hinter dem Rücken verschränkt und der brisanten Lage zum Trotz mit unbewegter Miene. Lidia konnte sich nicht erklären, wie die Lachende Ye zu ihrem Namen gekommen war, denn sie hatte die Kapitänin noch nicht einmal lächeln sehen – geschweige denn lachen.
Die Siljonicz schwang den schlanken Rumpf herum, der Wind drückte sie in Schräglage auf die Backbordseite. Schnell verloren sie an Fahrt.
Ihre Gegner mussten sie für verrückt halten. Sie befanden sich bereits in einer misslichen Lage, und mit eingeholten Segeln hockte ihre Brigg jetzt geradezu auf dem Präsentierteller, egal, wie wendig das Schiff sein mochte – einer Breitseite wich man nicht einfach so aus! Eine Inselkette mit zahlreichen Untiefen schränkte ihren Kurs an Backbord ein, in ihrem Rücken näherte sich eine aquinzische Fregatte. Eine weitere fuhr neben ihnen, mittlerweile war sie auf Kanonenreichweite heran, und auf den grauen Wellen eines aufgewühlten Meeres wirkte sie wie ein sagenhafter Leviathan. Ein Leviathan mit über einem Dutzend geöffneter Stückpforten. Wie Lidia diesen Anblick hasste – und dennoch brauste eine Aufregung durch ihren Körper, dass sie beinahe gejauchzt hätte.
Das aquinzische Kriegsschiff an Steuerbord zögerte nicht und nutzte seine Chance. Feuerzungen blitzten in den Stückpforten auf, dicke Rauchsäulen füllten den Raum zwischen den beiden Schiffen.
»Deckung!«, schrie Lidia.
Die Besatzung zog die Köpfe ein, als die Kugeln in Deck und Bordwand einschlugen. Wolken aus Holzsplittern erfüllten die Luft, Deckaufbauten wurden zerfetzt.
Mit einem lang gezogenen Schrei stürzte ein Matrose aus den Wanten in den Dardantik.
Durch die Schräglage der Siljonicz wurden das Deck und damit der Großteil der Mannschaft vor dem Schlimmsten bewahrt. Zahlreiche dumpfe, prasselnde Einschläge zeugten von Rumpftreffern. Für ein gewöhnliches Schiff hätte das fatal geendet, nach einer solchen Salve waren Lecks unterhalb der Wasserlinie bei ihrer Schräglage nicht unwahrscheinlich. Aber die Siljonicz war kein gewöhnliches Schiff: Alle paar Meter waren Zeichen in das Eichenholz des Rumpfs geritzt, das Holz war hart und unnachgiebig, und Kanonenkugeln dieses Kalibers und aus dieser Entfernung prallten schlicht an der Bordwand ab.
Klatschend tauchte der Rumpf der Siljonicz wieder vollständig ins Wasser, und die Brigg hielt quälend langsam auf die Fregatte zu, deren Geschützmannschaften gerade sicherlich für eine weitere Salve nachluden – und aus nächster Nähe mochte das Ergebnis anders aussehen! Die Matrosen der Siljonicz überprüften die Schäden, kümmerten sich um die Verletzten. Die meisten Seeleute, Männer wie Frauen, hatten ihre Hemden vor dem nahenden Gefecht ausgezogen und kämpften mit nackten Oberkörpern. Sie hatten Lidia erklärt, dass man halb nackt besser dran sei, wenn man von umherfliegenden Holzsplittern getroffen wurde, weil keine Stofffasern in die Wunde gelangen und eine Entzündung verursachen konnten. Aber Lidia Vierweg war zu sehr Sygnaerin, um sich dieser Sitte anzuschließen.
Sie blickte sich um. Vor ihr ein mächtiges Kriegsschiff der Aquinzischen Nation: drei Masten, ein vollbestücktes Kanonendeck – über dreihundert Seelen, die Lidia und ihre Leute tot am Grund des Meeres sehen wollten. Welch ein armseliges Bild musste ihre zweimastige Brigg abgeben, als sie auf die Fregatte zuschlich! Keine ihrer eigenen, mühsam von aufgebrachten aquinzischen Schiffen erbeuteten Kanonen war auf den Feind ausgerichtet, während sie ihrerseits von achtzehn Geschützen bedroht wurden. Gegen diese Übermacht hätte ihre Handvoll Kanonen und Drehbassen ohnehin nichts ausgerichtet.
Rasch schloss der zweite dieser waffenstarrenden, aber dennoch schnellen Segler zu ihnen auf, der sich zuvor an ihrem Heck befunden hatte und jetzt von Steuerbord nahte. Weiter hinten am Horizont rauchten Trümmer: die traurigen Reste der kleinen Flottille, die von der Siljonicz angeführt worden war. Die Brigantine Blutiger Morgen versank im Meer, nur ihr Bug ragte noch aus dem Wasser. Der Schoner T’nada war von den Aquinzacken einfach in Stücke geschossen worden. Ihre Besatzungsmitglieder waren als reiche Männer und Frauen gestorben, obwohl auch ihr Bug von Zeichen verstärkt gewesen war – aber all das Gold brachte ihnen nun nichts mehr.
Es war eine Falle gewesen, da war sich Lidia mittlerweile sicher. Aber die Siljonicz war kein gewöhnliches Schiff, und sie war keine gewöhnliche Rudergängerin. Sie würden sich hier schon rausboxen. Lidia wandte sich zur Lachenden Ye um. Die nickte grimmig, und Lidia nickte ebenfalls. Sie wusste, was Ye in ihren Augen sah: filigrane braune Linien, verwobene Muster. Das Hölzerne Urzeichen. Lidia fasste das Steuerrad fester, fühlte das Holz des Schiffs unter ihren nackten Füßen. Sie schloss die Augen, spürte die Fasern, das immer noch lebendige Material, aus dem das Schiff bestand, und sie versetzte es mit der Macht des Urzeichens in Bewegung.
Mit einem Ruck nahm die Siljonicz Fahrt auf. Sie beschleunigte derart schnell gegen den Wind, dass sich ihr Bug ein Stück aus dem Wasser hob. Und gleichzeitig verformte sich das Schiff. Lidia nutzte die Fähigkeit des Eichenholzes zu wachsen, zerrte an der Wuchsrichtung und verstärkte so den Rumpf am Bug. Knotige Wülste bildeten sich aus, um die Brigg vor dem Unvermeidlichen zu schützen. Dornen wuchsen daraus hervor, beindicke Sporne und mannslange Sicheln.
Die Geschütze der Fregatte feuerten eine weitere Salve, Drehbassen und Musketen spuckten ihre tödliche Ladung auf das Deck der Siljonicz. Entermesser waren ausgegeben worden, für alle Fälle. Aber Lidia wusste, dass es diesmal nicht zu einem Kampf Deck an Deck kommen würde. Sie wollten keine Prise machen, sie wollten einfach nur lebendig entkommen – und wenn das bedeutete, dass sie dabei Rache für die Blutiger Morgen und die T’nada nehmen konnten, war das umso besser.
Matrosen auf dem Deck der Siljonicz schrien vor Schmerz und Angst, seit die Kugeln an Bord eingeschlagen waren, dann hörte Lidia Rufe an Bord der Fregatte. Panische Schreie, lauter als die verebbenden an Bord der Siljonicz.
»Festhalten!«, schrie Lidia, und die Besatzung klammerte sich an Seile, Masten und Wanten. Sie wussten, was jetzt folgen würde.
Krachend fuhr der Bug der Brigg in die lange Seite des Kriegsschiffs. Holz brach und splitterte, Körper wurden umhergeschleudert. Schreie und Schüsse mischten sich in den Klang der kollidierenden Schiffskörper. Der Bug der Siljonicz drang ein Stück in den Rumpf der Fregatte ein, glitt dann ab und schob sich an dem größeren Schiff entlang, das stöhnende Klagelaute von sich gab. Dann waren sie auch schon vorbei.
Mehr oder weniger unbeschadet brach die Brigg auf das offene Meer durch. Die Mannschaft machte sich sofort daran, die Segel zu entfalten. Lidia drehte sich um.
Dornen und Sicheln hatten die aquinzische Fregatte der Länge nach aufgerissen. Sie hatte bereits starke Schlagseite. Ein Mast brach ächzend zur Seite weg. Es würde nicht lange dauern, bis sie sank.
Die Aquintianer haben Glück, dachte Lidia. Sie konnten sich vielleicht zu den nahen Inseln retten oder wurden von ihrem Schwesterschiff aufgelesen, das offenbar jegliche Lust an der Verfolgung verloren hatte. Zumindest würden sich diejenigen retten können, die die unter Seeleuten anscheinend als leidensverlängernd angesehene Fähigkeit des Schwimmens beherrschten oder die sich an ein Trümmerstück klammerten. Lidia hatte schließlich dafür gesorgt, dass davon genug zur Verfügung standen. Sie war zwar nicht zimperlich mit den verdammten Aquinzacken, aber sie versuchte, Tote zu vermeiden. Es konnte ja keiner etwas dafür, auf welcher Seite er stand, und sie hatte gehört, dass man viele Soldaten in der Aquinzischen Nation neuerdings zwangsverpflichtete. In diesem Punkt hatte sie in der Lachenden Ye eine Gleichgesinnte gefunden – eine seltene Tugend unter Piraten.
Lidia griff nach dem Werkzeugsymbol des Großen Handwerkers, einem hölzernen Anhänger, der neben zahlreichen Goldketten an einer schlichten Schnur um ihren Hals baumelte, und küsste ihn.
»Wann feiern wir?«, fragte sie ihre Kapitänin.
»Wenn wir die Opfer betrauern«, antwortete Ye, wie stets ohne jede Emotion in der Stimme. »Kurs Luciwa.«
Nur wenig später kam der unabhängige Stadtstaat Luciwa bereits ins Sicht: Die Küstenlinie und die vorgelagerten Inseln waren flach, sodass die spektakuläre Silhouette der Stadt mit ihren irdenen Türmen, ihren gewaltigen Kontoren mit den Gerüsten der Kräne daran, ihren tausend Brücken und den Spielhäusern, in deren bunten Fenstern das Sonnenlicht blitzte, bereits auf viele Seemeilen hinweg zu erkennen war.
Die Siljonicz glitt quer zum Wind rasch dem Hafen entgegen. Lidia Vierweg genoss die Sonne auf ihrer Haut, den Geruch des Salzwassers, die Schreie der Möwen und das Auf und Ab des Schiffs – und Luciwa, verheißungsvoll zu ihrer Rechten. Sie bildete sich ein, bereits den Zuckerrohrschnaps und das scharfe Essen zu riechen, obwohl das sicherlich nur der Einbildung und der Vorfreude geschuldet war.
Luciwa, die Stadt der Hundert Inseln, war unverkennbar und jedem Seefahrer geläufig, der den Dardantik um das Sichelkap herum bereiste. Drei Landmarken stachen besonders hervor und erhoben sich aus dem Gewimmel der Häuser, um jedem Besucher beim Einlaufen in einen der Häfen von der Größe und vom Wohlstand Luciwas zu künden.
Am eindrucksvollsten war der Leuchtturm von Luciwa: Obwohl die Inseln und das Landmassiv der Sichel flach und von Sand und Kalkstein geprägt waren, ragte dem Kap ein wenig vorgelagert eine siebzig Meter hohe Felsnadel aus tiefschwarzem Gestein aus dem Wasser – ob natürlich oder von Menschenhand dorthin geschafft, wusste Lidia nicht. Begabte Baumeister hatten dem Felsen jedenfalls die Form einer kolossalen, göttlichen Frauengestalt verliehen, die den Wellen entstieg. Möwen zogen an ihrem von schwarzen Locken umrahmten Gesicht vorbei. Eine fein gemeißelte Muschelkette schmückte ihren Hals und ein schulterfreies, steinernes Gewand floss an ihr herab bis ins Meer. Dabei reckte sie mit beiden Händen einen übergroßen Schildkrötenpanzer wie eine Feuerschale in die Höhe. Früher mussten darin jede Nacht Unmengen von Holz verbrannt worden sein, um Schiffe vor den Felsen der Küste zu warnen. Heute war eine moderne Linsenapparatur in der Schale errichtet worden, die das Licht einer Petroleumlampe in die Nacht schicken konnte. Lidia bestaunte den Leuchtturm nicht zum ersten Mal, und dennoch war sie jedes Mal aufs Neue ergriffen von diesem gewaltigen und gleichzeitig wunderschönen von Menschenhand geschaffenen Wunder.
Hinter dem Leuchtturm bohrte sich – weniger beeindruckend, aber noch höher – die zweite Landmarke in den Himmel: der Pyramidenturm. Stockwerk um Stockwerk verjüngte sich das Bauwerk mit dem quadratischen Grundriss, aus dessen Lehmfassade in immer gleichen Abständen massive Holzbalken herausragten wie die Stacheln eines Igels. Der Pyramidenturm galt als das höchste Bauwerk der bekannten Welt und diente als Stammsitz einer der noblen Familien der Stadt, deren Namen Lidia zu entfallen pflegten. Sie waren Piraten gegenüber, die aquinzische Kriegsschiffe aufbrachten, nicht feindlich gesinnt – es hieß, sie stellten sogar Kaperbriefe aus, aber falls dem so war, dann sprach die Lachende Ye nicht darüber.
Als dritte Landmarke wachte die massige Seefestung über die Einfahrt zum Kriegshafen wie ein gedrungener Bluthund. Sie war aus dunklen Gesteinsquadern errichtet worden und wies zahlreiche Objekte an ihren Zinnen auf, die mit Tüchern verhangen waren. Angeblich, so hatte man es Lidia erzählt, waren darunter Spiegel verborgen, die für ein Vermögen vor langer Zeit von den Glasermeistern ihrer Heimat Sygna erstanden worden waren. Die gezeichneten Parabolspiegel waren, so hieß es, in der Lage, Lichtstrahlen der Sonne einzufangen und zu bündeln, womit sich Segel und Decks von Schiffen in wenigen Augenblicken in Brand stecken ließen. Das machte einen Überfall auf die Stadt bei Sonnenschein zu einem Ding der Unmöglichkeit. Auch konnte sich Lidia vage daran erinnern, als Kind in Sygna ein Märchen von reichen Prinzen mit schwarzer Hautfarbe gehört zu haben, die einem Meister der Gläsernen Zeichen sein Gewicht in Gold für ein Geheimnis versprochen hatten. Der Mann sandte ihnen seine Werkstücke mit Zeichen, die nur ihm bekannt waren, und versuchte dann, das Geheimnis auch an einen Banditenkönig zu verkaufen, woraufhin ihm die Prinzen seinen Lohn in flüssigem Gold aushändigten und ihn damit überschütteten. Mit seinem qualvollen Tod ging das Geheimnis seiner Zeichen auf immer verloren. Wenn das Märchen einen Funken Wahrheit enthielt, dann war diese Bastion die einzige ihrer Art.
Für Lidias Mannschaft gab es kein flüssiges Gold, doch einen Landgang mit ein paar klimpernden Münzen in der Tasche hatten sie sich verdient. Trotz der wenig erfolgreichen Kaperfahrt reichte es aus, um keine Langeweile aufkommen lassen zu müssen. Und eine Stadt wie Luciwa bot genügend Möglichkeiten, den Beutel etwas zu erleichtern.
Während sie das Schiff in den sicheren Hafen steuerte, merkte Lidia, dass die Aufregung der vergangenen Stunden sich legte und so etwas wie Melancholie zurückließ – Melancholie, einen kleinen Funken Trotz und noch eine Portion mehr Stolz. Wer hätte gedacht, dass sie eines Tages als leibhaftige Piratin die Meere befahren würde? Zumal gerade die Flucht vor der Langeweile ihr dieses Leben beschert hatte – und seit jenem schicksalshaften Tag hatte sie nie wieder diese innere Ödnis befallen. Sie bereute nichts.
Die Seefahrt hatte sie bereits als kleines Mädchen fasziniert. Während der wenigen Male, die sie ihren Vater auf seinen Handelsreisen begleitet hatte, hatte sie Stunden damit zugebracht, auf einem hölzernen Pier zu sitzen und die Masten der großen Segler hinter dem Horizont verschwinden zu sehen, derweil andere Kinder am Wasser gespielt hatten. Sie hatte sich ausgemalt, welche Abenteuer die Seeleute wohl erleben, welche geheimnisvollen Länder sie bereisen, welche Inseln sie entdecken würden. Lidia hatte gern die Häfen der Sichelstaaten, in Riefland oder in Naronne besucht – damals, vor dem Krieg, als das Handelsimperium der Vierwegs noch florierte.
Ihre Brüder waren unfähige, eitle Trottel; Lidia hingegen hatte ein Talent für Zahlen und Verträge. Also hatte ihr Vater, der reichste Monopolist und Handelsmagnat Sygnas, gehofft, dass sie eines Tages die Geschäfte übernehmen würde. Er war in dieser Sache etwas offener als ein Großteil der Sygnaer, die dem Geschäftssinn von Frauen für gewöhnlich misstrauten. Vielleicht, weil er Städte wie Luciwa bereist hatte, während die meisten Handwerker die Stadtmauern zu Hause ein Leben lang nur von innen zu Gesicht bekamen.
Aber selbst diese Aussicht hatte Lidia auf Dauer nicht reizen, diese schreckliche Langweile nicht mindern können. Denn ihr Vater erfreute sich bester Gesundheit und war imstande, alle nötigen Handelsreisen selbst durchzuführen, während er Lidia einen Platz hinter dem Schreibtisch zuwies. Das bedeutete viel Verantwortung bei wenig Tageslicht für eine junge Frau, die sich austoben wollte.
Also hatte sie sich ein wenig danebenbenommen, wie es bei den Kindern des Hauses Vierweg Tradition war. Sie hatte sich mit Abel Aurilhand, einem Freund und Gildenkameraden ihres Bruders, vergnügt. Sie hatten jeden Abend gesoffen, Grotto und Schwarzmohn geraucht, sich geprügelt und miteinander geschlafen, aber auch das war irgendwann zu schnödem Alltag verkommen. Das war bereits während der Besatzung durch Aquintien gewesen. Weder Lidia noch Abel hatten sich sonderlich an der Präsenz der Blauröcke in der Stadt gestört. Für die Geschäfte ihres Vaters hatte sich die zollfreie Handelszone, der Sygna damals angehörte, zunächst eher positiv ausgewirkt, bis die Zustände in Sygna Sanktionen nach sich gezogen hatten.
Und schlussendlich war alles wieder über den Haufen geworfen worden: Die Rebellion hatte die Besatzer vertrieben. Ausgerechnet ihr Bruder Danil hatte während der Aufstandsgefechte seine patriotische Ader entdeckt – und das wie viele andere Fechter mit dem Leben bezahlt.
Wenige Wochen später hatte sich ihr Leben zum dritten Mal in kurzer Zeit von Grund auf geändert, und diesmal war es etwas durch und durch Persönliches: Etwas war in ihr erwacht. Sie erinnerte sich noch gut an den Moment; sie hatte ihre Trauer – und ihren Frust über Abels schlechte Laune – in billigem Branntwein ertränkt und in einer Grottowolke erstickt. Lidia hatte sich weit fortgewünscht, ein anderes Leben an einem anderen Ort. Die Langeweile, die Trauer, die Eintönigkeit hatten sie schier überwältigt. Immer wieder hatte sie diesen verdammten Herzschlag in ihrem Kopf gehört, und dann war er plötzlich verstummt, während sie die Maserung eines Buchenholztisches mit dem Finger nachfuhr, den Kopf auf die in Bier getränkte Tischplatte gelegt. Und das Holz war plötzlich so viel mehr für sie gewesen als zuvor.
Von einem auf den anderen Augenblick, innerhalb eines Wimpernschlags, hatte sie gewusst, was zu tun war.
Lidia Vierweg hatte Abel ohne weiteres Zögern den Rücken gekehrt und seither keinen Gedanken an ihren Liebhaber verschwendet. Als sie begriffen hatte, was mit ihr geschehen war, hatte sie ihrem Vater die Faust auf den Schreibtisch gedonnert und verlangt, dass er ihre Mitgift auszahlte. Heiraten würde sie ohnehin nie. Vielleicht war es die Angst vor dem Zeichen in ihren Augen, vielleicht die Erleichterung, von weiteren Skandalen seiner Tochter verschont zu werden, vielleicht der Trübsinn ob des Todes seines Sohns, vielleicht aber auch die Einsicht, wie er seiner Tochter zu ihrem Glück verhelfen konnte – jedenfalls ging ihr alter Herr darauf ein.
Lidia hatte – anders als diese Erdhand-Tochter, die in ihrem Alter war – keine großartigen Ambitionen oder gar versponnene Gleichwerkerphantasien. Eigentlich wollte sie nur ein bisschen Spaß. Mit einem kleinen Vermögen in Form von Wertpapieren hatte Lidia Vierweg Sygna verlassen, um zur See zu fahren.
In einer schmierigen Bodega in Luciwa hatte sie das Schicksal dann beim Schopf ergriffen, denn dort hatte sie die Lachende Ye kennengelernt. Die Kapitänin, die aus den Tóng-Méngh-Haiyáng-Staaten stammte, und ihre Mannschaft saßen hier ohne Schiff fest, denn ihres hatten aquinzische Freibeuterjäger unter ihren Hintern zerschossen. Eine Kapitänin war selbst in einem von einem Weibsbild regierten Stadtstaat wie Luciwa eine Seltenheit – und Lidia sah es als Wink des Großen Handwerkers, dass sie bei Ye richtig war. Zum Glück beherrschten sowohl sie als auch Ye das hiesige Falce, das in allen Sichelstaaten verstanden wurde, und so wurden sie sich schnell einig. Lidia kaufte von ihrer Mitgift ein schnelles Schiff und brachte ihren kaufmännischen Sachverstand ein. Die Lachende Ye stellte ihre Leute als Mannschaft zur Verfügung. Lidia war die Eignerin, aber sie verlangte nicht viel mehr als den Posten am Steuerrad, den Titel der ersten Offizierin und einen erhöhten Anteil an der Beute. Die Lachende Ye wurde zur Kapitänin ernannt und bestand darauf, die Ziele ihrer Kaperfahrten auszuwählen – was vor allem aquinzische Handelskähne sein würden, wie sich später herausstellte. Außerdem wollte sie das Schiff Siljonicz taufen. Lidia sagte dieser Begriff nichts, aber sie hielt Namen ohnehin für Schall und Rauch und stimmte zu.
Sie hatten sich in die Hände gespuckt und eingeschlagen, wie es sich für Freibeuter, Geschäftsleute und sonstiges Gesindel gehörte. Lidia war dennoch keine Närrin. Ihr war bewusst, dass diese Bande von Halsabschneidern sie bei der nächsten Gelegenheit über Bord werfen würde, wenn sie sie nicht von ihrer Nützlichkeit überzeugte – was ihr mithilfe des Urzeichens jedoch blitzschnell gelang. Sie mauserte sich mit ihren einzigartigen Fähigkeiten in kurzer Zeit trotz mangelnder nautischer Erfahrung zum wertvollen Mitglied der Besatzung.
Lidia machte sie alle sehr schnell sehr reich. Sie kreuzten in den Gewässern im Westen und Süden, nahe den Inselkolonien Aquintiens und brachten mit Lidias übermenschlicher Begabung ein Schiff nach dem anderen auf. In wenigen Wochen hatten sie den aquinzischen Kolonialhandel quasi zum Erliegen gebracht und den Preis für Kaffee in astronomische Höhen katapultiert, hieß es. Das geschah dem widerlichen Gesöff, das man offenbar überall außer in Sygna statt Tee in sich hineinzuschütten pflegte, nur recht! Wenn Lidia damit zudem ihrer alten Heimat einen Dienst erwies, war ihr das ebenfalls lieb. Sie schickte ganze Schiffsladungen ihrer Beute an ihren Vater. Vielleicht hatte sie doch noch nicht ganz mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen, denn ihren Vater mit exotischen Geschenken zu beeindrucken bereitete ihr eine schelmische Freude.
Doch bald blieben die Schiffe aus. Die Blauröcke versuchten neue Routen. Nicht die direkte, sondern die Südpassage zur Sichel und dann an der Küste entlang nach Norden gen Naronne.
Aber Ye kam ihnen auf die Schliche. In Luciwa hatte sie einen Hinweis erhalten zu einem Pott voller Gewürze von den Paradiesinseln, der in den hiesigen Gewässern erwartet wurde. Es hätte ihnen auffallen müssen, dass es zu gut klang, um wahr zu sein, aber Gier war eine verräterische Gefährtin: Natürlich erwies sich das Frachtschiff als Falle, statt fetter Beute fanden sie Kriegsschiffe vor. Die zwei Schiffe, die sie zuvor in ihre kleine Piratenflottille aufgenommen hatten, verendeten spektakulär und weitab der Küste.
Die Siljonicz jedoch war wieder einmal davongekommen. Lidia konnte keine Trauer um die Gefallenen in sich finden, aber auch keine bohrende Langeweile mehr. Sie war zufrieden, und sie war frei.
Die Siljonicz lief in den Hafen von Luciwa ein. Die bunt gemischte Mannschaft konnte kaum erwarten, die Brigg ordentlich zu vertäuen und die Schenken, Spielhäuser und Bordelle zu stürmen. Lidia fühlte sich wohl in Luciwa. Die Stadt, ursprünglich als Kolonie des südlichen N’kua gegründet, tat alles, um ihr Fernweh zu mindern. Auch die Besatzung der Siljonicz war kosmopolitisch: Tóngs wie die Lachende Ye, die ganz untypisch für Freibeuter meist in eine Art Uniform mit Metallbeschlägen gekleidet war, gab es hier ebenso wie blasse Riefländer mit lustigen Mützen, schwarze Seefahrer aus Luciwa oder den Königreichen im Süden, meist in farbenfrohe Gewänder gehüllt. Selbst ein Praneshi war an Bord.
Lidia selbst stach mit ihrem blonden Zopf ziemlich heraus, also hatte sie zumindest ihre Kleidung mit lederner Hose und einfachem Hemd der allgemeinen Mode an Bord angepasst. Dazu hatte sie sich mit Goldketten und Ohrringen behängt. Sie waren schließlich ehrlich erbeutet.
Vor ihr erstreckte sich die Stadt – der südlichste der Sichelstadtstaaten war auf vielen Inseln erbaut, auch wenn es sich eher um ein Dutzend und nicht hundert handelte, wie der Beiname der Stadt behauptete. Am Hafen herrschten die weiß gekalkten Bauten des Sichelstils vor, bei dem die Gebäudekanten mit charakteristischem unverputztem Bruchstein verziert waren. Weiter hinten, in den jeweiligen Zentren der Inseln, erhoben sich die hellbraunen Türme der Gründer der Stadt.
Die Mitglieder dieser Herrscherhäuser sowie die zahlreichen mit ihnen verbundenen Gefolgsleute pflegten eigene Traditionen und Bräuche, trugen einen bestimmten Kleidungsstil und charakteristische Gesichtsmarkierungen. Sie sprachen sogar eigene Sprachen, wobei das Falce der Sichelstaaten von allen verstanden wurde.
Schließlich war die Siljonicz vertäut, und Lidia hatte Zeit für ein bisschen Spaß. Sie meldete sich bei Ye ab und schloss sich Anozie, Naoya und Oluwaseun an, die gerade über die Planke den Hafen betraten.
Bereits hier roch es nach Gebackenem und Gebratenem, das hungrigen Reisenden angeboten wurde – für viele die erste Mahlzeit nach Wochen oder gar Monaten Zwieback. Ein Hauch der scharfen Gewürze N’kuas lag in der Luft und vermischte sich mit dem Geruch nach Meer, Fisch und dem Schweiß der vielen Seefahrer und Hafenarbeiter, die eifrig Schiffe be- und entluden. Die Nachmittagssonne brannte auf das Treiben im Hafen, das einem Ameisenhaufen ähnelte. Aus der Ferne betrachtet erkannte man nur wimmelndes Chaos, aber jedes einzelne Geschöpf verfolgte ein klares Ziel, eine Aufgabe – sei es zur Beschaffung des Lebensunterhalts oder zur Befriedigung von Gelüsten.
Um Lidia herum ragte ein Wald an Masten auf, die sich um die vielen Kais des Freihafens drängten. Ihr war kein anderer Hafen bekannt, der so viele Schiffe beherbergen konnte wie der von Luciwa. Entsprechend viel Betrieb herrschte hier.
Ein Zollbeamter bahnte sich seinen Weg durch das Gewühl. Der goldene Kopfputz, das rote, einem Talar ähnelnde Gewand und seine Beamtenrute wiesen ihn als Respektsperson aus, was ihm zumindest etwas entgegenkam bei seinen Bemühungen, gegen den Strom aus Seeleuten zu hasten. Dies, und die zwei Meyskineri, ein Mann und eine Frau, beide glatzköpfig, die ihm mithilfe ihrer Stabkeulen Platz verschafften. Beide trugen sie die gelb-schwarzen Gewänder ihrer Zunft. Zwei senkrechte Narben markierten das Gesicht der Frau, was Lidia nichts über ihre Herkunft verriet, und beide zierten die wellenförmigen Narben am Kinn und an den Schläfen, was sie eindeutig als Meyskineri auswies. Diese Kriegerelite stellte die gefürchtete Polizeitruppe der Stadt und unterstand der Malkia, der Herrscherin der Gründerhäuser, persönlich. Angeblich beherrschte jeder Einzelne von ihnen die Stabkeule meisterlich. Diese Waffen eigneten sich gleichermaßen zum Auseinanderdrängen von Streithähnen wie zum Erschlagen von Schwerverbrechern.
Lidia erwartete, dass der Kerl und seine beiden hünenhaften Begleiter an ihr vorbeischreiten würden, um den Hafenzoll und die Liegegebühr an Bord der Siljonicz zu kassieren, doch er baute sich direkt vor ihrer Nase auf. Er wirkte etwas außer Atem, was seiner Stimme jedoch nichts an Schärfe nahm.
»Du bist Rudergast an Bord der Siljonicz, nicht wahr?«, sprach er Lidia auf Falce an.
»Genau die«, sagte sie, hob den Kopf und grinste herausfordernd.
Tatsächlich gab sie sich selbstsicherer, als sie war. Ihr Blick streifte das tiefdunkle, glatte Holz der Stabkeulen. Dann zwang sie sich, ihrem Gegenüber in die Augen zu blicken. Sie fühlte sich plötzlich fremd an diesem Ort. Ihre helle Haut stach zwischen ihren drei Begleitern hervor, umringt von dem Beamten und den Meyskineri war sie geradezu unbehaglich anders. Ob Einwandererfamilien wie die Jaranjids in Sygna Ähnliches empfanden, als offensichtliche Angehörige einer anderen Welt? Nicht ganz dazugehörig – und das ununterbrochen? Kein angenehmer Gedanke.
»Wir dulden keine Piraten in der Stadt. Ohne Kaperbrief erwartet euch alle das Schafott!«, sagte der Beamte.
Die Meyskineri traten daraufhin vor, drängten Lidia und ihre protestierenden Begleiter mit den Stäben zurück, sodass sie drohten, ins Wasser zu stürzen.
Lidia ergriff den Stoff von Anozies Hemd, um ihr Gleichgewicht zu wahren. Das Herz sank ihr in die Bauchgegend. Auch ihre Begleiter schienen wenig Interesse zu verspüren, sich auf einen Kampf mit den Meyskineri einzulassen – zumal am helllichten Tag. Aber sie durften jetzt auch nicht klein beigeben.
Wenn du Schwäche zeigst, kriegst du noch größere Schwierigkeiten! Dann finden sie was und immer mehr und mehr, und dann bleibt nachher keine Prise mehr für uns, hörte sie die Stimme der Lachenden Ye in ihrer Erinnerung.
»Keine Sorge, wir achten schon darauf, dass die finanziellen Interessen der Stadt gewahrt bleiben«, sagte sie so ruhig wie möglich.
»Was ihr draußen bei den Paradiesinseln treibt, ist der Malkia völlig egal«, sagte der Beamte, »wenn ihr aber Schiffe der Handelspartner Luciwas vor ihren Gewässern aufbringt …«
»Schiffe einer konkurrierenden Nation, mit der sich die Häuser Luciwas in den Kolonien öfter bekriegen, als dass sie Geschäfte machen«, unterbrach sie ihn. »Schiffe, die die Sichel nur umsegeln wollten und nie vorhatten, hier Waren umzuschlagen und Zölle zu zahlen.«
»Das Wort von Piraten!«
»Wir können Beweise vorlegen!« Die Vereinbarungen von Ye mit dem reichsten Haus der Stadt waren mehr als Gold wert, aber die trug natürlich nicht Lidia bei sich, sondern Ye, und die war noch an Bord. Wenn sie aber den Beamten an Bord ließ, wäre das bereits zu viel Entgegenkommen. Sie musste das hier schnell beenden. »Olu, zeig den Herren und der Dame doch mal, was du in deiner Tasche hast.«
Der Angesprochene, ein schlaksiger Kerl mit eindrucksvollen Haaren, die seinen Kopf wie eine Wolke umgaben, zog eine Leinentasche von der Schulter. Darin klimperte es vielsagend. Olu zog eine Handvoll »Beweise« hervor und reichte sie dem Beamten, der die Gegenstände sofort unter seinem Talar verschwinden ließ. Silberner Halsschmuck, Perlenketten. Dann einen goldenen Pokal. Schließlich zwei Hände voll Kovry – mit Stempel versehene Muscheln, die als Währung dienten. In den Spielhäusern Luciwas eigneten sie sich zudem hervorragend als Jetons. Beute aus dem Haushalt eines aquinzischen Inselgouverneurs, dessen Anwesen sie überfallen hatten und die eigentlich heute Abend als Wetteinsatz hätte dienen sollen. Daraus wurde wohl nichts.
Sie wusste, dass das hier keine simple Bestechung war wie in allen anderen Häfen der Welt. Es war Teil eines komplexen Zollsystems, an dem nicht nur der Beamte, sondern auch die Herrscherhäuser und die Stadtkasse verdienten. Daher waren sich auch die Meyskineri nicht zu schade, sich offen an dieser staatlichen Erpressung zu beteiligen.
»Ja, die Beweise sind eindeutig«, sagte der Beamte entgegenkommend. »Aber nicht ganz ausreichend. Ich sehe, dass eure Tasche noch nicht ganz leer ist.«
Die beiden Meyskineri verstärkten den Druck. Nur ein wenig. Lidia stand mit den Fersen unmittelbar vor dem Rand des Kais, unter ihr das schmutzige Nass. Die Passanten schenkten der Szenerie im Vorbeigehen kaum Beachtung. Solche Schauspiele waren hier nichts Besonderes.
Lidia schüttelte dennoch den Kopf und packte die Stabkeule der Frau mit der rechten Hand, spürte das Holz unter ihrer Handfläche, rief die Macht des Urzeichens und legte dem Tropenholzstab die Last von vielen Jahren Witterung auf. Er wurde morsch und vergammelte augenblicklich, sodass Lidia die Keulenspitze einfach abbrechen konnte.
»Ich sehe das anders. Die Beweise sind wohl ausreichend. Schließlich haben wir Durst und brauchen noch etwas Geld, um es in der Stadt ausgeben zu können«, sagte sie mit einem Lächeln, das hoffentlich so entwaffnend war wie ihr Griff um das Holz der Keule.
Der Beamte bedeutete den überrumpelten Gardisten, sie freizulassen. Er straffte sich. »Jetzt, da ich noch einmal darüber nachdenke, scheinen mir die Beweise ausreichend. Willkommen in Luciwa. Genießt euren Aufenthalt!«
Das war nicht optimal über die Bühne gegangen, aber immerhin schnell. Die kleine Truppe zögerte nicht und drängte sich vorwärts, an einem Stand vorbei, der frittierten Fisch anbot. Sie passierten billige Spelunken und ein paar Straßenhuren, die sie mit eindeutigen Angeboten lockten. Die edlen Spielpaläste lagen auf einer anderen Insel, doch zuvor mussten sie sich ordentlich betrinken. Das Gewirr der Gassen Luciwas nahm sie auf und umfing sie mit dem Versprechen eines gelungenen Abends.
»Was, verdammt noch mal, stimmt nicht mit dir?«, zischte Dawyd.
Der sonst so arrogante Aquinzacke klammerte sich geradezu an seinen Arm, und Dawyd konnte spüren, dass er am ganzen Körper zitterte.
»Hast du noch ein Schwefelholz?«, fragte Rufin mit klappernden Zähnen.
»Ja, aber mir wäre wohler, wenn wir erst irgendetwas finden würden, das wir damit anzünden könnten! Ich überlege gerade, ob du als lebende Fackel vielleicht mehr Nutzen bringst als als zitterndes Kleinkind.«
»Maul«, sprach ihn der andere schicksalsergeben mit dem Spitznamen an. »Ich …«
Bislang tappten sie wortwörtlich im Dunkeln. Dawyd wusste, dass die Verkehrte Stadt tückisch war, plötzliche Treppen, Gänge, Schrunden konnten sich überall auftun, ohne sich vorher durch einen Luftzug zu verraten, aber sie hatten trotzdem im Finstern kehrtgemacht und versuchten, den Weg wiederzufinden, auf dem sie offenbar hierhergelangt waren. Denn von irgendwoher mussten sie schließlich gekommen sein.
Sie waren die Treppe in die Kluft hinabgestiegen und nach nur wenigen Stufen in dieser Höhle gelandet, in der jedoch keine Spur mehr von einer Treppe zu finden war. Der Gedanke beunruhigte Dawyd mehr als nur ein bisschen, aber er fand Trost darin, Lysandre Rufin einen schmerzhaften Flammentod anzudrohen.
Vorsichtig tastete er sich mit dem Fuß vorwärts – irgendwo musste die Treppe nach oben doch sein! Vielleicht war dies hier auch nur ein besonders perfides Schmugglerversteck in der Kluft, in das sie irgendwie in Nacht und Nebel hineingeraten waren.
»Iackmar, halt«, flehte Rufin auf einmal.
Dawyd hielt in seinem Suchen, Tasten und Sich-Vorwärtsschieben inne. »Was ist jetzt?«, stieß er unwillig hervor.
»Wir … wir sollten überlegen. Ich habe Schwarzpulver. Eine Pistole. Wir haben Kleidungsstücke, du hast eine Lederscheide – wir müssen ein Feuer machen, irgendwie. Im Licht finden wir vielleicht etwas, woraus wir mehr Licht machen können. Reste von Lafayets Expeditionen. Fackeln, Lampen. Aber wir … wir brauchen jetzt hier Licht!« Er sprach schnell und verhaspelte sich mehrmals. Seine Stimme klang schriller als sonst. »Wir können nicht einfach in die Dunkelheit weitertappen!«
»Du machst dir gleich in die Hose, oder?«, fragte Dawyd. »Wenn du dir in die Hose machst, dann lasse ich dich hier einfach stehen und gehe allein weiter. Das sollte ich vielleicht eh. Dann bin ich dich los. Dann sind wir dich los.« Er versuchte, Rufins Griff um seinen Arm zu lösen, doch der andere klammerte sich fest.
»Bitte!«, sagte Rufin hilflos und brauchte einige Augenblicke, um sich zu fassen. »Ich … du brauchst mich! Ich war vor wenigen Tagen noch hier unten, und die Gänge … etwas stimmt nicht. Gänge, die nach unten führen, bringen einen nach oben und umgekehrt. Man läuft im Kreis, obwohl der Weg schnurgeradeaus führt. Und … und Gebäude aus Naronne sind hier sichtbar geworden, hier, in einer der Höhlen!«
»Das ist doch Unsinn!«
»Dawyd, du wirst die Treppe hinter uns nicht finden! Die … die Verkehrte Stadt hat uns geschluckt! Es gibt keine Treppe. Ich … aber ich hab herausgefunden. Beim letzten Mal. Irgendwie bin ich rausgekommen. Ich komme wieder heraus. Du brauchst mich.«
»Du brauchst mich«, sagte Dawyd ausdruckslos. »Damit du nicht den Verstand verlierst. Richtig?«
Rufin stieß die Luft aus. »Bringt es dir etwas, wenn ich das zugebe?«
»Nein«, urteilte Dawyd. »Aber es ist gut zu hören, dass du nicht wieder versuchen wirst, auf mich zu schießen.«
»Hör zu, ich bin ein vernunftbegabter Mensch, ich würde sogar sagen, meine Begabung für Vernunft übertrifft die vieler anderer Menschen. Zum Beispiel die deine. Ich bin hier unten gestorben. Dieses Wesen hat das Erdhand-Mädchen beschützt, damit sie die Sarkophage öffnen konnte, und es hat mich getötet, damit ich ihr nichts tue. Es hat meinen Körper … zu … etwas … Unaussprechlichem verwesen lassen. Ich habe überlebt, weil sich große Teile meines wachen Verstands in diesem Körper hier befanden, in Ignaz’ Körper! Ich bin in der Lage zu reflektieren, dass mich diese Dunkelheit und diese vermaledeiten Höhlen in eine Art … katatonischen Zustand versetzen, weil ich sie mit meiner eigenen … Todeserfahrung in Verbindung bringe.«
Dawyd schwieg. Er konnte nicht leugnen, dass das eine sehr vernünftige Analyse war.
»Dieser Ort hier ist das für mich, was die Erinnerung an deinen drohenden Tod im Duell mit Azir für dich ist, Iackmar.«
Dawyd knurrte etwas Wortloses und schleifte Rufin noch ein Stück weiter. Dann blaffte er: »Dann zieh dein verdammtes Hemd aus, wir wickeln es um meine Schwertscheide und zünden es an, und dann suchst du mir diesen Treppe-runter-Treppe-hoch-Ausweg.«
Sie werkelten eine Weile stumm herum, bevor Dawyd die Stille nicht mehr ertrug, die nur von gelegentlichem hohlem Klopfen unterbrochen wurde, als würden Wassertropfen auf die ruhige Oberfläche eines Teichs fallen.
»Und was heißt das überhaupt, Gebäude aus Naronne? Was soll das sein? Was weißt du über die Verkehrte Stadt? Was geht hier vor sich?«
»Was hat Schönauge dir erzählt?«
»Mir? Gar nichts. Ich war im Krieg, ich habe nicht den blassesten Schimmer, was Ismayl in Naronne in Erfahrung gebracht hat.«
Rufin seufzte. »Also soll ich dir jetzt Geschichten erzählen?«
»Warum nicht? Bringt dich vielleicht auf andere Gedanken.«
»Wohl kaum«, murmelte Rufin, während Dawyd versuchte, das Hemd so zum Brennen zu bringen, dass sie möglichst lange etwas davon hatten. Schließlich seufzte Rufin und füllte die Stille doch mit Worten. »Weißt du, wie die Hauptstadt Beider Zarenreiche heißt, Dawyd?«
Dawyd warf ihm einen irritierten Seitenblick zu. »Natürlich, ich bin Lehrerkind. Stare Traha.«
»Stare Traha, die alte Schwelle. Die Stadt befindet sich exakt auf der Grenze der beiden alten Reiche, und deshalb ergibt der Name auch heute noch Sinn. Aber als die ersten Besiedelungsversuche Beider Reiche unternommen wurden, vor beinahe sechzehnhundert Jahren, da nannte man diesen Ort vor allen Dingen deshalb so, weil sich dort ein Übergang zwischen unserer Welt und einem … Jenseits befand. Dieses Jenseits hatte sich auf unserer Seite der Welt ausgebreitet und beherrschte ein Gebiet, das beinahe so groß ist wie die heutigen Beiden Reiche des Zaren.«
»Was soll das heißen, unsere Seite der Welt?«
Dawyd erhob sich und leuchtete mit dem um die Schwertscheide gewickelten und nur zögerlich brennenden Hemd in alle Richtungen: Die Kaverne erstreckte sich weit, der Boden war eben und ohne bemerkenswerte Charakteristika – roter Sandstein. Die Luft roch nach Moder und Steinstaub. Nirgends war die Treppe zu sehen, die sie herabgekommen waren.
Von Rufins und seinem Mund stiegen Atemwölkchen auf, und die provisorische Fackel bebte in Dawyds kalten Fingern.
»Willst du mir wirklich jetzt und hier Schauermärchen erzählen, Rufin?«, ergänzte er unbehaglich.
Rufins – Ignaz’ – Gesicht war angstbleich und die Flammen malten tiefe Schatten darauf. »Du solltest vielleicht wissen, womit wir es zu tun haben.«
»Du weißt es also, ja?«
»Ich habe … eine lange Schiffsreise hinter mir. Und habe viel gelesen.«
»Eine Reise … zu Azir.«
»Richtig.«
»Ich hasse dich so sehr, dass es mir im Herzen wehtut, dich nicht einfach töten zu können«, brachte Dawyd mit Überzeugung hervor.
»Ich weiß.« Rufin rang sich ein schmales Lächeln ab. Er hielt immer noch Dawyds Ärmel umklammert. Unter seinem Mantel trug der Geheimpolizist kein Hemd, was lächerlich aussah. Immerhin das. Immerhin ist er lachhaft. Während Dawyd wahllos eine Richtung einschlug, fuhr Rufin fort: »Die andere Seite unserer Welt ist kein Reich der Menschen. Es wirkt auf uns wie der Tod, wie die Finsternis, wie blanke Angst, wie die Hölle, in die der Vater im Himmelblau Verräter, Mörder und Vergewaltiger schickt. Vielleicht braucht man andere Sinne als die unseren, um sie wahrzunehmen, wie sie ist. Wir sehen darin nur Schatten und Irrsinn. In den Beiden Reichen gelang es einer Kriegerkönigin vor sechzehnhundert Jahren, diesen Schatten in seine Schranken zu weisen, diese Schwelle unter Stare Traha zu verschließen und Jenseits und Diesseits zu trennen.«
»Nett von ihr.« Dawyd sah sich um. Finsternis. Blanke Angst. Schatten und Irrsinn. Er schluckte. Das Hemd flackerte auf, als weitere Teile des Stoffs Feuer fingen, und er fürchtete, dass es nur eine Sache von Minuten war, bis sie wieder in pechschwarzer Dunkelheit standen.
»In Beiden Reichen und den angrenzenden Staaten weiß man sehr wohl, dass dieses Siegel keine … vollendete Trennung bedeutet. Man kennt Stellen, an denen sich Jenseits und Diesseits immer noch überlagern – man nutzt dort die Kraft, die der Schatten anbietet. Die Yuguren, die Zarkassen, die Tóngs, die Zarenbürger: Für sie alle ist eine übernatürliche Macht mehr als nur Geschwätz. Wer verzweifelt oder arrogant genug ist, sich mit den Schatten einzulassen, erhält Fähigkeiten, die wir uns nur träumen lassen können.«
Dawyd starrte ihn an.
»Ach, halt«, sagte Rufin trocken. »Das erinnert mich doch an etwas – dich auch?«
Dawyd starrte wieder geradeaus. Kurz hatte er befürchtet, diese Höhle nehme kein Ende, doch jetzt kam eine Wand in Sicht. Er änderte die Richtung und ging weiter, bis er eine finstere Öffnung entdeckte, eine gezackte Wunde im Fels.
»Ist der Ausgang genehm, Märchenonkel?«
Rufin nickte und nahm dann seinen Gesprächsfaden wieder auf. »Mich erinnert es an die Zeichen, Dawyd. Die Macht, die die Alchimisten Stare Trahas sammeln, die die wandernden Cikani ihr Eigen nennen, die die Yugurentöchter in sich aufnehmen: Das alles erinnert mich sehr stark an Sygnas Zeichen. Weißt du, was ich glaube, Dawyd?«
»Ja«, knurrte er, und sie schoben sich hintereinander in den Riss, hinter dem der Weg sich in unregelmäßigen Stufen steil nach oben wand. »Du denkst, dass wir hier auch eine Art Schwelle haben und dass wir gerade auf der falschen Seite davon sind.«
»Nicht ganz richtig, Lehrerkind. Ich glaube, wir waren kurz auf der falschen Seite. Wir sind in den Schatten getreten, weil der sich … aus irgendeinem Grund … in der Kluft aufgetan hat. Wir sind darin zwei, drei Schritte gegangen und wieder hinausgetreten. In Beiden Reichen kennt man das Phänomen, durch den Schatten zu reisen und ganz woanders herauszukommen, als mit Menschenverstand nachzuvollziehen wäre. Es heißt, es gibt sogar Waghalsige, die das nutzen, um sich rascher zwischen zwei Orten hin- und herzubewegen, als das zu Fuß oder mit Pferden möglich wäre.«
»Praktisch. Ich würde dann jetzt gern wieder zurück.«
»Der Schatten ist launisch. Der Zugang, durch den wir hineingeraten sind, hat sich offenbar wieder geschlossen. Und die Verkehrte Stadt wird schon von ihm in Mitleidenschaft gezogen. Als ich das letzte Mal hier unten war, wiesen die Gänge keine logische Folge mehr auf. Ich bin sicher, das lag daran.«
Rufins Finger bohrten sich geradezu in Dawyds Arm, was mehr als hinderlich war beim Treppensteigen. Das Hemd brannte nun lichterloh, das Leder der Scheide begann zu stinken, und Dawyd beeilte sich, irgendwohin zu kommen.
Einfach irgendwohin.
Bald verbreiterte sich der Gang und führte in absurden Kehren immer weiter aufwärts, bis beide Männer keuchten – Rufin heftiger als Dawyd, wie dieser zufrieden feststellte.
»Aufwärts war doch schlecht, sagtest du?«, hakte er nach. »Hatten wir nicht die Vereinbarung, dass du uns hier rausbringst?«
»Es … kommt mir bislang hier wenig bekannt vor«, gab Rufin zu.
Dawyd erreichte den obersten Treppenabsatz, falls man die unregelmäßigen Stufen in dem wie von Würmern gegrabenen Gang denn Treppe nennen wollte, und vor ihm verzweigte sich der Weg in wesentlich kleinere Tunnel, die weder anstiegen noch abfielen, in verschiedene Richtungen gingen und so niedrig waren, dass es mit der Fackel in der Hand ungemütlich zu werden versprach. »Welcher?«
»Nimm den linken.«
»Warum?«
»Weil wir keine Zeit zu verlieren haben und links eine ebenso valide Antwort ist wie jede andere.« Rufin keuchte. »Mach schon!«
Dawyd trat gebückt in den runden Tunnel, unter seinen Füßen war der Boden tückisch, Dellen und Beulen ließen ihn stolpern, aber im Licht eines erlöschenden Hemds beeilte er sich, voranzukommen.
»Ich denke, als Nächstes nehmen wir deine Hose«, knurrte er, und seine Stimme hallte wider, als erstrecke sich um sie herum ein weiter Raum, obwohl sie sich geradezu hindurchzwängen mussten.
»Wir nehmen dein Hemd, Maul.«
Dawyd biss die Zähne zusammen. Er musste zugeben, dass er zu gleichen Teilen wünschte, Rufin ohne Hose zu sehen, und den Anblick lieber vermeiden wollte. So oder so würde es die Beklemmung ein wenig lindern, die ihn in dieser verdammten Verkehrten Stadt überfiel. Auch er erinnerte sich hier unten an Dinge – an einen Herzschlag in der Tiefe … an Kälte und das plötzliche Drängen einer Bestimmung …
Als der Gang ein wenig breiter wurde, schälte sich Dawyd rasch aus seinem Rock und zog das Hemd aus. Er zog den Rock wieder an und fütterte die Flamme mit dem nächsten Hemd.
»Das wird ganz schön lächerlich, wenn wir splitternackt wieder nach draußen kommen«, grunzte er.
»Das wird mir ziemlich egal sein, wenn das bedeutet, dass wir nach draußen kommen!«
Als auch dieses Hemd annehmbar befestigt war, gingen sie weiter.
»Lafayet hatte doch so viel Ausrüstung hier unten – ich wünschte, wir würden etwas davon finden!«
»Das ist dieser Forscher, richtig? Erzähl mir doch noch ein paar Geschichten, Rufin. Was hat er denn so erforscht? Irgendetwas, das wir vielleicht wissen sollten?«
Rufin lachte nervös. »Ihr hättet vielleicht eure eigenen Aufzeichnungen über diesen Schattenriss, auf dem ihr sitzt, nicht vernichten sollen! Die Erinnerung daran nicht verbannen, die Geschichten darüber nicht unerzählt lassen sollen.«
»Du klingst schon wie Ismayl.«
»Ja, ich denke, darin bin ich mir mit Schönauge einig.« Auf Ignaz’ Gesicht flackerte dieses Grinsen auf, das Ignaz zugleich so ähnlich und so unähnlich sah. Die Dunkelheit rückte wieder näher an ihn heran, als die alten Flammen an Dawyds Lederscheide erstarben und die neuen nur langsam erwachten.
Rufin begann zu reden, rasch, als wolle er der Stille keine Gelegenheit geben, zwischen seinen Worten Einzug zu halten. Dawyd fiel auf, dass der Aquintianer meist den Sygnaer Dialekt nachahmte, den er so gut beherrschte, dass man ihn tatsächlich für Ignaz halten konnte – was sie ja auch lange getan hatten. Wenn er jedoch schnell sprach, verfiel er in den Singsang der Aquintianer, in dem ohnehin alle Worte zusammenzufließen schienen.
»Lafayet ist Professor für Geologie an der Naronner Universität. Er hat in seinen Studien schon vor Jahren herausgefunden, dass die Erdkruste sich nicht nur aus unterschiedlichen Gesteinsschichten zusammensetzt, sondern dass auch dieses … Jenseits, dieser Schatten, die Schichten im Gefüge der Welt durchdringt. So wie auch Öl oder Grundwasser oder Gas in der Erde liegen. Es ist natürlich nicht dasselbe. Aber Jenseits und Diesseits sind nicht völlig getrennt, und so, wie es Stellen gibt, an denen Öl an die Oberfläche tritt oder auch eine Erzader, so gibt es auch Stellen, an denen Schatten … sich mit unserem Diesseits verbinden. Dass Sygna solch ein Ort ist, wusste Lafayet schon lange bevor der Kaiser die Stadt einnahm. Er hatte den Auftrag, dem Ursprung der Zeichen nachzuspüren, und für ihn war es offensichtlich, dass er diesen hier unten finden würde. Im Bleiberg.« Rufin lachte humorlos. Mittlerweile hatte er etwas Contenance wiedergefunden. »Balai – weißt du, was das heißt?«
»Du wirst es mir sagen. Nein, halt, lass mich raten. Schatten.«
Die Flamme gewann an Kraft, und sie beeilten sich, weiterzukommen – der Weg verbreiterte sich und führte dann abwärts, so steil und glitschig, dass sie auf jeden Schritt achtgeben mussten.
»Hm«, machte Rufin, ungnädig über die ihm genommene Pointe. »So in etwa. Als Richtungsbezeichnung. ›Bal‹ ist im ganzen süddardantischen Sprachraum ein Wort für das Innere, das Dunkle. Es gab auf Alt-Daro den Anhang ›-ai‹, der eine Richtung anzeigte. Also ›ins Innere, ins Dunkle‹. So heißt euer Berg.«
Dawyd erwiderte nichts, obwohl er sich ziemlich sicher war, dass er in der Schule gelernt hatte, dass auch Blei darin abgebaut worden war.
»Lafayet glaubte, dass er etwas naturwissenschaftlich Erklärbares hier unten finden würde. Er hat lange gebraucht, um akzeptieren zu können, dass er damit falschlag. Dass die Zeichen wirklich das sind, was der Volksmund über sie sagt: Magie, Zauberei, Verdrehung der Naturgesetze.«
»Vielleicht sind es nur Naturgesetze, die wir noch nicht kennen«, knurrte Dawyd.
»Naturgesetze der anderen Seite«, schoss Rufin zurück. »Wir müssen akzeptieren, dass es so ist, besonders du und ich und die anderen Urzeichenträger müssen akzeptieren, dass etwas nicht nur in unsere Welt getreten ist, sondern in uns, in unsere Körper, Seelen, unseren Verstand. Dass uns etwas als Gefäße benutzt.«
»Das denkst du? Dass wir Gefäße sind? Die Zeichen sind die Werkzeuge der Handwerker, und ich bin ein Handwerker, kein Werkzeug!« Doch Dawyd war nicht entfallen, dass General Schlundner ihn immer als Werkzeug bezeichnet hatte. Ein gezeichneter Mensch war vielleicht doch wenig anderes als ein gezeichnetes Stück Metall oder Holz.
»Ich weiß noch nicht, was ich glaube. Aber vielleicht haben deine Leute die Zugänge deshalb vermauert: Sie wollten ihre kleinen, nützlichen Zeichen erhalten, aber nicht das Große, das Gierige, das Grauenhafte einlassen. Das hier.« Er wies vage mit der verstümmelten Hand um sich. Dawyd sah ihm an, dass er sich überwinden musste, weiterzusprechen. Dass es ihn Selbstbeherrschung und mehrere Anläufe kostete, während sie immer tiefer und tiefer gelangten, über einen spiegelglatten Boden, der wie aus Obsidianglas gehauen schien. Nein, nicht gehauen – herabgeflossen, so schien es Dawyd. Es ging einen breiten Abhang hinab, und das Dach der Höhle blieb weit über ihnen zurück. Die Flamme warf unruhiges Licht um sie herum, doch es war nicht genug Licht – nicht genug …
»Der Krumme Mann der Tiefe existiert. Du weißt das, oder? Kilianna weiß es.«
Dawyd wand sich unter diesen Sätzen, die Rufin mit so viel Mühe hervorgebracht hatte. Schließlich nickte er. Ihnen beiden stand der Schweiß auf der Stirn, und der kam nicht nur von der Anstrengung. Angst machte Dawyds Hände klamm.
»Was ist er?«, flüsterte er und sah sich um, als erwarte er ihn in den Schatten.
»Ein Gott?«, fragte Rufin.
»Was? Wie … wie der Große Handwerker?«
»Vielleicht mehr als das. Der Große Handwerker ist mutmaßlich eine fromme Einbildung, die deine Leute im Zaum halten soll, so wie es der Zweck aller Religionen ist, meiner eigenen eingeschlossen. Der Krumme Mann ist etwas Ewiges oder zumindest ewig nach menschlichen Maßstäben – etwas Machtvolles, etwas, das mein Leben mit einem Fingerschnipsen auslöschen konnte. Welche Ansprüche stellst du an einen Gott? Genügt dir das?«
Dawyd war sprachlos. Er war nie sonderlich fromm gewesen – Religion war etwas für alte Menschen, die schon zu viele Freunde hatten sterben sehen und Trost suchten. Sygna war eine pragmatische Stadt – der Glaube an den Großen Handwerker und die dreizehn Altmeister wurde als gegeben vorausgesetzt, aber es gab keine Geistlichen und nur sehr wenige Gotteshäuser. Selbst das Wort »Gott« wurde ungern im Mund geführt.
»Der Krumme Mann hat die Zeichen Sygnas erschaffen – oder gerufen, denn vielleicht sind sie eigene Wesenheiten, ganz wie euer Handwerker und seine Altmeister. Damit hat er Sygna etwas sehr Besonderes gewährt, aber offenbar musste die Stadt dafür einen Preis zahlen, den sie nicht mehr zu zahlen bereit war. Ich habe gelesen, dass ihr früher eure Toten in die Verkehrte Stadt gebracht habt. Dass manche der von der Decke hängenden Gebäude Nekropolen waren, letzte Ruhestätten. Aber Lafayet hat weder Knochen noch Beigaben noch Särge gefunden. Wer weiß, was genau sie dazu bewog, die Verkehrte Stadt zu verschließen und den Urzeichen zu entsagen. Aber was es auch war: Jetzt ist der Berg offen, die Urzeichen frei – und was immer der Krumme Mann von der Stadt will, er hat jetzt die Chance, es wieder zu verlangen.«
»Ich finde, du solltest wirklich aufhören zu reden«, sagte Dawyd unbehaglich.
Sie waren am Boden angekommen. Erneut dehnte sich um sie herum eine Kaverne, die so endlos schien, dass Dawyd sich fragte, ob sie sich überhaupt noch im Bleiberg befanden oder ob die Höhlen sie weit fort unter die Kuser Berge geführt hatten. Die Reste des Hemds glommen ein letztes Mal auf, die Lederscheide war zusammengeschmolzen, und bevor Dawyd ein weiteres Kleidungsstück von Rufin fordern konnte, sah er, dass es nicht nötig war. Vor ihnen in der schwarzen Tiefe der Höhle kräuselte sich silbriges Licht wie Mondschein auf Wasser.
»Licht …«, flüsterte Dawyd, und vorsichtig schritten sie in die Weite der Höhle hinein und darauf zu. Rufin wich ihm nicht von der Seite, Wortzeichen hin oder her, er schien hier unten nicht auf diese Macht zu vertrauen.
Ihre Augen gewöhnten sich an diese neue Lichtquelle – Dawyd konnte Tropfsteine ausmachen, die aus großer Höhe herabhingen oder wie Säulen in der Weite der Kaverne aufragten. Er versuchte, sich daran zu erinnern, ob er und Kilianna diese Höhle bereits durchquert hatten; nein, eine solch gewaltige Kaverne wäre ihm in Erinnerung geblieben. Sie kamen näher an die fahle, glitzernde Lichtquelle – leises Tropfen, Klicken, Schnalzen drang an ihre Ohren.
»Da kommt etwas näher«, flüsterte Rufin und packte Dawyd – einmal mehr – am Ärmel, diesmal, um ihn aufzuhalten.
Dawyd griff unwillkürlich an seine Seite – unsinnig, denn sein Schwert war fort und die Scheide nur noch verklumptes Leder in seiner Hand. »Hast du die Pistole nachgeladen?«
»Nein.«
»Verdammt, wenn wir hier unten sterben«, wisperte Dawyd und suchte nach einer Konsequenz, »… dann … dann hoffe ich, dass du diesmal mausetot bleibst!«
Klick-klack-ticktick-tack näherte sich der Klang von Wasser wie das Klicken von Spinnenbeinen oder von schnalzenden Zungen. Dawyds Herz ging schneller, er ballte die Hände zu Fäusten.
Sie sahen nicht, was sich näherte. Sie fühlten es in der Art, wie sich ihre Haare im Nacken aufstellten.
»Halt!«, rief Rufin, und Dawyd spürte die geballte, von Panik verstärkte Macht des Wortzeichens hinter dem Ausruf. Das Klicken hielt kurz inne – dann erschallte es wieder, näher als zuvor.
»Auf das Licht zu!«, presste Dawyd hervor. »Wir müssen es sehen können, was immer es ist!«
Sie rannten.
Kilianna saß mit dem Rücken zur Tür. Sie hörte schwere Schritte, sah sich jedoch nicht um. Es war nicht ganz einfach, den Gang ihres Bruders Benyam von dem ihres Vaters zu unterscheiden, doch sie vermochte es.
»Benyam«, sagte sie.
»Kilianna«, erwiderte er unwillig.
»Das wird für uns beide ungemütlich, wenn du mich hier auf der Wache behältst. In einer Ausnüchterungszelle. Ich bin sehr nüchtern. Ich denke, wenn jemand diese Zelle verdient hat, weil er gerade dabei ist, seinen eigenen Verstand zu zerlegen, dann ist es Papa.«
Benyam antwortete nicht sofort. Das war gut. Vielleicht zweifelte er. Sie blieb trotzdem mit dem Rücken zu ihm sitzen.
»Willst du lieber ins Gefängnis?«, sagte er. »Denn frei lasse ich dich nicht, und Vater sagt, dass es gnädig ist, dich hierzubehalten, statt dich zu gewöhnlichen Verbrechern zu stecken.«
»Die Gnade der hohen Geburt.«
»Du kannst es wiedergutmachen. Es wird jedem von euch einzeln der Prozess gemacht. Du hast viele Freunde in der Stadt, die für dich aussagen könnten. Ich bin bereit, sie zu kontaktieren. Ich habe keine Freude daran, dich hinter Gittern zu sehen, kleine Schwester.«
Kilianna schüttelte den Kopf. Sie würde keine Abmachung treffen, bei der sie ihre Freunde ans Messer lieferte.
»Was ist draußen geschehen?«, fragte sie dann. »Warum wurden die Alarmglocken geläutet? Papa war hier und hat … etwas erzählt, was mich fast wünschen lässt, die Aquintianer stünden wieder vor den Toren. Aber das ist es nicht, richtig?«
Benyam antwortete nicht. Kilianna blickte auf das Tablett, mit dem ein Gardist ihr Frühstück gebracht hatte. Sie hatte keinerlei Appetit und nur das Wasser getrunken.
»Dawyd ist noch frei, oder, Benyam?«, murmelte sie. »Darüber würde ich mir an eurer Stelle ernsthaft Sorgen machen.«
Wortlos ging Benyam durch den Korridor in seine Schreibstube und schloss die Tür hinter sich. Sie klopfte gegen die Wand. Stein, aber wenn sie laut genug sprach, würde er sie schon hören.
»Was beabsichtigt ihr?«, rief sie. »Papa ist wahnsinnig, willst du das mittragen? Was soll das? Soll er wieder Großgildenmeister werden? Und dann? Er will die Stadt an ein Monstrum aus alten Sagen verhökern, was glaubst du, was euch blüht, wenn er diese kleine Rede, die er bei mir geprobt hat, vor dem Gildenrat hält?«
Keine Antwort.
»Benyam, was ist da draußen los? Warum ist es so finster, es ist – was? Neun Uhr? Zehn?«
Sie wurde wütend, ihre Lethargie verwandelte sich in hell lodernden Zorn. Sie trat an die Gitterstäbe und rüttelte daran, sie brüllte durch den Korridor, dass er es bis in seine Amtsstube hören musste: »Du hast kein Recht, mich hier einzusperren, Benyam! Ich bin nicht verurteilt! Alles, was ihr vorgebracht habt, war erlogen, ihr habt Ismayl im Zeugenstand niedergeschlagen, während er ausgesagt hat! Das ist Unrecht! Ich fordere! Meine Freilassung!«
Sie wiederholte die letzten vier Worte eine geschlagene Viertelstunde, bis Benyams Tür gegen die Wand knallte und er wieder in den Korridor trat. Er war hochrot im Gesicht.
Zufrieden senkte sie ihre Stimme. »Sag mir, was draußen los ist und ob Papa dran schuld ist. Benyam.« Sie sah ihn an, nicht flehentlich, aber eindringlich. »Ich bitte dich darum als deine Schwester und als Einwohnerin dieser Stadt.«
Er sah sich nach allen Seiten um. Kilianna hatte mehrere Männer von der Garde gesehen, doch viele von ihnen schienen unterwegs zu sein.
»Die Tore«, begann Benyam und suchte sichtlich nach Worten. »Führen nicht mehr aus der Stadt heraus. Sie sind … dunkel. Ganz dunkel. Und … es gibt keinen Durchgang mehr.«
»Wir sind eingesperrt?«
Benyam nickte zögerlich. »Ich … denke. Vater sagt, wir sollen uns davon fernhalten. Er würde alles erklären.«
»Die ganze Stadt ist eingesperrt? Was ist mit dem Löhnerviertel außerhalb der Mauer?«
»Es ist … nicht erreichbar. Alles außerhalb der Mauern ist … nicht erreichbar. Für den Augenblick.«
»Wie kann das sein?«
Er verzog das breite Gesicht und sah sie nicht an. »Offenbar ist Vater nicht so wahnsinnig, wie du denkst. Offenbar ist … etwas geschehen, was wir uns nicht erklären können, und er weiß, was es ist.«
»Er hat es gemacht. Er hat es angerichtet. Du solltest ihn einsperren statt mich!«
»Das ist Unsinn, wie soll er das denn anrichten?«
»Diese Schattenmeisterin, sie und er arbeiten zusammen, nein, Benyam, das stimmt! Die Tore sind ganz dunkel und keiner kann hindurch? Nach wem hört sich das an? Wer weiß, vielleicht kombinieren sie Zeichen und schneiden uns damit ab?«
»Nein, Kilianna, du hast das nicht gesehen – sieh dir den Himmel an!«
»Ich sehe davon sehr wenig aus dieser Zelle heraus, weißt du!«, fuhr sie ihn an.
»Er ist bleigrau, wie vor einem Gewitter. Keine Sonne zu sehen. Und der Himmel endet … Kilianna, er endet an den Mauern, stößt daran, als wären die Mauern der Horizont, und das Grau wird immer finsterer, je niedriger es sinkt. Wir sind unter einer Glocke aus Finsternis, die ganze Stadt liegt darunter!«
»Und du tust immer noch, was er will?«, presste sie hervor. »Benyam, was, wenn das länger andauert? Dann werden wir verhungern!«
»Das kann er nicht gemacht haben!«, rief Benyam und ging im Korridor auf und nieder, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. »Kein Zeichen kann so etwas!«
»Was kann so etwas denn dann? Wie kann das sein? Was ist, wenn … wenn man auf die Wehrgänge steigt, auf die Schanzen, wenn man auf der anderen Seite runterklettert oder durch die Tore läuft? Ist es nur eine … eine Illusion, eine Art Traum, den alle träumen? Kommt man raus?«
Benyam ließ sich schwer auf einen Hocker fallen, der neben ihrer Zellentür stand.
»Er sagt, die Garde soll jeden abhalten, der es versucht.«
»Versucht es trotzdem!«
»Soll ich Leute in den Tod schicken, Kilianna? Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn man hineinläuft!«
»Ich würde es versuchen! Lass es mich versuchen!«
»Auf keinen Fall. Hör jetzt auf herumzuschreien. Vater wird alles aufklären. Es ist nur ein kurzes Phänomen. Es wird sich verziehen, bevor es gefährlich werden kann. Wie seltsames Wetter.«
»Das glaubst du.«
»Ja, das glaube ich.«
Sie schüttelte den Kopf und entfernte sich von der Gittertür. Sie sah aus dem kleinen Fenster, durch das sie die Giebel einiger Häuser, die Krone der alten, inneren Stadtmauer und den Himmel sehen konnte. Eine bleigraue Glocke über der Stadt.
»Glaube kann manchmal ganz gut sein«, murmelte sie. »Doch in den meisten Fällen ist er einfach nur eine Entschuldigung, um dumm zu sein.«
Ismayl trug keinen Knebel. Er befand sich in Isolationshaft, und obwohl er wusste, dass diese noch nicht allzu lange dauern konnte, fühlte er, wie die engen Wände der gezeichneten Zelle sich auf ihn senkten und von allen Seiten gegen ihn drückten. Es gab ein Loch, in das er seine Notdurft verrichten konnte, eine dicke, gepanzerte, zeichenversehene Tür mit einer Klappe darin, durch die man ihm Essen hineinschob, und eine Öllampe, die oberhalb der Tür in einem Glaskasten stand und ihm Licht spendete. Das Öl konnte ebenfalls von außen nachgefüllt werden, und das Glas war unzerbrechlich dank Zeichenmacht.
Ismayl standen ein Bett und ein Tischchen mit einem Stuhl zur Verfügung. Alles in allem litt er hier drin vielleicht schlimmer als in der Fußbodenheizung unter Lafayets Schreibstube.
Er war kein Mensch für Einsamkeit. Und er war kein Mensch für enge, bleierne Kellerzellen. Er sang einige Lieder vor sich hin, klopfte an die Tür und verlangte Schreibzeug oder ein Buch, aber nichts davon wurde ihm gewährt – vermutlich konnte man weder sein Klopfen noch sein Rufen hören, sonst hätte man ihn wohl geknebelt. Er setzte sich auf das Bett und starrte Löcher in die Decke. Er versuchte, sich an Gedichte zu erinnern, versuchte, sich die Zeit mit Wortspielen zu vertreiben, doch sein Hirn war leer.
Bald werde ich wie die Zelle sein. Diese Zellen machen so etwas mit einem. Sie machen einen zum Teil ihrer selbst.
Er dachte an seinen alten Meister, Aramaeis. Er hatte lange nicht an ihn gedacht.
Die Zelle ist Euch erspart geblieben, Meister.
Er dachte an Meister Simeon. Der Alte war ihm trotz der langen Gefangenschaft stark und klar erschienen, wenn auch nicht körperlich, so doch geistig.
Ich bin nicht so stark wie Ihr, Meister.
Er dachte an die Fußbodenheizung und an Neigels Gesicht, das vor dem freigewuchteten Ausgang auftauchte. An Neigels Arm, der ihn aufrecht hielt nach Stunden in zusammengekrümmter Haltung.
Holt mich diesmal auch jemand raus?
Er sah die Wände hinauf und hinab. Nirgends waren Spuren, sie wirkten unantastbar. Verdammte Zeichen!
Manchmal wünschte er, Sygna wäre eine Stadt wie Naronne, ohne Zeichenmacht, dafür mit weniger Angst vor Wissen.
Irgendwann öffnete sich die Klappe der Panzertür.
»Halt!«, rief er. »Ich brauche etwas zu schreiben! Oder zu lesen! Bitte! Lasst mich mit meinen Freunden sprechen! Hört ihr mich?«
Eine Art Lade wurde in seine Zelle geschoben. Kein Durchlass, keine Möglichkeit, gehört zu werden.
»Hört ihr mich?« Er kniete sich davor und schrie das Essen in der Lade an. Ohne Besteck und Geschirr lag es einfach darin: eine Wurst mit einem Stück Brot und einigen grünen Schoten, die er noch niemals zuvor gesehen hatte. »Ich bin nicht verurteilt! Ich will jemanden sprechen! Lasst mich wenigstens etwas schreiben!«