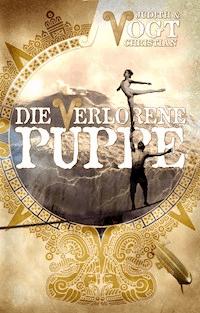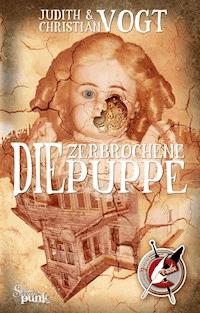9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Geheimnis der Zeichen
- Sprache: Deutsch
Die Rebellion war erfolgreich. Die Sygnaer Bürger haben die Besatzer aus Aquintien aus der Stadt gejagt. Doch auch die dreizehn mystischen Urzeichen wurden aus den unterirdischen Katakomben befreit. Sie haben sich neue Träger gesucht, denen sie übernatürliche Fähigkeiten verleihen - und zwar sowohl unten den Sygnaer Bürgern als auch unter den feindlichen Soldaten. Während seine Kameraden die Verteidigung von Sygna organisieren, reist der Dichter Ismayl als Spion in die Hauptstadt des Feindes, um dort nach der Ursprungslegende der Urzeichen zu forschen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 847
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autoren
Titel
Impressum
Widmung
Karte
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Danksagung
Über das Buch
Die Rebellion war erfolgreich. Die Sygnaer Bürger haben die Besatzer aus Aquintien aus der Stadt gejagt. Doch auch die dreizehn mystischen Urzeichen wurden aus den unterirdischen Katakomben befreit. Sie haben sich neue Träger gesucht, denen sie übernatürliche Fähigkeiten verleihen – und zwar sowohl unten den Sygnaer Bürgern als auch unter den feindlichen Soldaten. Während seine Kameraden die Verteidigung von Sygna organisieren, reist der Dichter Ismayl als Spion in die Hauptstadt des Feindes, um dort nach der Ursprungslegende der Urzeichen zu forschen …
Über die Autoren
Judith C. Vogt wurde 1981 geboren und wuchs im Heinrich-Böll-Ort Langenbroich auf. Sie ist gelernte Buchhändlerin. Christian Vogt, geboren 1979, stammt aus Kommern, studierte in Aachen und ist Physiker. Gemeinsam haben sie zahlreiche Romane veröffentlicht, darunter auch den Steampunk-Roman Die zerbrochene Puppe, für den sie 2013 den DEUTSCHEN PHANTASTIK PREIS in der Kategorie »Bester deutschsprachiger Roman« erhielten. 2014 gewannen sie nochmals den DEUTSCHEN PHANTASTIK PREIS, diesmal für die beste Anthologie. Das Ehepaar wohnt mit seinen Kindern in Aachen.
Judith & Christian Vogt
DIE 13 GEZEICHNETEN
DIE VERKEHRTE STADT
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Dieses Werk wurde vermittelt durch Castle Gate Agency, Literarische Agentur Harald Kiesel, 69198 Schriesheim (www.castlegate-agency.com)
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Hanka Leò, BerlinKartenillustration: © Hannah Möllman, KölnTitelillustration: © Raymond MinnaarUmschlaggestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.deE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-6102-5
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
Wir widmen dieses Buch Klaus und Kathrin.Das Duell zwischen Fanboy und Hater jedoch – das widmen wir Lena Richter.
Kapitel I
Ismayls Gegenüber hob sein Glas. »Wir sollten keine Gelegenheit verstreichen lassen. Heute oder nie, leben oder sterben. Das ist der Moment, in dem sich alles entscheidet.«
Das Glas in Ismayls Hand hob sich wie von selbst. Er fühlte sich nicht so zuversichtlich, doch er hatte gelernt, sich zu verstellen. »Heute oder nie.«
»Schon mal Sekundant gewesen?«, fragte der andere.
»Nicht wirklich«, sagte Ismayl und vermisste Dawyd. Ausgerechnet Dawyd das Maul – von allen, die er in Sygna zurückgelassen hatte, um nun hier zu sitzen. In einem spärlich erleuchteten Kellergewölbe im Naronner Studentenviertel. Mitten in der Höhle des aquinzischen Löwen!
»Ich kann dir sagen, mit Schusswaffen ist das alles noch viel spannender als mit Degen.«
Durch Ismayls Kopf fuhren Erinnerungen an Schüsse, an die Explosion eines Karrens, an ein Beben in der Tiefe. An Gewalt und Krieg und das Stürmen einer Festung. Ihm wurde kalt, wenn er daran dachte, und die Oberfläche des honigbraunen Naronner Kognaks zitterte in seinem Glas, als hätte der Schnaps ein Eigenleben. Ismayl beeilte sich, ihn herunterzustürzen. »Das glaube ich.«
Tapfer lächelte er sein Gegenüber an. Toma Delacroi, einen jungen Studenten der Geologie, der bereits das Studium der Theaterwissenschaften und Literatur abgebrochen hatte: der Anlass des Streits. Heute oder nie – leben oder sterben – das alles hing von Tomas Treffsicherheit ab. Ismayl wollte gar nicht darüber nachdenken, was eine Kugel mit dem zarten, blutarmen Leib des Studenten anrichten würde. Er brauchte ihn noch, nach dem Duell.
»Ich werde also dein Sekundant sein, und wenn wir das überleben, dann nimmst du mich mit in die Bibliothek?«
Toma warf Ismayl durch die rauchverhangene Luft einen tiefen, dunklen, schicksalsschweren Blick zu, nachdem er sein Glas mit in den Nacken gelegtem Kopf geleert hatte. Die sprichwörtliche aquinzische Melancholie lag so plakativ in diesem Gesichtsausdruck, dass Ismayl beinahe lachen musste.
»Wenn ich das überlebe, mein Freund. Wenn ich das überlebe.«
Ismayl Schönauge, Dichter und Wortzeichenwirker aus Sygna, befand sich auf gefährlichem Pflaster. Zehn Monate lang hatten Toma und Ismayl – ohne einander zu kennen – zur gleichen Nation gehört. Dann hatte sich das von aquinzischen Soldaten besetzte Sygna erhoben. Einiges Blutvergießen, beträchtliches Chaos und das vermutlich unerfreuliche Erwachen alter Geheimnisse in den Katakomben unter der Stadt später war der Aufstand im Frühling erfolgreich gewesen, und obwohl Ismayl es selbst nicht für möglich gehalten hatte, hatten die Aquintianer die Stadt nicht zurückerobern können. Mehr noch – die Glückssträhne des beispiellosen Feldzugs, auf dem sich der aquinzische Kaiser Yulian befand, schien auszufransen, und es sah ganz so aus, als sei ihr Ende nah. Die Front zur Noccurn-Allianz im Osten wich Scharmützel um Scharmützel zurück, und es waren nicht genug Soldaten da, um zu verhindern, dass ein kleines, aber schlagkräftiges Heer aus Sygna umliegende Städte, Dörfer und Landstriche befreite und als zum Stadtstaat Sygna zugehörig erklärte.
Damit hatte Ismayl nichts zu tun. Er war kein Soldat und kein Stratege, und auch wenn er eine nicht unwichtige Rolle bei der Befreiung der Stadt gespielt hatte, wusste er nur zu gut, dass er sein Glück nicht überstrapazieren sollte. Ismayl war zehn Monate lang der einzige Dichter auf freiem Fuß in Sygna gewesen, doch nun waren wieder andere da, die Reden halten und Menschen motivieren konnten. Und dass mit Dawyd Iackmar ein Urzeichenträger an der Spitze von Sygnas Armee kämpfte, wirkte sicherlich motivierender als jedes warme Wort, das Ismayl den Kämpfern hätte mitgeben können.
Ismayl hatte sich vor acht Wochen auf den Weg nach Naronne gemacht, der Hauptstadt Aquintiens am Dardantischen Ozean. Lange hatte er sich eingeredet, dass sein Blick auf Geheimnisse und Geschichten aus alter Zeit in die falsche Richtung gerichtet gewesen war, da es um die Zukunft Sygnas ging. Doch die Gegenwart hatte ihre Hand in die Vergangenheit ausgestreckt und mit den Urzeichen etwas Altes zutage gefördert, das sich niemand in Sygna erklären konnte.
Warum gab es in der Verkehrten Stadt unter dem Bleiberg hinter dreizehn Siegeln dreizehn Sarkophage, in denen Mächte eingesperrt gewesen waren, denen sie nun auf Gedeih und Verderb ausgeliefert waren? Um zu erkennen, in welche Zukunft die Stadt steuerte, musste Ismayl ihre Vergangenheit erkunden. Bedauerlicherweise schienen die Aquintianer mehr über diese Vergangenheit zu wissen als die Sygnaer, die nicht nur die Sarkophage versiegelt, sondern auch das Wissen darüber verbannt hatten. Um herauszufinden, was es mit den Urzeichen auf sich hatte, blieb Ismayl nur ein Weg – und der führte direkt in die Universitätsbibliothek von Naronne.
Ismayl war gleichzeitig der beste und der schlechteste Spion, den der Großgildenrat von Sygna hätte entsenden können. Er war bewandert in den alten Geschichten und hatte einen neuen Urzeichenträger – Dawyd – eingehend studieren können. Er hatte für diesen Auftrag in Feindesland ein neues Wortzeichen gelernt, nämlich jenes, das seine Worte vertraut klingen ließ in aller Herren Länder. Sein derzeitiger Dialekt hörte sich an, als sei er wie Toma von Geburt an Bürger Naronnes. Deshalb, so hatte er gehofft, würde es ihm nicht schwerfallen, sich als Student an der Universität einzuschreiben und Zugang zur Bibliothek und den alten Schriften zu erhalten.
Er hatte nicht damit gerechnet, dass von allen Orten, an denen es Unfrieden zu stiften galt, Lysandre Rufin ausgerechnet nach Naronne zurückkehren würde, und dass die Schreiber und Doktoranden des Zeichenwissenschaftlers Aquinçois Lafayet Bereiche der Bibliothek mithilfe von Soldaten und Waffengewalt absperren würden.
Normalerweise war Naronne, die Blaue Stadt am Gestade des Dardantiks, groß genug, dass zwei Todfeinde einander darin aus dem Weg gehen konnten – und nichts anderes waren Ismayl Schönauge und Lysandre Rufin. Doch wenn beide um die Universität kreisten wie Motten ums Licht, dann war es nur eine Frage der Zeit, bis der Commissaire der kaiserlichen Geheimpolizei auf den Dichter aufmerksam wurde.
Ismayl ließ sich von Toma noch einmal nachschenken; der Gedanke an Rufin weckte in ihm den törichten Wunsch zu trinken. Dass Rufins Geist im Körper von Ismayls Freund Ignaz steckte, machte es nicht besser.
Commissaire der Geheimpolizei – und Urzeichenträger des Wortes, hallte es hohl in seinem Schädel, als er den Inhalt des Glases herabstürzte. Ich bin vielleicht nicht der schlechteste Spion aller Zeiten – aber der, der am schlechtesten geeignet ist.
Toma Delacrois war hervorragend geeignet, um ihm aus dieser Zwickmühle zu helfen. Denn Toma war Doktorand der Geologie und promovierte bei Professor Lafayet, der den Lehrstuhl für Geologie innehatte, obwohl er seit der Eroberung Sygnas in einem anderen Feld forschte: der Zeichenkunde. Ein Studienfach, das es bislang weder in Naronne noch in Sygna noch anderswo auf der bekannten Welt gab.
Immerhin ein Gutes hatte Rufins Anwesenheit in Naronne: Ismayl nahm an, dass er hier jene Urzeichenträger um sich scharte, die auf der aquinzischen Seite der Front erwacht waren. Und das bedeutete, dass Ismayl etwas über sie herausfinden konnte, wenn er die Augen offen und seinen Feind im Blick behielt.
Mit einem Befehl seines aberwitzig mächtigen Wortzeichens hatte Rufin aus dem Zunftgefängnis heraus bewirkt, dass Kilianna Erdhand die elf verbliebenen Sarkophage öffnete und die Zeichen frei ließ. Sein willenloser Gehilfe Neigel hatte den schwer verletzten Rufin aus dem Gefängnis befreit – und mit ihm die Stadt verlassen. Rufin hatte von Elisabedas Hammerschlag mindestens einen Schädelbruch davongetragen, doch davon hatte er sich unverhältnismäßig schnell erholt.
Einige der befreiten Urzeichen hatten sich Träger in Sygna gesucht und andere unter den Soldaten der aquinzischen Armee. Als Ismayl Sygna verlassen hatte, hatten sich dort gerade einmal fünf Urzeichenträger befunden – oder zumindest zu erkennen gegeben.
Die Gezeichneten der Nährenden und der Alchimistischen Zeichen befanden sich jedenfalls auf Feindesseite, das zeigte Rufins rasche Genesung. Diese beiden – wen auch immer die Zeichen erwählt hatten – waren nun die mutmaßlich fähigsten Heiler und Alchimisten der Welt, und es war ganz und gar ungünstig, dass sie sich in Naronne und nicht in Sygna befanden.
»Du betrinkst dich doch nicht etwa aus Sorge um mich?«, spottete Toma und goss ihm ein weiteres Mal nach. Billiger Kognak schmeckte noch billiger, wenn man ihn in den verrauchten Kellergewölben der Studentenverbindung einnahm, und mittlerweile hatten die meisten von Tomas Kommilitonen in Erwartung der morgigen Kopfschmerzen ihre Zimmer aufgesucht.
»Ich trinke immer nur aus Sorge um mich selbst«, log Ismayl.
»Was hast du schon zu verlieren?«
Ismayl legte den Kopf in den Nacken und starrte an das spinnwebverhangene Trommelgewölbe. »Du würdest dich wundern.«
Der andere lachte und sagte: »Du bist betrunken, mein Freund. Als Sekundant droht dir kein anderer Schaden, als dass du in aller Frühe aus den Federn musst. Noch dieser eine Schluck, und dann kommst du mit hoch und schläfst bei mir und Remien im Zimmer.«
Ismayl hob sein Glas. »Auf einen erfolgreichen Morgen. Mögest du nicht sterben!«
»Möge ich nicht sterben!«, stimmte der Student ein, und beide leerten ihr letztes Glas.
Spätsommer in Naronne. Die Blaue Stadt trug den Beinamen nicht ohne Grund, denn wenn die Sonne das Meer azurblau gleißen ließ, dann fiel dieses Leuchten auch auf die weißen Türme der Hauptstadt und schimmerte auf den blauen Schindeln der Dächer.
Lysandre Rufin hatte das seltsame Gefühl, seine Heimat vermisst zu haben, obwohl er in der Ferne kein Heimweh gehabt hatte.
Sygna hatte unvergleichliche Handwerker hervorgebracht, doch offenbar hatten dort immer nur mittelmäßige Architekten gewirkt. Naronne verfügte über fabelhafte Architekten. Architektur war eben eine Wissenschaft und kein Handwerk, und Naronne war eine Stadt der Wissenschaft. Die Gebäude der Innenstadt – die Stadtpaläste, Kathedralen und die Universität – waren fast alle von den runden, weißen Türmen geziert, die der Stadt ihre weltberühmte Silhouette verlieh. Die Türme waren höher als jedes Gebäude in Sygna.
Rufin blickte vom Platz der Republik auf, sein Blick glitt über den blau geäderten Marmor der epochalen Statue von Kaiser Yulian und an den Prunkbögen des Regierungskomplexes hinauf zu den weißen Spitzen darüber. Er kniff die Augen zusammen und seufzte. Möwen kreisten um die Türme, und er konnte sie nicht besonders gut erkennen. Er wusste nicht, warum Ignaz Dreifinger keine Brille getragen hatte, aber der Mann war ganz offensichtlich kurzsichtig.
Rufin stieß ein leises, trockenes Lachen aus. Kurzsichtig, nicht nur, was seine Augen betraf! Nun, immerhin konnte man diese Kurzsichtigkeit mit einer Brille korrigieren. Lästiger war ihm die rechte Hand, aber er empfand es irgendwie als gerecht, dass er nun mit einer Verstümmelung gestraft war, die er selbst verursacht hatte. Und da sagte man, das Schicksal habe keinen Humor!
Trotz der Kurzsichtigkeit rief der Anblick der ihn umgebenden weißen Türme noch etwas anderes in ihm hervor – das Gefühl, fremd zu sein, obgleich dies seine Heimatstadt war. Er trug ein Gesicht, das keiner kannte, er war hier ein Niemand, ein Mensch ohne Wurzeln.
Er konnte seine Mutter nicht besuchen, ohne sie für den Rest ihres Lebens zu verschrecken, er konnte seinen Schwestern nur Briefe schreiben. Selbst im Büro der Geheimpolizei war er ein Fremder. Er hatte mit viel Mühe die hochrangigsten Mitglieder des Militärs, allen voran Marschall Soussin, davon überzeugt, dass er nicht der Anführer der Aufständischen war, sondern sich nur dank einer unerklärlichen, unnatürlichen Macht in dessen Körper befand. Bis er sich zu seiner Familie wagte, würde noch etwas Zeit ins Land gehen. Er musste erst ganz sicher sein, dass dieser Zustand von Dauer war und er keine Gefahr darstellte. Er musste herausfinden, oder vielmehr herausfinden lassen, ob so etwas schon einmal geschehen war und was es für die Zukunft der Aquinzischen Nation bedeutete, dass sich die Urzeichen dreizehn Träger gesucht hatten – fünf davon in der Armee Kaiser Yulians.
Rufin trat in den Schatten der Bogengänge des Regierungsbezirks. Zwei mit Musketen bewaffnete Gardisten kontrollierten das Schreiben, das er von Marschall Soussin erhalten hatte, und ließen ihn ein.
Die altbekannten Gänge fühlten sich fremd an unter den Füßen, die ihm noch immer nicht wie seine eigenen schienen. Als er aus einem weiten, mit rotem Teppich ausgelegtem Flur in einen schmaleren Korridor abbog, drängten sich ihm die Erinnerungen an die Katakomben unter Sygna auf. Er begann schneller zu atmen und musterte seine Stiefelspitzen auf dem ausgetretenen Teppich. Er ballte die verbliebenen zweieinhalb Finger der rechten Hand um das Sendschreiben.
Es gibt keine Rückkehr zu dem, der ich früher war. Das, was da gelegen hat, war nicht mehr ich. Das war kein Mensch mehr. Eiskalt lief es ihm den Rücken herab, gleichzeitig schwitzte er in seiner Uniform. Kein Zurück. Das hier ist alles, was ich bin.
Als er an der mit Perlmuttintarsien versehenen Tür des Besprechungsraums ankam, hatte er den Körper wieder unter Kontrolle. Er atmete tief durch und reichte das Schreiben einem Gardisten mit federgeschmückter Mütze. Während dieser es aufmerksam las, musterte Rufin die Einlegearbeiten in der Tür, die abstrakten Muster. Ob hier wohl ein Schreiner aus Sygna am Werk gewesen war? Lag der Tür ein Zeichen inne, war sie unzerbrechlich oder undurchdringlich für Schall? Er lächelte schmal. Ignaz Dreifinger hätte es gewusst.
Aber der bin ich nicht.
Der Gardist reichte ihm das Schreiben zurück, und die Tür schwang lautlos auf, als er dagegentippte.
Zeichenmacht aus Sygna, folgerte Rufin und trat in Marschall Soussins Strategiezimmer ein.
»Da seid Ihr ja, Commissaire«, begrüßte ihn Soussin etwas angespannt. Die anderen sechs Anwesenden hoben die Blicke, und zweien von ihnen entfuhr ein erschreckter Laut. Soussin runzelte verärgert die Stirn, da er sie offensichtlich über Rufins verändertes Erscheinungsbild in Kenntnis gesetzt und angenommen hatte, sie hätten sich besser unter Kontrolle.
Professor Lafayet war anwesend, ebenso wie der ehemalige Gouverneur von Sygna, Rodolphe Tranquil. Vormals Lieutenant, nun Capitaine Sarmand, der dafür befördert worden war, den Gouverneur aus Sygna herausgebracht zu haben, saß zu dessen Rechter und starrte Rufin unverhohlen entsetzt an. Jurisdikarin Simonee war da, die wie Lafayet früh genug aus Sygna abgereist war, um dem Fall und den damit verbundenen Morden an den aquinzischen Soldaten und Beamten zu entgehen. Ein Mann mit der Uniform eines Lieutenant sah übermüdet und ausgemergelt aus, das musste der Gesandte von der Front sein. Bleich und schmal wie ein strenger Priester saß Bürgermeister Prix am Kopfende der Tafel. Der Letzte im Bunde war der Außenminister selbst, Kristoff Sain-Diyee.
Rufin wusste, dass es an der Front alles andere als rosig aussah: Die Neun-Tage-Belagerung von Sygna hatten sie im späten Frühjahr abbrechen müssen, denn die Noccurn-Allianz hatte das Hauptheer des Kaisers an der Ostfront angegriffen, und der Marschall hatte alle Truppen dorthin zurückbeordert. Sygna würde ihnen nicht davonlaufen – und sie hatten nun Urzeichenträger in ihren Reihen.
Das Morgenlicht fiel durch die schmalen, hohen Glasfenster, und eine nahe Kathedralenglocke verkündete, dass Rufin mit vollendeter Pünktlichkeit eingetroffen war.
»Guten Morgen«, grüßte er in die Runde. »Wie erstaunlich. Ein Treffen zu so früher Stunde, und ich bin der Letzte, der eintrifft.«
Der Marschall nickte knapp. Lafayet lächelte ihn an, während der ehemalige Gouverneur den Blick abwandte.
»Setzt Euch. Wir beginnen.«
Lysandre folgte dem Wink, setzte sich an die spiegelblanke Tafel und war wenig überrascht, als der Lieutenant sich erhob und eine Karte entrollte, die ganz offensichtlich unter Wind, Wetter und einer nicht unbeträchtlichen Wegstrecke gelitten hatte.
»Meine Eskorte und ich trafen in der Nacht ein«, eröffnete er ohne Umschweife. »Ich komme direkt von der Front bei Grenin. Die Stadt ist noch in unserer Hand, aber ich sage absichtlich ›noch‹, denn ich glaube nicht, dass das noch lange der Fall sein wird. Der Kaiser ist mit der Garde entkommen, aber Teile unserer Truppen werden vermutlich in der Stadt belagert. Das heißt, unsere Armee wurde einmal mehr dazu gezwungen, sich aufzuspalten. Bald haben wir mehr Fronten als Kompanien.« Er wies auf mehrere Orte und Landmarken auf der Karte.
»Wie kann das sein?«, fragte Tranquil. »Warum gerät der Vormarsch so plötzlich ins Stocken? Das kann doch nicht am Verlust von Sygna liegen!«
»Es ist ein ungünstiges Zusammenspiel zahlreicher Faktoren«, gab Marschall Soussin zu. »Sygna hat viele unserer Soldaten zu lange gebunden, aber vor allen Dingen ist es der Söldnergeneral Siljonicz aus Beiden Reichen, der uns Sieg um Sieg kostet.«
»Ein einzelner Mann? Unmöglich!«, sagte die Jurisdikarin, die sich emsig Notizen machte.
»Die Noccurn-Allianz hat ihm nicht umsonst den Gegenwert eines kleinen Königreichs versprochen«, gab Marschall Soussin zu bedenken. »Er gilt als Yulians Nemesis. Er ist vielleicht der einzige Mann, dessen Strategien es mit denen des Kaisers aufnehmen können.«
»Was sollen wir hier in Naronne daran ändern?«, fragte Rufin und beugte sich in Richtung der Karte. Dabei fing ein kleines Detail in Simonees Wust aus Papier, Schreibfedern und einer erkalteten Teetasse seinen Blick. Zwei kleine Klumpen Wachs lagen griffbereit vor ihr.
Sofort kochte Wut in ihm hoch, und er biss die Zähne zusammen. Er war nie jemand gewesen, der sich leicht ärgern ließ, und hinter jeder Stimmungsänderung vermutete er die Zerbrechlichkeit des Gedankenkonstrukts, mit dem er sich in Ignaz’ Geist niedergelassen hatte. Er zwang sich, den Blick von den Wachsklümpchen abzuwenden.
»Nun ja«, sagte Simonee, ohne ihn anzusehen, »ich hörte, wir haben einige sehr mächtige Menschen in unseren Reihen, Commissaire. Vielleicht wäre es an uns, diese auszusenden, um das Blatt an der Front zu wenden.«
»Was meint Ihr damit, Madame Simonee?«, fragte er bemüht ruhig. »Haben wir nicht schon eine Armee, die mit zeichenbewehrten Musketen ausgestattet ist, einer Waffe, die im Rest der Welt ihresgleichen sucht?«
Sie schüttelte den Kopf. »Wir haben gehört, dass Siljonicz Lieferungen aus Stare Traha erhält. Die Allianz ist sich mit dem Zaren einig geworden, und Schattenpulverwaffen haben ihren Weg an die Front gefunden. Ich würde sagen, das stattet beide Armeen ganz ähnlich aus, nur dass der unsrigen der Nachschub an jungen Männern ausgeht und wir eine überdehnte Front mit zu wenigen Soldaten halten müssen.«
»Und dass uns Sygna abhandengekommen ist, war ein herber Schlag. Wir waren gerade dabei, Manufakturen für die Zeichen der Heiler zu errichten«, merkte Tranquil an.
»Ganz abgesehen davon, dass der Verlust von Sygna auch einen Verlust der Moral nach sich zog«, pflichtete der Marschall zähneknirschend bei. »Sygnas Bürgerwehr überzieht uns von Westen aus mit Scharmützeln, während im Osten wie der sprichwörtliche Bär der Zarenreiche Siljonicz lauert!«
Rufin glaubte, aus jedem einzelnen Wort Anschuldigungen triefen zu hören. Seine Missstimmung wuchs.
»Und sowohl dieser Rat hier als auch die Ratgeber des Kaisers haben bisher wenig mehr als Schadensbegrenzung betrieben«, presste er hervor und sah wieder auf die Wachspfropfen, die vor Simonee lagen. In seinen Ohren klingelte die Wut. »Es befinden sich fünf Urzeichenträger in unseren Reihen, meine Dame, meine Herren! Warum werden keine Manufakturen in Naronne gebaut? Oder nahe der Front? Wir haben das Nährende und das Alchimistische Zeichen in unseren Händen! Kombiniert ergeben sie die mächtigsten Heilmittel, von denen die Welt je gehört hat. Warum ist noch nichts davon auf dem Weg zu Front? Warum verschwendet Ihr Eure Zeit in den Bibliotheken, Lafayet?«
Der Geologe hob die Brauen, überrascht davon, dass sich der Wind plötzlich in seine Richtung drehte. »Weil nicht alles so … intuitiv ist wie Euer Zeichen, Lysandre. Alchimie ist ein explosives Handwerk, und wenn die Macht des Urzeichens nicht gelenkt wird, dann kann Naronne innerhalb von Stunden in Schutt und Asche liegen!«
»Intuitiv, sagt Ihr?«, spie Lysandre. »Monatelang habe ich eine blutige Spur durch die Dichtmeister Sygnas gezogen. Ich habe gefoltert und erpresst, um hinter die Geheimnisse des Wortzeichens zu kommen, und dabei große Teile meines Gewissens auf der Strecke gelassen. Ich habe das Wortzeichen nicht intuitiv gemeistert! Ich habe es mir mit allem erarbeitet, was ich habe, und dafür mit beinahe allem bezahlt, was ich habe, inklusive des Körpers, mit dem ich geboren wurde!«
Schweigen. Nicht einmal Lafayet war mehr nach seinem ironisch-freundschaftlichen Grinsen zumute. Er war jedoch derjenige, der sich räusperte und das Schweigen brach, während Simonee eine Hand über ihre Ohrstöpsel legte. Um seinen Worten Einhalt zu gebieten – aus Angst davor, seine Loyalität würde wanken und er würde sich diesen Rat untertan machen!
»Wir erweitern die Pulvermanufakturen in Naronne-Iyaire, Lysandre«, sagte Lafayet ruhig. »Das weißt du so gut wie ich. Die neuen Urzeichenträger werden sich erproben und beweisen können, und ihre Erkenntnisse werden dem Kaiser so schnell wie möglich zur Verfügung stehen. Sie arbeiten bereits jetzt daran, das wisst ihr alle. Bislang in den Räumen der Universität, aber dies könnte sich im Zentrum von Naronne als zu gefährlich herausstellen, und wir sind sicher bald in der Lage, ihnen in Iyaire genügend Platz und Material zur Verfügung zu stellen. Die Zeit läuft uns schneller davon, als uns lieb ist, und wir haben zu wenig Arbeitskräfte zur Verfügung, aber wir sitzen ganz gewiss nicht untätig herum. Es ist eine kurze Flaute, aber bald geht es aufwärts.«
»Flaute«, brachte nun der Minister hervor. »Alles steht unter einem schlechten Stern.«
»So abergläubisch, Sain-Diyee?«, spöttelte der Marschall.
Sain-Diyee winkte ab. »Der Kontakt zu den Kolonien in Übersee ist abgebrochen. Die Lage an der Front hat sich dramatisch verschlechtert. Ich rate dem Kaiser in beinahe täglichen Briefen, unsere Kräfte in Aquintien zu sammeln. In unserem Vaterland. Das zu sichern, was wir haben, statt alles auf dieses eine Blatt zu setzen. Auf diese … Gezeichneten!«
»Feigling«, stieß Rufin hervor.
Sain-Diyee stierte ihn an. »Sind wir sicher, dass das da Lysandre Rufin ist, oder könnten wir ihn aus diesem Ausschuss ausladen, bis das geklärt ist?«
Rufin erhob sich und streckte die verstümmelte Hand aus. Der längste Finger daran, der Ringfinger, deutete auf den Minister. »All diese Länder, die die Große Armee des Kaisers erobert hat, sind nun Aquintien, Minister! Alle, die darin wohnen, Mann und Frau, alt und jung, sind Bürger der Aquinzischen Nation! Ihr als Minister, als Vertreter der kaiserlichen Regierung, seid ihnen verpflichtet, seid ihr verpflichtet! Ist Yulian angetreten, um den Reichtum zu mehren, auf dem Euer breiter Arsch sitzt? Das ist es, was ihr alle vergesst! Yulian führt diesen Krieg nicht um der Macht willen, nicht um der Gebiete willen und nicht um der Tatsache willen, dass er über ein Reich gebieten wird, an das nicht einmal die Kaiserreiche alter Zeiten herankommen. Yulian führt diesen Krieg, um eine Gleichheit zu erzwingen, die für alle Bürger der Nation gelten wird, und wenn wir sie ihnen mit Feuer und Musketen bringen müssen! Eine Gleichheit für Männer und Frauen, für Arme und Reiche. Alle werden Zugriff auf die Zeichen Sygnas haben! Alle werden von den Waren aus den Kolonien profitieren! Alle vom Wissen der Naronner Universität! Das Weltreich, das Yulian schaffen will, wird ein Reich des Friedens sein, des Wohlstands und der gleichen Rechte für alle. Euch ist bang vor so etwas? Natürlich, denn Ihr seid ein Kleingeist, ein Unfriedenstifter, ein Mann ohne Vertrauen.«
Rufins Stimme dröhnte durch den Saal. Simonees Hand lag schlaff neben ihrer Teetasse, vergessen war das, womit sie sich vor seinen Worten hatte schützen wollen. Sein Zeichen wob sich mühelos durch ihren Geist. Er wandte sich an den Bürgermeister, der bislang geschwiegen hatte: »Wenn Euch Arbeiter fehlen, dann verpflichtet sie. Wenn dem Marschall Soldaten fehlen, dann zieht sie ein! Junge Männer, junge Frauen – alle, die bereit sein sollten, für diese Vision unseres Kaisers zu arbeiten. Naronne ist nun so weit weg von den Grenzen Aquintiens, dass sich hier niemand mehr seiner Pflicht bewusst ist. Wenn es in Iyaire an Arbeitern fehlt, dann seid Ihr nachlässig gewesen! Kommende Generationen werden uns daran messen, was wir heute tun!«
Kurz schoss ihm durch den Sinn, was er anrichten konnte. Er konnte sich hier und jetzt zur einzigen Regierungsinstanz von Naronne machen. Er konnte die, die ihm im Weg standen, für immer zum wortwörtlichen Schweigen bringen, und sich von denen unterstützen lassen, die begriffen, an welcher Schwelle sie standen. Der Kaiser würde es verstehen. Der Kaiser wusste, dass wahre Gleichheit nur eintrat, wenn sich ein Mann mit Vision zum Ersten unter Gleichen machte.
Rufin holte tief Luft. Dann stieß er sie wieder aus. Er legte die Rechte an die Brust und sagte lediglich: »Es lebe der Kaiser!«
Inbrünstig wiederholte es jeder im Raum, sodass die Fensterscheiben bebten.
»Es lebe der Kaiser!«
Steine rieselten Dawyd ins Gesicht, während er wie eine Ziege in der Steilwand stand.
»’tschuldigung«, hauchte Darius über ihm.
Dawyd schnaufte protestierend, sagte aber kein Wort. Das Zeichen, das ihnen Grau-Evy auf ein Stück Holz geritzt und mitgegeben hatte, würde sie zwar vor flüchtigen Blicken im Zwielicht verbergen, aber keinen Fluch verstummen lassen, den er wegen eines Tölpels wie Darius von sich gab, der sich allen beweisen wollte.
Dawyd Iackmar, Träger des Blutzeichens, erreichte kurz nach Darius das schmale Plateau; vor ihnen lag das Mauerwerk einer Festung, unter ihnen fiel die Steilwand dreißig Meter bis zum Fluss ab. Eine erste Ahnung der aufgehenden Sonne zeichnete sich am Horizont ab. Dadurch konnte er zu seiner Linken die Mündung der Lur in den Nadder ausmachen; und die von einem Flickenteppich aus Feldern geprägte Ebene, durch die der Nadder mäanderte. Zu seiner Rechten erstreckte sich ein Weg hoch zur Lurmundfeste, und dahinter waren die Ausläufer der Kuser Berge zu erkennen. Die Aussicht würde in der fortschreitenden Dämmerung noch spektakulärer werden, aber er konnte es sich nicht leisten, sie zu genießen. Jede weitere Minute, die verstrich, machte es wahrscheinlicher, dass sie entdeckt wurden.
Das volle Dutzend seiner Leute hatte sich inzwischen auf dem Plateau eingefunden und presste sich an die Mauer, weg vom gähnenden Abgrund. Oben auf der Mauerkrone war der sich bewegende Schemen einer Wache auszumachen, überragt vom Lauf der Muskete. Dawyd wartete, bis der aquinzische Soldat weitergezogen war. Dann nickte er seinen Männern zu. Sie bohrten mit unmenschlicher Stärke ihre Finger ins Gemäuer und fanden auf diese Weise Halt. Für gewöhnliche Soldaten wäre der Aufstieg – zunächst die Steilwand, dann die Mauer hinauf – schlicht unmöglich gewesen, zumal sie klitschnass waren, nachdem sie die Lur durchschwommen hatten. Das Dutzend Kletterer, das sich aus beiden Fechtergilden rekrutierte, hatte Zeichenmacht gewirkt, um die Muskelkraft zu steigern und den Fingern die Härte von Stahl zu verleihen. Dawyd hatte die verlorene Kunst der Blutzeichen wiederentdeckt und seine Mitstreiter gelehrt. Nun war jeder von ihnen in der Lage, das eine oder andere neue Zeichen zu wirken, sie hatten ihrerseits jedoch noch keine Zeit gehabt, dieses Wissen weiterzugeben, denn sie wurden im Krieg gebraucht. Auf Hände und Oberarme hatten sich die Fechter die Linien der Blutzeichen geritzt, die ihnen die Kletterpartie ermöglichten. Nur Dawyd war darauf nicht angewiesen: Das Urzeichen, erkennbar in seiner Iris, verlieh ihm die hier nötigen Fähigkeiten – und einige mehr.
Die Lurmundfeste war strategisch bedeutend. Von hier aus kontrollierte man seit Jahrhunderten die Dörfer der Umgebung, die Mündung der beiden Flüsse samt ihrem Schiffsverkehr und vor allem die Furt über den Nadder weiter im Süden. Sie war zwar alles andere als auf dem neusten Stand der Festungsbaukunst, aber ihre Lage auf einem steilen Hügel zwischen zwei Flüssen machte sie zu einem formidablen Bollwerk. Dawyd und seine Männer würden sie heute im Handstreich einnehmen.
Es war Elisabedas Plan, und er klang verrückt. Ihre Pläne klangen oft nicht durchführbar, wurden aber meist von Erfolg gekrönt. Dawyd vertraute ihr, und seine Leute vertrauten ihm.
Just bezahlte der Erste von ihnen dieses Vertrauen mit dem Leben: Joshua bohrte seine Finger in den Sandstein, der darunter zerbröckelte und keinerlei Halt mehr bot. Hilflos stürzte der Mann in die Tiefe und schlug im Gebüsch des Ufers auf. Kein Schrei war über seine Lippen gekommen – ein letzter Dienst an seine Kameraden, deren Unternehmung hier hätte zu Ende sein können. Dawyd schluckte. Das erste Opfer unter Hauptmann Dawyd Iackmars Kommando, obwohl er doch zugesichert hatte, dass seine Leute in der Lage waren, Elisabedas Plan auszuführen!
Er biss die Zähne zusammen, bis der verheilte Bruch seines Kiefers schmerzte, dann kletterte er weiter und zog sich hinter Darius über die Zinnen der Brustwehr. Darius hatte die Wache bereits lautlos niedergeschlagen und knebelte den Bewusstlosen gerade mit dem Federbusch der Mütze und einer dieser albernen silbernen Uniformkordeln. Nach und nach folgte auch der Rest von Dawyds Leuten. Bis auf die einzelne Wache stießen sie auf keinen Widerstand an dieser Seite der Befestigungsanlagen. Niemand erwartete einen Angriff aus dieser Richtung.
Gebückt und mit gezückten Klingen schlichen sie an der Brustwehr entlang, während das Rot der Dämmerung über den Horizont kroch und sie jeden Augenblick an die vielen Soldaten der aquinzischen Armee verraten würde, die im Innenhof lagerten – samt ihren Musketen. Dort unten befanden sich Stallungen, Quartiere und die Kommandantur. Zum Glück waren diese Gebäude, in denen gerade morgendliche Betriebsamkeit erwachte, nicht ihr Ziel. Ihr Ziel war der halb verfallene Turm an der Nordseite, auf dem weit sichtbar die aquinzische Flagge wehte: ein goldener Dreizack auf blauem Grund. Darius vergewisserte sich zum wiederholten Male, dass er sein Bündel umgeschnallt hatte, und beantwortete den stumm fragenden Blick seines Hauptmanns mit einem Nicken.
Die Gruppe erreichte den Nordturm unbehelligt. Die Tür war angelehnt.
Zu einfach, schoss es Dawyd durch den Kopf.
Sie verschwanden schnell im Inneren des Turms und stellten vier Mann als Wachen ab. Dann ging es die Wendeltreppe hinauf. Hier trafen sie auf Widerstand, doch die beiden Turmwachen waren der Fechterelite Sygnas nicht gewachsen und lagen durchbohrt auf dem Holzboden des Ausgucks, bevor sie einen Schuss hatten abfeuern können. Spielkarten lagen herum, und Dawyd dankte dem Großen Handwerker, dass sie mit ihrem Marionettspiel beschäftigt gewesen waren und nicht mit dem Erspähen von Eindringlingen an der Steilwand. Die blaue Flagge flatterte am Fahnenmast in einer leichten Brise.
Viel zu einfach.
Das Versteckspiel würde nun ein Ende haben. Eilig holten sie die Flagge Aquintiens ein. Anders als die Kerle hier oben waren ihre Kameraden im Hof achtsamer, denn kaum war die Flagge unten, flogen den Eindringlingen Musketenkugeln um die Ohren und zwangen sie in Deckung.
Das weithin sichtbare Einholen der Flagge war das vereinbarte Signal. Nun würden sich schwer gepanzerte Kämpfer aus den hohen Halmen der Weizenfelder erheben und unter Elisabedas Führung über den Zugangspfad auf die Festung zustürmen. Dawyds Trupp hatte wegen der Kletterpartie auf Harnische verzichten müssen.
Darius öffnete sein Bündel, holte eine eigene Fahne hervor und hantierte hektisch, um diese am Fahnenmast zu befestigen.
»Warte noch, das Tor!«, zischte Dawyd und sprang kurzerhand über die Brustwehr.
Der freie Fall kribbelte in seinem Unterleib, der Boden kam rasend schnell auf ihn zu. Er zählte langsam bis drei, dann kam der Aufprall.
Der Einschlag war so hart, dass Dawyd eine Kuhle in die Pflastersteine schlug und eine Staubwolke aufwirbelte, doch die Macht des Urzeichens bewahrte ihn davor, mit zerschmetterten Knochen sein Ende zu finden. Er rollte sich ab und lief geradewegs auf das Tor zu – sein gezeichnetes Schwert in der Hand. Vereinzelt krachten Schüsse in seine Richtung und verfehlten ihn – niemand hier unten hatte damit gerechnet, dass jemand von einem Turm mitten unter sie springen würde. Die Alarmglocke, die gerade geschlagen wurde, sowie die Rufe von der westlichen Mauer trugen ihr Übriges zur Verwirrung und damit zu Dawyds Unversehrtheit bei. Er hoffte inständig, dass die Rufe eine Folge von Elisabedas Vormarsch waren.
Er rannte zum Tor, das mit einem massiven Balken verschlossen war, schnitt auf dem Weg eine Wache nieder, die eine Hellebarde gegen ihn führte. Am Tor schlug er zweimal zu. Der Macht seines Urzeichens und der Kraft in der gezeichneten Klinge – ein von Elisabeda gefertigtes Meisterwerk – waren die verrosteten Eisenhalterungen nicht gewachsen. Krachend fiel der Holzbalken zu Boden. Sofort ging Dawyd in die Knie und stemmte sich dagegen, um ihn beiseitezuschieben. Dann zog er den Torflügel nach innen, während ungezielte Musketenkugeln das Holz um ihn herum aufrissen. Er warf nur einen hastigen Blick nach draußen – eine große Gruppe Bewaffneter stürmte auf die Lurmundfeste zu.
Eigentlich wollte er zurück zu seinen Leuten, die sich im Turm verschanzt hatten, aber die Aquintianer hatten sich von ihrem Schreck erholt und eröffneten jetzt koordiniert das Feuer auf ihn. Sie bildeten eine Reihe, und ihre Salve verwandelte Dawyds Umgebung in eine Wolke aus Blei, Holz- und Steinsplitter. Er rettete sich auf die Außenseite des Tors und erhaschte einen Blick zum Turm. Was er dort sah, war beunruhigend. Auf dem Ausguck wurde gekämpft. Die Aquintianer hatten also die vier Fechter, die er am Eingang zum Turm zurückgelassen hatte, überwältigt.
Er wagte einen weiteren Blick, alle Muskeln angespannt, um loszulaufen und seinen Leuten beizustehen, doch eine zweite Salve hielt ihn hier fest.
Verdammt! Es war höchste Zeit, die mitgebrachte Fahne zu hissen, um ein Gemetzel am Tor zu verhindern. Jetzt hing alles an Darius – sofern der Junge noch am Leben war!
Da waren die Angreifer aus Sygna heran und stürmten durch das Tor. Elisabeda, auch im Plattenpanzer unverkennbar durch ihren Kriegshammer, winkte Dawyd knapp zu, und er schloss sich ihr mit Kampfgebrüll an, erwartete eine weitere Salve, die jedoch nie kam. Als sie in den Hof der Festung stürmten, sahen sie die Fahne mit den dreizehn Gildenwappen Sygnas, die im Wind auf dem Turm flatterte. Der Anblick entfachte ein Feuer in seiner Brust – die Angst der Schlacht wich Mut und Zuversicht. Dawyd wusste, dass es eine von eingewobenen Zeichen künstlich herbeigeführte Tapferkeit war, wie ein Rausch, von Schnaps und Bier herbeigetrunken, aber sie entfaltete dennoch ihre Wirkung. Mit den Verteidigern geschah genau das Gegenteil, sie wirkten völlig überrumpelt. Vereinzelte Musketen krachten, Elisabedas Angreifer überwanden noch einige Hellebarden und Degen, dann brach die Linie der Blauröcke. Sie flohen, so weit die Begrenzungen der Festung das zuließen, dann ergaben sie sich. Die Lurmundfeste und damit die Furt über den Nadder waren in Sygnas Hand!
Die verschachtelten Viertel der Universität von Naronne reichten bis an die nördlichen Dünen, ein Meer aus Sand. Wie zu hellem Pulver geronnene Flut, dachte Ismayl.
Die Dünen waren unbebaubar und wurden nur von Studenten für wildes Nachtleben und körperliche Ertüchtigung genutzt. An einem solch frühen Morgen im Spätsommer – die Glocken der Kathedralen der Stadt schlugen gerade sieben Uhr – war weder die eine noch die andere Sorte Studenten in den Dünen unterwegs. Die Einzigen, die sich in den lang gezogenen Tälern zwischen mit Grasbüscheln bewachsenen Hügeln weißen Sandes aufhielten, waren fünf junge Männer. Ismayl wünschte sich, er wäre keiner von ihnen, aber wenn er schon einer sein musste, dann kam ihm die Rolle des Sekundanten am ehesten gelegen.
Bei seiner Ankunft in Naronne hatte ihn sein erster Weg ans Meer geführt: Er hatte viele Geschichten darüber gehört und gelesen, doch er hatte festgestellt, dass das Meer wie das Feuer war – unbeschreiblich in seiner Wandelbarkeit und Erhabenheit, und man konnte Stunden damit verbringen, es zu betrachten, und doch keine Worte finden, die ihm gerecht wurden.
Auch an diesem Morgen hätte er gut und gern seinen leichten Kater verscheucht, indem er, die schmerzenden Augen unter der Hutkrempe verborgen, auf einer Düne saß, die kühle Morgenluft spürte und dem Rauschen der Wellen und dem Gekreisch der Möwen lauschte. Stattdessen stand er hier mit einem ehemaligen Studenten der Theaterwissenschaften, zwei aktuellen Studenten der Theaterwissenschaften und einem ebenso aktuellen Medizinstudenten und wartete darauf, dass mindestens einer davon eine gravierende Schusswunde davontragen würde.
»Bist du so weit?«, fragte Toma und legte Ismayl die Hand auf die Schulter.
»Ich?«, fragte dieser entgeistert.
»Du musst die Waffen überprüfen. Ich habe Guillome herausgefordert, er hat die Waffen gewählt und mitgebracht – du musst sie überprüfen.«
»Ich habe keine Ahnung von diesen Waffen«, wandte Ismayl ein.
»Umso besser«, sagte Toma zuversichtlich. »Du darfst wählen, welche von den beiden ich erhalte.«
»Und was ist, wenn die nicht funktioniert?«
»Die funktionieren natürlich beide, zweifelt nicht an meiner Ehre!«, ließ sich Guillome vernehmen, der seinen Sekundanten, einen blassen, kleinen Kerl, der sich Ismayl noch nicht vorgestellt hatte, um sicherlich einen Kopf überragte. »Es reicht mir schon, dass ich mir Euer Geschwätz zur Dame von Rivenue anhören musste!«
»Ich werde kein Wort mehr zur Dame verlieren. Die Waffen werden sprechen, Guillome!«, zischte Toma, bevor er sich wieder freundschaftlich an Ismayl wandte. »Mach schon. Wirf einen Blick auf die Waffen!«
Ismayl trat vor. Guillomes Kommilitone und Sekundant verbeugte sich leicht, stellte sich als Michal vor und platzierte den Koffer zwischen ihnen auf den Boden.
Der Medizinstudent hatte ebenfalls einen Koffer dabei, sein Gesichtsausdruck schwankte zwischen Vorfreude und Unbehaglichkeit. Er stiefelte immer wieder einige Schritte die Düne hinauf und spähte in alle Richtungen, doch der Strand war menschenleer, und die Dünen liefen in einen kleinen Park aus, hinter dem die ersten Gebäude der Universität aufragten.
Ismayl beugte sich über den Koffer, den Michal mitgebracht hatte. Darin lagen zwei Pistolen nebeneinander auf einem dunklen Tuch. Er hatte diese Art der Schusswaffen erst ein Mal gesehen: Kiliannas Vater, Zachari Erdhand, besaß eine, ein prunkvolles Einzelstück, und Ismayl hatte gedacht, diese bedrohlich handliche Form der Feuerwaffen sei noch nicht allzu verbreitet.
»Woher habt ihr die?«, fragte er Michal, und der deutete mit seinem blassen langen Kinn auf seinen Freund. »Sie gehören Guillome. Sie sind ein kleines Vermögen wert.«
»Werden seine Theaterkritiken häufig mit Duellforderungen gekontert?«, fragte Ismayl, und der andere lächelte schmal.
»Es ist nicht das erste Duell mit diesen Pistolen, aber das erste Mal, dass es um ein Theaterstück geht«, antwortete der junge Mann. »Pistolen kursieren seit einigen Monaten in der Halbwelt. Jeder, der etwas auf sich hält und genügend Geld hat, versucht, an welche zu kommen.«
Ismayl schaute zu Guillome. Der Student sah hochmütig auf ihn herab, wie er da über der Kiste kauerte und nicht wagte, nach den Pistolen zu greifen.
»Sind wir wohl bald so weit?«, fragte er. »Ich muss heute noch bei einem Kontakt zur Zeitung vorstellig werden. Man ist an meiner Kritik interessiert.« Dabei wanderte sein höhnischer Blick zu Toma.
»Welche Zeitung denn?«, spie dieser. »Kein Blatt, das etwas auf sich hält, druckt einen Verriss des beliebtesten Theaterstücks des Sommers! Du gehst damit wohl selbst zum Drucker, um deine Schandtat danach an jeden dicken Baum zu nageln! Jemand, der Josefine Duponts als von Cikani aufgezogene Laiendarstellerin bezeichnet, verdient es, gleich mit drangenagelt zu werden!«
Ismayl wandte sich wieder den Duellpistolen zu, während die beiden Studenten erneut Giftigkeiten zur Dame von Rivenue austauschten. Die Pistolen auf dem Samt waren so lang wie sein Unterarm und weniger verziert, als der Koffer annehmen ließ. Sie sahen wesentlich schlichter aus als Erdhands Schmuckstück, und so, als wären sie bereits in Benutzung gewesen. Er nahm beide heraus und wog sie in den Händen, betrachtete die Läufe, die Abzüge, die Hähne und Pulverpfannen – und die Zeichen, die in das Metall eingeprägt waren. Er tauschte sie in den Händen, um zu beurteilen, ob eine davon schwerer oder unausgewogener war. Sie fühlten sich ein wenig unterschiedlich an, aber er konnte nicht beurteilen, welche für Toma besser oder schlechter geeignet war.
»Sie übertreiben es etwas, oder?«, fragte er Michal, und der stieß ein lautloses Lachen aus.
»Ein wenig«, gab er zu.
»Bist du immer sein Sekundant?«
»Schon ein paarmal. Meist geht es um Frauen.«
Ismayl sah erneut zu Guillome auf. Während die anderen inklusive ihm selbst bleich wie Brotteig waren, war Guillome schwarz, groß und breitschultrig und alles in allem sicherlich sehr interessant für die Naronner Damenwelt. Seine Locken waren kurz geschnitten, sodass er etwas von einer Statue hatte. Im Knopfloch trug er die blaue Lilie der Revolution, mit der Aquintien seine Adelshäuser abgeschafft hatte. Unter den Studenten, die es sich leisten konnten, war sie zu einem Symbol des Protests gegen den Kaiser geworden, von dem viele glaubten, dass er die Ideale dieses Umsturzes verriet.
Ismayl bezweifelte nicht, dass der Verriss in der Zeitung landen würde, sobald Guillome dazu kam, ihn persönlich zu präsentieren.
»Tatsache ist doch, dass die Dame ein absolut seichtes Drama um eine einfältige Protagonistin ist, obwohl wir alle darauf gewartet haben, dass sich Deseugnes spitze Feder endlich einmal den politischen Wirren widmet! Dem Krieg! Und was bekommen wir? Eine Schmierenkomödie!«
»Ah!«, schrie Toma. »Das ist nicht einmal eine Komödie! Es geht um die persönliche Entwicklung eines Charakters, der scheitert! Du bist im achtzehnten Semester und kannst eine Komödie nicht von einer Tragödie unterscheiden! Warum streite ich mich überhaupt mit so jemandem!«
»Sie bringen sich nicht wirklich um, oder?«, flüsterte Ismayl Michal zu. »Sie schießen daneben? Oder in den Arm oder so etwas?«
Michal sah ihn großäugig an. Auch er trug eine getrocknete Lilie am Revers, aber sie war bereits halb zerfallen. »Hast du schon mal mit solchen Dingern geschossen? Das hängt nur vom gnädigen Blau des Himmels ab, ob und was man damit trifft. Einen Arm! Ich glaube nicht, dass mein oder dein Freund in der Lage ist, einen Arm damit anzuvisieren, geschweige denn zu treffen.«
»Aber sie erschießen sich doch jetzt nicht, oder? Das ist absurd – es geht um ein Theaterstück! Ich hab es nicht einmal gesehen. Ist es denn schlecht oder gut?«
»Es ist ganz nett«, gab Michal zu.
»Ich nehme diese Pistole hier«, sagte Ismayl lauter und entschied sich für die, die er in der Rechten hielt. »Ich würde mir allerdings wünschen, dass die Herren den Streit anderweitig beilegen.«
»Niemals«, sagten beide entschlossen.
Ismayl und Michal tauschten Blicke.
»Es gibt schon Gründe, warum sich sonst niemand als Sekundant gefunden hat«, murmelte Michal. »Außerdem musst du das Pulver und die Kugeln noch überprüfen.«
Ismayl hatte sich schon gefragt, warum Toma ausgerechnet einen Neuling gebeten hatte, ihm an diesem Morgen zur Seite zu stehen. Beim nächtlichen Trinkgelage hatte niemand lange an ihrem Tisch gesessen, und der eine oder andere hatte Ismayl einen mitleidigen Blick zugeworfen.
»Machen wir uns eigentlich strafbar?«, fragte Ismayl Michal, während er recht wahllos eine der beiden Papierpatronen aus dem Koffer nahm.
Sein Gegenüber hob eine Augenbraue. »Jetzt ist es zu spät, das zu fragen. Du kommst nicht von hier, oder?«
»Doch«, sagte Ismayl schnell. »Mehr oder weniger. Vorstadt.«
»Genug geredet«, befahl Guillome und streckte die Hand nach der Pistole aus. Toma tat es ihm gleich.
Michal schloss rasch den Koffer, packte ihn mit der einen Hand, die Patrone in der anderen. »Also. Habt ihr eure letzten Gebete gesprochen?«
Beide Studenten nickten.
»Das Schreiben für eure Angehörigen?«
Beide griffen in ihre Rocktaschen, wobei Guillome bereits seinen Mantel von den Schultern streifte und achtlos in den Sand fallen ließ. Toma drückte sein Schreiben in Ismayls Hand.
»Schwört ihr, dass der Streit mit diesem Duell beigelegt und die Ehrenhaftigkeit des Gegenübers anerkannt ist, unabhängig vom Ausgang des Duells?«
Beide Studenten nickten erneut und blickten einander fest in die Augen. Ismayl fragte sich, ob dies wie ein Schicksalsurteil in Sygna war: Wer besiegt wurde, hatte Unrecht.
»Ladet eure Waffen«, sagte Michal und gab Guillome die Papierpatrone. Dieser riss das Papier fachmännisch mit den Zähnen auf, gab etwas Zündpulver auf die Pfanne und den Rest in die Mündung. Toma beeilte sich, es ihm gleichzutun, und obwohl er ganz offensichtlich Erfahrung damit hatte, war er doch nicht so schnell und routiniert wie Guillome. Ismayl begann ernsthaft, um Tomas Gesundheit zu fürchten – und um seine eigene Mission.
Beide stopften das Papier der Patrone und die Kugel mit den Ladestöcken, die sich unter dem Lauf im Holz der Waffe befanden. Damit war die Zeit für Worte abgelaufen, und Taten mussten folgen. Ismayl fragte sich, ob er ein Wortzeichen hätte nutzen sollen, um dieses Duell zu verhindern. Andererseits war sein Handel mit Toma klar: Er half ihm als Sekundant bei seinem Duell, und dafür brachte der ihn in die Bibliothek. Wenn das Duell nicht stattfand, kam Ismayl auch nicht an die Informationen. Er stieß den Atem aus und trat mit Michal zur Seite. Beide Kontrahenten standen Rücken an Rücken, die Pistolen erhoben. Sie gaben beide kein schlechtes Bild ab.
Der Medizinstudent trat zu Ismayl und Michal und wandte sich demonstrativ vom mörderischen Geschehen ab. Auch eine Art, die eigene Beteiligung zu leugnen. Wieder zuckten seine Mundwinkel in dieser Mischung aus Vorfreude und Unbehagen.
»Zehn Schritt – ich zähle!«, schrie der schmächtige Michal wie eine Drohung. »Eins!«
Ismayl wurde etwas flau.
»Zwei!«
Er ballte die Hände zu Fäusten.
»Drei.«
Er hatte gehofft, länger von Gewalt und Schusswechseln verschont zu bleiben.
»Vier.«
Andererseits galten die Kugeln in diesen Läufen nicht ihm.
»Fünf.«
Anders als im Frühjahr, als er die Flagge der dreizehn Zünfte geschwungen hatte.
»Sechs.«
Der Wind vom Meer ließ ihn frieren.
»Sieben.«
Plötzlich stiegen Bilder von blutenden Wunden in ihm hoch, denen er sich nicht gewachsen fühlte.
»Acht.«
Übelkeit sammelte sich in seiner Kehle. Er schluckte, doch das machte es eher schlimmer als besser.
»Neun.«
Nun lag fast die gesamte Länge des kleinen Dünentals zwischen den Gegnern. Noch ein einziger Schritt.
»Zehn!« Michals Stimme wurde vom Krachen der beiden Pistolen ausgemerzt. Beide Studenten waren herumgefahren, hatten ihre Pistolen ausgerichtet und die schwergängigen Abzüge durchgedrückt. Das Zeichen, zu dem der Pistolenhahn gearbeitet war, war auf die Pulverpfanne herabgefahren und hatte dort das Pulver entzündet. Die Kettenreaktion erfasste das Pulver im Lauf, die Kugel wurde auf ihre tödliche Bahn geschleudert.
Wie ein Knall aus zwei Richtungen hallten die Schüsse, die Läufe hatten so schnell Feuer gespien, dass Ismayl es nur als Nachbild sah. Rauch quoll hervor, und so dick und schwer er auch war, er verflüchtigte sich schnell in der Meeresbrise.
Beide Studenten standen aufrecht. Der Medizinstudent fuhr herum und sah von einem zum anderen. Ismayl wollte gerade aufatmen.
Da brach Toma zusammen.
»Scheiße«, entfuhr es ihm, und alle vier liefen auf den Verteidiger der Dame von Rivenue zu.
Ismayl verging selbst die Übelkeit, als er sah, dass Toma in die Brust getroffen worden war. Sie kannten sich seit zwei Wochen, doch er hatte genug Zeit mit ihm verbracht, um ihn als Freund zu bezeichnen, und trotzdem hatte er ihm diese unsäglich dumme Idee nicht ausgeredet! Sein Wille, in die Bibliothek zu gelangen, sein Vertrauen auf den Großen Handwerker, seine Angst vor Rufin und den Soldaten – all das hatte ihn davon abgehalten. Das Einschussloch, das der Student verwirrt anstarrte, als gehöre es nicht zu ihm, war zu hoch, um das Herz verletzt zu haben, doch die Kugel hatte ganz sicher die Lunge erwischt. Helles Blut sprudelte hervor. Die gepressten Atemzüge des anderen wurden von pfeifenden Geräuschen begleitet. Die Wunde war entsetzlich, Ismayl konnte Fleisch und Knochen erkennen und darüber Tomas entsetztes wie überraschtes Gesicht.
»Ich … ich bin getroffen worden«, keuchte er.
»Ganz ruhig«, sagte Ismayl und landete auf den Knien neben ihm im Sand. »Das … das …« Das wird schon wieder, hatte er sagen wollen, doch das hier war eine Schusswaffe und keine Klinge – Kugeln richteten sehr viel unsaubere Wunden an. Und sie befanden sich in Naronne und nicht in Sygna. Hier würden keine Heilzeichen die Schäden an inneren Organen beheben und die Wunde schließen. Gezeichnete Wundverbände waren zwar aus Sygna exportiert worden, stellten jedoch wahre Luxusartikel dar – und solche Verbände konnten nicht den zeichenkundigen Heiler ersetzen, der seine Zeichen direkt auf die Wunde oder sogar darin wirkte.
Guillome sah auf seinen Gegner herab. »Das tut mir leid«, sagte er dann, und Ismayl hörte den Worten eine schicksalsergebene Zerknirschtheit an. Das Sentiment eines Mannes, der nicht seinen ersten Duellgegner verwundet hatte und zwar kein Gefallen daran fand, es aber für unvermeidlich hielt.
»Albèr?«, fragte er den Medizinstudenten, den er mitgebracht hatte.
Der kniete ebenfalls neben Ismayl und schüttelte den Kopf. »Da kann ich wenig tun. Bei einer solchen Verletzung der Lunge …« Seine Rechte legte sich auf seine Rocktasche, als erwäge er, etwas daraus hervorzuziehen.
Toma packte Albèr am Kragen, seine Finger hinterließen blutige Abdrücke auf dem weißen Stoff. »Bitte! Ich kann so nicht sterben! Ich …« Er röchelte Blut hervor, tastete fassungslos nach der warmen Flüssigkeit auf seinen Lippen und ergriff dann wieder den Kragen des anderen. »Bitte! Ich will nicht sterben!«
»Gibt es nichts, was du versuchen kannst?«, drängte Ismayl den Medizinstudenten. Ihm wurde kalt. Das Blut, die offene Wunde – er wollte den Blick abwenden, doch er konnte nicht. Alles, was er beim Sturm auf die Festung gesehen hatte, Dawyds blutüberströmtes Gesicht mit dem zertrümmerten Kiefer, Elisabedas zerstochener Leib – all das ruhte unter einem viel zu dünnen Tuch, ein Windhauch konnte es heben und enthüllen, was darunter war.
»Es gibt etwas«, sagte Albèr langsam. »Aber ich kann nicht garantieren, dass es wirkt. Vielleicht geht es dadurch nur noch schneller. Oder ist noch schmerzhafter.«
»Bitte!«, stammelte Toma, dem die Tränen übers Gesicht rannen und sich mit dem Blut an seinem Kinn vermischten. »Alles – ich gebe dir alles, wenn du nur dafür sorgst, dass ich am Leben bleibe! Heiliger blauer Himmel, ich will nicht sterben!«
»Du musst mir gar nichts dafür geben. Wir forschen noch dran. Der Preis dafür ist abgegolten, wenn du einwilligst.«
Toma nickte hastig, doch Ismayl sah auf. »Einen Moment …« Er fühlte wieder diese Übelkeit in ihm aufsteigen, er roch das Blut, zugleich rasten seine Gedanken. »Was ist das, was du da hast?«
Albèr zog ein Beutelchen aus der Tasche. »Es ist noch nicht ausgereift«, sagte er und öffnete es. Das Pulver darin war schmutzig braun.
»Ist das … hat daran …« Ismayl riss sich zusammen, was er hier stammelte, war eines Dichters unwürdig. »Ihr arbeitet mit den Soldaten zusammen, die aus Sygna zurückgekehrt sind, richtig?«
Albèr sah ihn an, Fragen und Zweifel standen in seinem Blick. Keiner der anderen sagte einen Ton. Ismayl wusste, dass man sich in der Stadt bereits das eine oder andere erzählte. Albèr nickte schließlich.
»Willst du es oder nicht?«, fragte er Toma.
»Beim Allmächtigen, ja, natürlich!« Seine Lunge gab grausige Geräusche von sich, Ismayl konnte sie durch das Einschussloch kämpfen hören.
»Dann tun wir das jetzt«, flüsterte Albèr und schüttete Toma das Pulver in die Wunde. Der Schrei, der über die Dünen hallte, war lauter als die Schüsse zuvor.
Es war Ironie des Schicksals. Kilianna Erdhand, die in der Verkehrten Stadt herumgekrochen war, die Gefahren im Finsteren gemeistert hatte und Lysandre Rufin gleich zweimal vermeintlich den Tod gebracht hatte – einmal durch eine seltsame Verbindung zu einem uralten Wesen und einmal durch eine von nur sechs in der Stadt befindlichen Pistolen –, saß wieder in einem Salon wie die Salonrevolutionärin, als die sie verspottet worden war.
Mit dem Unterschied, dass niemand sie mehr verspottete. Von den Anwesenden wusste nur Jendra, dass Kilianna dafür verantwortlich war, dass alle Urzeichen wiedererwacht waren – dass ihr Blut sie aus den Sarkophagen befreit hatte. Allen anderen war die Befreiung dieser uralten, gleichzeitig verlockenden und bedrohlichen Mächte rätselhaft. Der Schock von Ignaz’ Verrat saß tief; er hatte nach der Revolution den Rat unter sich geeint, hatte die Erforschung der Verkehrten Stadt vorangetrieben – nur, um sich dann als Verräter herauszustellen.
Kilianna hatte anfangs versucht, ihrem Vater und dem verheerten und verwirrten Gildenrat klarzumachen, dass das nicht Ignaz Dreifinger gewesen war, dass Lysandre Rufin sich Ignaz’ Geist bemächtigt hatte, doch es war schon schwer genug zu fassen, dass weitere Urzeichenträger in der Stadt erwacht waren. Dass so etwas wie ein Körpertausch im Rahmen des Möglichen war, schoben die engstirnigen Gildenratsmitglieder lieber von sich. Kilianna konnte ihnen keinen Vorwurf machen: Allein die Vorstellung war bedrohlich, irreal, unwägbar.
Wenn so etwas mit der Macht der Urzeichen möglich war, dann war es nicht verwunderlich, dass ihre Vorfahren diese versiegelt und alles Wissen darüber verbannt hatten.
Doch es nutzte nichts: Die Urzeichen waren wieder frei, und fünf von dreizehn glühten nun in den Augen von fünf Sygnaer Trägern. Das Zeichen des Blutes in den Augen von Dawyd Iackmar, der Kilianna von der Front viel zu selten zurückschrieb. Das Eiserne Zeichen in den Augen von Elisabedas Sohn Johannis, einem achtzehnjährigen Jungen, dem im Krieg ein halbes Bein abgeschossen worden war. Die Trägerinnen des Gläsernen und Gewobenen Urzeichens befanden sich wie Dawyd an der Front – Kilianna wusste nicht, ob der Gildenrat sie fortgeschickt hatte, weil er ihrer Macht misstraute, oder weil er hoffte, dass sie dort irgendwelche Wunder vollbringen würden. Die fünfte Urzeichenträgerin – Kilianna war geradezu begeistert davon, dass drei von fünf Urzeichen in Sygna sich Frauen als Trägerinnen erwählt hatten! – die fünfte war mit dem Rauschzeichen gezeichnet. Kilianna wusste nur, dass man über das Rauschzeichen möglichst nicht sprach; daher hatte der Rat die Trägerin auch nicht um ihre Hilfe gebeten, was die politische Lage innerhalb und außerhalb der Stadt anging.
Kilianna musste ihr einen Besuch abstatten. Bisher kannte sie nur ihren Namen: Elena Südhang.
Vielleicht hätte ich sie einladen sollen.
Kilianna vermisste in diesem Salon schmerzlich Elisabeda. Wenn die Schmiedin und Gleichwerkerin sich noch in der Stadt befände, hätte der Rat sie nicht ignorieren können. Kilianna selbst beherrschte kein Handwerk; ihre Worte prallten am Rat einfach ab.
Nach und nach trudelten Kiliannas Gäste ein. Jede von ihnen wusste, dass Kilianna eigentlich nicht ihren Geburtstag feierte, und doch hatten alle ein Buch oder ein kleines Blumengesteck mitgebracht, das Kilianna mit ironisch hochgezogenen Brauen entgegennahm. Sie trafen sich in der Bibliothek der Erdhand-Villa, und tatsächlich lag Kiliannas Geburtstag erst acht Tage zurück, sodass sie ihn mit Fug und Recht hätte feiern können.
Noch immer bewohnte sie mit ihrer Familie das Anwesen des Großgildenmeisters, obwohl es ihnen eigentlich nicht mehr zustand. Doch solange es keinen neuen Großgildenmeister gab, solange der Rat sich nicht neu organisiert hatte, saß Kiliannas Familie in diesem Haus wie Zecken im Nacken eines Hofhunds.
Zach und Johanni waren vor den anderen Gästen eingetroffen – Kilianna achtete genau darauf, dass niemand außer Jendra erfuhr, woher sie kamen und wohin sie gingen. Die meisten anderen Besucher waren Frauen. Kilianna legte ein weiteres kleines Hausbuch auf den Stapel der Geschenke und tauschte dabei einen Blick mit Zach. Der Junge lächelte sie schüchtern an. Er blieb stets an der Seite seines aus langem Wundfieber erwachten Bruders, und er schien dieser Position niemals leid zu sein oder seinem Bruder zu neiden, dass diesen ein Zeichen ausgewählt hatte – zudem eines, das im momentanen Kriegszustand so wichtig war. Die beiden Brüder verstanden einander mit Blicken, und es war klar, dass Zach unvollständig gewesen war, als Johanni mit dem Tod gerungen hatte.
Schließlich waren alle anwesend, die diesem Treffen zugestimmt hatten. Merie drückte ihnen Weingläser in die Hand, und Kilianna ließ zu, dass sie kurz auf ihr Wohl tranken.
Sie hob ebenfalls ihr Glas, trank jedoch nicht. Mit einem höflichen Lächeln auf den Lippen wartete sie darauf, dass aller Lärm abklang.
»Ich freue mich, dass ihr alle hier seid«, begann sie schließlich. »Ihr wisst hoffentlich, dass es nicht um meinen Geburtstag geht. Eure Geschenke weiß ich trotzdem zu schätzen – ich hoffe, die Blumen welken nicht zu schnell und die Bücher sind nicht zu langweilig.«
Einige lachten.
»Es geht um Dauerhafteres als Blumen, ja sogar als Bücher, denn jetzt wissen wir, dass Bücher uns trügen können. Dass sie uns betrogen haben; um eine Vergangenheit, die wir hätten kennen müssen, und um Jahrhunderte seitdem, die hätten uns gehören können.«
Die meisten der Anwesenden wussten, wovon sie sprach, denn sie hatten die Streitschriften gelesen, die Kilianna seit einigen Monaten verfasste – einige davon sogar mit Ismayls Unterstützung, obwohl sie sich niemals hatte vorstellen können, dass sie einmal bei einem Text zusammenfänden.
Ihre zwanzig Jahre ältere Freundin Gavrila lächelte ihr aufmunternd zu.
»Jahrhundertelang hat man Menschen von ihrem Recht ferngehalten: Familien wie meiner war es gestattet, die Zeichen unter sich weiter und weiter zu reichen – an Söhne natürlich, nicht an Töchter –, während die, die nicht das Glück hatten, einer solchen Familie anzugehören, im Schatten der Zeichen leben mussten. Als Tagelöhner unter alteingesessenen Meistern, als Zuschläger, als Knechte, als unzünftige Halbmeister, als ersetzbares Gut einer Stadt, die auf unermesslichem Reichtum und Potenzial saß, um beides kleinzuhalten.«
Kilianna zwang sich, von einem gespannten Gesicht zum anderen zu blicken. Bei diesen Reden fühlte sie sich unbehaglich, aber beim Großen Handwerker, irgendwer musste sie schließlich halten! In der Tür der Bibliothek konnte sie unschwer die Silhouette ihres Vaters ausmachen, der sich an den Rahmen drückte wie jemand, der nicht eingeladen war, aber trotzdem teilhaben wollte. Sie wusste, warum: Jahrelang war Zachari Erdhand Großgildenmeister gewesen, doch seit er sich den Besatzern angebiedert hatte, straften ihn seine alten Ratsgenossen mit Missachtung. Was Kilianna da erzählte, wäre ihm vor einem halben Jahr als Ketzerei erschienen, doch nun war sie vielleicht seine letzte Hoffnung, doch noch zu alter Macht und alten Würden zu gelangen. Wenn sich die Unzufriedenen hinter ihr sammelten, dann mochte er davon profitieren. Sie blitzte ihn verärgert an, denn sie wusste, dass nicht nur er jemanden wie sie brauchte – sie brauchte auch jemanden wie ihn.
»Die Urzeichen haben sich niemanden aus den alten Familien in Sygna ausgesucht. Unsere Form von Hierarchie, ja, von Adel …« Bei diesem Wort verzogen ein paar der Anwesenden schmerzhaft das Gesicht. Das Prinzip des Adels war in Sygna nie gern gesehen gewesen, doch stellte der Rat der alten Familien etwas anderes dar? »… hat angesichts der Urzeichen keine Bedeutung. Ein achtzehnjähriger Kriegsveteran gebietet über das Eiserne Zeichen. Der adoptierte Sohn eines Lehrerehepaars über das Blutzeichen der Fechter! Eine einfache Arbeiterin aus den Manufakturen über das Gewobene! Wisst ihr, was das bedeutet? Diese Leute werden den Krieg entscheiden! Wir, die neue Ordnung Sygnas, werden den Krieg entscheiden. Und damit werden wir auch entscheiden, wie Sygnas Zukunft aussieht. Heute treffen wir uns noch in dieser Villa, aber bald werden die alten Villen abgerissen, damit nicht einige wenige alles haben und die meisten nichts!«
Sofort spendeten einige Beifall, angeführt von Gavrila und deren Tochter Adina, die in Kiliannas Alter war. Doch eine Stimme rief in den aufbrandenden Beifall: »Pah. Wer die Urzeichen hat, reißt sich einfach die Villen untern Nagel. Warum sollte man teilen wollen? Dreizehn Urzeichen – dreizehn Mächtige in der Stadt. Pech nur, dass die Aquinzacken auch ein paar Zeichen abgekriegt haben.«
Kilianna wandte sich um. Jendra hatte auf dem kostbaren Flügel neben dem Bücherstapel Platz gefunden und blätterte gelangweilt durch eines der Hausbüchlein.
Du bist mein Narr, Jendra, dachte Kilianna. Forderst mich heraus, damit ich nachdenke.
»Du hast recht«, sagte sie leise. Das Straßenkind grinste frech mit ihrem Mund voller schiefer Zähne. »Wir überlassen die Stadt weder dreizehn Zunftmeistern noch dreizehn Urzeichenträgern. Wir müssen eine Zukunft formen, die Bestand hat. Eine Zukunft, in der Zeichenträger, Zeichenkundige, Meister, Gesellen, Arbeiter, ja, Meisterinnen und Gesellinnen gleichgestellt sind. In der die einen auf die anderen achtgeben. In der Sygna für alle da ist wie eine Mutter für ihre Kinder. Eine Mutter würde keines ihrer Kinder verhungern lassen, um das andere in Saus und Braus leben zu lassen.«
»Ich hab schon ’ne Menge beschissener Mütter erlebt«, gab Jendra zurück. Zach schnaubte hinter ihr, als wäre er kurz davor, dem Mädchen eine Maulschelle zu verpassen.
»Das liegt hinter uns. Sygna war eine beschissene Mutter für uns! Für uns Frauen! Für die Armen! Für die Fremden! Für die, die lernen wollten und stets ausgeschlossen wurden. Sygna wird eine bessere Mutter werden. Und wir bessere Kinder. Gegen Aquintien müssen wir vereint sein. Und uns nicht streiten wie eine Familie aus Spatzen.«
»Und denkst du, die werten Familien Dengelschlag und Seidenschneid und Salvia werden uns dulden?«, fragte eine junge Frau namens Liora, die selbst entfernt mit den Seidenschneids verwandt war. »Die sind doch jetzt schon dabei, die alte Ordnung wieder aufzubauen. Die haben hier bald erneut alles in der Hand, und dann können wir uns wieder heimlich treffen, wie früher!«
»Sie müssen uns dulden!«, sagte Kilianna bestimmt, um ihre größte Angst abzustreiten. Nun, nicht ihre allergrößte – die betraf Dawyd an der Front.
»Mein Bruder ist der Urzeichenträger des Eisernen Zeichens«, sagte Zach mit seiner Jungenstimme. »Und er ist auf unserer Seite. Wie wollen die Gildenmeister einen Krieg gewinnen ohne ihn?«