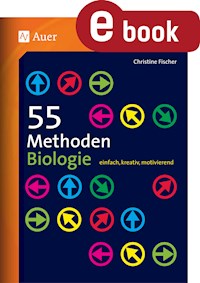Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Allmählich erkenne ich, dass nicht der Klang einer Violine ihre Nachfrage und ihren Preis bestimmt, sondern allein der spektakuläre Name des Geigenbauers." Der zauberhafte Klang der Stradivari seiner Mutter hat Wilhelms Ohr nie verlassen. Damit er als Cellist in der Dresdner Hofkapelle bestehen kann, repariert er sein Cello selbst und findet schließlich Gefallen am Instrumentenbau. Bald steht für ihn fest: Er will Violinen bauen, die denen von Stradivari ebenbürtig sind. Von ersten Erfolgen benebelt, stürzt er sich in die Arbeit, macht die Wohnung zur Werkstatt, verschuldet sich hoch. Ehefrau Charlotte und die vier Kinder haben sich dem grandiosen Ziel des Vaters unterzuordnen. Doch jetzt gefährden Wilhelms Visionen, die er fanatisch verfolgt, die Existenz der Familie. Charlotte droht, ihn zu verlassen. Da bekommt Wilhelm ein sensationelles Angebot und begeht den größten Fehler seines Lebens. Der historische Roman "Die Dresdner Stradivari" spielt im 19. Jahrhundert und beruht auf wahren Begebenheiten. Der spannenden Handlung liegen umfangreiche historische Recherchen zur Dresdner Hofkapelle, zum sächsischen Streichinstrumentenbau sowie zu Leben und Wirken des Dresdner Geigenbauers Wilhelm Schlick zugrunde. Seine Geigen haben im 19. Und 20. Jahrhundert wesentlich zum legendären Klang der Dresdner Hofkapelle beigetragen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cover
Christine Fischer
Die Dresdner Stradivari
Frei erzählt nach wahren Begebenheiten
Widmung
Für meine Mutter
(1928-2020)
Inhalt
Ein Leben für die Musik
Gotha im Juni 1820
1
Wilhelm verstand die Welt nicht mehr. Den Kopf in die Hände gestützt, hockte er am Tisch im Wohnzimmer und fragte sich, wie es mit ihm weitergehen sollte, jetzt, da alle Hoffnung verloren schien.
„Am besten, ich packe meine Sachen und mach mich vom Acker“, murrte er. „Einfach weg. Egal, wohin. Nur weg von der Stadt, die mein Talent nicht zu schätzen weiß. Weg von den verknöcherten Bürgerseelen und der verstaubten Fürstenfamilie da oben in ihrem pompösen Schloss!“
Seit dem Konzert im Gothaer „Mohrensaal“ waren drei Wochen vergangen. Mit dem Gedenkkonzert für den vor zwei Jahren verstorbenen Vater hatte Wilhelm den Gothaern beweisen wollen, dass er auf dem besten Weg war, in die Fußstapfen Conrad Schlicks zu treten. Mit Lob und Anerkennung hatte er gerechnet und insgeheim auf eine Stelle in der Hofkapelle gehofft.
Doch Gotha hüllte sich in Schweigen. Hof und Bürgerschaft taten, als hätte es das Konzert nie gegeben. Keine Rezension in der Presse, keine Reaktion der Fürstenfamilie, nicht einmal den tratschenden Weibern auf dem Markt war der solistische Auftritt des Sohnes von Conrad Schlick ein Schwätzchen wert.
„Dummköpfe! Ignoranten allesamt!“, schrie er und donnerte die Faust auf den Tisch.
Erschrocken kam Caroline, die ältere Schwester, hereingeplatzt. Sie hatte der Mutter beim Aussortieren der Wäsche geholfen und den Wutausbruch des Bruders gehört.
„Wilhelm!“, rief sie besorgt. „Warum brüllst du so herum, was ist passiert? Kann ich dir helfen?“
Sie schob sich auf den Stuhl, dem Bruder gegenüber und sah ihn bekümmert an.
Wilhelms Hände, die er vors Gesicht hielt, vibrierten. „Lass mich!“, zischte er. „Du bist die Letzte, die mir helfen kann! Wohnst mit deinem Doktor in einem respektablen Haus und hast dir jetzt, wie ich hörte, eine hübsche Anstellung als Gesangssolistin in der Hofkapelle an Land gezogen. Zu fürstlichen Konditionen. Kein Wunder auch, wenn man von Kind an so innig mit dem Bruder des Herzogs verbunden ist. Glückwunsch! Mir war dergleichen Zuneigung nie vergönnt. Nicht einmal von meiner eigenen Familie.“
„Wilhelm!“, feuerte Caroline zurück. „Das ist unerhört!“ Sie war nahe daran, ihn mit seiner Übellaune und den Anschuldigungen, die jeder Grundlage entbehrten, allein zu lassen, besann sich aber und hielt ihm in ruhigem Ton entgegen: „Tu nicht so, als wüsstest du nicht, wie hart ich an meiner Karriere gearbeitet habe. Außerdem war ich nie die treibende Kraft für Prinz Friedrichs väterliche Zuneigung.“
„Väterliche Zuneigung? Dass ich nicht lache. Zu deinem eigenen Vorteil hast du an der goldenen Gans geklebt und den Tag herbeigesehnt, an dem du sie rupfen kannst.“
Caroline schnappte nach Luft. Spätestens jetzt wurde ihr klar, dass der Bruder in den letzten zwei Jahren, die er in Weimar verbracht hatte, ein anderer geworden war; aufbrausend und ohne jede Scheu, die Menschen, die ihn liebten zu beleidigen.
„Wenn du so weitermachst, wird dich dein Neid noch zerfressen!“
Wilhelm rechte die Finger durchs dichte schwarze Haar und entgegnete kalt lächelnd: „Ich ... neidisch ... auf dich? Pah! Jedenfalls nicht auf deine, wie auch immer geartete Beziehung zu Prinz Friedrich. Schon eher darauf, dass es dir vergönnt war, alle Tage mit unseren Eltern zusammen zu sein. Was ich von mir nicht behaupten kann!“
Wieder war er mit jedem Satz lauter geworden.
„Ach, daher weht der Wind. Wieder die alte Leier vom armen zurückgelassenen Söhnchen, während Vater, Mutter und Schwester auf Tournee waren, um Geld zu verdienen, wie Eltern es tun, damit die Familie was zu beißen hat. Herr im Himmel, ist das so schwer zu verstehen? Wieso hackst du immer wieder darauf herum?“
Nervös trommelte Wilhelm mit den Fingern auf die Tischplatte. „Ich hacke nicht darauf herum. Ich erwähne es lediglich, wenn die Sprache darauf kommt, obwohl es an der traurigen Tatsache nichts ändert.“
„An welcher traurigen Tatsache? Dass die Tourneen unserem Gelderwerb dienten oder dass du während dieser Zeit wie ein Lausbub durch Gothas Gassen gestromert bist, obwohl du in der Obhut angesehener Menschen warst, die überdies reichlich Ärger mit dir hatten?“
Schweigen.
Das Thema war Wilhelms wunder Punkt. Caroline wusste das.
„Offenbar haben die Gothaer Bürger dich bis heute als ... wie soll ich sagen ... ungehobelten Hitzkopf in Erinnerung behalten. Zu glauben, dass aus ihm jemals ein ernstzunehmender Mensch und Musiker werden könnte, fällt ihnen schwer.“
„Ungehobelter Hitzkopf?“, brauste Wilhelm auf. „Was meinst du, was aus einem fünfjährigen Knaben wird, dessen Familie ihn die Hälfte des Jahres allein zurücklässt und ihn zu Leuten gibt, die weder die Zeit noch einen Grund haben, an seiner Erziehung zu feilen. Was meinst du, was aus ihm wird?“
Resigniert senkte Caroline den Kopf. Sie brauchte einen Moment, um Wilhelms Wutausbruch, den er ihr wie einer Straftäterin an den Kopf geworfen hatte, zu verdauen.
„Waren die Trennungen für dich wirklich so schlimm?“, fragte sie nach einer Weile. „Hast du so sehr darunter gelitten?“
Sie schob ihre Hand über den Tisch und berührte die Hand des Bruders mit den Fingerspitzen.
Wilhelm zog die Hand nicht zurück, doch er sagte auch nichts und dachte nicht daran, den zaghaften Versöhnungsversuch mit einer beschwichtigenden Geste, einem einsichtigen Wort, einem milden Blick zu erwidern. Im Gegenteil. Demonstrativ drehte er das Gesicht zum Fenster.
Caroline gab nicht auf. „Du weißt genau, weshalb wir auf Tournee gehen mussten. Und du weißt auch, dass es keine Bosheit unserer Eltern war. Gewiss, einige Male dauerte es ziemlich lange, bis wir wieder in Gotha ...“
„Ziemlich lange?“, fiel Wilhelm ihr barsch ins Wort und zog die Hand zurück. „Eure Italienreise mit Prinz Friedrich dauerte geschlagene zwei Jahre! Da war ich gerade mal acht und kam in die Schule, die mich genau so wenig interessiert hat, wie ich meine Eltern und meine Schwester interessiert habe.“
„Was redest du? Das ist doch alles nicht wahr.“
Caroline hatte die Rechtfertigung für diese Unverschämtheit schon auf der Zunge, doch Wilhelm war dermaßen in Rage, dass er sie nicht zu Wort kommen ließ und mit zornigen Augen draufloswetterte: „Kannst du dir nur ansatzweise vorstellen, wie mir zumute war, wenn ihr in eurer vollbepackten Kutsche davongefahren seid? Geht in dein blond gelocktes Köpfchen hinein, wie sehr mir die Zuwendung meiner Mutter gefehlt hat und wie weh es mir jedes Mal tat, wenn sie mich mit ein paar tröstenden Worten von sich geschoben und dieser fremden Frau übergeben hat?“
Während Caroline und Wilhelm im Wohnzimmer lautstark miteinander stritten, kam Regina die Treppe herunter. Auf der untersten Stufe verharrte sie. Ihr Herz pochte, als sie mitbekam, worüber ihre Kinder stritten. Sie ging zur Tür, wollte hineingehen, doch etwas hielt sie zurück. Also blieb sie stehen und lauschte.
Caroline tat ihr leid. Tapfer versuchte sie das Verhalten der Eltern zu rechtfertigen. Die Ärmste hatte keine Chance. Sie konnte das Wortgefecht mit dem Bruder nicht gewinnen, denn Wilhelm beklagte sich zurecht. Es war nicht seine Schuld, als Nachzügler eines in Europa gefeierten Musikerpaares auf die Welt gekommen zu sein, ein Jahr nach der Jahrhundertwende; die Mutter 40, der Vater 52, die Schwester 13 Jahre alt.
Sie erinnerte sich an die Wochen vor der großen Italienreise, als sie sich mit Mann und Tochter geeinigt hatte, Wilhelm vorerst nichts zu sagen, damit er sie nicht wieder bedrängte, ihn mitzunehmen. In der Nacht vor der Abreise war sie erst gegen Morgen eingeschlafen. Nicht wegen Conrads Schnarchen, nicht wegen des schreienden Käuzchens im nahen Wald, nicht wegen des kalten Mondlichts, das durchs Oberlicht auf ihre Bettdecke fiel. Sie hatte an Wilhelms enttäuschtes Gesicht denken müssen, wenn er am Morgen die Wahrheit erfuhr. Sie hatte seine tränennassen Wangen gesehen und die Angst in seinen Augen, erneut zurückgelassen zu werden. Sie hatte daran denken müssen, wie seine dünnen Ärmchen ihren Schoß umklammerten, weil er sich nicht von ihr trennen wollte, und wie er an ihrem Rock zerrte, wenn sie ihn, wie schon so oft, sanft, aber bestimmt von sich schob.
Heute noch fragte sie sich, ob sie eine Rabenmutter war. Hatte sie die Liebe zur Musik über die Liebe zu ihrem Kind gestellt? Vielleicht war es so. Doch damals gab es für sie kein anderes Leben, gab es keine Alternative. Die Dinge hatten sich so ergeben. Nun, da Conrad tot und Caroline verheiratet war, trat sie kaum noch solistisch auf. Ihre großartige Karriere war zu Ende. Jetzt hatte sie die Zeit, sich dem Sohn stärker zuzuwenden. Jetzt konnte sie ihn um Nachsicht bitten dafür, dass er in der Künstlerfamilie Schlick-Strinasacchi zu oft und zu lange das fünfte Rad am Wagen war.
„Was bist du nur für ein Mensch, Wilhelm!“, wetterte Caroline drinnen weiter. „Manchmal fällt es wirklich schwer, dich zu mögen. Auch wenn du mir für das, was ich dir jetzt sage, am liebsten die Haare ausreißen möchtest, sage ich es dennoch: Du bist enttäuscht über die sparsame Reaktion auf dein Gedenkkonzert für unseren Vater. Du verteufelst den Hof ebenso wie die Gothaer Bürger und beschwerst dich über deren Ignoranz. Ich glaube, der ausgebliebene Erfolg hat vor allem mit der Qualität deines Vortrags zu tun. Zwar beherrschst du das Cello technisch perfekt, seitdem du aus Weimar zurück bist, doch an Vaters Meisterschaft, an sein empfindsames, hingebungsvolles, von Freude und Liebe durchwobenes Spiel reichst du noch längst nicht heran. Und ich bezweifle, dass du daran jemals heranreichen wirst. Und weißt du, warum?“
„Pah!“ Wieder drehte Wilhelm demonstrativ den Kopf zum Fenster.
„Weil dir das Wichtigste fehlt: Ein gefühlvolles Herz und die Liebe zu den Menschen, die du mit deiner Musik erreichen willst. Du liebst die Menschen nicht. Du liebst nur dich!“
Als Regina das hörte, schrie sie innerlich auf. Das ging zu weit, selbst wenn ein Zipfel Wahrheit dahintersteckte. Mit solch erdrückenden Anschuldigungen durfte Caroline den Bruder nicht belasten.
Sie trat zwei Schritte von der Tür zurück und rief, scheinbar ahnungslos: „Caroline? Hilfst du mir ein wenig in der Küche?“
„Ich komme gleich, Mutter“, kam die Antwort etwas ungehalten aus dem Wohnzimmer. „Einen Moment noch, bitte.“
„Geh ruhig“, sagte Wilhelm mürrisch. „Es führt zu nichts, noch länger zu streiten. Vater war der einzige Mensch, der mich verstanden hat, der mit mir fühlte, weil er der einzige Mensch war, dem ich wirklich etwas bedeutet habe. Vater ist tot. Ich werde Gotha verlassen. Wenn Mutter jetzt zu dir zieht, habe ich ohnehin kein Zuhause mehr. Ihr ist egal, was aus mir wird. Sie liebt mich nicht. Ich war euch beiden immer egal und jetzt ...“
Caroline sprang auf und rief empört dazwischen: „Bade dich nur hübsch in Selbstmitleid, Wilhelm! Wärst du den Weg, den Vater dir gewiesen hatte, bis zu Ende gegangen, stündest du heute als ordentlicher Kaufmann da. Du hättest ein festes Einkommen, eine Wohnung, vielleicht schon eine Familie. Aber nein, du brichst die Lehre ab und setzt deinen Willen durch. In Anbetracht dessen finde ich es von Mutter mehr als großzügig, dir eine zweijährige Solistenausbildung in Weimar zu ermöglichen. Und jetzt, da du finanziell in der Luft hängst, kauft sie dir auch noch ein neues Cello und zahlt dir obendrein aus ihrem Erbe jährlich 150 Thaler. Ich frage dich, verhält sich so eine Mutter, die ihren Sohn nicht liebt?“
Ohne Wilhelms Antwort abzuwarten, schnellte Caroline herum und rannte kopfschüttelnd aus dem Zimmer. Lauter als sonst fiel die Tür hinter ihr ins Schloss.
Am nächsten Morgen nahm Regina eine Arbeit in Angriff, die sie lange vor sich hergeschoben hatte. Nun, da sie in wenigen Tagen aus dem geliebten Haus ausziehen und zu Caroline ziehen würde, kam sie nicht umhin, diese Arbeit zu tun. Alle Dokumente, Briefe und sonstigen Schriftstücke, die Conrad in seinem Sekretär hinterlassen hatte, las sie gründlich durch und prüfte sie gewissenhaft auf ihre Bedeutsamkeit, bevor sie in den Papierkorb wanderten.
Wehmut erfasste sie. Jedes einzelne Blatt erinnerte sie an den geliebten Mann und schürte ihre Sehnsucht nach ihm.
Erst, als die Standuhr im Zimmereck zur zehnten Stunde schlug, bemerkte sie, wieviel Zeit bereits vergangen war. Zehn Uhr wollte sie im Rathaus sein. Eilig legte sie alles zurück in den Sekretär, verschloss ihn und ging hinaus.
In dem Moment läutete jemand die Hausglocke. Regina öffnete. Ein Bote stand vor ihr, einen Brief in der Hand.
„Für Wilhelm Schlick“, sagte er. „Er wohnt doch noch hier?“
Regina nickte, nahm den Brief entgegen, legte dem Boten ein Geldstück in die Hand, schloss die Tür und rief dann laut durchs Haus: „Wilhelm! Post für dich. Bist du wach?“
„Ja, Mutter“, kam die Antwort verschlafen aus dem Obergeschoss.
„Ich leg den Brief auf die Kommode, hörst du?“
„Ja, Mutter.“
„Wilhelm? ... Ich bin bis zum Nachmittag in der Stadt, ein paar Wege erledigen. Wegen des Umzugs. Danach schaue ich bei Caroline vorbei. Mach dir einen schönen Tag. So gegen fünf bin ich zurück. Du bleibst doch hier, oder?“
„Ja, Mutter.“
Ein prüfender Blick in den bodentiefen Garderobenspiegel bestätigte Regina, dass ihr cremefarbenes, in der Taille eng geschnürtes Kleid perfekt saß. Mit geschickter Hand zupfte sie die weiße Spitze an Ausschnitt und Ärmelrändern zurecht. Zuletzt setzte sie die mit bunten Seidenblüten und zwei hellblauen Bändern versehene Schute auf und band eine Schleife unter dem Kinn. Dann nahm sie ihren Handbeutel und verließ das Haus.
Auf das Geräusch, als die Tür ins Schloss fiel, hatte Wilhelm nur gewartet. In einem Satz sprang er aus dem Bett und war plötzlich hellwach. Im Nachthemd rannte er die knarrenden Stufen hinunter, schnappte sich den Brief von der Kommode, eilte damit ins Wohnzimmer und warf sich der Länge nach aufs Sofa. Mutter wäre entsetzt, würde sie ihn so sehen.
Er platzte fast vor Neugier, als er das Siegel brach und den Brief auseinanderfaltete. Dabei fragte er sich, ob die Nachricht, die seine Musikerfreunde Josef und Alexander ihm mitteilten, gut oder schlecht war. Unzählige Abende hatten sie gemeinsam in der Schänke am Weimarer Markt gesessen und Pläne geschmiedet. Und je mehr Bier durch ihre Kehlen geflossen war, desto wundervoller hatten sich ihre Zukunftsvisionen angehört. Von der Mitgliedschaft in einem gefragten Streichquartett über das gut bezahlte Engagement in einer namhaften Kapelle bis hin zur Kapellmeisterstelle in einem städtischen Orchester. Gleich wusste er, ob er sich mit den Freunden zusammenschließen und als Cellist profilieren durfte oder ob er in Gotha bleiben und der Mutter weiterhin auf der Tasche liegen musste. Hielten die Freunde, was sie ihm in Aussicht gestellt hatten oder war alles nur heiße Luft?
Wie versprochen, kehrte Regina gegen 17 Uhr zurück. Sie war erschöpft von den zahlreichen Wegen bei den Behörden und von der nervigen Diskussion mit der Tochter. Wollte sie der Mutter doch tatsächlich vorschreiben, welche Möbel sie mitnehmen und welche sie verkaufen sollte.
Nach dem Abendessen wollte Regina gleich zu Bett gehen. Doch daraus wurde nichts.
Aufgedreht kam Wilhelm die Treppe herunter und überraschte die Mutter mit der Nachricht: „Wir gründen ein Trio! Klavier, Cello, Violine. In Schlesien. Josef Schnabel hat in Schlesien gute Kontakte. Als freie Musiker spielen wir zu festlichen Anlässen in Adelshäusern und bei wohlhabenden Bürgern. Auch öffentliche Konzerte geben wir. Ach, Mutter, endlich kann ich auftreten, kann Geld verdienen, kann meine Karriere vorantreiben.“
„Das freut mich, Wilhelm, da habe ich eine Sorge weniger“, sagte Regina gefasst, dabei war sie den Tränen nahe. Noch auf dem Heimweg hatte sie sich den Kopf darüber zerbrochen, was aus dem Sohn werden sollte, wenn sie ausgezogen war. Sie hatte überlegt, Prinz Friedrich zu bitten, für Wilhelm ein gutes Wort bei seinem Bruder, dem Herzog, einzulegen. Doch nach dem Zerwürfnis mit Prinz Friedrich, der ihr nach Conrads Tod das jahrelang großzügig gewährte Wohnrecht in seinem Gartenhaus gekündigt hatte, wollte sie jetzt nicht in privater Angelegenheit als Bittstellerin bei ihm erscheinen, obwohl sich die Wogen ein wenig geglättet hatten, nachdem der Prinz ihr eine einmalige Entschädigung von 80 Thalern bewilligt hatte. Gott sei Dank hatte Wilhelm nun selbst eine Lösung für sich gefunden. Zwar nicht die, die er sich erhofft hatte, aber eine, mit der er leben konnte.
Am liebsten hätte sie Wilhelm umarmt und ihn an sich gedrückt, doch das tat sie nicht. Zu weit hatten sich Mutter und Sohn in den zurückliegenden Jahren voneinander entfernt.
2
Lange Schattenbahnen malte die untergehende Sonne auf das Tischtuch. Regina glättete es mit beiden Händen. Dann deckte sie den Tisch und holte die Terrine mit dem Möhreneintopf aus der Küche, den sie auf dem Herd noch einmal aufgewärmt hatte. Die Magd, die Regina einige Stunden in der Woche zu Hand ging, hatte ihn am Vormittag gekocht.
Wilhelms Appetit war nicht zu übersehen. Vor lauter Aufregung hatte er sich den Tag über nicht einmal ein Butterbrot geschmiert.
Nach dem Essen zeigte er der Mutter den Brief seiner Weimarer Freunde und fragte sie, was sie davon hielt.
„Josef spricht von guten Kontakten in Schlesien. Was meinst du, kann ich ihm vertrauen? Schlesien ist weit. Und wenn ich einmal dort festsitze ...“
Regina faltete den Brief auseinander, und dabei überlegte sie, was hinter Wilhelms Frage stand. Hegte er Zweifel an dem gemeinsamen Vorhaben oder hatte sein Mut ihn schon verlassen? Aufmerksam las sie den Brief.
Wilhelm beobachtete sie aus den Augenwinkeln. Sie war fülliger geworden, aber noch immer eine wunderschöne Frau. Trotz ihrer 59 Jahre, ihrem rastlosen Leben und der vier Kinder, die sie geboren hatte; zwei der drei Töchter waren früh gestorben. Mutters dunkle Augen im schmalen, ebenmäßigen Gesicht hatten nichts von ihrem Glanz verloren. Ihr dichtes schwarzbraunes, sanft gewelltes Haar, das allmählich ergraute und das ein kirschrotes Samtband zusammenhielt, fiel ihr wie eine reife Traube in den Nacken.
Das dichte dunkle Haar hatte Wilhelm ebenso von der Mutter geerbt wie die äußerliche Ähnlichkeit und das südländische Temperament, das sie charmant zu ihrem Vorteil einzusetzen wusste, während er bei jeder Kleinigkeit drauflos polterte und seinen angestauten Emotionen Luft machte. Mutter war ein freundlicher, fröhlicher Mensch. Jeder mochte sie. Er hingegen war oft schlecht gelaunt und eckte allzu schnell bei den Leuten an.
Regina legte den Brief zurück auf den Tisch und gönnte sich einen Moment der Besinnung, bevor sie antwortete. „Josef schreibt, ihr trefft euch schon in vierzehn Tagen auf dem Rittergut Borkau. Dort könnt ihr gegen einen erschwinglichen Mietpreis auf unbestimmte Zeit wohnen. Das klingt gut. Ich glaube, du kannst deinen Freunden vertrauen. Zumal beide wesentlich älter sind als du und somit auch erfahrener. Das Angebot eröffnet dir eine solide Chance für deinen weiteren Lebensweg als Musiker. Das ist doch, was du dir so sehnlich wünschst. Du solltest es annehmen und das Beste daraus machen.“
„Also gut“, sagte Wilhelm entschlossen. „Dann breche ich Ende der Woche auf. In Dresden bleibe ich ein paar Tage. Ich schaue mir die Bilder in der Galerie an. Vielleicht gehe ich auch einmal in die Oper.“ Ein ironisches Lächeln huschte ihm übers Gesicht, als er anfügte: „Da sitze ich dann, beobachte die Musiker und stelle mir vor, ich wäre einer der geachteten, gut bezahlten Cellisten dieser berühmten Kapelle.“
„Warum nicht? Was nicht ist, kann noch werden“, munterte Regina ihn auf. „Übrigens ist Weber jetzt Kapellmeister der Dresdner Hofkapelle. Caroline war im Herbst 1818 einige Wochen in Dresden und hatte die Familie mehrmals besucht. Carl Maria ist ein wahrhaft feiner Mensch. Über all die Jahre – den guten wie den schlechten – hat er uns seine Freundschaft erhalten. Das kann ich weiß Gott nicht von allen unseren vermeintlichen Freunden behaupten.“
„Du meinst Carl Maria von Weber, der Pianist und Komponist der Opern Silvana und Abu Hassan?“
„Eben den meine ich. Ach, ja ...“ Nachdenklich legte Regina den Finger ans Kinn und erinnerte sich. „Stimmt, du hattest Weber gar nicht kennengelernt, als er im Jahr 1812 zweimal in Gotha weilte. Im Januar und im September. Der Herzog hatte ihn eingeladen. Wir sollten uns um den jungen, aufstrebenden Musiker kümmern. Das taten wir dann auch mit großer Freude. Du warst in dieser Zeit schon nicht mehr in Gotha. Wegen deiner unzureichenden Schulnoten hatte dein Vater dich auf das Gymnasium in Hildburghausen geschickt, damit du ...“
„Weggeschickt hat er mich von meinem Elternhaus!“, fiel Wilhelm ihr so laut und unvermittelt ins Wort, dass Regina erschrak. „Weg von Gotha in die gestrenge Obhut des Herrn Direktor Sickler.“
Mit dem Universalgelehrten Sickler verband die Schlicks eine enge Freundschaft. Er hatte Wilhelm als Pensionär in seine Dienstwohnung aufgenommen.
„Dieser noble Herr hat über mich und mein Betragen gewacht wie über einen Sklaven.“
„Mäßige deinen Ton, Wilhelm! Sicklers Einfluss hat dich zu einem gebildeten Menschen gemacht. Ihm verdankst du, dass du dich heute auch in gehobener Gesellschaft zu benehmen weißt. Bei dem, was du vorhast, dürfte das nicht unerheblich sein.“
Wilhelm, wütend wie er war, dachte nicht daran, seinen Ton zu mäßigen. „Du meinst, hätte ich den gestrengen Sickler nicht gehabt, wäre ich der ungehobelte, durch Gotha stromernde Hitzkopf geblieben?“
Regina zog die Lippen ein. Sie überlegte, was sie darauf antworten sollte, ohne preiszugeben, dass sie das gestrige Gespräch der Geschwister belauscht hatte.
„Ungehobelt ist nicht das richtige Wort. Du warst ein sehr lebhaftes Kind, das auf niemanden hören wollte und irgendwann nur noch das tat, was ihm Spaß machte. Zum Kummer deines Vaters. Wie oft haben wir überlegt, welcher Lebensweg für dich der beste sei. Auf jeder unserer Tourneen haben wir liebevoll und zugleich besorgt an dich gedacht, auch wenn du das kaum glauben magst.“
„Das zu glauben, fällt mir wahrlich schwer!“, entgegnete Wilhelm schroff und war kurz davor, draufloszuwettern. Doch er beherrschte sich und würgte die bissige Bemerkung, die ihm auf der Zunge lag, hinunter. Denn wenn er ehrlich zu sich war, hatte Mutter recht. Aus heutiger Sicht war er damals alles andere als ein Musterknabe. Wie oft war er seinen Gothaer Pflegeeltern davongelaufen. Wie oft war er, anstatt artig auf der Schulbank zu sitzen, zu den Handwerkern gelaufen, den Tischlern, Schustern, Scherenschleifern und immer wieder zu den Instrumentenmachern. Gebettelt hatte er sie, mit dem Werkzeug etwas arbeiten zu dürfen, etwas anzufertigen mit den eigenen Händen. Das war, was ihn interessierte, was ihn begeisterte, wofür er brannte.
„Auch wenn du es nicht wahrhaben willst, mein Junge, die Zeit in Hildburghausen war gut und nützlich für dich. Letztlich hat sie den selbstbewussten jungen Mann geformt, der du heute bist. Willst du dir als Musiker einen Namen machen und später von der Musik leben, dann musst du hart und diszipliniert arbeiten. In dieser Hinsicht war die gestrenge Hand unseres verehrten Sickler ein Segen für dich. Nur mit Disziplin und einem klaren Ziel vor Augen wird aus einem begabten Musiker ein in der Welt gefragter Solist.“
„Wie Vater und du, ich weiß.“
„Ja, wie Vater und ich. Jedoch profitierten wir in jungen Jahren von einigen recht glücklichen Fügungen. Als ich deinen Vater kennenlernte, war jeder von uns bereits ein in Europa gefeierter Solist. Letztlich war auch die Stelle deines Vaters als Privatsekretär des Prinzen August eine glückliche Fügung. Sie garantierte uns ein solides Einkommen. Wir waren nicht gezwungen, bei null anzufangen. Später profitierten wir zudem von der Gunst der Herzogin Anna Amalia in Weimar. Plötzlich hatten wir Zugang zu einem erlesenen Kreis bedeutender Persönlichkeiten. Wir lernten Goethe kennen, Herder, Wieland. Auch der Umzug in das Gartenhaus des Prinzen Friedrich zu einem günstigen Mietpreis betrachte ich als großes Glück.“
Wilhelm hörte der Mutter aufmerksam zu und verglich die Erfolge der Eltern mit seiner eigenen Situation, die momentan kläglicher kaum sein konnte. Nachdenklich ließ er seinen Blick zum Fenster schweifen. Der Abend schluckte die letzten Sonnenstrahlen. Ein frischer Wind fegte durch die Bäume im Park.
„So viel Glück hat nicht jeder“, brummte Wilhelm. „Und ich schon gar nicht.“ Die Ironie in seiner Stimme war nicht zu überhören. „Artig werde ich mit meinen Freunden in Schlesien von einer wohlhabenden Familie zur anderen ziehen und den Herrschaften gegen Bares aufspielen, solange es ihnen beliebt. Und fragt mich wer nach meiner Herkunft, antworte ich mit geschwollener Brust: Ich bin der Sohn der berühmten Geigerin Regina Strinasacchi und des nicht weniger berühmten Cellisten Conrad Schlick. Man wird staunen und mich bewundern. Na, wenn das keine glückliche Fügung ist.“
Regina ließ sich nicht provozieren. So war er nun mal. Eben noch freundlich und liebenswert und im nächsten Moment ein richtiges Ekel, das keine Skrupel hatte, sein Gegenüber mit bissigen Bemerkungen zu kränken. So gesehen, war es durchaus eine glückliche Fügung, dass Wilhelm sich nun dem Ernst des Lebens stellen musste und gezwungen war, sich als Wandermusiker die Hörner abzustoßen.
Es war schummrig im Zimmer geworden. Regina stand auf und zündete die Arganöllampe an, die auf der barocken Kommode neben dem Sofa stand. Dann trug sie das Geschirr in die Küche und kam mit einer Schale duftender Äpfel zurück. Sie fragte sich, was in Wilhelms Kopf jetzt vorgehen mochte. Würde er seiner zynischen Bemerkung von vorhin etwas Beschwichtigendes hinzufügen? Würde er die Mutter, wie es die Höflichkeit gebot, um Verzeihung bitten?
Nichts dergleichen geschah. Trotzig verharrte Wilhelm in stummem Protest.
„Warum bist du so missmutig?“, fragte Regina. „Du hast heute eine gute Nachricht bekommen. Ist das nicht Grund zur Freude?“
Wilhelm zuckte mit den Achseln. Nach einer Weile erhellte sich sein Gesicht. „Du hast ja recht. Es ist wahrlich eine freudige Nachricht, und dass die beiden mich ausgewählt haben, ist schon auch ein Glück für mich. Ein kleines Glück. Es kommt halt nicht so sintflutartig über mich wie bei dir und Vater.“
Regina lachte. „Weißt du, mit dem Glück ist es oft seltsam. Eine zunächst Glück verheißende Bekanntschaft mit dem berühmtesten Mann, dem ich jemals begegnet bin, mündete für mich in einem wahren Albtraum. Möchtest du wissen, wer dieser Mann war und in welche brisante Situation er mich damals brachte?“
„Und ob ich das will! Klingt spannend.“
„Allerdings ist’s eine längere Geschichte.“
„Um so besser. Es wäre die erste längere Geschichte, die du mir aus deinem Leben erzählst.“
Regina ignorierte den neuerlichen Seitenhieb und fuhr unbeirrt fort: „Dann lass uns zunächst zurückgehen in das Schreckensjahr 1783. Es war an Pfingstsonntag. Erst viele Jahre später las ich, wieso es zu den dramatischen Ereignissen gekommen war. An jenem 8. Juni ereignete sich im hohen Norden eine Naturkatastrophe von biblischem Ausmaß. Sie sollte das Leben auf der gesamten nördlichen Erdhälfte verändern. Tausende Menschen versetzte sie in Angst und Schrecken und forderte zahllose Opfer.“
„Unglaublich. Was war passiert?“
Regina überlegte kurz, dann stand sie auf, holte aus ihrem Schreibsekretär eine rote Ledermappe und schlug sie vor Wilhelms Augen auf. Darin lagen verschieden große Zeitungsausschnitte, manche mehrfach gefaltet, auch einige handschriftliche Aufzeichnungen und Skizzen. Regina zog einen vergilbten Artikel heraus. Er stammte aus einer geologischen Zeitschrift. Ein namhafter Wissenschaftler hatte ihn zwanzig Jahre nach dem geschilderten Ereignis geschrieben.
„Lies selbst!“, sagte sie und reichte Wilhelm den Artikel.
Wilhelm nahm ihn und las:
... Als habe jemand eine Lunte gelegt, eruptiert nach mehreren gewaltigen Erdbeben die Vulkanspalte der seit Jahrhunderten trügerisch schlummernden Laki-Krater im Süden Islands. Bis in den Februar des Jahres 1784 hinein speien 130 Vulkankegel glühende Feuertürme gen Himmel. Gefolgt von giftigem Rauch und Ascheregen. Die Erdrotation und mächtige Winde schieben Massen von schwefelhaltigen Wolken südwärts. Große Teile des Himmels über Westeuropa verdunkeln sich. Etwa 120 Tonnen giftiger Regen ergießen sich im Juni 1783 über dicht besiedelte Städte wie London, Prag, Berlin, Paris. Vogelschwärme fallen tot vom Himmel. Bis in den August hinein leiden besonders die Landarbeiter unter dem trockenen „Nebel“, der in Hals und Augen brennt und zu Atemnot führt. Die Sonne zeigt sich nur noch als kupferrote Scheibe, deren wärmende Strahlen die Erde nicht erreichen. Ein blassblaues, undurchsichtiges Nebelband umspannt den Himmel Europas und große Teile Amerikas. Missernten folgt eine globale Hungersnot.
Die Menschen sind ratlos. Untergangsstimmung macht sich breit. Der jüngste Tag sei gekommen, hört man die Ahnungslosen klagen, die sich den seltsamen „Höhenrauch“ ebenso wenig erklären können, wie das massenhafte Sterben von allem, was lebt. Ein Ende ist nicht abzusehen, denn jetzt rollt die nächste, nicht weniger dramatische Katastrophe heran. Im September setzt schlagartig Regen ein. Die Niederschläge vernichten auf den Feldern, was ohnehin nur spärlich gewachsen ist. Im Dezember geht der Regen in Schnee über. Klirrende Kälte hält große Teile auf der nördlichen Halbkugel im Würgegriff. Alle Flüsse tragen meterdickes Eis. Gigantische Schneemassen versperren die Versorgungswege.
In der letzten Februarwoche des Jahres 1784 setzt plötzlich Tau- und Regenwetter ein. Schlimmer kann es nicht kommen! Jetzt schieben sich die brechenden Eisschollen auf den Flüssen übereinander, türmen sich auf zu riesigen Bergen, durchstoßen Stadtmauern, reißen Häuserwände ein. Doch schon nach wenigen Tagen kehrt der Frost zurück. Dieser verhängnisvolle Wechsel von Kälte und Wärme wiederholt sich bis in den März hinein. Und als sei es mit der Not und dem Leid noch nicht genug, bricht jetzt das Schmelzwasser sintflutartig in die flussnahen Regionen ein, überschwemmt Städte und Dörfer und Felder. Europaweit stehen riesige Landstriche unter Wasser. In Wien behindern noch am 13. März die herantreibenden Eismassen auf der Donau das Abfließen des Schmelzwassers. Es steigt dramatisch an. Ganze Häuserzüge werden evakuiert. Erst in den letzten Märztagen beruhigt sich allmählich die Lage.
„Schrecklich!“, flüsterte Wilhelm. „Und währenddessen bist du mit deiner Violine von Stadt zu Stadt gereist, hast Konzerte geben, hast unbeirrt an deiner Kariere gefeilt?“ Abfällig verzog er die Mundwinkel. „Musik machen, während draußen die Welt aus den Fugen gerät? Freudig weiterspielen, während Menschen in Not geraten, hungern, sterben? Wie war das möglich? Hat dich das nicht berührt?“
Regina überlegte nicht lange. „Ich habe weiter Musik gemacht, eben weil ich zusehen musste, wie die Welt aus den Fugen geriet.“
Da war er wieder, dieser verächtliche Blick, den Wilhelm sich angewöhnt hatte, wenn er mit der Mutter sprach. „Mal ehrlich“, sagte er unverblümt. „Ging es dir nicht vor allem um deine Karriere und ums Geldverdienen? Im Grunde geht es doch immer nur ums Geldverdienen.“
Seine Worte, sein Ton – schlagartig wurde Regina klar, wie wenig Achtung der Sohn ihr entgegenbrachte. Sie lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück, sah ihm fest in die Augen und sagte so gelassen wie möglich: „Gewiss, auch das war ein Grund. Schließlich braucht ein Musiker wie jeder andere Mensch einen Broterwerb. Doch für mich war er nie der treibende Grund, Musik zu machen. Ich glaube, ein Künstler, der allein des Geldes wegen zur Musik findet, bringt es nicht weit. Ich habe es weit gebracht. Sehr weit! Weil ich den Menschen mit meiner Musik vor allem Freude bringen wollte. Auch damals in diesen trostlosen Jahren. Ich wollte, dass die Menschen, während sie meinem Spiel lauschten, ihre Sorgen vergaßen und neuen Mut fassten, damit sie Gott und dem Leben wieder vertrauten.“
Regina stand auf und trat ans Fenster. Ihre Lippen bebten. Die schmerzliche Erinnerung an jene Zeit und Wilhelms respektloses Verhalten schnürten ihr die Kehle. Genug für heute, dachte sie, wollte den Abend beenden und sich schlafen legen, als sie plötzlich Wilhelms Hand auf ihrer Schulter spürte und hörte, wie er leise, fast flüsternd sagte: „Verzeih mir, das hätte ich nicht sagen sollen. Bitte Mutter, verzeih mir. Manchmal sage ich Dinge, die ich gar nicht sagen will. Sie platzen einfach aus mir heraus.“
Sie zog ihr Schnupftuch aus der Rocktasche, drehte sich zu ihm um und sagte, während sie sich die Augen trocknete: „Ich weiß, mein Junge, und ich weiß auch, dass ich dir keine so glückliche Kindheit schenken konnte wie deiner Schwester. Aber musst du deine Mutter deshalb für den Rest ihres Lebens mit Verachtung strafen? Ist in deinem Herzen, in deiner Seele nichts geblieben, was dich mit mir verbindet? Nicht der kleinste Funke Liebe?“
Zögernd ergriff Wilhelm ihre Hand, führte sie an seine Lippen, küsste sie und sagte, gegen die aufkommenden Tränen kämpfend: „Seit ich denken kann, sehne ich mich danach, bei dir zu sein und von dir geliebt zu werden. Ich war überglücklich, wenn du mit Vater und Caroline nach Hause kamst, mich umarmt, geküsst und für mich auf deiner Violine gespielt hast. In dieser Zeit waren wir eine fröhliche, glückliche Familie. Einer war für den anderen da. Doch kaum hatte ich mich an die heitere Unbeschwertheit gewöhnt, seid ihr wieder gegangen, habt mich zurückgelassen mit meiner Sehnsucht nach euch. In den ersten Nächten habe ich mein Kissen nassgeweint. Am Tage konnte ich vor Kummer nichts essen. Mit allen Fasern wehrte sich mein Inneres gegen diese Trennungen, die ich als Strafe empfand für etwas, das ich nicht begreifen konnte.“
Regina legte ihre Hände auf seine Wangen. „Ich weiß“, flüsterte sie. „Und ich bin froh, dass du mir das gesagt hast. Von nun an bin ich immer für dich da, mein Sohn. Das verspreche ich dir.“
Sie nahm ihn in die Arme, drückte ihn an sich und spürte, wie auch er sie umarmte. Es war, als schüttelten sie in diesem Moment all das ab, was über Jahre hinweg zwischen ihn gestanden und ihr Verhältnis zueinander vergiftet hatte.
Nach einer Weile löste Regina sacht die Umarmung, trat einen Schritt zurück und neigte den Kopf ein wenig zur Seite. „Was hältst du davon, wenn wir uns eine gute Flasche Wein gönnen?“
„Keine schlechte Idee.“
„Dann geh rasch in den Keller und bring eine Flasche von dem Fränkischen Weißen aus Vaters Weinregal. Und eine zweite von dem Roten. Der Abend wird gewiss lang. Du möchtest doch bestimmt wissen, wie die Geschichte weitergeht?“
Wilhelm nickte. „Und ob ich das möchte!“
Er eilte die Kellertreppe hinunter. Das raumhohe Weinregal war noch gut gefüllt. Mit den beiden Flaschen kam er zurück.
Regina holte zwei Weingläser aus der Vitrine, setzte sich damit auf ihren gewohnten Platz auf dem Sofa und bedeutete Wilhelm, sich neben sie zu setzen.
Das tat er auch, nachdem er die Flasche entkorkt und die Gläser gefüllt hatte. Er erinnerte sich nicht, jemals neben der Mutter auf diesem Sofa gesessen zu haben. Es war ein edles Möbel mit geschwungener Lehne, das Polster bespannt mit grün schimmernder Seide, in der winzige, leuchtend gelbe und rote Rosenknospen eingewebt waren. Auf diesem Sofa zu sitzen war allein den Eltern und gelegentlich Caroline vorbehalten, und alle achteten streng darauf, dass das gute Stück keine Flecken oder Risse bekam.
„Zum Wohl, mein Sohn!“, prostete Regina Wilhelm zu, nahm einen kräftigen Schluck und sagte dann etwas versonnen: „Am besten ich beginne mit meiner Erzählung dort, wo ich deinem Vater zum ersten Mal begegnet bin und mich Hals über Kopf in ihn verliebt habe: Frühjahr 1784. In dieser unwirtlichen Zeit reiste ich, nachdem ich mehrere Wochen in Paris gastiert hatte, durch Deutschland. Im Gepäck meine Stradivari, sicher verstaut im hölzernen, mit braunem Rindsleder bespannten Geigenetui. Weil die Fahrt oft über holprige Straßen ging, hielt ich es wie ein bedrohtes Kind im Arm und atmete erleichtert auf, wenn meine Kutsche das jeweilige Ziel erreicht hatte. Hamburg, Ludwigslust, Leipzig. Viel Zeit für private Unternehmungen ließ mir der straffe Tourneeplan wahrhaftig nicht. Erwartungsvoll sah ich schließlich dem Höhepunkt und Abschluss der Tournee entgegen: Wien.
Am 26. März erreichte ich die Musikhauptstadt Europas, wählte ein vornehmes Hotel in ruhiger Lage und mietete mich dort auf unbestimmte Zeit ein. Zwei Tage später gab ich mein erstes Konzert. Das Publikum jubelte, und die hiesige Presse lobte mich in den höchsten Tönen. Für das zweite Konzert – es sollte in zwei Wochen stattfinden – hatte ich mir etwas Besonders ausgedacht. Doch dafür musste ich zunächst ins Stadtinnere fahren.
Der Fiaker, den ich für vier Uhr bestellt hatte, ließ auf sich warten. Ungeduldig lief ich vor dem Hotel auf und ab und war nahe daran, wieder hineinzugehen. Ich hatte die Hand schon an der Klinke, als ich vom Ende der Straße her Pferdegetrappel hörte und das holprige Rattern von Rädern.
„Fiaker für Madame Strinasacchi!“, rief der Fahrer. Ich lief zurück und machte aus meinem Groll kein Hehl. „Reichlich spät, Verehrtester“, sagte ich spitz. „Hat er keine Uhr oder keine Manieren?“
Betreten schob sich der beleibte Graukopf, der die Schnelligkeit wahrlich nicht erfunden hatte, vom Bock herunter. Er lüftete seinen Hut und entgegnete kleinlaut: „Madame, ich bitte um Nachsicht. Mein armes Pferd hatte eine Kolik, ich musste ein anderes vom Nachbarstall holen, und das dauert halt.“
Spöttisch verzog ich den Mund und verkniff mir jeglichen Kommentar. Jetzt rasch loszufahren war mir wichtiger als ein Disput mit dem Fahrer. Und was würde es bringen, ihm klarzumachen, dass ich nicht gewohnt war zu warten und erst recht nicht mich zu verspäten. Eine Verspätung gerade an diesem Tag, nicht auszudenken! Mit eiliger Hand raffte ich meinen Rock und stieg in den Wagen ein, noch ehe mir der Fahrer, nachdem er das Trittbrett heruntergeklappt hatte, die Hand reichte.
„Zum Trattnerhof!“, herrschte ich ihn an. „Mit Beeilung, wenn ich bitten darf.“
Nach einer guten Viertelstunde war das Ziel erreicht. Ich drückte dem Mann ein Geldstück in die Hand und eilte zum Eingang des imposanten Gebäudes.
Trotz des Zeitdrucks blieb ich einen Augenblick davor stehen. Es zählte zu den größten und repräsentativsten Bürgerhäusern Wiens. Ein exzellentes Zuhause für einen exzellenten Musiker, sagte ich mir, holte den zweimal gefalteten Zettel aus meinem Handbeutel und vergewisserte mich, dass ich auch wirklich richtig war: W. A. Mozart. Am Graben 29-29a, im Trattnerhof.“
„Du warst bei Mozart?“, fragte Wilhelm überrascht. „Dem berühmten Mozart?“
Regina nickte. „So ist es. Und ich versichere dir, dieser Besuch wird mir bis an mein Lebensende in hellster Erinnerung bleiben. Mein Herz wollte sich überschlagen, als ich das zweite der vier Treppenhäuser suchte, andächtig die Stufen hinaufschritt und mich dabei fragte, wie er wohl aussehen mochte, dieser geniale, nur fünf Jahre ältere Mozart. Sein Porträtbild hing im Musikzimmer meiner Eltern in Mantua. Von daher kannte ich sein Gesicht. Mein Repertoire umfasste etliche seiner Kompositionen, doch war ich ihm noch nie persönlich begegnet.
Der Maestro fände nur dienstags nach 16 Uhr die Zeit, irgendwen zu empfangen, hatte ich in Erfahrung gebracht und meinen Besuch daraufhin schriftlich angekündigt. Ich war mir nicht sicher, ob Mozart mich überhaupt empfangen würde. Er arbeitete damals noch als freier Musiker und Kompositeur. Was würde geschehen, wenn er zu beschäftigt oder nicht bei Laune war, sich meinem Anliegen zu widmen. Wiederum hatte ich keine Veranlassung, mein Licht unter den Scheffel zu stellen. Schließlich galt auch ich einmal als musikalisches Wunderkind und war inzwischen, bei aller Bescheidenheit, nicht irgendwer.
Im dritten Stock angekommen, verharrte ich einen Moment vor Mozarts Tür, beruhigte meinen Atem, sammelte meine Gedanken. Dann zog ich – nicht zu stark und nicht zu zaghaft – an der Türglocke. Schritte eilten heran. Jemand drückte auf die Klinke, und dann stand er vor mir: Wolfgang Amadeus Mozart. Ich war überrascht, nicht das Hausmädchen oder Mozarts Frau zu erblicken, sondern den Maestro persönlich. Mit einer leichten Verbeugung begrüßte er mich, bat mich herein und versicherte mir, welche Ehre mein Besuch für ihn sei.
Die Ehre sei ganz meinerseits, entgegnete ich höflich und bedankte mich dafür, dass er die Zeit gefunden hatte, mich zu empfangen.
Er ging voraus. Mir war nicht entgangen, wie interessiert er mich an der Tür von Kopf bis Fuß gemustert hatte. Ich denke schon, dass ihm, was er sah, gefiel. Kleid und Schmuck hatte ich mit Bedacht gewählt. Unter dem steingrauen Umhang trug ich ein blaues, in der Taille eng geschnürte Kleid. Hals und Dekolleté umspielte ein luftiges Fichu aus weißer Seide. Hut und Schuhe waren im Blau des Kleides gehalten. Schlichte Eleganz – das war mir wichtig.
Mozart schien guter Laune. Im Musikzimmer sagte er zu mir: Mademoiselle, wie ich hörte, befinden Sie sich trotz der Wetterunbilden auf einer Kunstreise durch Deutschland und Österreich und erobern die Musikwelt Europas mit Ihrer Violine. Meine Hochachtung! Seit ihrem ersten Konzert in Wien überschlagen sich die Lobeshymnen in den Journalen. Ich bin auf das Angenehmste überrascht.
Ich schmunzelte über sein charmantes Erstaunen, das ich ihm nicht abkaufte. Er wusste sehr wohl, wen er vor sich hatte. Die Kunde von meiner Virtuosität auf der Stradivari hatte längst die Tore Wiens erreicht. Bereits Wochen vor meinem ersten Konzert hatte man in großer Aufmachung über mich berichtet und anerkennend hervorgehoben, ich sei binnen weniger Jahre in die vorderste Reihe der Soloviolinisten aufgestiegen und verkehre mittlerweile in den vornehmsten Kreisen.
Mozart bat mich, an dem runden Tisch in der Mitte des Zimmers Platz zu nehmen. Er setzte sich mir gegenüber. Im gleichen Atemzug entschuldigte er die Abwesenheit seiner Frau. Übrigens eine Cousine von Carl Maria von Weber. Sie erwarte ein Kind und sei mit einer Vertrauten auf dem Weg zum Arzt.
Während er die beiden Gläser, die auf dem Tisch standen, mit Wein füllte, schweifte mein Blick neugierig im Zimmer umher. Vor der Fensterwand Mozarts Hammerflügel. Darauf, wild verstreut, etliche beschriebene Notenblätter. Neben dem Flügel ein schmaler Tisch, ebenfalls mit Notenblättern übersät. An der fensterlosen Wand ein barockes, leicht ramponiertes, mit hellblauem Stoff bespanntes Sofa.
Um Mozarts Zeit nicht über Gebühr in Anspruch zu nehmen, kam ich gleich auf den Punkt. Maestro, sagte ich frei heraus, seit Tagen überlege ich, womit ich das Wiener Publikum bei meinem zweiten Konzert im Kärtnertortheater überraschen könnte. Aus zuverlässiger Quelle erfuhr ich, dass einige hochgestellte Personen, die bereits mein erstes Konzert besucht haben, mich erneut mit ihrer Anwesenheit beehren werden. Deshalb wage ich Sie zu fragen ... Ich stockte in meiner Rede, weil Mozart plötzlich die Beine übereinanderschlug, die Hände um das rechte Knie schlang und mich mit großen, die innere Unruhe verratenden Augen ansah. Sogleich schoss mir die Frage durch den Kopf, ob mein Anliegen vielleicht doch etwas zu vermessen war.
Nun ja, fuhr ich irritiert fort. Ich kam zu dem Schluss, wenn Sie, Maestro, sich mit einem Stück aus Ihrer Feder an dem Konzert beteiligten, wäre das nicht nur eine künstlerische Bereicherung des Abends, es wäre sein glanzvoller Höhepunkt.
Mozart rieb sich das Kinn und sagte aus einem bubenhaften Lächeln heraus: Glanzvoller Höhepunkt des Abends, welch hübsches Kompliment. Allein deshalb fühle ich mich verpflichtet, Ihrer Bitte nachzukommen. Er erhob sein Glas und rief triumphierend: Und zwar mit dem allergrößten Vergnügen!
Ich jauchzte innerlich, danke ihm von Herzen und fragte, welches Stück er zu spielen gedenke, dementsprechend würde ich die Programmhefte ergänzen und neu drucken lassen.
Er legte den Kopf in den Nacken und dachte einen Moment mit geschlossen Augen nach. Plötzlich riss er sie wieder auf und sagte mit schelmischem Blick: Soeben beschleicht mich ein trefflicher Gedanke: Mademoiselle Strinasacchi, ich spiele nicht nur für Sie, ich spiele mit Ihnen.
Sie begleiten mich am Klavier? Ich war begeistert.
Er stand auf, trat hinter den Stuhl und stützte sich mit den Händen auf die Lehne. Nicht nur das, Mademoiselle, sagte er, einen geheimnisvollen Hauch in der Stimme. Was halten Sie davon, wenn ich eigens für Ihr Konzert, eigens für unseren gemeinsamen Auftritt, eigens zur Überraschung des Wiener Publikums eine Sonate komponiere?
Eine Serenade eigens für mein Konzert, fragte ich erstaunt. Maestro, ich bin überwältigt. Allerdings findet das Konzert bereits am 29. des Monats statt.
Mozart setzte sich wieder, rückte seine silberne Zopfperücke zurecht, was ihm Zeit zum Überlegen gab, dann sah er mir in die Augen und sagte, den Zeigefinger erhoben: Genau das ist der Punkt, Mademoiselle. Zurzeit arbeite ich an meinem Klavierkonzert in G-Dur. Zu den Klavierstunden, die ich am Vormittag gebe, kommen noch einige Konzerte hinzu. Am Sonntag, den 18. verreise ich in privater Angelegenheit, allerdings nur drei Tage, dann bin ich zurück und widme mich sogleich Ihrer Sonate. Mein Wort darauf! Ich komponiere Ihnen ein Meisterwerk, ein musikalisches Juwel, das vor südländischem Temperament nur so sprühen wird. Ich komponiere Ihnen die Sonate für Regina Strinasacchi. Ja! So werde ich sie nennen.
Er sprang auf, eilte durchs Zimmer, setzte sich an den Hammerflügel, klappte den Deckel hoch und schlug fortissimo einen Reigen wohlklingender Akkorde an. Dann verschränkte er die Hände hinter dem Kopf und sagte entschlossen, nachdem er einen Augenblick versonnen zur Decke geschaut hatte: Sonate für Violine und Klavier in B-Dur. Das musikalische Konzept wächst bereits in meinem Kopf.
Schwungvoll drehte er sich auf dem Schemel zu mir herum und rief in heller Freude: Mademoiselle, was halten Sie von einem heiteren Dialog beider Instrumente, ein an Emotionen reicher Dialog, der sich furios durch alle drei Sätze zieht. Etwa so: Wir beginnen mit einer langsamen Einleitung, einem weichen, singenden Largo. Das zum Beispiel wäre neu. Noch nie habe ich eine Sonate mit einem Largo begonnen. Mademoiselle, wie gefällt Ihnen das?
Mit gleichem Schwung wie vorhin wandte er sich wieder seinem Flügel zu, jedoch spielte er noch nicht.
Ich stand auf und huschte hinüber zu dem schlichten Holzstuhl, der seitlich des Flügels stand. Von hier aus konnte ich Mozarts Gesicht besser sehen, konnte ihn beobachten, während er komponierte. Ich war unsagbar aufgeregt. Noch nie hatte ich einem Komponisten bei seinem Schaffensprozess zugesehen, und nun, da sich die Gelegenheit dazu ergab, war es gleich einer der größten lebenden Komponisten.
Zwei, drei Sekunden schwebten Mozarts Hände über der Tastatur. Ein Moment der Besinnung. Ein Moment höchster Konzentration. Es war, als schaffe er zwischen sich und dem Instrument eine magische Verbindung. Und dann, urplötzlich, schlug er so heftig in die Tasten, dass ich zusammenzuckte. Doch diesem rasanten Klangfeuer folgte ein lieblich singender Melodienreigen, so bunt und strahlend, dass ich meinte, ich spazierte über eine Blumenwiese.
Das ist die Violine, nur die Violine, rief er mir kurz zu. Haben Sie das? Gut. Jetzt die Klavierstimme.
Er spielte wie von Zauberhand geführt. Ich überlegte, ob er das Largo doch schon einmal gespielt hatte und es jetzt aus der Erinnerung hervorholte. Aber nein, der Vorschlag, gemeinsam etwas vollkommen Neues von ihm zu spielen, war ihm erst in meinem Beisein gekommen. Ein spontaner Gedanke. Er hatte diese wundervolle Musik vor meinen Augen geboren. Meine Zweifel verflogen. Jetzt wusste ich, dieser geniale Mensch brachte das Meisterstück fertig, in denkbar kurzer Zeit etwas Großes für mein Konzert zu erschaffen. Etwas, das die Zeiten überdauerte.“
„Und?“, fragte Wilhelm, „hat Mozart die Sonate für dich komponiert? War das Konzert ein Erfolg? Warst du zufrieden?“
„Herrje, so viele Fragen. Lass mich erst einmal Luft holen und einen Schluck trinken. Erzählen macht durstig.“
Die barocke Carteluhr über der Kommode schlug zur elften Stunde. Trotzdem verspürten Mutter und Sohn keine Müdigkeit. Doch es waren nicht nur die aus der Vergangenheit geholten Erinnerungen, die beide wachhielten, es war vor allem das Gefühl, sich wieder nahe zu sein.
„Zum Wohl mein Sohn!“
„Zum Wohl Mutter!“, prostete Wilhelm ihr zu und nahm einen kräftigen Schluck. „Nun sag schon“, drängte er. „Hielt Mozart Wort?“
Regina wiegte den Kopf. „Das hat er, der Herr Kompositeur. Ehrlich gesagt, denke ich nicht allzu gern an die bangen Tage zwischen dem Besuch bei ihm und meinem Konzert. Nie zuvor hatte mich ein Mensch in eine derart hilflose Situation gebracht. Ich war seinem Wohlwollen vollkommen ausgeliefert.“
„Wie bitte? Du warst Mozart ausgeliefert?“
„So ist es. Mir blieb nichts anderes übrig, als geduldig zu warten. Und so wartete ich und wartete und konzentrierte mich auf die Vorbereitung des Konzerts. Zu meinen täglichen drei Übungsstunden nahm ich noch zwei hinzu und duldete in dieser Zeit keinerlei Störung. Ich feilte an den schwierigsten Stellen, forcierte die Geschwindigkeit der Triller, malträtierte meine Violine mit artistischen Fingerübungen, bis ich meinte, gleich falle mir die Hand vom Gelenk.
Dabei schielte ich immer wieder mit einem mulmigen Gefühl zu den frisch gedruckten Konzert-Programmen. In großer Aufmachung kündeten die Wiener Zeitungen die Premiere einer eigens für Regina Strinasacchi komponierten Sonate von Herrn W.A. Mozart an.
Alles war akribisch vorbereitet, nur hatte ich seit meinem Besuch bei Mozart nichts mehr von ihm gehört. Zehn Tage verstrichen. Allmählich befürchtete ich, der Maestro habe mich samt der versprochenen Sonate vergessen oder die Komposition wegen seines vollen Terminkalenders nicht geschafft. Ich bebte innerlich, nachdem ich drei Tage vor dem Konzert noch immer keinerlei Nachricht von ihm hatte. Panik machte sich breit. Schon sah ich den grandiosen Höhepunkt in einem Eklat enden. Nicht auszudenken, die Blamage!“
Wilhelm schüttelte den Kopf. „Unglaublich, und warum bist du nicht einfach zu ihm gegangen und hast ihn gefragt? Schließlich war die Sache zwischen euch fest vereinbart.“
„Warte ab, das Beste kommt noch. Am Vormittag des 28. April klopfte ein Bote hektisch an die Tür meines Hotelzimmers. Der Bursche war keine 15 Jahre alt. Die zerschlissenen Hosen, die er anhatte, waren ihm viel zu groß. Die dünne Jacke hatte wohl noch nie einen Waschtrog gesehen. Dieser erste Eindruck hielt mich davon ab, ihn kurz hereinzubitten, wie ich es sonst gern tat. Eilig überreichte er mir einen Packen loser Notenblätter, die ein grober Strick zusammenhielt. Auf dem Deckblatt stand: Sonate in B-Dur, Violine.
Ich bedankte mich, schloss die Tür und wusste im selben Moment, dass ich mit der neuen Situation nicht glücklich war. Zwar hielt ich jetzt die ersehnten Noten in den Händen und das quälende Warten war vorbei, doch wurde mir schlagartig klar, wie wenig Zeit Mozart mir zum Einstudieren der Sonate gelassen hatte. Ich fragte mich, wieso? Wollte er mein solistisches Können auf die Probe stellen? Wollte er meinen Ruf als Violinistin ruinieren oder mich der Lächerlichkeit preisgeben? Sollte ich mich so in dem Manne getäuscht haben?
Mitten in diesen hektischen Gedanken fiel mir auf, dass ich nur den Part für die Violine bekommen hatte. Der Bote – das war mir aufgefallen – trug noch zwei weitere Pakete bei sich. Ich rannte hinaus und rief laut nach ihm. Zum Glück war er noch nicht weit gegangen. Ich fragte ihn, ob er nicht noch ein zweites Paket mit dem Klavierpart für mich hatte. Er verneinte. Herr Mozart habe ihm nur dieses eine Paket gegeben. Doch dann fiel ihm plötzlich ein, Herr Mozart lasse mir ausrichten, er werde morgen pünktlich zum Konzert erscheinen. Und ach ja, zu dem Paket gehöre ein Brief, den habe er in seine Jackentasche gesteckt und dort in der Eile vergessen. Kleinlaut zog er den halb zerknitterten Brief heraus und reichte ihn mir mit der Bemerkung, Herr Mozart lasse ebenfalls ausrichten, ich solle den Brief lesen, bevor ich in Panik geraten würde und zu ihm gelaufen käme. Er sei heute Abend ohnehin nicht zu sprechen. Mit einer flüchtigen Verbeugung machte er kehrt und rannte davon.
Fassungslos sah ich ihm nach und dachte mit Unbehagen an die Aufführung der erst vor wenigen Tagen komponierten Sonate. Ich musste sie vom Blatt spielen ohne eine einzige Probe mit dem Pianisten. Ich dachte an das anspruchsvolle Wiener Publikum, an die namhaften Gäste, die kommen würden, an die Schmach, wenn ich den hohen Erwartungen nicht gerecht würde.“
„Dann hattest du nicht einmal zwei volle Tage Zeit, um dich mit den Noten vertraut zu machen und die schwierigsten Passagen zu üben? Kaum zu glauben!“
Wilhelm überlegte, wie lange er gebraucht hatte, das A-Dur Cellokonzert von Bachs Sohn Emanuel einzustudieren. Noten vom Blatt spielen konnte jeder versierte Cellist, doch sie mit Leben zu erfüllen, ihnen, wie bei diesem Bach-Konzert, die vom Komponisten beabsichtigte Leichtigkeit und Verspieltheit zu schenken, das machte den wahren Musiker aus.
„Und was stand in dem Brief?“
Noch einmal klappte Regina die rote Ledermappe auf. Der Brief lag ganz unten. Das Papier war ebenfalls vergilbt und recht zerknittert.
„Du hast ihn noch?“, staunte Wilhelm, stand auf, drehte die Arganöllampe ein wenig höher und kam zurück.
„So etwas wirft man nicht weg. Diese Dinge, so unscheinbar sie auch sein mögen, gehörten zu meinem Leben. Bitte lies ihn mir vor. Ich schließe dabei die Augen und tue so, als säße ich auf der Couch in meinem Hotelzimmer in Wien.“
Ehrfürchtig faltete Wilhelm den Brief auseinander, stellte sich wie ein Redner in einigem Abstand vor das Sofa und begann im Lichtschein der Arganöllampe laut zu lesen:
Meine liebe, hochverehrte Mademoiselle Strinasacchi, ich bin untröstlich. Bitte schelten Sie mich nicht, weil ich Ihnen die Noten aus den befürchteten Gründen erst heute überreiche. Jedoch hege ich nicht den geringsten Zweifel, dass Sie die Sonate morgen Abend in überragender Weise spielen werden. Und bitte wundern Sie sich nicht wegen des fehlenden Klavierparts. Bedauerlicherweise wurde die schriftliche Ausfertigung ein Opfer meines allzu straffen Kalenders. Ich spiele morgen nach flüchtiger Markierung. Übrigens nicht zum ersten Mal. Dies zu Ihrer Beruhigung. Für den Feinschliff nehme ich mir später Zeit.
Auf morgen, Ihr ergebenster W. A. Mozart.
Kopfschüttelnd setzte sich Wilhelm wieder und sagte: „Wenn man das gelesen hat, kann man Mozart nicht einmal böse sein. Meinst du nicht?“
Regina schmunzelte. „Im Nachhinein nicht, da stimme ich dir zu. Aber wie du dir denken kannst, war ich, als ich den Brief damals gelesen habe, mehr als empört. Ich kochte innerlich und konnte mir nicht erklären, wieso Mozart mich in eine derart brisante Situation gebracht hatte. War es sein heiteres, unbekümmertes Gemüt? War es Überheblichkeit? Oder ging er wie selbstverständlich davon aus, dass andere Menschen fertigbrachten, was für ihn eine Leichtigkeit war? Mit fahrigen Händen löste ich den Strick vom Paket, überflog die eilig aufs Papier geworfenen Noten, um mir ein erstes Bild von der Sonate zu machen und fasste dann zwei wichtige Entschlüsse: Ich wollte morgen Abend dem musikverwöhnten Wiener Publikum Stürme der Begeisterung entlocken. Und ich wollte Herrn Mozart beweisen, wozu eine Regina Strinasacchi fähig war.“
„Ich merke schon“, sagte Wilhelm. „Da hat dich der Ehrgeiz gepackt. Aber wieso wusstest du, dass du beides schaffen würdest?“
Regina nahm ihr Glas, trank genüsslich einen Schluck und sagte dann: „Weil ich die Sonate so lange üben wollte, bis sich jede Note wie mit glühenden Eisen in mein Gedächtnis eingebrannt hatte und ich der Meinung war, ich hätte diese Sonate schon hundertmal gespielt. Jedenfalls stand ich am nächsten Abend erwartungsvoll auf der Bühne des Wiener Kärntnertortheaters. Ich riss mich zusammen, doch ich gebe zu, ich war unsagbar aufgeregt. Ich trug ein cremefarbenes Kleid mit rundem Ausschnitt bis zu den Schultern, wie es Mode war. Im Haar ein filigraner silberner Reif, dazu Perlenohrringe. Mein Papa hatte sie mir zum 18. Geburtstag geschenkt. So intensiv, wie ich am Vortag geübt hatte, hätte ich die Sonate wahrscheinlich aus dem Gedächtnis spielen können, was ich zu meiner eigenen Sicherheit natürlich nicht tat. Doch da mir die Noten inzwischen vertraut waren, konnte ich mich auf die technische Perfektion und die emotionale Tiefe meines Vortrags konzentrieren. Mal schmetterte mein Geigenbogen kraftvoll über die Saiten, mal glitt er sanft wie eine streichelnde Hand darüber hinweg. Als der letzte Takt verklungen war, hielten die Gäste im Saal für einen Moment den Atem an. Zunächst langsam, dann immer stärker brauste Beifall auf. Dazwischen Bravorufe. Minutenlang. In den hinteren Reihen erhob man sich von den Plätzen.
Mozart, der mich, wie versprochen, am Klavier begleitet hatte, trat neben mich, ergriff meine Hand und verbeugte sich mit mir gemeinsam wieder und wieder. Doch das Publikum wollte mich nicht gehen lassen. Eine Zugabe folgte der nächsten, jeweils belohnt von nicht enden wollendem Beifall. Was für ein gelungener Abend, dachte ich, nachdem ich den obligatorischen Blumenstrauß im Arm hielt – das Zeichen dafür, dass das Konzert ohne weitere Zugaben zu Ende war.
Später berichtete mir einer meiner Verehrer, ein hochgestellter höfischer Beamter, Kaiser Joseph II. habe sich gegenüber seinem Begleiter lobend über mich geäußert, und er habe sich gefragt, wie eine zierliche Person von gerade einmal 23 Jahren die Violine so kraftvoll, so ausdrucksstark und zugleich emotional berührend zu spielen verstand. In dieser Hinsicht reiche kein lebender Geiger an mich heran. Sag, Wilhelm, hätte ich ein schöneres Lob für meinen Fleiß und meine Beharrlichkeit ernten können?“
„Wohl kaum“, seufzte Wilhelm. „Ich bewundere dich, wie bravourös du die Situation gemeistert hast. Du bist wahrhaftig eine großartige Geigerin.“
„Ich war eine großartige Geigerin, mein Sohn. Seitdem dein Vater die Augen für immer geschlossen hat, gibt es das Trio Schlick-Strinasacchi nicht mehr. Alles im Leben geht irgendwann zu Ende. Wieviel Zeit uns bleibt, weiß Gott allein. Deshalb nutze die Zeit. Vertue sie nicht mit unnötigen Dingen. Stell dir ein Ziel und verfolge es beharrlich. Dann wirst du, wenn dein Ende gekommen ist, mit ruhigem Gewissen sagen können: Es hat sich gelohnt.“
Still betrachtete Wilhelm die Mutter aus den Augenwinkeln. Ihr letzter Satz war wie ein Abgesang, ein Endpunkt unter ihre Erzählung. Schon hörte er sie sagen, es sei spät und Zeit zu Bett zu gehen. Doch das wollte er nicht. War es Neugier oder das dritte Glas Wein, das ihn zu der Frage ermutigte: „Und wie hast du Vater nun kennengelernt? Davon wolltest du mir doch eigentlich erzählen.“
Als bräuchte sie Zeit zum Überlegen, stand Regina auf, zog die Vorhänge der beiden Fenster zu und fragte Wilhelm von dort: „Bist du nicht müde? Es ist längst Schlafenszeit.“
„Nein, ich bin nicht müde. Ich höre dir gern zu. Ehrlich gesagt, frage ich mich ... wenn du so viele hochkarätige Verehrer hattest, wie hat Vater es dann angestellt, dein Herz für sich zu gewinnen? Kam er mit teuren Blumen in deine Garderobe? Hat er dir seufzend seine Liebe gestanden?“
„Das wäre ihm zu banal gewesen“, sagte Regina lachend. „Dann hätte er sich mit den anderen Verehrern auf eine Stufe gestellt, und ich hätte ihn genau wie jene höflich, aber bestimmt abgewiesen. Nein, so einfallslos war dein Vater nicht. Er versuchte, mein Interesse auf recht außergewöhnliche und zugleich liebenswerte Weise zu gewinnen. Bildlich gesprochen hat er eine Lunte zu meinem Herzen gelegt, die, als sie mich erreicht hatte, ein heftiges Feuer in mir entfachte. Ein Feuer, das bis zum letzten Tag unseres gemeinsamen Lebens loderte.“