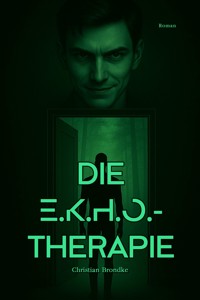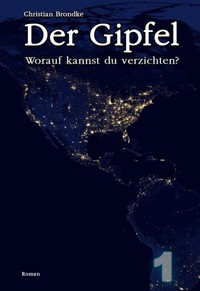Teil 1
- Die Ruhe vor dem Ton -
- OHNE ERINNERUNG -
Der Raum hatte keine Ecken. Also... nicht wirklich. Natürlich konnte man sie sehen – dort, wo Wand auf Wand traf, die Decke auf den Boden, das Licht auf den Schatten. Aber in seiner Wahrnehmung war alles weich, glatt und abgerundet. Als hätte jemand mit Bedacht die Konturen gelöscht, damit nichts schneidet, nichts hängen bleibt. Nicht einmal ein Gedanke.
Er lag auf dem Bett, genau in der Mitte. Die Decke war grau. Nicht das Grau von Schmutz, sondern das von Dingen, die zu oft gewaschen wurden, bis sie alles verloren hatten. Sie hatte keine Form, keine Gefühl und keine Identität. Einmal hatte er sie in einem Anfall von Trotz zerknüllt und gegen die Wand geworfen. Dann war sie einfach dageblieben, wie ein erschlagenes Tier. Seitdem faltete er sie morgens sorgfältig, obwohl es niemand verlangte.
Es war Tag. Das wusste er, weil das Licht anders war. Kein künstliches Deckenlicht, sondern das gedämpfte Weiß, das durch die matten Fensterscheiben fiel. Von draußen drang kein Laut herein. Kein Vogel. Kein Auto. Keine Kinderstimmen. Nur dieses gleichmäßige Schweigen, das wie Staub auf allem lag.
Die Tage begannen immer gleich. Um sieben Uhr: das Summen der Türöffnung. Dann Schwester Ingrid oder Schwester Miriam – nie beide. Manchmal jemand Neues. Ohne Begrüßung. Ohne Fragen. Tablett auf den kleinen Tisch, Abfrage des Namens:
»Niklas Kreklow?«
»Ja.«
»Gut.«
Drei Tabletten, manchmal vier. Weiß, rosa, eine gelbliche. Wasser im Plastikbecher. Er fragte nie, was es war. Er wusste, dass sie ihm nicht antworten würden. Stattdessen nur schweigen, schlucken, zurückgehen. Die Tür schloss sich wieder mit diesem leisen, magnetischen Klick, der mehr Endgültigkeit hatte als jedes Schloss.
Danach: Sitzen. Oder liegen. Oder gehen. In der Zelle – so nannte er sie manchmal heimlich – gab es ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl, ein Waschbecken, eine Toilette mit Sichtschutz. Und einen Spiegel. Rechteckig, unzerbrechlich, etwas milchig in der Reflexion. Genug, um sich zu erkennen, mehr aber auch nicht. Aber er hatte sich nie beschwert. Vielleicht hätte er längst einen neuen haben können, aber er fragte nicht danach.
Frühstück war um halb acht. Aber zurzeit aß er kaum. Der Hunger kam, wenn er schlief. Wenn er wach war, war er zu weit weg. Meist rührte er den Brei mit dem Löffel, bis er kalt war. Man ließ ihn. Es war Teil des Protokolls: Druck vermeiden, Autonomie fördern, Verhalten beobachten. Allerdings dauerte dieses Protokoll schon ewig. Vielleicht sollte man da mal was ändern. Niklas wusste es nicht. Er ließ viel über sich ergehen.
Danach durfte er in den Flur. Dreißig Minuten Bewegung, ab und zu mit Begleitung. Meist war es Herr Gläser, ein ehemaliger Sportlehrer mit schmalem Gesicht und zu großem Schlüsselbund, der sich umschulen ließ. Der Flur war sechzehn Meter lang. Von einer Tür zur anderen. Linoleumboden. Keine Fenster. Überall Kameras. Niklas ging langsam. Schritt für Schritt. Er zählte mit. Heute: 113 Schritte hin. 116 zurück.
Einmal hatte er gefragt, warum die Zahlen nicht gleich seien. Gläser hatte gegrinst und gesagt:
»Vielleicht läufst du schief.«
Dann wieder zurück ins Zimmer. Der Aufenthaltsraum mit den anderen Patienten? Natürlich. Aber da gab es auch nichts, was den Tag angenehmer machte. Die Bücher dort kannte er alle, die Spiele waren für Kinder. Also verbrachte er viel Zeit in seinem Zimmer; seiner Zelle. Und dort gab es meistens nicht viel zu tun, außer zu warten. Zwischen zehn und zwölf Uhr kam manchmal jemand zum Gespräch. Mal war es ein Arzt, mal war es ein Therapeut. Für Niklas waren es nur Stimmen mit Notizblöcken. Sie fragten nach Schlaf, Stimmung und seinen Gedanken. Niklas antwortete knapp. Längere Sätze wurden notiert. Kurze ignoriert. Er lernte, was registriert wurde. Und was nicht.
Mittagessen um zwölf. Dusche um vierzehn Uhr. Danach: Rückzug. Die sogenannte Stillzeit.
Dann wieder Abendbrot, Medikamente, Beobachtung durch das kleine runde Fenster in der Tür. Zwei Sekunden Blickkontakt,dann weiter. Immer zur vollen Stunde. Immer mechanisch. Keine Namen. Keine Gespräche.
Wenn das Licht gedimmt wurde, änderte sich die Farbe der Wände – zumindest war das in seiner Wahrnehmung so. Das Weiß wurde weicher, bekam etwas Warmes, fast wie Haut. Dann fühlte er sich, als wäre er nicht in einem Zimmer, sondern in etwas Lebendigem. In einem riesigen Tier vielleicht. Eines, das ihn verschluckt hatte. Und das jetzt verdauen würde.
Er sprach nicht mehr mit sich selbst. Hatte damit aufgehört, nachdem man ihm gesagt hatte, dass das auffällig sei. Also schwieg er. Tagelang. Wochenlang. Wenn er dann doch im Aufenthaltsraum saß, dann beobachtete er die anderen. Er wusste von jedem wie er oder sie hieß und konnte einschätzen, wie sie gerade drauf waren.
Allein im Zimmer dachte an nichts und gleichzeitig aber auch an alles. Und irgendwann – zwischen diesen langen, stumpfen Tagen – war ihm aufgefallen, dass die Welt draußen aufgehört hatte, sich für ihn zu interessieren.
So verliefen die ersten Wochen hier in der Klinik. Daran dachte er jeden Tag. Heute war das nicht mehr so.
In seinem Therapieplan stand es anfangs ganz nüchtern: Kontrollierte Isolationsbehandlung, Depressionsstabilisierung, schrittweise Rekonstruktion des autobiografischen Gedächtnisses.
Er hatte das Wort Rekonstruktion lange im Kopf herumgewälzt. Es klang wie eine Baustelle. Oder wie etwas, das zertrümmert war.
Einmal in der Woche wurde der Plan überprüft. Ein junger Assistenzarzt mit einem zu glatten Gesicht kam mit einem Tablet in den Raum, stellte Fragen nach Appetit, Schlaf und Erinnerungen. Manchmal ließ er Niklas einen Test ausfüllen – Reaktionszeit, kognitive Muster, Sprache. Alles wurde gespeichert. Niklas wusste nicht, wohin. Er stellte sich einen riesigen Serverraum vor, irgendwo unter der Erde, mit Tausenden Datensätzen, Gesichtern, Stimmen und verflüchtigten Gedanken. Er war dort nur eine Nummer.
»Patient 21-1-13. Männlich. Amnesie – wahrscheinlich deliktbedingt.. Stabil.« So musste es sein. Er war wahrscheinlich nur ein Datensatz in der großen allumfassenden Statistik.
Die Therapien selbst waren flach. Es waren Gespräche und keine Konfrontationen. Sogenannte strukturerhaltenden Maßnahmen. Das Ziel: eine fragile Stabilität. Keine Erinnerung, keine Wahrheit – noch nicht. Nur das Jetzt.
Manchmal saß er mit Frau Dr. Ebling in dem kleinen Zimmer am Ende des Westflügels. Dort gab es Sessel, ein Fenster mit Gittern, eine Topfpflanze, die nie wuchs. Dr. Ebling sprach leise und stellte einfache Fragen.
»Was hast du heute gespürt, Niklas?«
»Nichts.«
»Gar nichts?«
»Etwas Druck in der Brust.«
»Worauf führst du das zurück?«
»Auf das Atmen.«
Manchmal lächelte sie. Manchmal schrieb sie. Aber sie fragte nie nach dem, was davor war; bevor er hier gelandet war. Es war, als umkreisten sie etwas Unsagbares. Ein Zentrum, das brannte. Doch niemand wagte sich hinein.
Erinnerungen sollten kommen, nicht geholt werden. So lautete die Devise. Wie Echos, sagte sie einmal.
»Sie hallen zurück, wenn es Zeit ist.«
Niklas hatte genickt, obwohl ihn das Wort innerlich zusammenzucken ließ. Manchmal kam es ihm vor, als würde Dr. Ebling ihn anders ansehen, als die anderen Patienten. Nicht das es ihn wirklich interessierte. Aber Gedanken machte er sich schon manchmal darüber, denn irgendwo in seinem Inneren hatte er das Gefühl, dass er sie mögen könnte.
Am schwarzen Brett im Flur hing ein Kalender mit den Besuchszeiten. Montag, Mittwoch, Samstag. Jeweils zwei Stunden.Viele Patienten warteten an diesen Tagen in der Besucherlounge.Sie machten sich zurecht. Kämmten sich die Haare, parfümierten sich ein – und zitterten vor Aufregung. Niklas ging nie hin. Er hatte in den ersten Monaten gewartet. Jeden Mittwoch. Jeden Samstag. Doch niemand kam.
Nach einem Jahr fragte er eine Pflegerin, ob jemand nach ihm gefragt hätte. Sie hatte nur die Lippen zusammengepresst und gesagt:
»Nein.«
Ob das stimmte, wusste er nicht. Vielleicht hatte man es ihm verheimlicht. Vielleicht wollte man, dass er glaubte, er sei allein.Vielleicht war er es aber auch einfach nur und niemand interessierte sich für ihn.
Manchmal stellte er sich Gesichter einer Mutter und eines Vaters vor. Meistens war es aber doch nur ein leerer Stuhl, der in seinem Kopf stand. Wenn sie in seiner Fantasie da waren, saßen sie nur auf der anderen Seite des Tisches und sahen ihm beim Schweigen zu.
In der Akte, die er nie zu Gesicht bekam, stand vermutlich:
»Keine Besuche von Angehörigen. Patient äußert keinen Wunsch nach Kontaktaufnahme.«
Und das war die Wahrheit. Denn irgendwann hatte er begriffen: Wenn jemand ihn hätte sehen wollen, wäre er gekommen.Wenn jemand ihn hätte retten wollen, hätte er es getan.Aber da war niemand. Und vielleicht war das auch ganz gut so. Denn wenn jemand gekommen wäre – was hätte er ihm sagen sollen?
»Ich weiß nicht, was ich getan habe. Aber es war schlimm. So schlimm, dass ich es nicht wissen darf.«?
Wenn es so war, dann war das keine Bitte um Vergebung. Das war ein Urteil. Er lebte nicht. Er wartete. Er wartete nicht auf Heilung oder auf die Gnade seiner Mitmenschen, die ihm sagten, dass er wieder leben darf. Er wartete auf die Rückkehr dessen, was hinter der schwarzen Wand des Vergessens lauerte.
Niklas wusste, dass etwas hinter dieser Wand lauerte. Etwas, dass herausgelassen werden wollte. Etwas... das ihn entweder zerstören oder heilen konnte. Doch bisher gab es keine Weg, um diese Wand einzureißen.
Manchmal kam ihm der Gedanke, dass er gar nicht echt war. Dass er Teil eines Traumes war, den jemand träumte, draußen irgendwo. Vielleicht in einem Krankenhaus. Vielleicht in einem Kinderzimmer. Vielleicht war er selbst dieser Jemand – nur in einem anderen Zustand. Ein anderer Niklas. Einer, der sich an alles erinnerte. An all das, was davor war.
Denn etwas war davor. Das wusste er. Dort, wo sein Bewusstsein aufhörte, war diese Wand. Eine schwarze Fläche, die bei jeder Berührung zurückwich, sich aber nicht durchdringen ließ.
Er erinnerte sich an Blut. Er erinnerte sich an Schreie.Aber er erinnerte sich an nichts davon mit Bildern. Er sah nichts vor seinem geistigen Auge. Aber er wusste, dass es da war. Wie wenn man unter Wasser ist und weiß, dass oben Luft ist. Aber man kommt nicht hoch.
Einmal hatte er gefragt, ob jemand gestorben sei.Die Schwester hatte gesagt:
»Du warst blutverschmiert, als sie dich gefunden haben. Das reicht doch, oder?«
Er hatte genickt und aufgehört zu fragen. Am Abend, wenn er das Licht löschte – selbstständig, wie gewünscht –, legte er sich wieder auf das Bett. Auf dem Rücken, Hände über dem Bauch, Augen an die Decke geheftet. Und dann wartete er.
Worauf? Das wusste er nicht. Nur, dass etwas kommen würde. Etwas, das längst da war. Etwas, das ihn beobachtete, sobald die Tür sich schloss. Etwas, das seine Stimme hatte, sein Gesicht, aber nicht sein Herz.
Dann kamen in der Nacht ab und zu Gedanken, die sich wie Erinnerungen anfühlten. Aber Niklas konnte nie einschätzen, ob es sich wirklich um Erinnerungen handelte, oder ob es Wunschträume gewesen waren. Er erinnerte sich dann an den Sommer, der nach Asphalt und glühender Luft roch. An die rissigen Gehwege der Vorstadtsiedlung, die Hitze, die zwischen den Häuserwänden flimmerte, als würde die Welt vibrieren. Er war vielleicht zehn oder elf gewesen. Alt genug, um allein mit dem Fahrrad zum Kiosk zu fahren. Jung genug, um dabei noch das Gefühl von Freiheit zu empfinden. Das Klirren der Speichen, der weiche Staub unter den Reifen – das alles war noch da, irgendwo in ihm, tief vergraben.
Es waren keine großen Erinnerungen, keine dramatischen Wendepunkte. Es waren kleine Dinge, wie Splitter in der Haut: der Geschmack von Brausepulver, das Prickeln auf der Zunge. Das Gefühl, barfuß über den Küchenboden zu laufen, während seine Mutter am Spülbecken stand, den Rücken gekrümmt, die Zigarette in der Linken. Sie drehte sich selten um, aber wenn sie es tat, war in ihrem Blick immer eine Mischung aus Müdigkeit und Melancholie.
Der Fernseher lief ab und zu mal im Hintergrund, aber Niklas interessierte sich nicht wirklich für das, was dort abgespielt wurde. Nachrichten, Spielshows, Sitcoms und ab und zu mal ein Spielfilm. Es war eine flimmernde Wand aus Geräuschen, die niemand wirklich wahrnahm. Sein Vater kam spät nach Hause. Trug Anzüge, die immer ein bisschen zu ordentlich wirkten für ihr kleines Leben. Er sprach nicht viel, aber wenn er sprach, hörte man zu. Niklas erinnerte sich an die Abende, an das Knacken der Eisschale im Glas, wenn sein Vater Whisky einschenkte. An das schwere Schweigen, das sich über den Esstisch legte, wenn irgendetwas nicht gesagt wurde. Es gab viele solcher Abende.
Er erinnerte sich, in der Schule zwar kein Außenseiter gewesen zu sein, aber er war auch nie jemand, der auffiel. Er gehörte zum durchschnittlichen Mittelfeld. Er hatte gelernt, sich still durch die Tage zu bewegen, wie ein Schatten durch Licht. Lehrer mochten ihn, weil er nicht störte. Mitschüler vergaßen ihn, sobald er außer Sicht war. Es war ihm recht so. In den Pausen setzte er sich lieber in die Nähe des Zauns und beobachtete die anderen. Weniger aus Neugier, als aus Vorsicht.
Einmal – daran erinnerte er sich besonders deutlich – hatte er einen Aufsatz über Angst schreiben sollen. Es war eine Hausaufgabe, nichts Besonderes. Aber er hatte sich damit Zeit gelassen, hatte Wörter gewählt, die er kaum selbst verstand. Der Lehrer hatte den Text am Ende der Stunde vorgelesen. Ohne seinen Namen zu nennen. Und alle waren still gewesen, als hätte jemand für einen Moment die Luft aus dem Raum gezogen. Danach hatte niemand mehr mit ihm geredet. Es war so, als hätten sie durch seine Worte erkannt, dass er es geschrieben hatte. Und nun war er der Merkwürdige.
Er wusste nicht mehr, worum es in dem Aufsatz genau ging. Nur, dass etwas darin wahr gewesen war. So wahr, dass es wehgetan hatte.
Manchmal glaubte er, dass sein Leben in zwei Teile zerbrochen war. Vorher und nachher. Nur dass das nachher aus Nebel bestand. Ein dichter, schwerer Nebel, in dem alles verschwand: Stimmen, Farben, sogar die Zeit.
Der Tag, an dem er in der Klinik aufwachte, markierte den Anfang von etwas Neuem. Aber es war kein Anfang, der sich wie ein solcher anfühlte. Es gab kein Licht; es gab kein Aufbruch. Eher ein Abbruch. Als hätte jemand den Film angehalten und ihn an eine Stelle gespult, die nicht vorgesehen war. Er war dreckig gewesen, Blutverschmiert und müde bis ins Mark. Das haben sie ihm jedenfalls gesagt. Und er fühlte sich leer. So unfassbar leer.
Man hatte ihm gesagt, er sei gefunden worden. Allein, mitten in der Nacht. Keine Tasche, kein Ausweis. Nur seine Kleidung – zerrissen, durchnässt – und seine Hände, die sich immer wieder zu Fäusten ballten, als wüssten sie etwas, das sein Kopf vergessen hatte. Seine Hosen waren verdreckt und an ein paar Stellen aufgerissen. Er hatte ein paar Schürfwunden, aber ansonsten war er unverletzt.
Die Ärzte sprachen von einem traumatischen Schock. Von einer Amnesie. Von dissoziativen Schutzmechanismen. Worte, die gut klangen, aber nichts erklärten.
Niklas erinnerte sich an keine Schreie. An keinen Schuss, an kein Messer, oder gar an einen Sturz. Da war einfach nichts. Nur daran, dass er aufgewacht war. In diesem weißen Raum, mit dem Summen der Leuchtstoffröhre über seinem Kopf und dem stechenden Geruch von Desinfektionsmittel in der Nase. Und seitdem wusste er auch nicht, ob seine Erinnerungen an eine rauchende Mutter, den trinkenden Vater im Anzug, oder den vom Lehrer vorgetragenen Aufsatz echt waren, oder ob es nur Produkte seiner Fantasie gewesen sind, die sich aufgrund seiner Amnesie in seinem Kopf breitgemacht hatten.
Seitdem vergingen die Tage wie auf einer Schiene. Und in manchen Nächten – wenn die Wände knisterten und der Wind durch das Lüftungsgitter zog – hatte er das Gefühl, dass sich hinter seinem Gedächtnis etwas regte, so wie ein Tier, das im Schlaf zuckt. Es fühlte sich so an, wie etwas das tot war, aber noch nicht vergessen wurde.
Die Nächte waren das Schlimmste. Nicht wegen der Dunkelheit – an die hatte er sich längst gewöhnt. Es war das was dazwischen war. Das Schweben, wenn die Schatten an den Wänden zu atmen begannen und die Zeit sich dehnte wie zäher Teer. Schlaf war ein flüchtiges Versprechen, das sich selten einlöste. Manchmal döste er ein, für wenige Minuten, taumelte in eine Leere, in der es keine Bilder gab. Ein Gefühl hinter den Augen, als würde etwas von innen gegen den Schädel klopfen.
Und wenn er dann aufschreckte, plötzlich, ohne Anlass, ohne Geräusch, lag er starr in seinem Bett, als hätte man ihn an die Matratze genagelt. Mit offenem Blick, die Decke vor sich, das Neonlicht aus dem Flur wie ein schmaler Riss an der Tür.
Die Gedanken kamen dann. Zuerst leise, wie der Beginn eins Regens.
»Was ist, wenn du etwas vergessen willst, das dich zerstören würde, wenn du es wüsstest?«
Er stellte sich diese Frage nicht zum ersten Mal. Sie war wie ein Mantra geworden. Ein langsames Ticken in seinem Schädel. Vielleicht war es nicht einmal eine Erinnerung, sondern ein Gefühl. Etwas, das ihm die Haut unter den Rippen aufscheuerte und ihn wachhielt.
Was, wenn hinter der Lücke in seinem Kopf nichts war als Gewalt? Er hatte Angst vor seinen eigenen Händen. Vor dem, wozu sie fähig gewesen waren – oder immer noch waren. Manchmal starrte er sie minutenlang an. Drehte sie langsam, betrachtete die Linien, die Hornhaut am Daumen, den kaum sichtbaren Schnitt an der rechten Handfläche. Und dann dachte er: Diese Hände haben geblutet. Aber wessen Blut war das?
Und dann fiel ihm wieder ein: Er hatte keine Familie. Zumindest keine, die kam. Keine Mutter, kein Vater, keine Verwandten, die ihn vermissten oder fragten, wie es ihm ging. Nur ein leerer Platz in seiner Akte, in seinem Leben. Selbst der Name Niklas fühlte sich manchmal fremd an. Als hätte jemand ihn ihm gegeben, weil ein Etikett nötig war. Es gab Tage, an denen war klar, dass er Niklas war. Und dann gab es welche, an denen glaubte er, nie einen Namen gehabt zu haben.
In einer der ersten Nächte – er war vielleicht drei Tage in der Klinik – hatte er geträumt. Es war einer dieser Träume, die mehr Geräusch waren als ein Bild. Metallisches Knirschen. Ein Aufschlag. Ein Atemzug. Jemand flüsterte einen Namen, aber es war nicht seiner. Auch seine Stimme war es nicht. Er war aufgewacht mit aufgerissenen Augen und einem Schrei im Hals, der sich nicht lösen wollte.
Seitdem wartete er auf das, was da kommen würde. Was es war, wusste er nicht. Vielleicht war es eine Wahrheit, die sich irgendwann offenbaren würde. Vielleicht war es ein Moment der Klarheit, in dem er verstehen würde, wer er war – oder was. Und manchmal dachte er, es wäre besser, wenn dieser Moment nie kam. Wenn das Nichts, das jetzt in ihm wohnte, ihn ganz verschluckte, bis nichts mehr von ihm übrigblieb, dann war das vielleicht besser. Aber dann hörte er wieder das Ticken.
Und er wusste: Etwas in ihm war wach. Und es wartete ebenfalls. Es wartete darauf, herausgelassen zu werden.
- Anna Heller -
Es war kurz nach acht Uhr morgens, als sie zum ersten Mal durch den Korridor ging. Ihre Schritte hallten nicht, obwohl der Boden aus Linoleum bestand. Sie waren weich gedämpft, fast lautlos. Als hätte sie geübt, unauffällig zu sein. In ihrer Bewegung lag nichts aufdringliches, nichts strenges. Sie bewegte sich, als gehörte sie längst hierher, als sei sie kein neues Gesicht, sondern ein vergessenes, das einfach wieder aufgetaucht war.
Niklas bemerkte sie zuerst durch das Glas der Tür im Gruppenraum. Er saß auf einem Platz am Tisch, den Rücken zur Wand, das Kinn in die Hände gestützt. Er saß zum ersten Mal seit Tagen wieder hier. Die anderen Patienten waren verstreut – manche lasen, andere starrten nur ins Leere. Niemand sprach.
Sie blieb kurz stehen, als sie an der Glastür vorbeiging. Ihre Augen glitten über die Gesichter im Raum, ohne zu verharren. Doch als sie Niklas sah, hielt sie kurz inne. Nicht lange. Nur einen winzigen Moment. Dann ging sie weiter, als sei nichts gewesen.
Er wusste nicht, warum es ihm auffiel. Vielleicht war es die Art, wie sie ging. Oder dass sie ihn nicht gemustert hatte wie die meisten Neuen. Dieses neugierige, vorsichtig-abschätzende Mustern, das in Wahrheit nichts anderes war als Angst. Sie hatte ihn nicht wie ein Fall betrachtet. Nicht wie ein Patientenakten-Konstrukt mit einem Etikett. Eigentlich hätte sie auch irgend eine Besucherin sein können. Aber sie trug den Kittel. Den hatte sie wahrscheinlich schon bekommen, als sie die Stelle angenommen hatte.
Später, in der Teambesprechung, wurde sie offiziell vorgestellt. Dr. Anna Heller, Psychologin. Fünf Jahre Erfahrung in einem anderen Zentrum. Schwerpunkt: junge Erwachsene mit dissoziativen Störungen. Ruhig. Engagiert. Nicht auf den Mund gefallen, aber auch keine, die sich in den Vordergrund drängte. Sie trug keine auffällige Kleidung, kein Make-up. Ihre Haare hatte sie zu einem schlichten Zopf gebunden. Es gab nichts an ihr, woran man sich hätte festhalten können – außer an der Art, wie sie schaute. Direkt, aber nicht fordernd. Wach, aber nicht unruhig.
»Ich übernehme die Schicht auf Station A«, sagte sie, während ihre Finger ruhig ineinander verflochten waren. »Ich möchte mir Zeit nehmen, um jeden Patienten kennenzulernen.«
Niemand sagte es laut, aber Niklas war der Grund, warum sie hier war. Das wussten alle. Er war der Schatten unter dem Teppich, das Thema, um das man herumlief. Jeder hier wusste, dass es mit ihm kein Schema gab, keine Fortschritte, keine Rückfälle – nur eine merkwürdige Konstanz. Einen Stillstand mit dem es seit drei Jahren keinen Fortschritt gab. Und das beunruhigte die Klinikleitung mehr als jeder Wutanfall, jedes Trauma-Gestammel. Stillstand konnte auch ein Zeichen von Deckung sein. Vielleicht wollte er es auch einfach nicht anders. Aber selbst das musste man herausfinden und untersuchen.
Anna war sieben, als sie zum ersten Mal verstand, dass Menschen unterschiedlich mit Schweigen umgehen.
Ihr Vater war jemand, der es benutzte wie eine Mauer. Wenn er schwieg, war es ein Raum ohne Türen, ohne Fenster. Ihre Mutter dagegen machte aus dem Schweigen ein Netz – feinmaschig, vibrierend. Alles konnte darin hängenbleiben: ein Blick, ein Seufzen, ein halber Satz.
Anna lernte früh, in diesen Zwischenräumen zu lesen. Es erschien ihr irgendwann natürlich zu sein. Sie war kein auffälliges Kind. Kein übermäßig stilles, kein besonders lautes. Eher das Mädchen, das die Lehrerin vergaß, wenn sie den Raum zählte. Dasjenige, das in der hintersten Reihe saß, die Schuhe ordentlich unter dem Stuhl, die Hände gefaltet, der Blick auf das Gesicht der anderen gerichtet.
Menschen faszinierten sie. Sie versuchte mit ihren Beobachtungen ein System zu entschlüsseln, dessen Regeln niemand je zu Ende erklärt hatte.
Nach dem Abitur wusste sie lange nicht, wohin mit sich. Psychologie war eine Idee, Medizin eine andere. Am Ende hatte sie sich für die Psychologie entschieden. Sie wollte die Menschen nicht nur verstehen, sie wollte ihnen helfen mit dem klar zu kommen, was sie selbst nicht verstanden.
Sie begann in einer Akutpsychiatrie für Erwachsene. Zwei Jahre lang wusch sie Menschen, die ihren eigenen Namen vergessen hatten. Sie beruhigte Frauen, die glaubten, ihre Kinder seien aus Glas, und reichte Männern die Hand, die sich weigerten, noch einmal zu essen.
Sie sah, wie Medikamente halfen, wie sie Menschen zudeckten wie feuchte Tücher und wie sie aus Menschen Zombies machten. Menschen, die zwar noch atmeten, aber keinen Bezug mehr zur Außenwelt hatten. Sie lernte, wie wichtig ein geregelter Tagesablauf war. Und wie wenig er bedeutete, wenn ein Mensch in sich selbst unterging.
Mit der Zeit spezialisierte sie sich auf die Arbeit mit Jugendlichen. Es war keine bewusste Entscheidung. Eher eine Bewegung, wie Wasser sie nimmt, wenn man es in eine geneigte Schale gießt. Es musste irgendwann einfach passieren.
Auf der Jugendstation lernte sie, was es heißt, sich nicht nur mit einer Krankheit, sondern auch mit der Wut eines Lebens auseinanderzusetzen. Dort waren nicht nur Symptome und Schmerz, sondern auch Widerstände, Schuldgefühle und Entwurzelungen zu bedenken.
Anna hatte nie das Bedürfnis, jemanden zu retten. Sie wollte schlicht helfen. Für sie bestand ein Unterschied darin, jemandem zu helfen, oder ihn zu retten. Sie hatte auch nie den Drang, ihnen zu erklären, warum sie so waren, wie sie waren. Aber sie konnte bleiben und sie aushalten. Auch wenn sie nur schwiegen. Vor allem, wenn sie nur schwiegen.
Mit neunundzwanzig wechselte sie in eine Einrichtung, die auf dissoziative Störungen spezialisiert war. Sie hatte kein besonderes Interesse an diesem Krankheitsbild. Sie hatte gemerkt, dass dort ihre Geduld eine andere Bedeutung bekam.
Dort traf sie auf Jugendliche, die von der Gesellschaft weggesperrt worden waren, um sich vor ihnen und sich selbst zu schützen. Es waren Menschen, in denen Stimmen wohnten, die keine Namen hatten und Erinnerungen, die wie tote Winkel funktionierten.
Anna arbeitete dort fünf Jahre. Sie wurde zur Konstante für viele. Sie war ein stiller Pol. Für manche sogar eine Freundin. Aber sie ließ sie niemals zu nah an sich ran. Sie war jemand der da war, wenn alle anderen schon den Raum verlassen hatten.
Und als man ihr die Stelle in der neuen Klinik anbot – mit dem Hinweis, dass es sich um einen schwierigen, langjährigen Fall handelte –, zögerte sie. Sie hatte keine Angst. Sie wusste, dass mit manchen Patienten einfach kein Fortschritt möglich war. In solchen Fällen half nur Nähe. Oder wenigstens: Nicht Allein zu sein.
Sie entschied sich letztendlich, es zu versuchen. Nicht, weil sie glaubte, dass sie etwas verändern könnte. Sondern weil sie verstand, wie viel es manchmal bedeutete, einfach da zu sein, ohne zu werten.
Anna kam nicht mit der Vorstellung in die Klinik, dass man Menschen heilen kann. Sie wusste, dass viele Wunden nicht verschwinden. Dass es nicht immer eine Ursache und eine Lösung gibt. Aber sie wusste, dass es möglich war, einem anderen Menschen das Gefühl zu geben, gesehen zu werden. Dass man niemanden retten muss, um ihm das Gefühl zu geben, dass sein Schmerz ein Echo hat.
Sie mochte keine schnellen Entscheidungen. Sie stellte wenige Fragen. Und sie ließ sich nicht erschüttern von plötzlichen Ausbrüchen, Schweigen oder Misstrauen.
Vielleicht war das ihre Gabe. Das Zuhören, das Verstehen und die Geduld, die es erforderte, diese Patienten zu betreuen.
Und vielleicht war genau das der Grund, warum sie jetzt, in dieser seltsam stillen Klinik, das erste Mal Niklas Kreklow gegenüberstand.
Sie wusste nichts über ihn. Noch nicht. Nur, dass er seit drei Jahren hier war. Dass er schweigsam war, aber nicht stumm. Dass er Dinge vergessen hatte, über die niemand sprechen wollte. Aber sie wusste auch: Man muss nicht alles verstehen, um zuzuhören.
Und manchmal beginnt Nähe nicht mit einer Frage, sondern damit, dass man neben jemandem sitzt und nichts sagt.
Am dritten Tag trat sie an seinen Tisch. Er hatte sie bemerkt, lange bevor sie sprach. Ihre Schritte waren anders. Kein hastiges Trippeln wie bei Schwester Marion. Kein schlurfendes Schlappen wie bei Uwe, dem alten Nachtpfleger. Es war fast so, als hätte sie keinen Boden gebraucht, um sich zu bewegen.
»Darf ich mich setzen?«
Er sagte nichts. Er nickte nicht. Sah sie nur an.
Sie setzte sich trotzdem. Schrieb nicht. Beobachtete nicht mit Block und Stift. Nur ihre Hände lagen vor ihr, gefaltet. Wie ein Versprechen, nichts überstürzen zu wollen.
»Ich bin Anna. Ich arbeite seit ein paar Tagen hier.«
Niklas sagte immer noch nichts. Seine Augen blieben an ihr hängen, suchten nach dem Bruch, der irgendwann bei jedem kam. Dem einen Moment, in dem Mitleid durchblitzte, oder Angst. Und dann dieser Ausdruck, der sagte: Du bist krank. Ich weiß es, und du weißt es auch.
Aber er fand ihn nicht. Stattdessen war da nur Wärme. Es war nicht kitschig. Es war kein aufgesetztes Lächeln, das nur mit dem Mund vollzogen wurde und bei dem die Augen ausdruckslos blieben. Ihre Präsenz war anders. Sie war einfach nur da. Es schien für Niklas nicht so, als würde sie eine Rolle spielen oder nur für eine Aufgabe hier sein. Sie war einfach nur hier.
Er senkte den Blick.
»Ich rede nicht viel.«, murmelte er schließlich.
»Das ist in Ordnung.«, sagte sie leise. »Ich höre trotzdem zu.«
Sie blieb etwa zehn Minuten. Fragte nichts über seine Vergangenheit. Keine Diagnosen, keine Symptome. Nur kleine Dinge. Ob das Licht in seinem Zimmer zu hell sei. Ob das Essen schmecke. Ob er manchmal Musik höre. Ganz normale, langweilige Fragen.
Und er, zu seiner eigenen Überraschung, antwortete. Nicht ausführlich. Nicht freiwillig. Aber immerhin. Zwei, drei Sätze. Mehr nicht.
Als sie ging, blieb ihr Platz leer. Er sah die Stelle lange an. Zum ersten Mal seit Wochen hatte etwas seine Aufmerksamkeit durchbrochen. Leise, wie ein Windhauch unter der Tür. Und als er in der Nacht wieder wach lag, an die Decke starrend, spürte er, dass etwas anders war. Es war kein Gedanke, der sich formte. Auch ein Bild stellte sich nicht ein. Es war einfach dieses Gefühl, als hätte jemand in einem abgedunkelten Raum ein Streichholz angezündet.
In der Klinik herrschte kein Lärm. Kein Stimmengewirr auf den Gängen, kein metallisches Klappern von Essenswagen, kein dumpfes Rufen aus den Zimmern. Es war eine dieser Einrichtungen, in denen alles absorbiert wurde – Geräusche, Bewegungen, Energie. Wie in einer Bibliothek, in der man vergessen hatte, dass es Bücher gibt.
Anna mochte diese Stille, weil sie ehrlich war. Die Patienten, die still waren, wollten still sein. Sie wurden nicht gezwungen.
Station A war keine gewöhnliche Station. Hier wurde nicht sediert und abgefertigt. Hier sollte beobachtet, begleitet und – wenn möglich – integriert werden. Viele der Patienten waren schon lange hier. Fälle, die in anderen Einrichtungen als „austherapiert“ galten. Anna wusste, was das bedeutete. Man hatte aufgehört, nach einer möglichen Hilfe zu suchen.
Ihr Arbeitsalltag begann früh. Sie war jemand, die ihre Rituale hatte: dieselbe Pendelstrecke, dieselbe Thermosflasche mit Kaffee, dieselbe Art, ihren Namen an der Pforte zu sagen.
»Guten Morgen. Anna Heller, Frühdienst.«
Und dann trat sie durch die Tür, in das andere Tempo. Auf dieser Station ging es nicht um Pflegeschlüssel oder Dokumentationsdruck. Hier war Zeit ein Werkzeug. Und Geduld eine Qualifikation.
Anna hatte in ihrer Ausbildung gelernt, wie man Verbände wechselt, wie man Medikamentengaben dokumentiert, wie man Zwischenfälle nach ICD-Schlüssel einträgt. Aber was sie hier brauchte, hatte ihr niemand beigebracht.
Wie man sich neben einen Jugendlichen setzt, der seit Tagen oder Wochen kein Wort gesagt hat. Wie man erkennt, ob ein kurzes Zucken in der Schulter ein Zeichen von Anspannung oder Vertrauen ist. Wie man damit lebt, dass es vielleicht nie eine Antwort gibt.
Sie hatte gelernt, wie wenig es manchmal braucht, um etwas auszulösen. Eine Geste, ein Geruch, ein Wort. Und wie sehr man aufpassen musste, damit nicht das Falsche ans Licht kam.
Die Jugendlichen hier waren wie Eisschollen: ruhig an der Oberfläche, unberechenbar in der Tiefe. Und Anna bewegte sich zwischen ihnen, Schritt für Schritt, mit dem Wissen, dass alles, was zu schnell ging, zerbrechen konnte.
Sie machte sich keine Illusionen. Viele ihrer Kolleginnen und Kollegen blieben ein Jahr, vielleicht zwei. Die, die dachten, sie könnten etwas bewegen, gingen oft zuerst. Enttäuscht, aufgerieben, leer. Anna blieb.
Sie glaubte nicht an Durchbrüche. Sie glaubte an Kontakt. An minimale Bewegungen. Daran, dass ein einziger Blick am richtigen Tag mehr sagen konnte als hundert Therapiestunden. Und manchmal, ganz selten, glaubte sie an Nähe. Nicht als Ziel, sondern als ein Zustand der Vertrauen aufbauen konnte.
Sie führte ein Notizbuch. Kein offizielles – das stand im Dienstcomputer, ordentlich verschlüsselt, anonymisiert, codiert. Ihr Notizbuch war für Zwischentöne.
»P. sieht mir seit zwei Tagen nicht mehr in die Augen, aber sie hebt die Schultern, wenn ich Guten Morgen sage.
M. hat heute das Messer mit der linken Hand gehalten, obwohl sie Rechtshänderin ist.
N.: Bewegungsmuster starr. Reaktion auf Geräusche unauffällig. Augenmuskulatur kontrolliert. Sprachverhalten: minimal. Stimmung: nicht lesbar. Eindruck: zurückgezogen, aber nicht feindlich.«
N. – Niklas. Er war der Grund, warum sie eigentlich hergekommen war. Aber sie wollte auch die anderen Patienten betreuen. Mit nur einem Patienten war sie nicht ausgelastet.
Aber Niklas sollte ihr Hauptaugenmerk gelten Die Leitung suchte jemanden, der nicht auf Erfolge hoffte, aber sich von Misserfolgen nicht unterkriegen ließ.
Anna hatte seinen Namen gelesen, bevor sie ihm begegnet war. Seine Akte war lang. Das lag aber nicht an der Vielzahl von begangenen Taten, sondern an der Dauer seines Aufenthalts hier in der Klinik.
Er war erst siebzehn, aber in dieser Welt war das viel. Natürlich war Anna mehrere Jahre älter als er, aber dennoch hatte sie bei ihrem ersten Treffen nicht das Gefühl, einem Jugendlichen gegenüberzusitzen.
Seine Haltung war kontrolliert, seine Bewegungen präzise. Kein Zittern, kein Zucken. Alles schien wie einstudiert. Nichts mechanisches. Viel schlimmer: es war bewusst. Als hätte er sich selbst gezähmt.
Anna wusste, dass der Auftrag war, ihn zu beobachten. Ihn kennenzulernen. Vielleicht würde es ihr gelingen, einen Zugang zu ihm zu finden. Aber sie würde nichts forcieren. Sie hatte schon zu viele gesehen, die sich in andere hineinlehnten und mit dem Gewicht ihrer Erwartungen alles zerstörten. Sie würde warten. Auf einen Blick. Eine Veränderung in seiner Stimme. Einen Satz, der nicht in ein Schema passte.
Sie wusste, dass Vertrauen nicht mit einem Lächeln beginnt. Sondern manchmal mit einem Satz, wie zum Beispiel:
»Ich bleib noch ein bisschen, wenn das okay ist.«
Am nächsten Tag war der Raum in warmes Licht getaucht, das durch die halb geöffneten Lamellen der Fenster fiel und sich in schrägen Streifen über den Boden zog. Der Fernseher an der Wand war stumm geschaltet, eine Talkshow lief, doch niemand sah hin. In einer Ecke schlief ein Patient mit offenem Mund in einem der speckigen Ohrensessel, während gegenüber ein junger Mann nervös an einem Puzzle arbeitete, das ausgerechnet ein Bild vom Eiffelturm zeigte – nachts, in silberblauem Glanz.
Anna saß still an einem der Tische, auf dem eine leere Kaffeetasse stand. Der Raum roch nach Desinfektionsmittel, staubiger Heizungsluft und einem Hauch von Instantkaffee. Sie trug die dunkelblaue Hose und das grauweiße Oberteil der Pflegerinnen und hatte ihre braunen Haare locker zu einem Knoten gebunden. Ihre Hände ruhten gefaltet vor ihr, die linke leicht verkrampft, wie immer, wenn sie sich auf eine Begegnung vorbereitete.
Niklas Kreklow kam wortlos herein. Kein Blick zu den anderen, kein Zögern, kein Muster in seinem Gang. Er bewegte sich ruhig, fast vorsichtig, als wolle er keine Spuren hinterlassen. Er trug einen dunklen Pullover, die Ärmel bis zu den Handgelenken gezogen. Die dunklen Haare waren sauber, aber unfrisiert. Seine Augen, blassgrau und schmal, streiften kurz durch den Raum, bevor sie sich auf Anna richteten – nicht abschätzend, oder neugierig. Er registrierte sie lediglich mit einem Blick.
Dann setzte er sich ihr gegenüber, als wäre es längst abgesprochen. Anna lächelte kaum merklich.
»Guten Morgen, Niklas.«
Er antwortete nicht sofort. Seine Hände ruhten still auf dem Tisch. Schließlich sagte er:
»Du bist wieder hier.«
»Ja«, sagte Anna. »Wir werden uns öfter sehen.«
Niklas nickte, langsam.
»Die meisten halten nicht lange durch.«
»Ich hab vor, zu bleiben.«
»Warum?«
Anna nahm sich einen Moment.
»Weil ich glaube, dass es Menschen wie dich gibt, die man nicht aufgeben sollte.«
Niklas sah sie an, für eine Sekunde zu lange. Dann richtete er den Blick auf die Tischplatte.
»Manchmal will ich, dass mich jemand aufgibt. Damit ich mich nicht mehr erinnern muss, dass ich existiere.«
Es war keine Provokation. Keine Suche nach Mitleid. Es war einfach nur eine Feststellung – so klar und hart wie ein Kieselstein in der Brust.
Anna nickte.
»Ich weiß, dass dieser Ort schwer auszuhalten ist. Aber du musst ihn nicht allein aushalten.«
Wieder ein stilles Nicken. Dann griff Niklas nach dem Kaffeebecher vor sich, der leer war. Er sah hinein, als könne darin eine Antwort verborgen sein.
Anna beobachtete ihn. Wie er wirkte, wenn er schwieg. Wie er den Raum zu fühlen schien. Sie bemerkte, dass er nichts in sich hineinwarf – keine Emotionen, keine Worte, kein Lächeln. Er trug alles an der Oberfläche, als eine Art Schutzpanzer, der durchsichtig war und dennoch unüberwindbar.
»Du bist nicht neugierig, warum ich hier bin?« fragte Niklas leise.
»Neugier ist eine Unsitte der Menschen. Aber, wenn du es erzählen willst, dann höre ich dir sehr gerne zu.«
Er zuckte mit den Schultern.
»Ich weiß es selbst nicht so genau. Angeblich… habe ich etwas getan. Aber ich erinnere mich nicht daran. Sie sagen, ich wurde blutverschmiert gefunden. In einer Straße in der Stadt. Ich saß nur auf dem Boden. Danach – leer. Wie ein Filmriss. Seitdem bin ich hier.«
Anna antwortete nicht sofort. Es war nicht der Moment, um etwas zu sagen. Stattdessen ließ sie eine Stille zu, in der Niklas weitersprechen konnte, wenn er wollte.
Nach einer Weile stand er auf, als wäre die Szene mit der neuen zu ende gespielt
»Vielleicht morgen wieder.«, sagte er. Und ging.
Anna sah ihm nach. Es war kein Rückzug. Es schien, als sei es ein vorsichtiger Schritt zurück in ein inneres Dunkel, das nicht feindlich war, sondern dass ihn beschützte.
Sie schrieb später nichts darüber in den Bericht. Kein Wort über seine Bemerkung, kein Urteil über seinen Zustand. Stattdessen notierte sie:
»Niklas Kreklow wirkt stabil. Kommunikationsbereit. Mögliches Vertrauensfenster erkennbar.«
Aber das stimmte nur zur Hälfte. Denn was sie eigentlich gespürt hatte, ließ sich nicht in Formulare gießen: Niklas war kein gebrochener Mensch. Er war jemand, der sich selbst verlor – mit jeder Minute, in der er nicht wusste, warum. Und sie war hier, um mit ihm zu gehen. So weit er sie ließ.
- Der Patient -
Dr. Natascha Ebling trat frühmorgens durch den Korridor des Westflügels. Der Lichtstreifen, der aus dem Fenster auf den Boden fiel, schnitt ihr in den Weg, doch sie hielt nicht inne. Ihre Schritte waren gleichmäßig, ihre Bewegungen ruhig, beinahe bedächtig. In ihrer rechten Hand hielt sie eine Ledermappe, alt, abgenutzt, aber gepflegt. Links balancierte sie einen Becher schwarzen Kaffees, dem ein zarter, bitterer Duft entstieg – ihr täglicher Begleiter zwischen Tür und Entscheidung.
Die Klinik war leise in diesen frühen Stunden. Noch vor den Visiten, vor dem Frühstück, vor dem Lärm des Tages. Es war die Zeit, in der das Gebäude atmete und nicht die Menschen darin. Diese Stille war ihr vertraut, beinahe kostbar. Sie war es, die ihr Raum gab um sich daran zu erinnern, warum sie hier war.
Nicht, weil sie musste. Sondern weil sie es wollte. Natascha Ebling war 42 Jahre alt, Mutter von Zwillingen, verwitwet seit etwas über vier Jahren. Ein unfallbedingter Tod – ein betrunkener Fahrer, eine regennasse Straße, ein Tag, der sich in ihr eingebrannt hatte wie ein schlecht verheilter Schnitt. Aber sie trug ihn nicht wie eine Wunde. Sie hatte ihn innerlich eingerahmt, wie man ein Foto auf dem Kaminsims eines Hauses aufstellt, das man nicht verlässt.
Sie war keine kalte Frau. Im Gegenteil. Doch sie wusste, wie man Distanz hielt, wenn Nähe zu viel forderte.
Vor Raum 113 blieb sie stehen. Die Nummer war auffällig schlicht: Zimmer 13 auf Station 1. In vielen Kliniken hätte man sie übersprungen, aus Aberglauben oder Rücksicht auf Patient und Personal. Hier nicht. Hier hatte jeder seine Nummer. Und Niklas Kreklow war Patient 13. Genauer gesagt natürlich Patient 21-1-13; aufgenommen in der Klinik im Jahr 2021 auf Station 1 in Zimmer 13.
Sie klopfte nicht. Die Tür war nicht verschlossen, nur angelehnt. Sie trat ein, ließ die Tür offen. Wer den Raum betrat, sollte ihn nicht gleich wieder verschließen müssen.
Niklas saß auf seinem Bett, angezogen, die Füße fest auf dem Boden, die Hände ineinander verhakt. Sein Blick ging nicht zu ihr, sondern durch sie hindurch, als wäre sie ein Nebelbild, das vergehen würde, wenn er nur lang genug nicht hinsehen würde.
»Guten Morgen, Niklas.«
»Morgen.«
Seine Stimme war flach, aber nicht feindlich. Er leistete keine Widerstand. Er hatte bereits resigniert. Wie bei einem Schüler, der sich auf die Frage vorbereitet hat, aber weiß, dass die Antwort keinen Unterschied mehr macht.
Dr. Ebling stellte den Kaffeebecher auf den kleinen Tisch neben seinem Bett.
»Ich dachte, vielleicht brauchst du einen echten Kaffee. Nicht das braune Spülwasser aus dem Automaten im Aufenthaltsraum.«
Er sah den Becher an. Dann sie.
»Was kostet mich das?«
Ein kurzes, beinahe müdes Lächeln huschte über ihr Gesicht.
»Gar nichts. Ich hatte einfach Lust, jemanden einzuladen.«
Er sagte nichts dazu. Aber sie sah, dass er es annahm – nicht den Kaffee, sondern die Geste. Das war genug. Sie setzte sich auf den Stuhl neben der Tür. Nah genug, um gehört zu werden, weit genug, um ihn nicht zu bedrängen.
»Ich möchte ehrlich mit dir sprechen, Niklas«, sagte sie. »Heute mal nicht als deine Therapeutin, sondern lieber von Mensch zu Mensch.«
»Menschen reden zu viel.«
»Stimmt«, sagte sie. »Aber manchmal lohnt es sich, zuzuhören.«
Er sah sie an. Zum ersten Mal wirklich. Sein Blick war nicht scharf, nicht prüfend. Eher still. Fragend, ohne eine Frage zu stellen.
»Ich habe deine Akte gelesen. Deine Protokolle. Deine Testergebnisse. Deine Gespräche mit Kollegen. Und trotzdem weiß ich auch nach drei Jahren nicht, wer du bist. Und das, Niklas, ist das Einzige, was mich interessiert.«
Er ließ die Hände sinken.
»Ich weiß selbst nicht, wer ich bin. Nicht mehr seit...«
Er brach ab. Ein leises Geräusch im Flur, vielleicht ein rollender Wagen oder ein quietschender Schuh, lenkte ihn kurz ab. Dann richtete er den Blick wieder auf sie.
»Sie sagen, ich war blutverschmiert. Wortlos in einer Ecke. Irgendwo im Nirgendwo. Dass ich jemanden verletzt habe. Vielleicht... getötet. Aber ich erinnere mich nicht. Ich sehe kein Bild. Kein Messer. Keine Pistole. Kein Gesicht.«
»Das ist okay.«, sagte sie. »Manchmal schützt uns das Gehirn vor Dingen, die wir nicht ertragen könnten. Oder noch nicht.«
»Und dann? Irgendwann kommt alles zurück?«
»Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht verändert es sich, mit der Zeit. Erinnerungen sind keine festen Bilder. Sie sind wie Rauch. Man kann ihn greifen, aber nie festhalten.«
»Und wenn das, was ich getan habe... zu viel ist? Wenn es besser ist, es nie zu wissen?«
Natascha Ebling antwortete nicht sofort. Dann sagte sie leise:
»Ich glaube, dass jeder Mensch eine Chance verdient. Auch der, der etwas Unverzeihliches getan hat. Weil es einen Unterschied macht, ob er bereut oder nicht. Und weil Reue ein Weg sein kann. Es ist kein Freispruch... natürlich nicht. Aber ein Anfang.«
Niklas lachte leise, bitter.
»Klingt wie ein Kapitel aus einem Ethik-Lehrbuch.«
»Vielleicht. Aber ich glaube daran. Sonst wäre ich nicht hier.«
Sie ließ eine Pause. Dann stand sie auf.
»Ich werde dich nicht drängen, Niklas. Aber ich werde auch nicht aufgeben.«
Sie ließ den Becher stehen, warf ihm noch einen letzten Blick zu und verließ das Zimmer so leise, wie sie gekommen war.
Niklas sah ihr nicht nach. Er drehte seinen Kopf hoch zum milchigen Fenster, um die Wärme der Sonnenstrahlen einzufangen, schloss die Augen und gab einen Seufzer von sich.
Der Gang war lang, das Licht weich. Keine grellen Neonröhren, keine sterile Kälte wie in herkömmlichen Kliniken. Die Flure dieser Klinik wirkten eher wie Korridore eines modernisierten Sanatoriums. Holzvertäfelungen, schlichte Gemälde, dazwischen vereinzelte Wanduhren mit leise tickenden Sekundenzeigern – das langsame Herz dieser Einrichtung. Nichts sollte hier laut sein. Nicht die Räume. Nicht die Menschen. Und schon gar nicht die Entscheidungen.
Natascha Ebling schritt langsam, ihre Ledermappe erneut unter dem Arm. Sie kannte diesen Ort in- und auswendig. Hatte ihn mitgestaltet, nicht nur baulich, sondern konzeptionell. Er war ihr Projekt. Ihr Risiko. Ihre Vision.
Und doch – während sie nun durch den südlichen Verbindungstrakt ging, vorbei an der geschlossenen Station B, die extra B genannt wurde und nicht Station 2 oder 3, damit sie sich von der normalen Station schon vom Namen her unterschied. Als sie an einer der Pflegekräfte vorbeikam, die ihr kurz zunickte, spürte sie das Gewicht einer Frage, die sich seit Tagen nicht mehr abschütteln ließ. Ist das hier wirklich der richtige Weg?
Sie hatte die Akte nicht nur gesehen, sie konnte sie fast fehlerfrei vortragen. Sie wusste alles von Niklas Kreklow, seit er hier hergebracht worden war. War es wirklich der Zeitpunkt, etwas anderes auszuprobieren? Etwas, dass sie selbst ausgearbeitet und vorbereitet hatte? Und was wäre das Ergebnis? Wird er entlassen? Gesund, stabil, hoffnungsvoll. Oder bleibt er hier? Zerschlagener als zuvor.
In ihren Händen lag eine Methode, ein System, ein tiefgreifender Eingriff in das psychische Gefüge eines Menschen. Etwas, das helfen konnte, ja – aber nicht musste. Und es gab auch keine Garantien. Der Mensch und vor allem sein Gehirn war schließlich kein Algorithmus, kein Rechenmodell, keine Formel. Sondern ein Zusammenschluss aus Erinnerungen, Traumata, Träumen, Taten und Schutzmechanismen.
Und Niklas Kreklow? Er war irgendwie alles auf einmal und nichts Greifbares zugleich. Ein junger Mann mit einem zerschnittenen Gedächtnis, einem verlorenen Selbstbild, einer unsichtbaren Schuld. Vielleicht unschuldig, schuldig, oder beides.
Der Verdacht, dass er jemanden verletzt hatte – dass er in einem Zustand gefunden worden war, der auf Eskalation, auf Gewalt, auf tiefgreifende psychische Zerrüttung schließen ließ – war nie abschließend bestätigt worden. Die Untersuchungen verliefen im Sand. Keine Anzeige. Keine Familie. Niemand, der nach ihm fragte. Keine Spuren – außer denen an ihm selbst.
Und das machte ihn zum perfekten Kandidaten. Sie blieb vor dem verglasten Therapieraum stehen. Der Raum war leer. Zwei bequeme Sessel, ein niedriger Tisch, eine schlichte Topfpflanze in der Ecke. Kein Tonbandgerät. Keine Kamera. Nur Worte und Stille, wenn dort gearbeitet wurde.
Vor sechs Monaten hatte ein anderer junger Mann hier gesessen. Auch er ein Fall mit hohem Risiko. Auch er ohne soziale Anbindung. Damals hatte es funktioniert – für drei Wochen. Dann war der Rückfall gekommen. Nicht heftig, nicht zerstörerisch. Nur traurig. Ein langsames Zurückgleiten in die Dunkelheit.
Natascha Ebling erinnerte sich an das Nachgespräch. An die stille Stimme des Patienten:
»Ich war kurz jemand. Dann wurde ich wieder nichts.«
Sie schloss die Augen. Nur für einen Moment. Und dann ging sie weiter. Die Stahltür zu ihrem Büro war schlicht, grauweiß gestrichen. Keine Namensplakette. Nur ein unscheinbarer Zahlencode, den sie eintippte. Der Türsummer surrte. Sie trat ein.
Drinnen herrschte eine penible Ordnung. Keine sterile Leere, aber auch keine persönliche Überfrachtung. Ein heller Schreibtisch, ein ergonomischer Stuhl, ein bodentiefes Bücherregal, das von klassischer Psychologie über Neurowissenschaften bis hin zu moderner Trauma-Therapie reichte. Auf dem Schreibtisch stand ein einzelnes gerahmtes Bild der Zwillinge, lachend im Herbstlaub. Sie hatte es so aufgestellt, dass es außer ihr niemand sehen konnte, der sich im Raum befand. Es wirkte fast so, als würde sie sie nur für sich behalten wollen, ohne dass jemand anderes Notiz von ihnen nahm.
Sie setzte sich, legte die Ledermappe ab, faltete die Hände. Dann öffnete sie die oberste Schublade.
Darin befand sich ein elektronisch gesicherter Ordner auf einem USB-Stick. Kein Papier. Nur Daten. Auswertungen. Diagnosen. Simulationen. Unterlagen für die Therapie. Jener Therapie, die sie selbst mitentwickelt hatte. Jener, die mehr versprach als jede konventionelle Behandlung. Und mehr riskierte. Doch noch war nichts passiert. Noch war Niklas Kreklow nicht involviert. Noch hatte sie Zeit, ihre Entscheidung zu überdenken.
Aber das Fenster wurde kleiner. Jeden Tag. Der Aufsichtsrat wartete. Niklas lebte seit 3 Jahren in der Klinik und niemand wusste wirklich, warum. Er kostete Geld und sein Fall lieferte keinerlei Ergebnisse, weil niemand wusste, warum er sich nicht erinnerte; geschweige denn an was. Und was würde passieren, wenn die Erinnerungen wieder da wären und seinen Zustand nur verschlimmern?
Und doch: in ihr nagte etwas. Es war keine Angst, sondern ein Verantwortungsgefühl. Die echte, stille, oft übersehene Schwester der Ethik. Die Stimme, die fragte: Nur weil wir es können – sollen wir es auch tun?
Sie ließ die Finger über das Touchpad gleiten. Ein letzter Klick – und der Bildschirm wurde dunkel.
Nicht heute. Noch nicht. Die Dunkelheit des Bildschirms spiegelte ihr Gesicht. Linien, die sie nicht kannte, hatten sich in den letzten Jahren dort festgesetzt – tiefer als die Falten der Zeit. Es waren Linien von Entscheidungen, Verantwortung und Kummer.
Natascha Ebling lehnte sich zurück, der Stuhl knarzte leise. Ihre Hände lagen nun lose auf der Sessellehne, und für einen Moment ließ sie sich treiben – nicht von Terminen, nicht von Forschung, nicht von ihrer Rolle als Klinikleiterin. Sondern von einem Gedanken, der sich nicht abschütteln ließ, seit sie Niklas Kreklow zum ersten Mal gesehen hatte.
Was verbirgt sich in diesem Jungen? Nicht in seinem Verhalten, nicht in seinen Akten, nicht in den Diagnosen, die man ihm irgendwann übergestülpt hatte wie zu große Kittel. Sondern in ihm selbst. In jenen Schichten, die tiefer lagen als Sprache, tiefer als Erinnerung, vielleicht sogar tiefer als Schmerz.
Er war kein typischer Fall. Er passte in kein Raster. Und genau das machte ihn so gefährlich und gleichzeitig so verletzlich.
Er hatte sich nicht gegen das Aufnahmegespräch gewehrt. Nicht gegen die Testreihen. Nicht gegen die stummen Beobachtungen durch das Einwegglas. Aber er hatte auch nichts preisgegeben. Keinen Funken Wahrheit, keine Andeutung von dem, was davor war. Als hätte man ihn aus der Zeit gerissen und direkt in diese Klinik gesetzt. Körperlich war er gesund, geistig scheinbar stabil. Und doch leer. Wie ein Raum, in dem jemand das Licht gelöscht hatte und die Fenster zugeschraubt.
Sie erinnerte sich an den ersten Blickwechsel. Es war, als würde er einfach durch sie hindurchsehen und auf die Wand hinter ihr starren.
Und das war es, was sie nicht losließ. Als hätte Niklas Kreklow selbst aufgehört, Fragen zu stellen. Als hätte er aufgehört, sich als jemanden zu betrachten, der etwas wissen darf. Etwas fühlen darf. Jemand, der ein menschliches Wesen ist.
Natascha Ebling stand auf und ging zum Fenster. Draußen glitzerte der Frost in den Baumkronen wie zerbrochenes Glas. Die Kälte war zurückgekehrt, pünktlich zum Herbst.
Sie dachte an den Bericht der Pflegekraft, die Niklas in den ersten Wochen beobachtet hatte. Kein Ausraster. Kein Zusammenbruch. Keine emotionale Reaktion, weder auf Reize noch auf Konfrontation. Nur Routinen. Als würde er die Tage über sich ergehen lassen wie Wellen, die immer wieder an ein leeres Boot schlugen. Er fragte nicht, warum er da war, er wollte nicht wissen, was sie mit ihm machen würden. Er lebte einfach vor sich hin.
Ist das seine Schutzreaktion? Oder ist da wirklich nichts mehr? Sie hatte in ihrer Laufbahn viele Patientinnen und Patienten begleitet, die litten. Einige an klar erkennbaren Krankheitsbildern. Andere an diffusen Diagnosen, an sozialen Verwahrlosungen, an Missbrauch oder an sich selbst. Aber bei Niklas war es anders. Er war kein Einzel- oder Sonderfall, aber er trug etwas in sich, das man nicht benennen konnte.
Was, wenn er sich an etwas erinnert, das ihn zerbrechen könnte? Und was, wenn es genau das ist, was ihn auf der anderen Seite heilen würde? Sie fürchtete beides.
Ein junger Mann, seit drei Jahren in staatlicher Betreuung. Ohne Verwandte, die ihn besuchen. Ohne Freunde, die sich erkundigten. Ohne ein Foto aus der Vergangenheit. Kein einziger Mensch, der sich an seine Seite stellte, in dem Moment, als seine Welt auseinanderbrach.
Vielleicht will niemand mehr wissen, wer er war. Vielleicht hat man ihn vergessen, weil es leichter war. Sie konnte das nicht. Nicht vergessen. Nicht verdrängen. Nicht stillstehen.
Wenn sie ehrlich war zu sich selbst, dann wollte sie wissen, was in ihm schlummerte. Was seine Erinnerung ihm verschwieg. Sie wollte das nicht aus Neugierde. Naja... vielleicht doch ein bisschen. Aber eigentlich wollte sie es aus diesem alten, fast kindlichen Wunsch heraus: jemandem helfen zu können, der sich selbst nicht mehr findet.
Sie hatte sich einst für diesen Beruf entschieden, weil sie glaubte, dass Heilung mehr ist als Medikamente. Mehr als Diagnosen oder Gespräche. Heilung war: jemanden zu begleiten, bis er wieder bei sich selbst ankam. Auch wenn dieser Weg durch Finsternis führte.
»Du weißt nicht, wer du warst, Niklas.«, flüsterte sie jetzt, lautlos vor sich hin, während sie nach draußen sah. »Aber vielleicht weißt du bald, wer du sein willst.«
Die Entscheidung war längst gefallen. Doch mit jedem Tag wurde ihr klarer: Sie wollte ihm nicht nur helfen. Sie musste es.
Es klopfte.
Dr. Ebling sah vom Fenster in den Raum und reagierte.
»Herein.«
Die Tür öffnete sich vorsichtig, fast zögerlich. Anna Heller trat ein, ihre Haltung war gerade, aber nicht steif, ihre Miene aufmerksam.
»Sie wollten mich sprechen, Frau Dr. Ebling?«
»Ja. Bitte, setzen Sie sich.«
Anna tat es. Die Stille zwischen ihnen war kurz, aber nicht unangenehm. Es war jene Art Stille, die sich einstellt, wenn zwei Menschen begreifen, dass sie in den nächsten Minuten mehr als nur Informationen austauschen werden.
Natascha Ebling musterte sie. Ihre blauen Augen wirkten wacher, als sie es um diese Uhrzeit eigentlich sein dürften. Ihre Hände lagen ruhig auf dem Schoß. Kein nervöses Zupfen am Stoff, kein unruhiger Blick zur Uhr. Sie setzte sich wieder auf ihren Stuhl hinter dem Schreibtisch und begann ein freundliches, formloses Gespräch mit der neuen Psychologin, die erst seit ein paar Tagen hier arbeitete.
»Zunächst einmal der Form halber: Ich bin Natascha. Die Kollegen und ich siezen uns nicht. Wir gehen hier recht locker mit einander um. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich Anna sage?«
Anna nickte freundlich und nahm das Angebot des Duzens gerne an.
»Du hast in den letzten Tagen mit Niklas Kreklow gesprochen und gearbeitet?«
Anna nickte.
»Ja. Wir haben miteinander gesprochen. Also – versucht, zu sprechen.«
»Und dein Eindruck?«
Anna überlegte. Sie schien nicht der Typ Mensch zu sein, der vorschnelle Antworten gab. Das gefiel Natascha.
»Er ist da, oft aber nicht anwesend. Sein Körper reagiert – auf Geräusche, auf Licht, auf meine Stimme. Aber innerlich… ich weiß nicht. Es ist, als würde man versuchen, durch eine Fensterscheibe mit jemandem zu reden, der auf der anderen Seite steht und dich nicht sieht.«
Natascha schwieg einen Moment. Dann sagte sie:
»Gute Beobachtung.«
Sie stand wieder auf, ging zum Sideboard und holte eine schmale Mappe hervor. Nichts Besonderes – grauer Karton, schwarzer Clip. Keine Aufschrift. Sie legte sie vor Anna auf den Tisch, öffnete sie aber nicht.
»Was ich dir jetzt sage, bleibt bitte zwischen uns. Es wird offiziell keine Protokolle geben, keine Aktennotizen. Was du erlebst ist real, aber nicht registriert. Nicht im herkömmlichen Sinne.«
Anna blickte sie an. Sie war nicht verwirrt, sondern sehr konzentriert. Natascha spürte, wie sich eine winzige Spannung im Raum aufbaute.
»Niklas Kreklow wurde uns vor drei Jahren von einem geschlossenen Zentrum überstellt. Zu diesem Zeitpunkt war sein Zustand – medizinisch betrachtet – stabil. Keine körperlichen Traumata, keine akuten psychotischen Episoden. Und doch: komplette Amnesie.«
»Nichts?«, fragte Anna leise.
Natascha schüttelte den Kopf.
»Keine Namen. Kein Zeitgefühl. Kein familiärer Bezug. Kein eigenes Ich. Als hätte jemand bei ihm den Stecker gezogen und wie einen Computer neu gebootet.«
Anna schwieg. Natascha fuhr fort:
»Wir haben sehr früh erkannt, dass konventionelle Methoden bei ihm versagen. Deshalb habe ich entschieden, ihn zu einem Teil eines Pilotprojekts zu machen; entwickelt im interdisziplinären Verbund, unter strengsten ethischen Richtlinien. Eine Therapie, die wir E.K.H.O nennen.«
Anna blickte nun auf die Mappe. Die Buchstaben standen dort nicht, aber sie schienen zwischen ihnen zu hängen wie Staub in Sonnenlicht. Währenddessen zog Natascha den USB-Stick aus ihrem Computer und legte ihn zu der Mappe auf den Tisch.
»Was ist E.K.H.O?«
Natascha überlegte kurz, dann sagte sie ruhig:
»Ein therapeutisches Verfahren. Komplex. Multimodal. Ziel ist es, verlorene Erinnerungen nicht nur durch Suggestion zu rekonstruieren, sondern durch Resonanz wieder spürbar zu machen. Wenn man so will: den Patienten in eine Position zu bringen, in der seine eigene Psyche wieder zu ihm spricht.«
Anna runzelte leicht die Stirn.
»Also… keine Rekonstruktion von außen, sondern eine Rückführung von innen?«
»Genau. Aber der Prozess ist labil. Wenn die Struktur der verdrängten Erinnerung zu instabil ist, kann es zu psychischen Brüchen kommen. Wenn sie zu stark ist, die Verdrängung zu tief… dann entsteht Abwehr, ein Rückzug, oder sogar neue Traumata.«
Anna schwieg lange. Dann fragte sie:
»Warum ich?«
Natascha lehnte sich zurück.
»Weil du zuhören kannst. Nicht nur mit dem Ohr, sondern auch mit deiner Haltung. Weil du nicht glaubst, dass eine Diagnose einen Menschen erklärt. Und weil du keine Angst davor hast, zu versagen.«
Das Büro war still. Draußen zogen die letzten Lichtfetzen des Tages über das Glas. Ein Dämmerzustand – genau wie der, in dem sich Niklas Kreklow befand.
»Du sollst ihn begleiten.«, sagte Natascha. »Beobachten und natürlich analysieren. Mit ihm sprechen, wenn er es zulässt. Schweigen, wenn es nötig ist. Und eines Tages – wenn die Zeit gekommen ist – wirst du spüren, wenn etwas in ihm zu schwingen beginnt. Ein Wort. Ein Blick. Ein Bild. Irgendetwas, das ihn an ihn selbst erinnert. Baue Vertrauen zu ihm auf.«
Anna senkte den Blick. Ihre Stimme war ruhig, aber klar:
»Und wenn nichts kommt?«
»Dann war er nicht der Einzige, der es versucht hat.«
Natascha reichte ihr die Mappe mit dem USB-Stick und dann führte Sie weiter aus.
»Die Resonanz-Therapie ist das Herzstück von E.K.H.O. Sie unterscheidet sich grundlegend von allem, was wir in der klassischen Psychiatrie nutzen. Es geht nicht darum, den Patienten mit Fragen zu durchbohren oder ihn über Reize zu stimulieren, bis etwas herausbricht. Es geht darum, ihn in Kontakt zu bringen mit jenen inneren Frequenzen, die durch ein Trauma zum Verstummen gebracht wurden.«
Anna runzelte leicht die Stirn.
»Frequenzen im übertragenen Sinn?«
»Nein, im tatsächlichen Sinne. Denke an emotionale Schwingungen, Erinnerungsmuster, unbewusste Reaktionsketten. Jeder Mensch trägt eine innere Architektur in sich – aus Klang, Licht, Berührung, Sprache. Bei einem Trauma stürzt ein Teil davon ein. Diese Resonanz-Therapie versucht nicht, diesen Teil zu rekonstruieren, sondern das, was noch da ist, zum Klingen zu bringen. Wenn ein Mensch sich wieder spürt, findet er manchmal den Weg zu dem, was verloren ging.«
»Und wie geschieht das konkret?«
»Sehr behutsam. Über gezielte Impulse – visuelle, auditive, somatische. Nicht aufdringlich, nicht zwanghaft. Es beginnt mit wiederkehrenden Mustern: bestimmten Farben, Tönen, Gerüchen, manchmal Texten oder Bewegungen. Dinge, die der Patient nicht bewusst versteht, die aber etwas in ihm in Schwingung versetzen. Bei Niklas denke ich, dass Töne der Schlüssel zu seinem Unterbewusstsein sind. Wenn Resonanz entsteht, ist es wie ein Echo aus dem Inneren – schwach, verzerrt vielleicht, aber real. Dann beginnt die eigentliche Arbeit.«
Anna wirkte nachdenklich.
»Das klingt fast… poetisch.«
Natascha lächelte matt.
»Trauma ist ein Gedicht in der falschen Sprache. Wir versuchen, es zurück zu übersetzen.«
Eine kurze Stille entstand, bevor Natascha Ebling ernster wurde.
»Es gibt keine Garantien, Anna. Manche Patienten öffnen sich – andere zerbrechen. Manche erinnern sich – andere vergessen noch mehr. Deshalb habe ich gezögert, ob wir Niklas tatsächlich in die aktive Phase führen sollen. Aber ich denke, es ist Zeit. Er ist alt genug. Und wenn es jemanden gibt, der diesen Prozess begleiten kann, dann, so glaube ich, bist du es.«
Anna atmete langsam aus. Ihre Stimme war ruhig.
»Ich bin keine Therapeutin. Ich bin Psychologin.«
»Das ist richtig. Deshalb sollst du ihn ja begleiten. Die Sitzungen werde ich durchführen, mit deiner Unterstützung und für ihn als Beistand.«
»Okay. Dann werde ich mein Bestes geben.«
Natascha nickte, fast unmerklich.
»Höre ihm zu. Auch wenn es am Anfang nur Stille ist.«
- Die Therapie -
Die Mappe lag schwer in Annas Händen. Und damit war nicht ihr tatsächliches Gewicht gemeint, sondern durch das, was sie bedeutete. Sie hatte sie den ganzen Nachmittag bei sich getragen, sie von Raum zu Raum mitgenommen, als könnte sie durch bloße Nähe verstehen, was in ihr steckte. Jetzt, spät am Abend, saß sie allein im kleinen Personalzimmer, das direkt an den Ostflügel der Klinik angrenzte, und schlug sie endlich auf.
Der Deckel knisterte leise, als sie ihn umklappte. Der erste Eindruck war nüchtern – sauber getippte Seiten, ein Inhaltsverzeichnis, Seitenzahlen. Und doch: Zwischen den Zeilen schwang etwas mit. Eine Unruhe. Eine Ahnung. Fast so, als würde sich etwas zwischen den Buchstaben verbergen.
Auf der Innenseite ein schlichtes Titelblatt, darauf nur ein Wort in Versalien: E.K.H.O. – in eleganter, serifenloser Schrift. Darunter, handschriftlich ergänzt:
Empathische Kognition zur Heilung und Opferbetreuung.
Anna runzelte die Stirn. Nicht etwa Experimentelle Kognition oder Erweiterte, wie sie vermutet hätte. Sondern Empathische. Das überraschte sie – und beruhigte sie zugleich. Es war also kein kaltes, wissenschaftlich seziertes Verfahren, sondern ein Ansatz, der Verständnis und Menschlichkeit in den Mittelpunkt zu stellen schien. Das passte zu dem, was sie bislang über Dr. Ebling erfahren hatte. Und es passte zu Niklas. Jedenfalls zu dem Eindruck, den sie von ihm hatte.
Empathische Kognition – also ein Verfahren, das über gezielte neuronale Reize den Zugang zu verschütteten Erinnerungen ermöglichen sollte. Nicht durch Konfrontation oder Schock, sondern über Resonanz. Über Resonanz... Ein Begriff, der Anna gefiel. Der Klang, die Schwingung, die Verbindung. Vielleicht auch etwas Vertrauen.
Sie blätterte weiter, überflog Diagramme, Tabellen, Therapieberichte. Der Inhalt war dicht, aber verständlich aufbereitet. Immer wieder tauchte der Begriff „binaurale Stimuli“ auf. Es ging um gezielte auditive Impulse – leicht versetzte Töne auf dem linken und rechten Ohr –, mit denen das Gehirn in bestimmte Frequenzzustände versetzt werden konnte. Ein Zugang zum Langzeitgedächtnis, zur emotionalen Codierung von Erinnerungen. Anna kannte das Prinzip in Grundzügen, aber sie hatte es nie in einem therapeutischen Kontext angewendet gesehen.
Der nächste Abschnitt enthielt eine Fallbeschreibung: Patient 21-1-13 – Niklas Kreklow. Keine Details, keine Diagnose, nur eine klinische Kurzform, in der von dissoziativen Symptomen, Amnesie und regressiven Zuständen die Rede war.