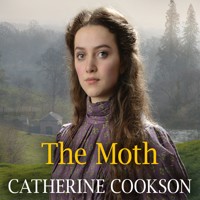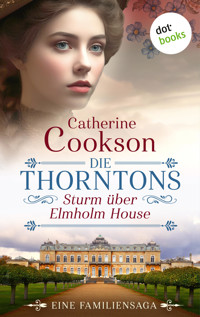Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ist diese Liebe es wert, dafür alles aufzugeben? Die Schicksalssaga »Die Emmersons – Tage der Entscheidung« von Catherine Cookson als eBook bei dotbooks. England im 20. Jahrhundert: Schon seit Generationen ist der altehrwürdige Landsitz »The Gables« im Besitz von John Emmersons Familie. Doch diese Ära scheint nun zu Ende zu gehen: Seine Ehefrau ist schon lange nur noch kalt und abweisend, sein schrecklich verwöhnter Sohn Lorie wirkt auf ihn wie ein Fremder … Aber erst Johns Begegnung mit Cissie, einer jungen, mittellosen Witwe, stellt das Schicksal endgültig auf die Probe. Cissie ist gerade erst mit ihrem kleinen Sohn in die nahe Stadt gezogen, doch sofort spürt John ein tiefes Band zu ihr, das ihm mehr Halt gibt, als seine Familie es je könnte. Durch eine fatale Verwechslung droht ihre zarte Freundschaft jedoch bald zu einem Skandal zu werden, der das ganze Dorf gegen Cissie aufbringt. Kann es für sie und John trotzdem noch Hoffnung geben? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der mitreißende Englandroman »Die Emmersons – Tage der Entscheidung« von Catherine Cookson wird Fans von Barbara Taylor Bradford begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
England im 20. Jahrhundert: Schon seit Generationen ist der altehrwürdige Landsitz »The Gables« im Besitz von John Emmersons Familie. Doch diese Ära scheint nun zu Ende zu gehen: Seine Ehefrau ist schon lange nur noch kalt und abweisend, sein schrecklich verwöhnter Sohn Lorie wirkt auf ihn wie ein Fremder … Aber erst Johns Begegnung mit Cissie, einer jungen, mittellosen Witwe, stellt das Schicksal endgültig auf die Probe. Cissie ist gerade erst mit ihrem kleinen Sohn in die nahe Stadt gezogen, doch sofort spürt John ein tiefes Band zu ihr, das ihm mehr Halt gibt, als seine Familie es je könnte. Durch eine fatale Verwechslung droht ihre zarte Freundschaft jedoch bald zu einem Skandal zu werden, der das ganze Dorf gegen Cissie aufbringt. Kann es für sie und John trotzdem noch Hoffnung geben?
Über die Autorin:
Dame Catherine Ann Cookson (1906–1998) war eine britische Schriftstellerin. Mit über 100 Millionen verkauften Büchern gehörte sie zu den meistgelesenen und beliebtesten Romanautorinnen ihrer Zeit; viele ihrer Werke wurden für Theater und Film inszeniert. In ihren kraftvollen, fesselnden Schicksalsgeschichten schrieb sie vor allem über die nordenglische Arbeiterklasse, inspiriert von ihrer eigenen Jugend. Als uneheliches Kind wurde sie von ihren Großeltern aufgezogen, in dem Glauben, ihre Mutter sei ihre Schwester. Mit 13 Jahren verließ sie die Schule ohne Abschluss und arbeitete als Hausmädchen für wohlhabende Bürger sowie als Angestellte in einer Wäscherei. 1940 heiratete sie den Gymnasiallehrer Tom Cookson, mit dem sie zeitlebens zurückgezogen und bescheiden lebte. Ihren ersten Roman veröffentlichte sie 1950; 43 Jahre später wurde sie von der Königin zur Dame of the British Empire ernannt und die Grafschaft South Tyneside nennt sich bis heute »Catherine Cookson Country«. Wenige Tage vor ihrem 92. Geburtstag starb sie als eine der wohlhabendsten Frauen Großbritanniens.
Bei dotbooks veröffentlichte Catherine Cookson auch ihre englischen Familiensagas »Die Thorntons – Sturm über Elmholm House«, »Die Lawsons – Anbruch einer neuen Zeit«, »Die Coulsons – Schatten über Wearcill House« und »Die Masons – Schicksalsjahre einer Familie«.
Bei dotbooks erscheinen außerdem ihre Schicksalsromane »Der Himmel über Tollet’s Ridge«, »Das Erbe von Brampton Hill«, »Sturmwolken über dem River Tyne«, »Sturm über Savile House« und »Der Hutsalon am Willington Place«.
***
eBook-Neuausgabe Februar 2024
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1966 unter dem Originaltitel »The unbaited Trap«. Die deutsche Erstausgabe erschien 1983 unter dem Titel »Der einsame Mann« bei Franz Schneekluth.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1966 The Catherine Cookson Charitable Trust
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1983 by Franz Schneekluth Verlag, München
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/HiSunnySky, Helen Hotson und AdobeStock/Cary Peterson
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-050-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Emmersons« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Catherine Cookson
Die Emmersons – Tage der Entscheidung
Eine Familiensaga
Aus dem Englischen von Lydia L. Dewiel
dotbooks.
TEIL 1
Dinner um acht
Kapitel 1 – Das Dach
John Emmerson verlangsamte das Tempo, als er mit seinem Wagen das Ende der Straße erreichte. Obwohl es erst sechs Uhr abends und Beginn des Monats November war, schien der Frost nicht fern. Er wußte aus Erfahrung, daß die Straße beim Handley’s Place naß sein würde. Auf irgendeinem Feld in der Nähe war die Quelle, die ständig die Straße überschwemmte, und man konnte nichts dagegen tun. Im letzten Jahr war er zweimal auf derselben Stelle ins Schleudern gekommen, ebenfalls Anfang November, und er wollte nicht, daß das heute noch einmal passierte. Nicht mit seiner neuen Errungenschaft, die erst eine Woche alt war. Er fuhr schon lange Rover und hatte die Modelle oft gewechselt. Doch diesmal war eine Art von Begeisterung in ihm hochgestiegen, ein Zustand – so hatte er immer geglaubt –, der nur anderen Männern und der Jugend Vorbehalten war. Dieser Rover 2000 hatte irgend etwas in ihm in Schwingung gebracht. Zwar zaghaft, doch da er Emotionen nicht gewöhnt war, kam ihm diese geradezu wild vor. Die Wirkung mußte der Einnahme eines Aufputschmittels ähnlich sein. So stellte er sich das zumindest vor.
Als er in die Lime Avenue einbog, bestrahlten seine Scheinwerfer die Baumreihen. Steif und starr säumten sie den Straßenrand und verloren sich in der Ferne. Ihre Schatten zeichneten sich schwarz vor dem Abendhimmel.
Am Beginn der Straße kamen ihm zwei andere Scheinwerfer entgegen, und er wich nach rechts aus. Dann hupte er zweimal und bekam die gleiche Antwort vom anderen Wagen. Heute Abend würde der Fahrer dieses Wagens zu ihnen zum Dinner kommen, und nächstes Jahr um diese Zeit würde dessen einzige Tochter seine einzige Schwiegertochter werden.
Sein Haus lag auf der anderen Seite der Straße, Nummer 74, »The Gables«, und war eine ganze Strecke von Nummer 7, »Syracuse«, entfernt. Da jedes Grundstück etwas über 1000 Quadratmeter groß war.
Er lebte nun schon zehn Jahre in der Lime Avenue. Er hatte sich das Haus geleistet, als er Seniorpartner der Firma wurde. Irgendwie schien es ihm das Kennzeichen seines Erfolges. Und das war kein geringer Erfolg, denn er hatte immerhin Ratcliff, Arnold & Baker ausgezahlt. Nun gehörte ihm als führender Anwalt der Stadt Ratcliff, Arnold & Baker. Dieser Zustand würde sich auch nicht ändern, wenn Arnold Ransome ihn auszahlen würde. Der Juniorpartner Boyd hatte noch einen langen Weg hinter sich zu bringen, bis er zum Ziel kam.
Er bog in die Einfahrt ein, fuhr um eine Kurve und hielt vor seiner Eingangstüre. Ann hatte vergessen, das Licht anzuschalten. Sie hatte die Angewohnheit, in kleinen Dingen zu sparen und in großen Dingen verschwenderisch zu sein. In zwei Stunden würde nämlich das ganze Haus erleuchtet sein, um die Familie Wilcox zu empfangen. Ihre liebe Freundin May, ihre zukünftige Schwiegertochter Valerie und den Sproß des hiesigen Richters, James. Dinner um acht, dieselbe alte Sitte, dieselbe Besetzung.
Er stieg aus und steckte den Schlüssel in das Schloß der schweren Eichentüre zur Vorhalle. Bevor er sich umdrehte, um sie zu schließen, schaltete er die Beleuchtung ein. Als er die große Halle erreicht hatte, knipste er auch dort die Lampen an. Die orangefarbenen Schirme der Wandleuchter gaben den weißen Wänden einen warmen Ton. Er konnte die weißen Wände in der Nacht ertragen, doch am Tag machte ihre Nacktheit ihn nervös. Vor etwa zwei Jahren hatte Ann ihre Vorliebe für die Kargheit entdeckt. Die Diele war weiß geworden, das Eßzimmer hellgrau, das Treppenhaus weiß, ihr Schlafzimmer blaßlila und weiß. Er hatte den Angriff auf sein eigenes Zimmer abgewehrt, doch er hatte es sanft getan. Wie immer, wenn er es mit Ann zu tun hatte, und mit jedem anderen auch, aber besonders mit seiner Frau. Daher war sein Raum grün geblieben, und es war der einzige Raum, der ihm nicht die Tränen in die Augen trieb, wenn er sich umschaute.
Er ging in die Garderobe und hängte Hut und Mantel auf. Nachdem er sich die Hände gewaschen hatte, beugte er seinen großen schweren Körper zum Spiegel hinunter, befeuchtete zwei Finger und strich an beiden Seiten der Ohren übers Haar. Dann blickte er sich an, wie es seine Gewohnheit war. Die blauen Augen, die ihn anschauten, sahen wäßrig und müde aus. Er fuhr mit dem Zeigefinger und Daumen an seiner langen Nase herab und rieb sich dann eine Stelle über der Oberlippe. Die Bewegungen seiner Finger schienen wie die eines Mannes, der sich über den Schnurrbart strich, obwohl er sorgfältig rasiert war. Dies waren unbewußte Handlungen, die er jeden Tag vollzog und nicht mehr zur Kenntnis nahm. Zu allerletzt fuhr er mit einer Hand in sein dichtes, graues Haar.
Dann zog er seine Weste zurecht, kehrte zurück in die Halle und wollte gerade die Treppe hinauf gehen, als er die Stimme seiner Frau aus der Küche hörte. Nach kurzem Zögern wandte er sich um, ging auf die Tür zu und öffnete sie.
Seine Frau stand am Tisch. Ihr Haar war mit einem hellblauen Chiffonschal hochgebunden, und sie trug über einem langen Hauskleid eine Küchenschürze. Als er eintrat, schaute sie hoch und lächelte, während sie sagte: »Da bist du ja, mein Lieber. Du bist aber früh dran.«
»Ja, ja. Der Fall hat nicht so lang gedauert, wie wir gedacht haben. Ich bin direkt von Newcastle hierhergekommen … Aber, was sehe ich, ihr seid ja wirklich tüchtig!« Er rieb die Hände gegeneinander und lächelte sein gehemmtes Lächeln, als er sich der Frau zuwandte, die am Herd stand. »Nein wirklich, Mrs. Stringer, das riecht ja hervorragend hier. Was zaubern Sie uns denn heute Abend wieder auf den Tisch?«
Wenn er in der Küche mit Mrs. Stringer sprach, war er immer herzlich. Er hatte das Gefühl, daß man es von ihm erwartete. Sozusagen als Anerkennung für geleistete Dienste, und es freute Ann, denn sie sagte immer, sie wüßte nicht, was sie ohne Mrs. Stringer tun sollte. Trotzdem kam er sich wie ein Tölpel vor, wenn er sich so benahm.
Mrs. Stringer sprach immer in gehetztem Stakkato. »Aber nicht doch, Sir«, wehrte sie ab. »Ich hab ja fast gar nichts getan, das war alles Ihre Gattin. Sie wird heute Abend todmüde sein. Sie sollte jetzt wirklich ein Bad nehmen und sich hinlegen … Ja, das hab ich ihr gesagt.«
»Ja, wirklich. Ein vernünftiger Rat. Was ist damit?« Er blickte zu seiner Frau, und als sie nicht antwortete, blieb er verlegen stehen und starrte sie an. Ja, Ann konnte so etwas tun, sich einfach weigern zu antworten. Sie konnte sich in ihr Schweigen einmauern, und es schien sie überhaupt nicht zu stören. Nein, das stimmte nicht, es störte sie. Er konnte beinahe fühlen, wie ihre Nerven zitterten. Während er sie weiter anstarrte, mußte er feststellen, daß sie immer noch gut aussah. Trotz allem hatte sie ihr gutes Aussehen bewahrt – und ihre gute Haltung. Sie war groß und schlank, so schlank, daß ihre Kleider immer wirkten wie bei einem Mannequin. Auch ihr Gesicht hatte sich kaum verändert, seit er sie kennengelernt hatte, bis auf den Mund, der sich an den Mundwinkeln jetzt sichtbar senkte. Doch ihr Teint war immer noch so makellos wie bei einem jungen Mädchen. Dabei war sie dieses Jahr fünfundvierzig geworden. Arme Ann. Doch nach diesem Gedanken und dem Mitleid, das er auslöste, gab er sich einen Ruck.
Als er sich abwandte, weil er nicht mehr wußte, was er sagen sollte, unterbrach sie ihr angestrengtes Schweigen: »Warte einen Augenblick, ich komme gleich.« Als sie ihre Schürze auszog und Mrs. Stringer sie ihr abnahm, sagte die Frau: »So ist’s recht, Madam. So ist’s recht.«
Er trat beiseite und öffnete die Türe für sie, dann folgte er ihr in die weiträumige Wohnhalle.
Im Kamin, dessen Abzug sich wie ein Trichter in den Raum schob, brannte ein Holzfeuer. Er hielt diesen Raum für besonders geglückt und nahm an, daß es in der ganzen Stadt keine elegantere Wohnhalle gab. Das müßte auch so sein, denn die Einrichtung hatte ihn eine erkleckliche Summe gekostet. Der neue Teakholzboden leuchtete rötlich bis ins Eßzimmer hinein, dessen Schiebetüren jetzt offen standen. Er sah, daß der lange Eßtisch mit Glas und Silber geschmückt war. Hinter dem Tisch verbargen mattgoldene Samtvorhänge die eine Wand vollständig, und in der Halle selbst teilten die Vorhänge die weite Fläche der Wand in drei Teile. Wenn es in ihm überhaupt eine Gefühlsregung gab, die stark genug war, um Haß genannt zu werden, dann konnte er sagen, daß er diesen Raum haßte.
Er blickte sie jetzt an, während er sagte: »Möchtest du einen Drink haben?« Seine Stimme, die nun nicht mehr herzlich war, klang zögernd.
»Nein. Nein danke.« Sie machte eine fahrige Geste. Dann setzte sie sich auf die Couch, lehnte den Kopf zurück und sagte plötzlich: »Ja, doch, ich glaube, ich möchte doch einen haben. Aber bitte nur einen kleinen.«
Er ging ins Eßzimmer, am Tisch vorbei, auf ein Eckbüfett zu, das aus massiver Eiche gezimmert war. Das Innere des Büfetts barg funkelnde Gläser und Unmengen von Flaschen. Die Anzahl der Flaschen reichte in drei Etagen vom Boden bis in seine Kopfhöhe. Die Gläser standen darüber, nach Größen und Sorten geordnet, jede Sorte auf einem eigenen Regal. Er nahm zwei heraus und stellte sie auf einen Teewagen. Dann nahm er eine Flasche Sherry, füllte die Gläser und kehrte zurück zum Couchtisch. Er reichte ihr eines der Gläser, nahm seines mit an den Kamin, und wieder entstand das verlegene Schweigen zwischen ihnen. Nach dem zweiten Schluck fragte er mit ruhiger Stimme: »Was werden wir heute Abend essen?« Es war ihm ziemlich gleich, was sie aßen, denn das Essen interessierte ihn nicht besonders. Er mußte sich schon seit längerer Zeit in acht nehmen, damit sein Bauch nicht zu dick wurde. Doch da sie sich immer viel Mühe gab, neue Menüs für ihre Dinner auszudenken, hatte er das Gefühl, er müsse sein Interesse für das Essen bekunden.
»Ach, nichts Besonderes.« Sie schüttelte den Kopf. »Seezunge mit Weißweinsauce, Ananasschinken und Apfelhasen mit den üblichen Beilagen, und dann französische Pfirsiche.«
Nichts Besonderes, hatte sie gesagt. Dabei würde es sicher sechs verschiedene Arten von Gemüse geben und eine Sauce mit allem Drum und Dran, passende Weine zu den einzelnen Gerichten und eine Platte mit acht verschiedenen Käsesorten. Nichts Besonderes! Und das alles für die Wilcox’, die sie mindestens jeden zweiten Tag sah!
Die Wilcox’ waren schon seit vielen Jahren mit ihr befreundet und stammten noch aus der Zeit, bevor er sie kannte. Sie und May Wilcox waren zusammen zur Schule gegangen und waren seitdem unzertrennlich, doch zwischen ihnen fand ein ständiger Kampf um den gesellschaftlichen Vorrang statt, und diese kleinen Dinner gehörten zu diesem Kampf. Nichts Besonderes! Wenn Mays Dinner mit Shrimp-Cocktails oder Horsd’oeuvres begannen, konnte man sicher sein, daß in seinem Haus solche Dinge sicherlich auf Monate hinaus vom Tisch verbannt wurden.
In diesem versteckten und affektierten Kampf war seine Frau – das wußte John – immer die Gewinnerin gewesen, ganz gleich, ob es sich um die Vorbereitung eines Essens, die Organisation von offiziellen Frühstücken oder den Vorsitz eines Komitees handelte. Das hatte sich ergeben, als James Wilcox, der in der Firma von Baxter und Morton untergeordneter Sachbearbeiter war, seinen eigenen Betrieb gegründet hatte. Das gelang ihm dank des unerwarteten Todes seines Schwiegervaters, eines Witwers mit beträchtlichem Vermögen. Da man May Wilcox nun nicht mehr so ohne weiteres taktvoll unterstützen konnte, war dieser Kampf unter gleichen Voraussetzungen zustande gekommen.
Doch John war zu der Ansicht gekommen, daß dieser Kampf ein Ende nehmen mußte, denn er betraf nicht mehr nur die Dinner, sondern auch die Innendekoration, und er hatte das bestimmte Gefühl, daß die nächsten Kampfwaffen dann die Nerzmäntel werden würden. Trotzdem wußte er, daß es nicht so ganz einfach sein würde, sein Ziel zu erreichen, denn es war ihm nur zu klar, daß er ihr das einmal gewählte Betätigungsfeld nicht zu weit einschränken durfte.
Während er sein Glas leerte, kam aus der Halle der Ton eines tiefen Lachens, eines kehligen, vergnügten Lachens. John beobachtete aufmerksam seine Frau. Einst hatte ihr Gesicht sich erhellt, wenn sie dieses Lachen gehört hatte. Es war so, als ob in ihren Augen ein Licht angeknipst würde, doch seit das Hochzeitsdatum ihres einzigen Sohnes mit der Tochter ihrer Freundin festgesetzt war, war dieses Licht erloschen. Sie hätte überglücklich sein sollen, daß ihr Sohn und die Tochter ihrer liebsten Freundin die Freundschaft ihrer Eltern zementieren würden, aber das war nicht der Fall. Sie hatte es ihm gegenüber nie zugegeben, doch er wußte genau, daß sie ihre zukünftige Schwiegertochter nicht mochte. Doch würde sie irgendein anderes Mädchen mögen, das ihr den Menschen nehmen würde, der ihr Leben überhaupt erträglich gemacht hatte?
Als Laurence Emmerson hereinkam, lachte er immer noch. »Hallo, ihr beiden«, sagte er. Er schloß seinen Vater in die Begrüßung ein, doch nur ganz am Rande. Dann fuhr er ohne Pause fort: »Stringy ist unbezahlbar, die läßt nichts auf dich kommen. ›Niemand macht so einen guten Ananasschinken wie die Madam‹, hat sie gesagt.« Er grinste. »›Sie wollen doch nicht etwa behaupten, daß meine zukünftige Schwiegermutter keine gute Köchin ist?‹« habe ich gesagt. »Ich will gar nichts behaupten, ich habe Ihnen das nur gesagt.«
Er lachte schallend, während er sich neben seiner Mutter auf die Couch fallen ließ. Er legte den Arm um sie und gab ihr einen Kuß und sagte, immer noch fröhlich: »Wie geht es dir?«
»Oh, danke.« Sie blickte ihn an.
»Müde?«
»Nur ein bißchen. Ein heißes Bad wird alles wieder in Ordnung bringen.«
Er drehte den Kopf und blickte zum Eßzimmer hinüber. »Sieht ja toll aus.« Dann blickte er sie noch einmal an, zärtlich und besorgt. »Du bist müde«, sagte er. »Geh jetzt hinauf und ruh dich etwas aus. Du hast noch gute anderthalb Stunden. Los, ab mit dir.«
Er stupste sie leicht an, doch sie rührte sich nicht. Statt dessen verließ sein Vater den Raum. Laurence sah ihm nach, blickte auf die sich leise schließende Tür, seufzte und lehnte seinen Kopf an den seiner Mutter.
Er konnte sich immer erst richtig entspannen, wenn sein Vater nicht in der Nähe war, obwohl seine Gegenwart ihn jetzt nicht mehr so störte wie früher. Er war zu der Erkenntnis gekommen, daß es gar nichts gab, was einen bei diesem Vater irritieren mußte. Er war viel zu farblos, zu fad und – zu schlapp. Ja, das war das richtige Wort, um seinen Vater zu charakterisieren. Es war schwer zu begreifen, daß ein so großer Mann so wenig Eindruck auf andere machen konnte. Trotzdem sagte man, daß er vor Gericht gut sei, daß er gut reden könne. Es war ein Jammer, daß er von seiner juristischen Wendigkeit zu Hause keinen Gebrauch machte, denn dann wäre das Leben für seine Mutter bedeutend interessanter. Es war ihm wirklich ein Rätsel, wie sie es so lange mit ihm ausgehalten hatte. Seine massige Gestalt, seine sanfte Stimme und dieses lautlose Lachen. Weshalb lachte er denn nicht, lachte nicht wirklich? Es war merkwürdig, aber er hatte seinen Vater noch nie wirklich laut lachen hören.
Er nahm ihre Hand, die wie wartend neben seiner lag, und seine Mutter fragte ihn, ohne sich zu bewegen: »Wie war denn dein Tag heute?« Sie saß mit geschlossenen Augen neben ihm.
»Ach, wie immer … Weißt du, unter uns gesagt ist der alte Wilcox ein ekelhafter Wichtigtuer. Er macht mich ganz krank.«
»Schsch!«
»Ach was, es kann uns ja niemand hören.«
»Das spielt keine Rolle. Wenn du es auch denkst, solltest du es nicht sagen.«
Sie machte eine nervöse Handbewegung.
»Es ist ein Jammer, daß du überhaupt bei ihm arbeitest. Aber damals wußtest du ja nicht, daß er mal dein Schwiegervater werden würde. Vielleicht hättest du doch Jura studieren sollen.«
»Nein, nein!« Seine Stimme wurde auf einmal rauh. »Nein, Jura kommt für mich nicht in Frage.«
Sie schwieg eine Weile. Es war, als ob er erklärt hätte: ›Was? So sein wie mein Vater?‹
Wieder bewegte sie unruhig die Hand. »Wenn du erst mal verheiratet bist, könnte er dir eine Partnerschaft anbieten.«
»Darauf verlaß ich mich nicht. Wenn er an so etwas dächte, hätte er es mir längst gesagt. Nein, der spielt gern den Leithund und liebt es, wenn eine Menge kleiner Hunde hinter ihm herläuft.«
»Schsch!!«
»Sag doch nicht immer ›Schsch!‹« Er drückte ihre Hand, und sie lachten beide.
»Weiß Valerie denn, was du von ihm denkst?«
»Ich glaube, ja.«
»Er hat sie sehr gern. Wenn du erst verheiratet bist, wird sie ihn vielleicht dazu überreden, dir …«
»Oh, nein, das wird sie nicht tun.« Er setzte sich auf und blickte sie an. »Schau, ich möchte keine Gunst durch meine Frau. Vergiß nicht, daß der alte Wilcox seine jetzige Stellung im Leben nur der Gunst seiner Frau zu verdanken hat, und das läßt sie ihn nie vergessen.«
»Ach, Laurie, sei doch nicht so töricht. Und paß auf, daß du May nicht immer ›Mama Wilcox‹ nennst. Eines Tages plapperst du es mal hinaus, ohne daran zu denken.«
»O ja, das wäre wirklich schlimm. Nein, ich bin nicht töricht, und du weißt es auch ganz genau. Er ist der große Boß im Büro, doch darüber hinaus … O je! Wer hat denn zu Hause die Hosen an, und wer sitzt auf dem Portemonnaie? Ich weiß es doch genau, liebe Mama.« Er nickte ihr zu und grinste. »Doch wie es auch sei«, er stand langsam auf, »es gibt auch andere Jobs. Wenn er bis zum nächsten Jahr nicht mit einem Angebot herauskommt, kann ich mich immer noch verändern.«
»Du wirst doch nicht … du wirst doch nicht die Stadt verlassen?«
Er blickte sie an, wie sie auf dem Rand der Couch saß und ihn ängstlich anstarrte. Da streckte er seine Hand aus und berührte sanft ihre Wange. »Nein, hab keine Sorge, ich werde nicht weit weg gehen. Immerhin gibt es in dieser Stadt mindestens vier andere Steuerkanzleien. Außerdem könnte ich mich ja auch selbständig machen. Ich brauche bloß einige Klienten abzuwerben und mein eigenes Büro zu mieten.«
Sie senkte den Blick, als ob sie sich schämte.
»Los jetzt.« Seine Stimme klang munter. »Hinauf mit dir, bevor du dich ins Kampfgetümmel stürzt.«
Er hatte immer noch ihre Hand gefaßt, als sie in die Halle kamen. Dort sah er seinen Vater, wie er gerade mit einem Aktenköfferchen hinausgehen wollte.
»Ich … ich geh schnell noch ins Büro.«
John blickte Ann an, und sie blickte hinauf zur Wand am ersten Treppenabsatz, an der eine reichverzierte Uhr hing. »Es ist zwanzig vor sieben«, stellte sie kühl fest.
»Ich werde nicht länger als eine halbe Stunde brauchen. Ich möchte einige Papiere holen. Der Fall ist heute zu Ende gebracht worden. Und ich … ich möchte alles ordnen.«
»Sie werden gegen Viertel vor acht hier sein.«
»Oh, ich bin lange vorher wieder hier.«
»Du bist noch nicht mal umgezogen.« Sie musterte ihn von oben bis unten.
»Ich werde es kurz machen. Eine halbe Stunde, nicht länger. Ich bin rechtzeitig zurück.«
Als er aus der Tür hinaus und in die Vorhalle ging, wußte er, daß sie ihn beide beobachteten. Er stieg in den Wagen und fuhr über die Einfahrt auf die Straße. Auf die eventuell eisigen Stellen achtete er nicht mehr.
Nachdem er über einige Nebenstraßen die Hauptstraße erreicht hatte, fuhr er am Park und an Brampton Hill vorbei. Dieser Hügel mit seinen vornehmen alten Villen bedeutete nicht mehr als ein Relikt früherer Zeiten, eine Fundgrube für Bauspekulanten, die miteinander wetteiferten, wer mehr Apartments aus einem Haus herausbringen konnte. Er kam an der Altstadt vorbei, an Bog’s End, an dem neuerbauten Stadtteil mit seinem häßlichen Einkaufszentrum; er querte die Hauptbrücke, die den Strom überspannte, und kam schließlich zu den Greystone Buildings. Die Greystone Buildings bestanden aus fünf vierstöckigen Häusern. Sie waren im Jahr 1874 von einem Mann namens Arthur Greystone gebaut worden, ursprünglich als Wohnhäuser für gutgestellte Bürger, die in Newcastle arbeiteten und es sich leisten konnten, dort mit der Kutsche hinzufahren. Das einzige Überbleibsel aus dieser glanzvollen Vergangenheit waren die Wagenschuppen auf der Rückseite, die nun ausgezeichnete Garagen abgaben. Vier der Häuser waren für Bürozwecke eingerichtet worden, und nur noch eines, Nummer zehn, war ein Wohnhaus, das in vier Apartments aufgeteilt war.
Johns Büro war in Nummer acht untergebracht, und er fühlte sich dort heimischer als in »The Gables«, 74 Lime Avenue.
Seine Finger zitterten, als er den Schlüssel in das Yaleschloß steckte. Die Halle, in die er trat, unterschied sich nicht von den anderem Hallen, die zu Anwaltskanzleien führten. Sie war völlig kahl, bis auf ein Eichenbrett mit Namenslisten, das an einer Wand hing. Auch das Licht war ebenso trüb wie anderswo. Er ging die Treppe mit ihren Messingkanten hinauf, vorbei an der Türe, auf der »Auskunft« stand, dann eine weitere Treppe hinauf, an zwei Türen vorbei, welche die Schilder »J. A. Ransome« und »M. O. Boyd« trugen, und dann über eine dritte Treppenflucht zum obersten Stock.
Dort befanden sich drei Türen. Eine trug seinen Namen, eine zweite führte zu einem Lagerraum und die dritte zu einer antiquierten Toilette mit einem ebenso antiquierten Waschbecken.
Als junger Mann war er in diesen obersten Stock gesetzt worden und hatte zusammen mit zwei anderen Angestellten den einen kalten Raum geteilt. Als er dann im Laufe der Jahre befördert wurde und die Mitarbeiter die Zimmer wechselten, hatte er darum gebeten, im dritten Stock bleiben zu dürfen. An dieser Bitte war damals nichts Ungewöhnliches gewesen, denn er war immer noch nicht besonders wichtig. Aber jetzt, als Leiter der Firma, hätte er einen Raum im Stock darunter beziehen müssen. Den Raum, den sein Juniorpartner hatte. Doch er zog es vor, hier oben zu bleiben. Das wurde als merkwürdig angesehen und darüber hinaus auch als ungünstig für die Firma. Einflußreiche Kunden waren an Lifts gewöhnt, und in den Greystone Buildings gab es keine Lifts und würde es auch niemals welche geben.
Trotzdem stiegen die Leute die Treppe zum obersten Stock hinauf, und das Geschäft ging so gut, daß er manchmal Arbeit an seine weniger glücklichen Kollegen in der Stadt weitergab.
Der Raum, in den er trat, war durch Zentralheizung gewärmt. Er sah nach dem aus, was er war – ein Büro, aber ein sehr gemütliches. Es hatte einen großen Teppich auf dem Boden, vier große Lehnsessel und einen großen Mahagonistuhl. Eine der Wände wurde von einem hohen Bücherschrank mit Glastüren eingenommen. An den restlichen hingen alte Jagd- und Pferdestiche, doch manche so verblaßt, daß man kaum erkennen konnte, was dargestellt war. Er knipste die Bronzelampe auf dem Schreibtisch an, dann ging er zur Türe und löschte die Deckenbeleuchtung.
Nachdem das erledigt war, ließ er sich langsam auf einen der Sessel nieder, bedeckte sein Gesicht mit beiden Händen und blieb völlig regungslos sitzen. Er hätte nicht hierherfahren sollen. Noch dazu mit so wenig freier Zeit. Doch er hatte das Gefühl, er wäre wahnsinnig geworden, wenn er zu Hause geblieben wäre. Nach dem Umziehen hätte er nicht einfach in seinem Zimmer bleiben können, bis die anderen da waren. Also wäre er nach unten gegangen, und dort hätten sie gesessen, die beiden, hätten sich an der Hand gehalten, miteinander gelacht oder über seinen Kopf hinweg unterhalten. Er konnte es nicht länger ertragen, er würde wahnsinnig werden. Konnte es besser werden, wenn Laurie erst einmal verheiratet wäre und nicht mehr zu Hause wohnen würde? Nein, dann würde es vermutlich noch schlimmer. Denn er würde ihre Verzweiflung spüren und könnte nichts tun, um sie zu lindern.
Er hätte heute jedoch nicht hierherkommen sollen. Er wußte, welchen Wert sie auf dieses Dinner legte. Mehr verlangte sie nicht von ihm, als da zu sein und oben am Tisch zu sitzen, wenn sie ihre Essen gab. Er wußte auch, daß sie ihm auf ihre Weise dankbar war, wenn er lächelte, Konversation machte und sich allgemein von seiner besten Seite gab. Er versuchte auch immer ihr zu gefallen, denn er wußte genau, daß es eine Angst in ihrem Leben gab: es könne jemand erfahren, wie es in Wirklichkeit um sie beide stand.
Er war davon überzeugt, daß selbst May Wilcox nicht wußte, wie ihr gemeinsames Leben in Wirklichkeit ablief. Die Wilcox’ hielten ihn für nichts anderes als einen ruhigen, reservierten Mann. Sprach Laurie jemals mit Valerie über die Situation zu Hause, eine Situation, die sich nicht geändert hatte, seit er ein kleines Kind war? Nein. Das konnte er sich nicht vorstellen, Laurie würde mit niemandem außer mit seiner Mutter darüber sprechen, noch nicht einmal mit seiner zukünftigen Frau. Auf jeden Fall würde er ihr nichts sagen, das sie dazu veranlassen könnte, hinter die Fassade ihrer Mutter zu dringen, dieser Fassade der Wohlerzogenheit, Kultiviertheit und Gewandtheit, hinter der man jede unerträgliche Situation verbergen konnte. Instinktiv wußte er, daß sein Sohn ebensogut wie sie selbst bestrebt war, das Image seiner Mutter zu wahren.
Doch er mußte jetzt nach Hause zurück. Weshalb um alles in der Welt war er ausgerechnet heute hierhergekommen? Er würde die Papiere, die er brauchte, mitnehmen und dann etwas arbeiten, wenn sie alle gegangen waren.
Seine Hand fiel auf die Armlehne des Sessels, und er wollte sich aufrichten. Doch da hielt er inne, das eine Bein ausgestreckt, die Schulter nach vorn gekehrt. Er legte seine eine Hand an die Rippen, und während er versuchte, ruhig durchzuatmen, fragte er sich, wie lange es jetzt her war, daß er einen Anfall gehabt hatte. Vielleicht zwei Monate. Doch diesmal konnte es eine Magenverstimmung sein, vielleicht war das Essen zu schwer gewesen. Er würde hinuntergehen und frische Luft schnappen, denn das tat ihm immer gut. Aber er konnte in diesem Zustand keinen Wagen lenken. Steh auf, steh auf, mahnte er sich selbst. Mach langsam, doch steh auf. Er hatte seinen Mantel nicht ausgezogen, nur seinen Hut abgelegt. Doch er ließ ihn liegen und knipste auch die Schreibtischlampe nicht aus, als er sich mühsam aufgerichtet hatte.
Auf dem Korridor steckte er schwerfällig den Schlüssel von außen ins Schloß, ließ das Schlüsseletui in die Manteltasche gleiten und ging auf die Treppe zu. Die Beleuchtung war so gut, daß er jede einzelne Stufe erkennen konnte, bis hinunter zum nächsten Treppenabsatz. Doch als er die Hände auf das Geländer legte, merkte er, daß ihm schwindelig wurde. Er schloß die Augen, ging zurück zu seiner Türe und lehnte sich eine Weile dagegen. Sein Atem kam rasselnd und stoßweise. Er brauchte frische Luft, unbedingt. Das Dach. Weshalb hatte er nicht schon früher daran gedacht? Natürlich, das Dach. Er ging langsam an der Tür des Lagerraums und an der Toilette vorbei, auf acht Stufen zu, die an der Ecke des Ganges lagen und zu einer Dachluke führten. Er mußte sich bloß auf die unterste Stufe stellen und den Riegel öffnen, der den Glasrahmen sicherte. Mit größter Anstrengung gelang es ihm, den Verschluß zu lösen, und als er auf der zweiten Stufe stand, drückte sein Kopf den Fensterrahmen nach oben. Er kippte mit dem Oberkörper aufs Dach und rang gierig nach Luft. Dankbar merkte er, daß seine Kräfte wiederkehrten, und er schob sich auf das flache Dach hinaus. Das war schon besser, viel besser.
Er kannte das Dach so gut wie den Raum darunter, denn es war lange Jahre für ihn eine Art geheimer Schlupfwinkel gewesen. Im Sommer hatte er sich hier einen Klappstuhl hingestellt. Er saß dann mit dem Rücken zum Kamin und konnte über die Stadt hinweg auf den Fluß blicken und hinüber zum Moor, zu der Gegend, die noch nicht durch Wohnbauten verdorben war. Er hielt diesen Blick vom Dach für einen der schönsten.
Er lehnte sich einen Augenblick mit dem Rücken gegen die Kaminbrüstung, bevor er zu der niedrigen Steinmauer hinüberging, der einzigen Grenze zwischen den anderen Häusern. Er kauerte sich darauf und stützte den Kopf in die Hände.
Es fegte hier oben ein rauher, eisiger Wind, was ihn aber nicht störte, denn ihm war heiß. Er spürte, wie der kalte Schweiß unter seinem Hemd den Körper hinunterrann.
Von irgendwoher hörte er ein gedämpftes Geräusch, ein seltsames Geräusch, wie von lachenden, singenden jungen Leuten. Es kam sicher aus einer der Wohnungen. Ja, diese Wohnungen! Die ganzen Jahre hindurch, in der Zeit, in der er auf dem Dach saß, hatte er kaum einen Menschen erblickt. Bis dann durch den warmen Sommer vor einigen Jahren seine Angestellten entdeckten, daß das Gebäude ein begehbares Dach hatte – ebenso wie die Büros von Wallace & Pringle und die Großhandelsfirma von Nr. 1.
Er hätte sich gern hingelegt, doch er mußte jetzt zurück nach Hause. Er könnte allerdings einfach die ganze Nacht hier bleiben. Würde das eine Rolle spielen? Nein. Nein, überhaupt keine. Es wäre das Beste, was ihm passieren könnte. Und wenn man ihn fände, könnte man nicht behaupten, daß er sich etwas antun hätte wollen, oder? Nicht wie das letzte Mal. Er war müde, oh, er war so schrecklich müde von allem.
Er hörte wieder die Musik und das Lachen. Es war immer noch fern und gedämpft. Doch dann, als ob jemand das Radio voll aufgedreht hätte, schrie eine Stimme über seinem Kopf: »Liebe mich, liebe mich oder ich sterbe.«
Er glitt an der niedrigen Mauer hinab und lehnte seinen Kopf gegen die Brüstung. Während er das tat, hörte er eine Kinderstimme rufen: »Mann! Mann!«
Sein Denken war wie ein leerer Raum, als ob sein Herz aufgehört hätte zu schlagen und er gestorben sei. Dann fühlte er, wie jemand seinen Kopf hob, und er hörte, wie aus weiter Entfernung, eine Stimme, die sagte: »Ist er tot?«
Dann hörte er einige andere Stimmen, die um ihn herum auf und ab fluteten, und er versuchte, sich zu den Stimmen Gesichter vorzustellen. Er reagierte sehr empfindlich auf Stimmen. Wenn er Klienten zum ersten Mal sah und sie den Mund öffneten, konnte er sie gleich beurteilen, und er irrte sich nur selten.
»Ist er tot?«
»Nein, nein. Aber geh jetzt aus dem Weg.«
»Ich hab seine Hand gesehen, Mam, im Treppenlicht, wie sie über die Mauer hing. O Gott, war das gruselig!«
»Sei jetzt ruhig, Pat, und geh hinunter. Kannst du ihn auf die Beine stellen, Ted?«
»Er ist sehr groß, aber ich werd es versuchen … Nein, das hat so keinen Zweck. Ich kann ihn nicht allein über die Mauer heben. Was ist denn mit dem alten Locket? Ruf ihn doch mal herbei.«
»Nein, der würde vor Schreck einen Herzanfall bekommen. Außerdem könnte er sowieso nicht hier heraufkommen. Wir müssen es zusammen versuchen.«
»Warte mal, ich glaube, er kommt wieder zu sich.«
»Wie fühlen Sie sich?« Es war eine weiche, warme Stimme. Er öffnete die Augen und flüsterte zu der dunklen Gestalt: »Besser, vielen Dank.«
»Meinen Sie, Sie können aufstehen? Wir helfen Ihnen.«
»Danke.«
Sie setzten ihn auf die Mauer, und es war die Frau, die seine Beine anhob, eins nach dem anderen, bis sie ihn über die niedrige Brüstung gebracht hatten. Der Mann ging langsam rückwärts die Stufen hinab, ganz ähnlich wie die, die John zuvor von seinem eigenen Treppenabsatz hinaufgekommen war, und die Frau hielt ihn fest an den Schultern, um ihn von oben her zu stützen.
Er schwankte und blinzelte, während sie ihn über den Treppenabsatz in ein Zimmer brachten, in dem eine Menge Menschen waren. Jedenfalls kam ihm das, benommen wie er war, so vor.
Sie legten ihn hin, und die Frau lockerte seine Krawatte und seinen Kragen. Es waren Jahre vergangen, seit jemand seinen Hals berührt hatte. Er schämte sich und wehrte sich ein wenig. Nun waren die Stimmen wieder zu hören, diesmal sanfter und leiser, und jede ganz anders. Bilder entstanden vor seinem inneren Auge.
»Oh, der sieht schlecht aus.« Das war eine alte Stimme, eine schwerfällige, nordenglische Stimme, eine Arbeiterstimme. »Schätze, der kann jede Minute hinübergehen.«
»Red doch keinen Unsinn, Bill. Was ist, wenn er dich hört?« Eine andere schwerfällige Stimme, die einer Frau, aber sehr freundlich.
»Glaubst du, wir können ihm einen Schluck Brandy geben, Ted?«
Das war die Stimme, die er zuerst gehört hatte. Er hätte am liebsten seine Augen geöffnet, um zu sehen, wie die dazugehörige Frau aussah.
»Ich glaube nicht, daß es ihm schaden würde. Natürlich hängt es davon ab, was ihm fehlt. Ich glaube, wir sollten einen Arzt holen.« Dies sagte eine bestimmte, knappe Stimme. Auch nordenglisch, doch anders als die von dem anderen Mann. Es war eine Stimme, der man anhörte, daß der Mann gewohnt war zu reden.
»Oh, den kenne ich.« Der erstaunte Ausruf veranlaßte ihn, kurz die Augen aufzumachen. »Das ist Mr. Emmerson, der Anwalt von nebenan. Ich hab euch doch gesagt, daß die Tochter von meinen Leuten, Miss Valerie, seinen Sohn heiraten wird. Du erinnerst dich doch daran, Cissie, daß ich dir von der Verlobung erzählt habe!«
Die Stimme war hoch und aufgeregt, und sie brachte ihn wieder zu sich. Er öffnete die Augen und blickte die Gesichter an, die um ihn herum waren. Sie waren alle etwas verschwommen, doch er wußte, daß das Gesicht, das ihm am nächsten war, zu der Frau mit der netten Stimme gehörte. Sie schien noch nicht ganz Frau, doch auch kein junges Mädchen mehr. Neben ihr stand ein schlanker, eleganter Mann. Er war derjenige, der ihm die Stufen hinabgeholfen hatte, und besaß die Stimme, die Übung verriet. Am Ende der Couch stand ein altes Paar. Wahrscheinlich waren es die mit den nordenglischen Stimmen. Neben ihnen standen zwei andere Frauen. Die schmale, kleine Frau lächelte ihn an. Er hatte das Gefühl, daß sie es war, die ihn kannte. Ihre Begleiterin war ebenfalls klein, doch sehr dick. Daneben stand ein Junge. Er war dünn und schmächtig, hatte strohblonde Haare und war etwa neun Jahre alt.
»Geht es Ihnen jetzt besser?«
»Ja. Ja, vielen Dank.« Er schaute in zwei warme, dunkelbraune Augen in einem ovalen Gesicht, das von glattem blondem Haar umrahmt war.
»Möchten Sie vielleicht einen Schluck Brandy haben?«
»Danke … ja, bitte.«
Niemand sagte ein Wort, bis man ihm den Brandy gebracht hatte. Als er versuchte zu trinken, rann die Flüssigkeit an seinem Kinn herab und tropfte auf sein Hemd.
»Trinken Sie alles aus, es wird Ihnen guttun.« Sie stützte seinen Kopf, um ihm das Trinken zu erleichtern.
Es dauerte nicht lange, da fühlte er sich schon viel besser und stärker. Sein Herz raste nicht mehr so schnell, obwohl es immer noch laut klopfte.
»Warten Sie, ich lege Ihnen ein Kissen unter den Kopf.«
Sie schob ihm ein Kissen unter und fragte dann: »Soll ich Ihren Arzt rufen?«
»Nein, nein, vielen Dank. Ich … es wird mir bald bessergehen. Es ist mir sehr unangenehm …«
»Aber, seien Sie doch nicht …« Er hatte das Gefühl, daß sie hinzufügen wollte: »so dumm«, doch sie unterbrach sich und tauschte es mit »beunruhigt«. »Sie brauchen sich wirklich nicht zu beunruhigen …« Dann setzte sie sich auf den Rand der Couch, neben seine Beine, beugte sich zu ihm vor und fragte sanft: »Soll ich bei Ihnen zu Hause anrufen?«
Diese Frage hatte die Wirkung einer Injektion, die ihn mit einem Schlag lebendig machte. Er hob ruckartig den Kopf und wehrte fast verzweifelt ab: »Nein, nein, bitte nicht. Es wird schon wieder besser. Wenn ich …, wenn ich nur eine Weile liegen bleiben kann.«
Er sah, wie sie ihren Kopf neigte und ihm begütigend zulächelte. »Sie können so lange bleiben, wie Sie wollen.«
»Danke.« Er blickte jetzt die Leute, die im Zimmer standen, der Reihe nach an. Es fiel ihm auf, daß das keine Familie sein konnte. Seine Stimme klang entschuldigend, als er sagte: »Ich habe ein Fest gestört?«
»Aber nein. Das haben Sie gewiß nicht.« Wieder neigte sie den Kopf und lächelte beschwichtigend. »Sie waren sowieso gerade beim Aufbruch, nicht wahr?« Sie blickte sich nach den anderen um, und alle nickten. »Ja, ja, wir wollten wirklich gerade gehen.«
Dann sprach die alte Frau. »Es war eine von Cissies Partys«, sagte sie. »Wir sind nur zu einer Tasse Tee heraufgekommen, doch wie immer, wenn wir hier sind, haben wir uns zu lange aufgehalten. Gut, daß wir daran erinnert werden.« Sie nickte ihm zu.
»Oh, Mrs. Locket!« Die junge Frau blickte die alte Frau an und wiederholte noch einmal: »Oh, Mrs. Locket!«
»Doch, es ist wahr, Cissie, wir bleiben immer zu lang.« Mrs. Locket nahm nun ihren Mann beim Arm und nickte John noch einmal zu, bevor sie sich zur Türe wandte, fast auf Zehen, als ob sie befürchtete, ihn zu stören.
Jetzt machten sich die kleine Dicke und die kleine Dünne auf den Weg. Die kleine Dünne blickte ihn an und schüttelte den Kopf, während sie ihm zuflüsterte: »Ich hoffe, es geht Ihnen bald wieder besser, Mr. Emmerson.«
Der Mann, den sie Ted nannten, folgte ihnen. Dann kam das Geräusch einer sich schließenden Türe, und der Mann kam zurück. »Wie fühlen Sie sich denn wirklich?« fragte er freundlich und kam mit seinem Gesicht nahe an John heran. »Viel besser. Schon viel besser. Vielen Dank.«
Ja, er fühlte sich besser, doch er war schrecklich müde. Er wollte schlafen, und er hatte das Gefühl, daß er schlafen könnte, denn er lag so bequem, und er war so entspannt. Er hatte diese Leute aufgestört und ihre Party gesprengt, und doch irritierte ihn das nicht, was sehr ungewöhnlich war. Seine Augen richteten sich nun auf den Jungen, der vor ihm stand und ihn neugierig anstarrte. Er stellte fest, daß er ein nettes, offenes Gesicht hatte, ganz ähnlich dem der jungen Frau. Wahrscheinlich waren sie Mutter und Sohn. Sie hatten die gleiche Haarfarbe, den gleichen Gesichtsschnitt und die gleichen braunen Augen.
Die junge Frau fragte: »Meinen Sie, Sie könnten eine Tasse Kaffee vertragen?«
»Das ist nett von Ihnen. Ja, ich glaube, das wäre gut.«
»Ich werde ihn machen. Du bleibst sitzen.« Der Mann legte seine Hand auf ihren Arm und verschwand hinter der Couch.
John blinzelte und versuchte seinen Blick auf die junge Frau zu konzentrieren. Sie saß zwar, doch selbst so sah sie groß aus. Er sagte zu ihr: »Ihr Mann ist sehr freundlich.«
Das Lachen des Jungen kam so herzlich, daß John langsam seinen Kopf drehte und die beiden nacheinander anblickte. Sie grinsten einander an. Er sah, wie sie ihre Hand nach ihm ausstreckte, als ob sie ihn am Lachen hindern wollte, doch es war Spaß. Sie fügte dann sachlich hinzu: »Nein, das ist nicht mein Mann. Das ist Mr. Glazier vom untersten Stock.«
»Oh, entschuldigen Sie.«
»Das konnten Sie ja nicht wissen. Er ist Reisender und ist sehr wenig hier. Doch er kommt immer zu uns hinauf, wenn er mal zu Hause ist.«
John nickte, sagte jedoch nichts.
Sie begann, ihm die Gesellschaft zu erklären, als ob es für ihn wichtig wäre. »Der alte Mann und die alte Frau«, begann sie, »sind Mr. und Mrs. Locket. Sie wohnen im zweiten Stock, in der Wohnung Nr. 3. Es sind Rentner, und sie fühlen sich manchmal einsam. Ich bitte sie öfter mal zum Tee zu mir.« Ihre Hände bewegten sich leicht, während sie sprach. »Dann, die eine, die Sie kennt, ist Mrs. Orchard. Sie arbeitet als Tagesmädchen für Mrs. Wilcox und lebt mit Miss O’Neill zusammen, das ist die Dicke. Miss O’Neill ist Köchin in der Schulkantine. Sie wohnen im ersten Stock.« Sie deutete mit dem Zeigefinger nach unten. Dann machte sie eine Pause, blickte ihren Sohn an, lächelte wieder und sagte: »Und hier oben im Olymp leben wir beide, Pat und ich.« »Pat und ich«, hatte sie gesagt. Sie hatte keinen Mann erwähnt. Sie könnte Witwe sein oder vielleicht auch nicht verheiratet und das Kind unehelich. Ja, sehr wahrscheinlich, denn sie war die Art von Mensch, die jeden anzog, alt und jung, Köchinnen und Handlungsreisende.
»Ich ermüde Sie. Sie wollen sicher nicht so viel von uns hier hören. Aber ich habe mir gedacht, ich sollte es Ihnen erklären. Soll ich nicht doch bei Ihnen zu Hause anrufen?«
»Nein, nein, vielen Dank.« Er begann plötzlich unruhig zu werden, so als ob er aus tiefer Betäubung erwachte, und fragte: »Wie spät ist es, bitte?« Als er das fragte, tastete er schon nach seiner Uhr. Sie wandte ihren Kopf, blickte auf die alte Dielenuhr in der Ecke und sagte: »Zwanzig Minuten vor neun.«
»Zwanzig vor …!« Mit einem Ruck setzte er sich hoch. »Das … das kann nicht sein.« Er blickte sie an, als ob er sie darum bitten wollte, ihm zu bestätigen, daß sie nicht recht habe. »Ich bin kurz vor sieben ins Büro gekommen und … und ich war nach zehn Minuten wieder draußen … Wenigstens habe ich …«
»Sie müssen eine ganze Weile auf dem Dach gelegen haben.«
»Nein, nein.« Er schüttelte den Kopf. Er hatte eine Stunde verloren, und er hatte sie im Büro verloren, nicht auf dem Dach. Es war nicht das erste Mal, daß ihm eine Stunde abging, wenn er sich in diesem Zustand befand. Er würde in Zukunft sehr aufpassen müssen. Doch jetzt mußte er nach Hause, und zwar sofort. Wie würde Ann reagieren? Er fühlte sich wieder müde, wenn er daran dachte, daß sie dasselbe sagen würde, ob er jetzt käme oder erst in einer Stunde oder auch morgen früh, denn er war um acht Uhr nicht zu Hause gewesen. Das allein zählte. Er würde ihr von diesen Anfällen erzählen müssen, dann würde sie es vielleicht verstehen. Doch nein, sie würde es nicht verstehen, sie würde ihm das nie verzeihen. Noch nicht einmal diese Bitte könne er ihr erfüllen, das würde sie ihm sagen. Sie würde es ihm ganz ruhig sagen, und das Echo dieser Ruhe würde dann in den nächsten Wochen immer tiefer in sie eindringen. Die Tatsache, daß er sich seit Jahren ihrer gesellschaftlichen Etikette gefügt hatte, würde dabei gar kein Gewicht haben. Er hatte sich dieses eine Mal nicht gefügt, und es war immer das eine Mal, das zählte.
»Hier.« Der Mann kam mit einem Tablett zu ihm an die Couch. »Ich habe ihn stark gemacht. Möchten Sie viel Zucker haben?«
»Einen Teelöffel, bitte.« Als er dem Mann die Tasse abnahm, sagte er: »Ich muß unbedingt nach Hause. Ich würde Sie nur bitten, so freundlich zu sein und mir ein Taxi zu bestellen, denn ich glaube, ich kann meinen Wagen im Augenblick nicht selbst fahren.«
»Sie haben ein Auto unten?«
»Ja.« Er nickte dem Mann zu.
»Gut, dann sage ich Ihnen, was wir tun werden. Ich werde Sie in Ihrem Wagen nach Hause bringen, und Cissie kann in meinem hinterherfahren und mich wieder mit zurücknehmen. Wie wäre das?« Er blickte Cissie an, die schnell sagte: »Ja, das ist eine famose Idee.«
»Kann ich mit dir kommen, Mam?«
»Ja, ja, natürlich.« Sie nickte ihrem Sohn zu.
»Ich mache Ihnen viel zuviel Scherereien.« John versuchte von der Couch aufzustehen, und als sie sich zu ihm beugte, um ihm zu helfen, wurde ihm ganz heiß vor Verlegenheit. Er wollte sagen: ›Nein, nein, tun Sie das doch nicht‹, doch das hätte alles nur noch verschlimmert. Daher ließ er es zu, daß sie ihm dabei half, die Beine auf den Boden zu stellen. »Übrigens, was für einen Wagen fahren Sie?« fragte der Mann.
»Einen Rover 2000.«
»Wirklich? Fabelhaft, das wird ein Spaß für mich werden, den zu fahren. Man hört ja allgemein, wie toll die sind. Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich ihn fahre, oder? Ich bin ein guter Fahrer, das gehört zu meinem Beruf.«
»Davon bin ich überzeugt, und es ist mir eine Freude, wenn Sie ihn fahren. Vor allem heute Abend.« Er lächelte schwach.
Sie waren allein im Zimmer, nachdem Cissie mit ihrem Jungen verschwunden war, um ihn warm anzuziehen. Der Mann nutzte die Gelegenheit, seine Gastgeberin zu rühmen. Er beugte sich zu John hinunter und flüsterte vertraulich: »Die Cissie ist ein guter Kerl, wirklich unübertrefflich. Von der Sorte gibt es heute nur noch wenige. Ein fabelhafter Kumpel.« Er nickte bekräftigend mit dem Kopf und kniff ein Auge zu.
Das alles konnte viel bedeuten, doch fühlte John sich nicht in der Lage, darüber weitere Gedanken zu verlieren.
Er stand auf und versuchte, das Gleichgewicht zu halten. Er fühlte sich immer noch etwas benommen. Sein Mantel war zerknittert, und er strich ihn mit den Händen glatt und knöpfte ihn bis zum Kragen zu.
Pat und seine Mutter kamen nun ins Zimmer zurück. Strahlend krähte der Junge: »War es nicht ein Glück, daß ich wegen der Eiscreme rauf gegangen bin?«
John blickte über den blonden Schopf in die leuchtenden braunen Augen und wiederholte verständnislos:
»Eiscreme?« Er konnte nicht verstehen, was das Kind meinte.