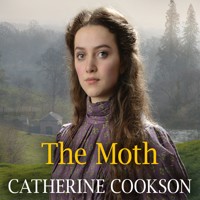Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwischen Krieg und Frieden: Der mitreißende Liebesroman »Sturmwolken über dem River Tyne« von Catherine Cookson als eBook bei dotbooks. Kann Liebe alle Hindernisse überwinden? In den dunkelsten Nächten des Krieges hütet der junge Soldat Geoff diese Erinnerung wie einen Schatz: Als er die vierzehnjährige Nachbarstochter Lizzie vor einem grausamen Schicksal bewahrte und damit ein unzerbrechliches Band zwischen ihnen knüpfte. Als Geoff 1943 in die nordenglische Heimat zurückkehrt, ist aus Lizzie eine schöne junge Frau geworden – doch Geoff muss die Tochter des reichen Gutsverwalters Bradford-Brown heiraten, wenn er seiner Familie ein gutes Leben ermöglichen will. Seine Liebe zu Lizzie scheint unmöglich … obwohl sie die einzige ist, die seine tiefen Verletzungen aus dem Krieg heilen könnte. Aber dürfen sie es wagen, entgegen aller Vernunft füreinander zu kämpfen? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Schicksalsroman »Sturmwolken über dem River Tyne« der Bestsellerautorin Catherine Cookson wird Fans von Lia Scott und »Downton Abbey« begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Kann Liebe alle Hindernisse überwinden? In den dunkelsten Nächten des Krieges hütet der junge Soldat Geoff diese Erinnerung wie einen Schatz: Als er die vierzehnjährige Nachbarstochter Lizzie vor einem grausamen Schicksal bewahrte und damit ein unzerbrechliches Band zwischen ihnen knüpfte. Als Geoff 1943 in die nordenglische Heimat zurückkehrt, ist aus Lizzie eine schöne junge Frau geworden – doch Geoff muss die Tochter des reichen Gutsverwalters Bradford-Brown heiraten, wenn er seiner Familie ein gutes Leben ermöglichen will. Seine Liebe zu Lizzie scheint unmöglich … obwohl sie die einzige ist, die seine tiefen Verletzungen aus dem Krieg heilen könnte. Aber dürfen sie es wagen, entgegen aller Vernunft füreinander zu kämpfen?
Über die Autorin:
Dame Catherine Ann Cookson (1906–1998) war eine britische Schriftstellerin. Mit über 100 Millionen verkauften Büchern gehörte sie zu den meistgelesenen und beliebtesten Romanautorinnen ihrer Zeit; viele ihrer Werke wurden für Theater und Film inszeniert. In ihren kraftvollen, fesselnden Schicksalsgeschichten schrieb sie vor allem über die nordenglische Arbeiterklasse, inspiriert von ihrer eigenen Jugend. Als uneheliches Kind wurde sie von ihren Großeltern aufgezogen, in dem Glauben, ihre Mutter sei ihre Schwester. Mit 13 Jahren verließ sie die Schule ohne Abschluss und arbeitete als Hausmädchen für wohlhabende Bürger sowie als Angestellte in einer Wäscherei. 1940 heiratete sie den Gymnasiallehrer Tom Cookson, mit dem sie zeitlebens zurückgezogen und bescheiden lebte. Ihren ersten Roman veröffentlichte sie 1950; 43 Jahre später wurde sie von der Königin zur Dame of the British Empire ernannt und die Grafschaft South Tyneside nennt sich bis heute »Catherine Cookson Country«. Wenige Tage vor ihrem 92. Geburtstag starb sie als eine der wohlhabendsten Frauen Großbritanniens.
Bei dotbooks veröffentlichte Catherine Cookson ihre englischen Familiensagas »Die Thorntons – Sturm über Elmholm House«, »Die Lawsons – Anbruch einer neuen Zeit«, »Die Emmersons – Tage der Entscheidung«, »Die Coulsons – Schatten über Wearcill House« und »Die Masons – Schicksalsjahre einer Familie«.
Bei dotbooks erscheinen außerdem ihre Schicksalsromane »Das Erbe von Brampton Hill«, »Der Himmel über Tollet’s Ridge«, »Sturm über Savile House« und »Der Hutsalon am Willington Place«.
***
eBook-Neuausgabe Mai 2024
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1995 unter dem Originaltitel »A Ruthless Need« bei Bantam Press, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1997 unter dem Titel »Der Himmel so hoch« im Heyne Verlag, München.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1995 The Catherine Cookson Charitable Trust
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1997 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/AN NGUYEN, Helen Hotson, MNStudio und AdobeStock/masson
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-032-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Sturmwolken über dem River Tyne« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Catherine Cookson
Sturmwolken über dem River Tyne
Roman
Aus dem Englischen von Lydia Nahas
dotbooks.
Abschiednehmen ist alles,
was wir vom Himmel wissen
und was wir von der Hölle brauchen.
Emily Dickson (1830-1886)
Teil 1
Auf Urlaub, 1937
Kapitel 1
»O Geoff, mit diesem Regenmantel und der schwarzen Kappe siehst du aus wie einer dieser komischen Spione in den Kinofilmen. Dein Vater wirkt in diesen Sachen ganz anders.«
»Das tut er nicht, aber bei ihm hast du dich daran gewöhnt.«
»Wie auch immer ‒ warum ziehst du das überhaupt an? Es ist doch dunkle Nacht, und es regnet auch nicht.«
Der große junge Mann beugte sich zu seiner Mutter hinab, die ihm gerade bis zur Schulter reichte, und flüsterte ihr verschwörerisch ins Ohr: »Zu Ihrer Information, Mrs. Fulton, wie Sie wissen, bin ich nun seit vier Jahren bei der Armee, wo ein liebenswürdiger Korporal mir schon in den ersten Wochen eintrichterte, daß jedes Messingteilchen meiner Uniform glänzen müsse, um sozusagen wie ein Licht vor mir herzustrahlen. Und das sogar am hellichten Tag! Aber was glauben Sie, sagte der alberne Kerl einige Zeit später? Er behauptete: ›Was immer eure vertrottelten Lehrer euch beigebracht haben, eines ist gewiß: Gewehrkugeln prallen nicht an Messing ab. Also, ihr Idioten, schwärzt eure Messingknöpfe oder verdeckt sie, wenn der Mond scheint!‹«
»Ach du!« Seine Mutter hängte ihren Gehstock an die Rückenlehne eines Stuhls. Dann packte sie ihren Sohn am Kragen des Regenmantels und versuchte, ihn zu schütteln. »Du wirst dich wohl nie ändern«, meinte sie vorwurfsvoll. »Immer nur Witzeleien! Und außerdem, da du nun selbst Sergeant bist, was bringst du deinen Jungs bei?«
Geoff ergriff ihre Hände und antwortete in gespieltem Ernst: »Ich würde nicht im Traum daran denken, den Jungs etwas vorzuschreiben. Heutzutage fragt man sie höflich, zum Beispiel so: ›Soldat Reginald Johnson Smith, würde es Ihnen etwas ausmachen, Ihre Ausrüstung etwas ordentlicher zu halten; sozusagen als Vorbild für Ihre Kameraden?‹«
»Ach du!« sagte sie noch einmal und entzog ihm ihre Hände. »Manchmal wäre ich dankbar, wenn du ein wenig ernsthafter sein und mir erzählen würdest, was wirklich vor sich geht.« Sie griff nach ihrem Stock und humpelte zum Klavier.
Er starrte ihr nach. Von hinten wirkte sie so rank und schlank wie ein junges Mädchen. Er erinnerte sich daran, wie sie ausgesehen hatte, als er zwölf war. Wenn er sie mit den Müttern seiner Mitschüler verglichen hatte, war er immer stolz auf sie gewesen. Manchmal war sie auf einem ihrer Ausritte an der Schule vorbeigekommen; dann hatte sie ihn zu sich aufs Pferd gehoben, und er hatte sich dadurch stets in ein Zeitalter versetzt gefühlt, in dem Ritter in schimmernder Rüstung junge Damen erretteten, indem sie sie zu sich in den Sattel zogen und mit ihnen davongaloppierten. Es hatte ihm nichts ausgemacht, daß seine Mutter die Dame war und er der Hinaufgehobene; er hatte sich dabei immer wundervoll gefühlt. Doch eines Tages war sie zu schnell geritten und zu hoch gesprungen. Es war glimpflich ausgegangen: Sie hätte ihr Leben lang gelähmt bleiben können. Doch ihre Hüfte war irreparabel verletzt, und mit der Zeit war eine Arthritis dazugekommen. Trotzdem schien sie, zumindest nach außen hin, immer munter. Wie es wirklich in ihr aussah, konnte er nur ahnen. Er tröstete sich jedoch damit, daß sie außer ihrem Ehemann, der sie liebte, noch ihre Musik hatte.
Während sie sich nun auf den Klavierstuhl setzte, sagte sie lachend: »Du glaubst doch nicht, daß du Ted Honeysett erwischst, oder?«
»Weshalb sollte ich sonst rausgehen?« Geoff ging auf sie zu. »Ich sage dir, ich habe ihn gestern gesehen, wie er mit undurchdringlicher Miene einen großen Aktenkoffer vom Gepäckträger seines Fahrrads hob und damit im Hintereingang des Hotels in Durham verschwand. Und als er dann wieder herauskam, sah er so selbstgefällig aus wie eine Katze, die heimlich Sahne geschleckt hat.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, wie Ted Honeysett jemals selbstgefällig aussehen könnte. Und was würdest du überhaupt mit ihm anstellen, wenn du ihn schnappst?«
»Ich würde ihn Gottesfurcht lehren!«
»Ich bitte dich«, Bertha verdrehte die Augen, während ihre geschürzten Lippen Spott verrieten, »du kennst Ted schon dein ganzes Leben; kannst du dir vorstellen, daß irgend jemand ihm Gottesfurcht beibringen kann?«
»Allerdings! Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte ihm zum Beispiel androhen, ihn nach Low Tarn Hall zu schleifen.«
»Ach«, lachte sie, »ich kann mir das richtig vorstellen. Aber wie ich dich kenne, wäre es dir noch lieber, wenn du Mr. Ernest Badford-Brown zum Fluß schleifen und seinen Kopf unter Wasser tauchen könntest.«
»Vergiß nicht, Mam, ich bin vier Jahre weggewesen. Da kann viel passieren. Ich könnte meine Meinung über diesen Herrn geändert haben.«
Lächelnd sagte seine Mutter: »Du nicht. Weißt du noch, wie du aus seinem Hof gegangen bist und ihm gesagt hast, wohin er sich seinen Job stecken soll? Du warst damals erst achtzehn. Und weißt du was?« Ihr Gesicht wurde ernst, als sie fortfuhr: »Er hätte deinen Vater rausgeschmissen, wenn er nicht immer so zuverlässig für ihn gearbeitet hätte. Ja, es stand auf Messers Schneide! Und ich sage dir noch etwas: Es ist ein Glück, daß dieses Haus nicht zum Gut gehört, sonst hätte er uns gekündigt wie der Familie Rice. Er kann sich nicht damit abfinden, daß es unser Eigentum ist. Ständig versucht er deinen Vater zum Verkauf zu überreden. Das ist ein weiterer Grund, warum er ihn behält. Denn nachdem du damals diesen Aufruhr verursacht hast ‒ und es war ein Aufruhr! ‒, haben alle Männer mehr Lohn verlangt. Sie haben nicht alles bekommen, was sie wollten, aber ein bißchen mehr war es doch; und Mr. Bradford-Brown hat nur nachgegeben, damit sein Name nicht noch schlechter dastünde, als es ohnehin schon der Fall war. Und denk dran, was er mit den Rices gemacht hat! Wenn sie nicht freiwillig ‒ oder besser gesagt ohne Aufhebens ‒ gegangen wären, hätte er sie alle gekündigt: Peter, den jungen Michael, Sally und alle anderen. Du weißt, wie schwer es ist, Arbeit zu finden, und dann Bella, die so kränklich ist ‒ was blieb ihnen übrig, als auszuziehen? Und das alles, weil Wochenendhäuser viel Geld einbringen. Er hat jahrelang keinen Penny in die Rice-Kate gesteckt, aber kaum waren sie weg, ließ er eine Wasserleitung legen, Strom, und wer weiß was noch. Und weißt du, wieviel er dafür bekommen hat, samt einem Morgen Land und den Fischereirechten?«
»Nein.«
»Viertausend Pfund! Ein Mann namens Kidderly hat es gekauft. Er taucht nur an den Wochenenden auf und scheint ein wenig merkwürdig zu sein. Jedenfalls«, sie lächelte wieder, »wenn du Ted erwischen willst, solltest du dich beeilen, sonst kommst du vor Mitternacht nicht zurück.«
Geoff hob ein Notenheft auf und blätterte darin. »Das macht nichts«, meinte er. »Vielleicht ändere ich meine Meinung.« Bertha antwortete nicht sofort, sondern sah ihn einige Sekunden lang unverwandt an. Dann fragte sie ruhig: »Was ist los? Langweilst du dich?«
Er blickte von dem Heft auf. »Ja, ich glaube, ein wenig schon.«
»Warum gehst du nicht runter zum Gasthof und unterhältst dich mit den Männern?«
Geoffrey schob sein Kinn vor. »O Mam, ich war in den letzten fünf Tagen zweimal dort; und was mußte ich mir anhören? Ronald Coleman, der versuchte, seinem Namensvetter nachzueifern und mit seinen Eroberungen prahlte. Es scheint, daß seine Affären um so aufregender werden, je weiter er sich von zu Hause entfernt. Und Peter Campbell, der damit angibt, daß er in einer Stunde mehr Ziegel legen kann, als in der Mauer von Jericho verbaut waren. Ach ja, und May«, ‒ sein Ton veränderte sich ‒ »die gute May hinter der Bar, die die Bierkrüge mit ihren Brüsten auf dem Tresen herumschiebt. Puh!« Er schüttelte den Kopf und fuhr in gespielt nachdenklichem Ton fort: »Ich weiß nicht, wie sie es macht. Sie muß sie ausgestopft haben. Sie können sich unmöglich von selbst zu einer solchen Größe ausgewachsen haben. Schade, daß meine Jungs sie nicht sehen können; für einen Blick darauf würden sie gerne in den Bau gehen. Und dann ihr Harry, der versucht, den Tropfen an seiner Nase zu bremsen, wenn er ein Bier zapft …«
»Hör auf, hör auf!« Bertha Fulton hielt sich die Seiten, während ihr vor Lachen die Tränen über die Wangen rollten. »So siehst du sie also?«
»So sind sie, Mam; nichts hat sich verändert. Und dann gibt es die, die nur mal vorbeischauen, um ihre Klagelieder zu singen. Am schlimmsten sind Hobson und Ryebank. Sie stöhnen über die Mühsal des Farmerlebens und die Hungerpreise, die sie für ihre Produkte erhalten. Und doch stelle ich fest, daß Hobson eine riesige Scheune gebaut hat, und daß Ryebank irgendeinen neumodischen Apparat zum Melken in seinem Kuhstall installieren will. Arme, hungrige Mittelklassestrolche.«
Bertha hörte auf zu lachen, wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und stellte fest: »Du wärst froh, wenn dein Urlaub vorüber wäre und du wieder wegfahren könntest, nicht wahr?«
»O nein, Mam, so ist es nicht.« Geoff ging zu seiner Mutter und kniete vor ihr nieder. Dann ergriff er ihre Hände und sagte: »Du und Dad seid das einzige in meinem Leben, was sich nie verändert. Bei jedem Urlaub hoffe ich, daß alles gleichgeblieben ist. Aber ich stelle jedesmal fest, daß es nicht so ist, außerhalb dieses Hauses jedenfalls, und das macht mich oft so wütend, daß ich um mich schlagen möchte. Ich vermute, daß das von den Erfahrungen kommt, die ich draußen mache. Das Leben ist dort ganz anders. Dieses Fleckchen Erde könnte ebensogut auf einem anderen Planeten liegen. Weißt du das, Mam?«
Bertha blickte auf ihre Hände und fragte still: »Wäre es anders, wenn du nicht erfahren hättest, daß Janis Bradford-Brown sich verlobt hat?«
Langsam ließ er ihre Hände los und richtete sich auf. Er knöpfte das Revers des Regenmantels unter dem Kragen fest. »O Mam, wovon sprichst du? Das war nur ein Traum.«
»Ich glaube, vor zwei Jahren war es kein Traum für dich.«
»Natürlich war es das.« Geoff runzelte die Brauen über seinen tiefliegenden braunen Augen. »Welche Chance hatten wir denn? Es war für uns beide nur eine Art Zeitvertreib, eine heimliche Erregung, um gegen die Langeweile anzugehen. Es begann, als ich sechzehn war, das weißt du. Es war die heimliche Freude, ihren Vater zu hintergehen, die uns zusammenhielt; denn sie liebte ihn sicher ebensowenig wie ich, da bin ich sicher. Und stell dir vor, was geschehen wäre, wenn er es bemerkt hätte. Daher waren wir so vorsichtig wie möglich. Also mach dir keine Gedanken darüber, Mam.« Er nickte ihr zu, aber Bertha war nicht so leicht zufriedenzustellen. »Und warum hat es dann so lange gedauert?« wollte sie wissen. Geoff schob das Kinn vor und legte seinen Zeigefinger an seine große, schmale Nase. »Wahrscheinlich immer noch dieselbe heimliche Erregung, und noch dazu, als ich Soldat wurde, tapfer und mutig … Erinnerst du dich an mein kleines Lied?« Mit seinem klaren Tenor begann er zu singen:
»Ich fürchte mich vor gar nichts mehr,
auch wenn das manchmal besser wär.
Doch tauche ich im tiefen Meer,
dann fürchte ich mich wirklich sehr.«
»Oh, hör auf und verschwinde!« rief Bertha.
»Macht es dir nichts aus, allein zu bleiben?«
»Doch. Dein Vater fehlt mir sehr. Es ist das erstemal seit Jahren, daß er über Nacht weg ist. Typisch, daß dein Onkel Henry ausgerechnet während deines Urlaubs sterben mußte! Henry tat immer alles zum unpassendsten Zeitpunkt. Ich wette, daß seine letzten Worte zu deinem Vater waren: ›Warum mußtest du unbedingt heiraten?‹ Er hat John niemals verziehen, daß er mich geheiratet hat, weißt du das? Nachdem er deinen Dad aufgezogen hat, fühlte er sich wie Vater und Mutter gleichzeitig. Eines ist jedenfalls sicher: Dein Dad wird nicht einen Penny von dem erben, was Henry über die Jahre erspart und zusammengekratzt hat, und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich es sonst ausgeben könnte … Also, gehst du jetzt oder nicht? Ich will schließlich noch in dieser Nacht zu Bett gehen.«
»Du brauchst doch nicht zu warten, bis ich zurückkomme.«
»Ich werde aufbleiben, bis du wieder da bist. Also geh jetzt! Mach wenigstens einen kurzen Spaziergang, damit du wieder einen klaren Kopf bekommst«, drängte sie ihn sanft.
Geoff nickte ihr zu; dann ging er durch den langen schmalen Raum, durchquerte den ebenso langen wie schmalen Vorraum, betrat die Küche und gelangte durch die Hintertür auf den großen, gepflasterten Hof, der auf einer Seite von verlassenen Pferdeboxen und Kuhställen flankiert war.
Er nahm nicht den kurzen Weg zur Straße, sondern ging über den Hof auf ein angrenzendes Feld. Dort knipste er seine Taschenlampe an und suchte sich einen Weg über die Weide. Diese Weide war alles, was von der einst blühenden Farm seines Großvaters mütterlicherseits geblieben war.
Er sprang über die niedrige Mauer und befand sich nun auf einer schmalen Landstraße, die auf der gegenüberliegenden Seite von einem durch eine Hecke überwucherten Drahtzaun begrenzt wurde.
Einen Moment lang war er unentschlossen, ob er durch eine der Zaunlücken die angrenzenden Privatgrundstücke betreten oder einfach nur die Straße entlangspazieren sollte.
Wenn er seinem ersten Einfall folgen und Ted schnappen wollte, gäbe es zumindest etwas zu lachen. Geoffs Vater hatte es nie geschafft, das behauptete er jedenfalls; aber seine Mutter hatte erzählt, daß Dad den Wilddieb mehr als einmal erwischt, ihn jedoch gegen Kaution wieder laufengelassen hatte wegen der Kinderschar, die dieser aufzuziehen hatte. Doch das war einige Zeit her. Teds Ältester war jetzt siebzehn und Katy fünfzehn; beide arbeiteten schon. Drei gingen noch zur Schule und einige waren noch kleiner. Während des Winters standen die Dinge immer schlecht. Im Frühling und Sommer gab es für ›das Wiesel‹, wie Ted überall genannt wurde, alle möglichen Gelegenheitsarbeiten auf den Farmen, doch war es allgemein bekannt, daß Ted ein lukratives Geschäft unter der Hand allemal lieber war als ehrliche Arbeit. Das Schwarzfischen von Lachs und Forelle war äußerst gewinnbringend, und Ted verstand sich darauf.
Der Wasserstand im Fluß war ziemlich hoch. Wahrscheinlich würde Ted jetzt an der Brücke bei Warren Corner zu finden sein. Die Brücke lag unterhalb der früheren Kate der Rices, in der jetzt an den Wochenenden der Städter wohnte.
Während er unter dem Zaun hindurchkroch, fragte sich Geoff, was wohl passieren würde, wenn er jemandem vom Herrenhaus begegnen würde, möglicherweise sogar dem Gutsbesitzer. Nun, er konnte sich darauf hinausreden, daß er anstelle seines Vaters nach dem Rechten sähe. Was sonst?
Als er den Pfad erreichte, der neben dem Fluß herlief, wurde ihm klar, daß er genausogut im hellen Licht stehen könnte, denn seine dunklen Umrisse mußten gegen den Nachthimmel deutlich auszumachen sein. Wenn er die Brücke unbemerkt erreichen wollte, so mußte er sich hinter der Kate anschleichen.
Er hielt sich dicht unter den Bäumen, bis er zu dem Zaun kam, der das Häuschen umgab. Plötzlich glaubte er, einen Schrei zu hören, und hielt inne.
Es war windstill; nicht einmal die Zweige in den Bäumen raschelten. Nachdem alles ruhig blieb, bewegte er sich vorsichtig weiter. Kurz darauf vernahm er wieder denselben Laut ‒ es klang fast wie ein Hilferuf. Vielleicht hatte der neue Besitzer eine Besucherin mitgebracht, und sie hatten jetzt ein wenig Spaß miteinander.
Geoff ging weiter am Zaun entlang und befand sich schon fast am Flußufer, als ein erneuter Schrei aus dem Haus ertönte. Diesmal erkannte er am Klang der Stimme, daß, wer auch immer geschrien hatte, alles andere als Lust empfand.
Von seinem Standort aus sah er, daß in einem der Fenster im Erdgeschoß Licht brannte, doch er war zu weit weg, um jemanden dahinter zu erkennen.
Wenn er die Brücke erreichen wollte, ohne daß Ted ihn sah, mußte er die verbleibenden zehn Yards äußerst vorsichtig überqueren.
In geduckter Haltung wollte er den ersten Schritt tun, als eine Folge von Schreien ihn bewog, sich aufzurichten und über den Zaun hinweg zur Vordertür des Häuschens zu spähen, die aufgeflogen war. Gegen das Licht zeichneten sich zwei miteinander ringende Schatten ab.
Eine junge Stimme rief wie in höchster Not: »Nein, nein! Lassen Sie mich los! Nein, ich will nicht!« Geoff erkannte die Gestalt eines Mädchens, das sich verzweifelt gegen einen Mann wehrte, der versuchte, sie ins Haus zurückzuzerren.
Anstatt zum Tor zu laufen, schwang Geoff sich über den Zaun und erreichte mit wenigen Schritten das kämpfende Paar. Er sah sofort, daß der Mann bis zum Gürtel nackt war. Jetzt war es der Mann, der einen überraschten Schrei ausstieß, als Geoff ihn mit eiserner Hand am Hals packte und ihm einen Hieb in die Weichteile versetzte. Ein weiterer Schlag unter das Kinn streckte ihn rücklings zu Boden.
Erst jetzt wandte Geoff sich dem verschreckten Mädchen zu, das am Türpfosten kauerte und mit beiden Händen die Vorderseite ihres zerrissenen Kleides zusammenhielt. Er beugte sich zu ihr hinab und fragte leise: »Alles in Ordnung?« Sie schauderte und schluckte schwer.
Sanft legte er seine Hand auf ihre Schulter und drehte sie zum Licht. »Du bist doch eine von den Gillespies, nicht wahr?« fragte er.
Sie schluckte wieder und nickte.
»Und was machst du hier um diese Zeit?«
Als sie nicht antwortete, meinte er: »Na, komm. Hast du einen Mantel?«
Auf seine Worte hin wandte sie sich um und stolperte ins Zimmer zurück. Geoff betrachtete inzwischen die Gestalt, die ausgestreckt auf den rohen Verandaplatten lag. Er kniete nicht neben dem Mann nieder und legte auch sein Ohr nicht an dessen Herz. Statt dessen beugte er sich nur zu ihm hinab, befühlte kurz seine Rippen und nickte.
Das Mädchen, in einen Mantel gewickelt, kam wieder heraus. Geoff ging auf sie zu, faßte sie am Ellenbogen und führte sie zum Tor.
Draußen sagte er zu ihr: »Komm jetzt, ich bring’ dich zu deiner Mutter nach Hause.«
Natürlich wußte er, daß Minnie Gillespie nicht die Mutter des Mädchens, sondern seine Stiefmutter war; und er wußte auch, daß Arthur Gillespie diese Frau, die seine zweite war, vor einem Jahr hatte sitzenlassen ‒ mit ihren drei Kindern aus erster Ehe, ihrem gemeinsamen Kind und den beiden Mädchen, die Arthur aus seiner ersten Ehe mitgebracht hatte.
»Welches von den Mädchen bist du?« fragte Geoff.
»Ich bin Lizzie«, antwortete sie und warf einen Blick zurück auf das Häuschen. »Ist er tot?«
»Nein, er wird es überleben. Aber jetzt komm, deine Mutter macht sich gewiß schon Sorgen. Was hast du hier überhaupt gesucht um diese Zeit?«
Lizzie antwortete nicht, sondern ging stumm neben ihm her. »Ich habe dich gefragt, was du so spät hier gemacht hast?« wiederholte Geoff.
»Sie hat mich geschickt.«
»Dich geschickt? Wozu?«
»Um ihm eine Pastete zu bringen.«
»Oh!« Er schaute sie nicht an, als er weiterfragte: »Warum hat sie dich nicht am Tag geschickt?«
Da das Mädchen nicht antwortete, fügte er hinzu: »Oder deine Schwester?«
»Midge ist letzten Monat abgehauen.«
»Oh«, machte Geoff wieder und schwieg einige Zeit, bevor er weiterfragte. »Hat deine Mutter sonst Midge mit den Pasteten geschickt?«
Das Mädchen zögerte, bevor es mit leiser Stimme antwortete. »Ja.«
»Wie oft ist Midge zur Kate gegangen?«
»Sie ist immer nachts zum Saubermachen hingegangen, wenn sie in Bexleys Laden Feierabend hatte.«
»Warum ist sie weggelaufen?«
»Seinetwegen«, lautete die kurze Antwort. »Sie wollte nicht, daß er mit ihr herummachte.«
»Guter Gott!« murmelte Geoff deutlich hörbar.
Er wußte alles über Minnie Gillespie, geborene Collier. Sie war eine Schlampe, aber er hatte nicht gedacht, daß es so arg war. Sie hatte mit siebzehn geheiratet und mit ihrem ersten Mann eine schlimme Zeit durchgemacht. Das hatte sie in die Trunksucht getrieben. Allerdings, so dachte er, gehörte sie zu der Sorte, die in jedem Fall zu trinken begonnen hätte. Was sie sich selbst damit antat, war ihre eigene Angelegenheit, doch diese zwei Mädchen zu verderben, stand auf einem anderen Blatt.
»Wie oft bist du dort gewesen?«
»Heute zum ersten Mal.«
»Hast du damit gerechnet, daß er dich belästigen würde?«
»Nein.« Lizzies Stimme klang ganz dünn. »Nein.«
»Hat deine Schwester dir nicht gesagt, was passiert ist, als sie hinging … mit einer Pastete am Samstagabend?«
Es dauerte einen Augenblick, bevor Lizzie antwortete. »Nein. Sie hat nie etwas gesagt, außer, daß sie es nicht leiden konnte, wenn er mit ihr herummachte. Aber ich dachte, sie redet von der Arbeit ‒ daß er pingelig wäre oder so. Er zahlte ihr fünf Shilling.«
»Soso! Fünf Shilling!«
Etwas in Geoffs Stimme reizte Lizzie zum Widerspruch. »Nun, sie hat aufgeräumt und all so was. Sie war gut bei der Hausarbeit.«
Ich wette, das war sie, dachte er bei sich; dann fragte er: »Wie alt bist du?«
»Vierzehn.«
»Gehst du noch zur Schule?«
»Nein, ich bin gerade fertig geworden.«
»Was willst du jetzt anfangen?«
»Meine Mutter sagt, ich soll zu ihrer Schwester nach Gateshead gehen und dort in einer Fabrik arbeiten. Man kann dort fünfzehn Shilling in der Woche verdienen.«
»Willst du dorthin gehen?«
»Nein. Dort ist es schlechter als hier. Es ist dreckig, und bei meiner Tante ist es noch schlimmer als daheim. Sie sind zu neunt. Aber hier gibt es keine Arbeit. Mrs. Bexley hat jemand anders eingestellt, nachdem Midge gegangen ist. Und Mam sagt, sie will die Hälfte von meinem Lohn, weil ich mithelfen muß, die Familie zu ernähren, nachdem mein Dad weggelaufen ist; und die andere Hälfte soll ihre Schwester bekommen.«
Sie hatten das Flußufer verlassen, durchquerten ein Wäldchen und standen jetzt auf der Hauptstraße. Geoff blieb stehen und sagte: »Jetzt kommst du allein zurecht.«
Lizzie blickte zu ihm auf, konnte aber sein Gesicht zwischen dem Mantelkragen und dem herabgezogenen Mützenschirm nicht erkennen. »Wer sind Sie?« fragte sie.
»Oh«, antwortete er leichthin, »ich bin ein Ritter in schimmernder Rüstung, nur kann man das wegen des Mantels nicht sehen.«
»Wohnen Sie hier in der Gegend?«
»Ja, ich wohne hier. Üblicherweise reite ich um diese Zeit auf meinem Schlachtroß umher, aber heute hat es ein lahmes Bein.«
»Sie machen Spaß.« Ihre Stimme klang ausdruckslos.
»Ja, ich mache Spaß«, antwortete Geoff und fragte dann: »Glaubst du, du bekommst Schläge, wenn du heimkommst?«
Ihr Gesicht bewegte sich im Schatten. »Sie wird es versuchen. Aber ich habe ihr gesagt, wenn sie mich noch einmal schlägt, werde ich davonlaufen wie Midge. Aber«, ‒ sie hielt inne ‒ »ich würde es nicht tun. Ich könnte es nicht, weil ich ja nirgends hin kann.«
»Wohin ist Midge denn gegangen?«
»Nach Newcastle. Sie hat Freunde dort. Sie wollte mir nichts über sie erzählen, aber sie hat versprochen, mir zu schreiben. Und das wird sie auch. Wenn sie etwas verspricht, hält sie es. So ist sie. Sie hat mir schon vor Wochen gesagt, daß sie weglaufen wird.«
»Und du, hast du keine Freunde?«
»Doch, hier in der Gegend. Aber da kann ich nicht hin, Mam würde mich dort finden.«
»Also wirst nach Gateshead in die Fabrik gehen?«
»Ja, ich glaube schon.«
»Und wann sollst du gehen?«
»Mam wartet auf Nachricht von ihrer Schwester, wenn eine Stelle frei ist.«
»Also könnten wir uns wieder begegnen.«
»Aber wie kann ich Sie erkennen?«
»Das geht schon in Ordnung, denn ich werde dich erkennen. Außerdem wirst du mein Pferd bemerken, obwohl es immer noch hinken wird.«
»Sie machen gern Späße, nicht wahr?«
»Zumindest behaupten die Leute das. Jetzt geh heim, und paß auf dich auf.«
»Auf bald!«
»Auf bald.« Er blieb stehen, bis die schmächtige Gestalt mit der Dunkelheit verschmolz. Dann drehte er sich langsam um und schlug den Weg nach Hause ein. Nach etwa einer halben Meile, als er sich dem Telefonhäuschen bei Grant’s Corner näherte, sah er das Flackern einer Taschenlampe. Das war nichts Ungewöhnliches ‒ jemand kam nach einem Telefongespräch aus dem Häuschen. Die Gestalt bewegte sich auf ihn zu, der Lichtstrahl richtete sich auf sein Gesicht, und eine dünne Stimme, die zu dem mickrigen Körper des Sprechers paßte, fragte: »Machst wohl einen Spaziergang, Geoff?«
Geoff ließ sich Zeit mit seiner Antwort. »Ja, so könnte man es nennen, Mr. Honeysett. Ich mache einen Spaziergang, geradeso wie Sie.«
»Auf solchen Spaziergängen geschehen merkwürdige Dinge. Kannst du erraten, weswegen ich gerade telefoniert habe?«
»Ich habe keine Ahnung, Mr. Honeysett.«
»Ich habe diesen Wochenend-Landbewohner in einem bösen Zustand vor seinem Häuschen aufgefunden. Er konnte kaum kriechen, und ich glaube, sein Kiefer ist gebrochen. Ich habe gerade den Doktor angerufen. War wohl das beste. Irgend jemand muß ihm heftig zugesetzt haben. Was meinst du?«
»Ich bin der gleichen Meinung wie Sie, Mr. Honeysett. Man muß schon mit etwas Hartem in Berührung kommen, um sich den Kiefer zu brechen.«
»Da hast du recht. Ich frage mich, wie das wohl zugegangen ist.«
»Ich habe keine Ahnung. Ich war spazieren, wie Sie schon bemerkt haben. Wenn ich nicht für König und Vaterland kämpfe, bin ich nämlich ganz friedlich.«
Honeysett brach in ein Gelächter aus, das sich zu einem Meckern steigerte und in einem Prusten endete. »Wenn ich mich recht erinnere, warst du in deinen jungen Tagen, die noch gar nicht so lange her sind, nicht so friedlich. Wie ich hörte, bist du jetzt Sergeant und wirst bald ins Ausland versetzt?«
»Ja, so ist es wohl, Mr. Honeysett.«
»Einen Augenblick lang dachte ich, es wäre dein Vater, der da auf midi zukommt. Er kleidet sich immer so dunkel, wenn er seine Runden macht. Ich frage mich, wozu? Schließlich trägt er elefantengroße Stiefel, mit denen man ihn schon Meilen vorher kommen hört. Nun, ich muß zurück und nachsehen, wie es dem Idioten in dem Wochenendhaus geht. Wahrscheinlich muß er ins Krankenhaus, weil seine unteren Zähne beinahe zu seiner Nase herauskommen. Wir sehen uns wieder.«
»Auf Wiedersehen, Mr. Honeysett.«
Geoff wollte seines Weges gehen, als der Wilderer sanft hinter seinem Rücken sagte: »Gänseschmalz wirkt Wunder bei aufgeschürften Knöcheln.«
Geoffrey senkte den Kopf und biß sich auf die Lippen, um nicht laut loszulachen, dann setzte er seinen Weg fort. Man mußte den alten Taugenichts einfach mögen. Vermutlich hatte er die ganze Szene beobachtet. Vielleicht hatte er sogar gewußt, was sich abspielte, noch bevor Geoffrey aufgetaucht war. Aber nein, Ted hatte selbst Töchter; er hätte das nicht zugelassen. Geoff schnaufte verächtlich: Er war so sicher gewesen, den alten Fuchs unbemerkt aufspüren zu können, während dieser ihn wohl schon beobachtete, seit er das Grundstück betreten hatte.
Geoff hörte die Musik, noch bevor er das Haus seiner Eltern betrat. Er stand eine Weile draußen vor dem Wohnzimmerfenster und hörte zu. Seine Mutter spielte ein Stück von Grieg. Sie spielte mit Können und Gefühl. Seit seinem sechsten Lebensjahr hatte sie ihm Klavierunterricht erteilt, und er hatte regelmäßig geübt, bis er mit vierzehn Jahren anfing, im Herrenhaus zu arbeiten. Trotzdem war er ziemlich unmusikalisch, und er wußte, daß sie darüber enttäuscht war. Er spielte zwar technisch korrekt, doch war sein Spiel einem Mann in der Armee vergleichbar. Die Armee konnte jeden zum Soldaten ausbilden, wenn er sich nur an die Regeln hielt und den Befehlen gehorchte. Das reichte jedoch nicht aus, um ein guter Soldat zu werden ‒ dafür mußte man mit dem Herzen dabei sein.
Anders als seine Mutter war er nicht mit dem Herzen bei der Musik.
Bertha Fulton hörte auf zu spielen, als Geoffrey ins Wohnzimmer trat. Sie drehte sich auf ihrem Klavierhocker herum und fragte: »Nun, hast du ihn geschnappt?«
»So kann man es nicht direkt nennen, aber wir haben uns unterhalten.«
»Ihr habt euch unterhalten?« Sie erhob sich mühsam, griff nach ihrem Stock und wiederholte: »Ihr habt euch unterhalten?«
»Ja. Was ist so merkwürdig daran? Wir hatten einen ziemlich langen Schwatz.«
»Worüber?«
»Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich spazierte so am Fluß vor mich hin … übrigens, hast du zufällig Kaffee gekocht?«
Bertha nickte. »Er ist in der Kaffeemaschine. Aber erzähl mir, was los war.«
»Erst brauche ich etwas zu trinken. Wenn ich es mir recht überlege, brauche ich etwas Stärkeres als Kaffee.« Mit diesen Worten ging er zum Schrank und goß sich eine ordentliche Menge Whisky ein. Dann setzte er sich zu seiner Mutter, die sich inzwischen am Kamin niedergelassen hatte. Nachdem er an seinem Glas genippt hatte, fragte er: »Weißt du etwas über die beiden Mädels von Arthur Gillespie? Ich meine, seine eigenen, nicht die von Minnie.«
»Nur Gerede darüber, daß Midge, die ältere, weggelaufen sein soll. Sie war immer schon flatterhaft und körperlich gut entwickelt. Ich habe sie zuletzt vor etwa einem Jahr gesehen. Sie kommen selten bei uns vorbei. Warum fragst du nach ihnen?«
»Weil ich heute die jüngere, Lizzie, getroffen habe.«
»Was, die Kleine ist um diese Zeit draußen?«
»Ja, unterwegs in Nacht und Dunkelheit. Ist das nicht eine Schande? Aber noch schlimmer ist es, daß sie als Hure losgeschickt wird und es nicht weiß.«
»Was?« Schockiert starrte sie ihn an. »Wie kommst du auf so etwas?«
Er erzählte ihr, was vorgefallen war. Bertha schwieg einen Moment, nachdem er geendet hatte. Und dann sprach sie nicht über das Mädchen, sondern über ihn selbst. »Was hätte da passieren können, wenn du Kidderly richtig schlimm verprügelt hättest ‒ wenn du ihn umgebracht hättest?«
»Dann müßte ich natürlich die Folgen tragen. Aber ich bin sicher, daß jeder Richter mir mildernde Umstände zubilligen würde, denn«, seine Stimme wurde ernst, »das Mädchen hatte keine Ahnung. Verstehst du? Wie sie kämpfte ‒ und ich weiß nicht, wie lange er ihr schon zugesetzt hatte, bevor sie es schaffte, die Tür zu öffnen. Ich hörte sie zuerst schreien, als ich am rückwärtigen Zaun entlangging, doch da wußte ich nicht, was los war. Man sollte dieses Weib einsperren!«
»Das sollte man in der Tat. Wir müssen die Behörden informieren.«
»Ja. Aber was geschieht dann?«
Bertha dachte einen Augenblick lang nach. »Wenn nachgewiesen wird, daß sie mißbraucht wurde wie ihre Schwester, kommt sie wahrscheinlich in staatliche Obhut.«
»Ich glaube nicht, daß sie das gut finden würde. Sie ist vierzehn.« Er trank seinen Whisky aus und stellte das Glas beiseite. »Ich habe auf dem Heimweg ein wenig nachgedacht. Gestern hast du darüber gesprochen, daß du eine Hilfe benötigst. Dad versucht seit Jahren, dich davon zu überzeugen. Du kannst wirklich jemanden brauchen, der dir hilft. Das Haus ist groß: fünf Räume oben und vier im Erdgeschoß; abgesehen von all den Nebenräumen. Wie wäre es, wenn du das Mädchen einstellst?«
»Du meinst, diese Lizzie?«
»Ja, genau. Diese Lizzie. Wo die andere ist, weiß ich nicht. Ich könnte sie suchen.«
»Ach, bleib ernst. Du verlangst von mir, daß ich eine von der Gillespie-Bande hier unterbringe? Ihre Mutter ist eine stadtbekannte Schlampe und ihr Haus der reinste Schweinestall!«
»Die beiden Mädchen sind nicht von ihr. Und ich habe dich sagen hören, daß Arthur Gillespie ein anständiger Kerl wäre, den nur seine Frau soweit gebracht hat, davonzulaufen. Außerdem glaube ich, daß sie mit dem Mädchen ziemlich grob umspringt. Lizzie hat mir erzählt, sie habe ihrer Stiefmutter gedroht, wegzulaufen, wenn sie sie noch einmal schlägt. Sie ist sicher nicht so übel; und so viele junge Mädchen, die Arbeit als Haushaltshilfe suchen, gibt es hier nicht. Es ist jetzt noch genauso, wie zu der Zeit, bevor ich wegging: Sie wollen in modischen Geschäften arbeiten oder tippen lernen. Hausarbeit ist ihnen nicht gut genug. Außerdem wäre es mir eine Beruhigung zu wissen, daß du Gesellschaft hast, wenn ich nicht hier bin. Und soviel ich in der Dunkelheit von ihr gesehen ‒ oder besser: gehört ‒ habe, scheint sie ein recht verständiges kleines Ding zu sein.«
»Ich werde es überschlafen. Jedenfalls bin ich der Meinung, daß dein Dad auch ein Wörtchen mitzureden hat.«
»Oh, sei nicht albern, Mam! Dad rät dir doch schon seit Jahren dazu.«
»Ja, das stimmt. Aber es ist eine von den Gillespies; und Dad kennt sie besser als du oder ich. Und da sie so lange von dieser Frau aufgezogen worden ist, weiß man nicht, was sie von ihr gelernt hat ‒ ich meine, was Benehmen und solche Dinge angeht.«
»Nun, dann bist du die Richtige, um ihr etwas Besseres beizubringen, nicht wahr? Manieren und solche Dinge, und nicht zu vergessen die Moral. Jawoll, Oberfeldwebel Fulton!«
Seine Mutter winkte belustigt ab. »Los, ins Bett mit dir!«
»Bleibst du noch unten?«
»Ja, ich bin noch nicht müde«, sagte sie und stand auf. »Ich werde dir noch ein paar Schlaflieder spielen. Gute Nacht!«
Er umarmte sie und drückte sie an sich. Dann küßte er sie sanft auf die Wange und ging aus dem Zimmer.
Als Bertha wieder allein war, ging sie jedoch nicht gleich zum Klavier, sondern setzte sich nochmals in den Sessel. Sie faltete die Hände im Schoß und starrte ins Feuer. Ein junges Mädchen im Haus ‒ jemanden, den sie unterrichten und anleiten könnte. Sie hatte darüber schon oft nachgedacht, war aber davor zurückgeschreckt, da sie sich gefragt hatte, wo heutzutage noch ein Mädchen zu finden wäre, das sich unterweisen ließe und dem sie möglicherweise sogar das Klavierspiel beibringen könnte. Sie hatte immer unterrichten wollen, doch in der Gegend gab es niemanden, der Interesse daran hatte. Und für jemanden aus der Stadt war es zu abgelegen. Und nun, da Geoff in ein fremdes Land gehen würde, bliebe da eine Lücke in ihrem Herzen, die auch seine Briefe nicht vollständig ausfüllen könnten. Sogar John, ihr Ehemann, konnte das nicht, so sehr sie ihn auch liebte. Schließlich war er den größten Teil des Tages und oft auch abends draußen bei seiner Arbeit. Doch wenn es noch jemanden im Haus gäbe, ein junges Mädchen, dem sie Können und Wissen vermitteln und mit dem sie freundlich sprechen könnte, wären die vor ihr liegenden Tage vielleicht nicht so lang und leer.
John hatte vorgeschlagen, einen weiteren Hund anzuschaffen, da Betsy so alt geworden war, daß sie sich nicht mehr die Mühe machte zu bellen. Sie hatte nicht einmal mehr Lust, zu jagen oder den Kohlelieferanten anzukläffen, wie sie es früher getan hatte. Sie lag nur noch auf ihrer Strohschütte und wartete auf das Ende. John weigerte sich, sie vom Tierarzt einschläfern zu lassen. Man konnte einen Hund zwar lieben und mit ihm sprechen, doch leider war er nicht in der Lage zu antworten, es sei denn, durch Lecken oder Pfotegeben.
Ja, sie wollte ernsthaft über Geoffs Vorschlag nachdenken.
Kapitel 2
Geoff rümpfte angewidert die Nase, als er sich an Minnie Gillespie vorbei in das ärmliche Häuschen zwängte. Die Frau hatte ihm den Eintritt verweigert, bis er gedroht hatte, sich an das Jugendamt zu wenden.
Jetzt stand er mitten im Zimmer, und die Kinder starrten ihn an. Für sein militärisch geschultes Auge war der Raum ein einziges Chaos, und für seinen Verstand, der an den ordentlichen, peinlich sauberen Haushalt seiner Mutter gewöhnt war, schmutzig und entwürdigend. Er sah sofort, daß das Zimmer gleichzeitig als Küche, Wohn- und Schlafzimmer diente, denn zwei Kinder hockten trotz der fortgeschrittenen Tageszeit noch auf einem rohen Bettgestell in einer Ecke. Zwei Jungen standen daneben und starrten ihn an. Der eine, dünn und schmächtig, mochte etwa zwölf Jahre alt sein. Der andere, ein stämmiger kleiner Kerl von fünf oder sechs Jahren, hatte ein aufgewecktes, rundes Gesicht. Am entfernteren Ende des Tisches stand Lizzie. Sie warf Geoff einen schnellen Blick zu, als er eintrat. Dann senkte sie wieder den Kopf und fuhr fort, dicke Scheiben von einem Laib Brot abzuschneiden. Geoff betrachtete sie eine Weile und bemerkte trotz ihrer offen herabhängenden braunen Haare, daß sich ein blauer Fleck auf ihrem Wangenknochen abzeichnete.
Die Frau deutete auf das Bett und sagte zu dem älteren Jungen: »Bring die zwei ins andere Zimmer.« Der Junge zögerte einen Augenblick, dann drehte er sich um und winkte den beiden kleinen Mädchen. Sie kletterten aus ihrem Bett und folgten ihm, ebenso wie der kleinere Junge.
»Macht die Tür zu!« schrie die Frau ihnen nach, und die Tür wurde krachend zugeworfen.
»Was ist mit ihr?« Er deutete auf Lizzie. Die Frau gab zurück: »Was soll mit ihr sein?«
»Ich möchte allein mit Ihnen sprechen.«
»Sie ist kein Kind mehr. Sie versteht mehr, als man glaubt. Also sagen Sie, was Sie zu sagen haben!«
Anstatt zu antworten, ging er zum Tisch und berührte Lizzie an der Schulter. »Geh eine Minute nach draußen«, sagte er sanft zu ihr.
»Heda! Was zum Teufel soll das! Kommt einfach in mein Haus und fängt an rumzukommandieren …«
»Halten Sie den Mund!« Geoff fuhr herum und starrte die Frau an. Dann blickte er wieder auf Lizzie. »Geh eine Minute hinaus.« Sie gehorchte. Als die Tür sich hinter ihr geschlossen hatte, sagte er zu der Frau: »Vielleicht war es falsch von mir, sie hinauszuschicken. Vielleicht hätte sie es gerne gehört, wie ich Sie eine dreckige Schlampe nenne!«
»Sie! Was glauben Sie, wer Sie sind?«
»Ich sage Ihnen, wer ich bin. Ich bin jemand, der es nicht leiden kann, wenn junge Mädchen zu alten Männern geschickt werden, damit die sich für fünf Shilling mit ihnen vergnügen. Deshalb ist ihre Schwester weggelaufen, nicht wahr? Sie wollte da nicht mehr mitmachen.«
Die Frau schluckte, dann strich sie ihr blondes Haar hinter die Ohren und antwortete: »Ich könnte Sie vor Gericht bringen, jawohl, das könnte ich. Das ist üble Nachrede!«
»Seien Sie still! Sie haben einen schlechten Leumund. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie das Gesundheitsamt hinter Ihnen her war nach der Schuluntersuchung. Aber sie als Huren herumzuschicken, ist eine andere Sache, und da wird niemand Nachsicht zeigen. Wenn Sie das Geld so dringend brauchen, warum gehen Sie dann nicht selbst anschaffen; Sie haben doch die nötige Erfahrung, nicht wahr?«
»Jetzt reicht’s aber! Ich werd’ mir das nicht länger anhören. Und wenn Sie was über mich wissen, so weiß ich auch was über Sie, Herr Großmaul Fulton! Bloß weil Sie’n paar blöde Streifen an Ihrem Ärmel tragen, führen Sie sich auf wie der liebe Gott. Was ist denn mit letzter Nacht, he? Das waren Sie, und man sucht schon nach dem Mann, der Mr. Kidderly krankenhausreif geschlagen hat.«
»Nun, warum gehen Sie dann nicht hin und erzählen alles? Ich bin bereit, vor Gericht auszusagen, warum ich den Kerl schlagen mußte: um ein junges Mädchen davor zu schützen, mit Wissen seiner Mutter vergewaltigt zu werden. Und Ihre beiden Stieftöchter würden meine Geschichte bestätigen. O ja, ich weiß, daß die eine weggelaufen ist, aber es ist nicht schwer, sie zu finden. Und das Gericht würde auch in Betracht ziehen, daß Sie noch zwei Töchter haben, von denen die eine alt genug ist, von Ihnen angelernt zu werden. Wie auch immer«, er schürzte die Lippen und seine Stimme klang nun ganz ruhig und ungezwungen, »lassen wir die Anschuldigungen beiseite ‒ ich bin hier, um Ihnen ein Angebot zu machen.«
Die Frau starrte ihn mit offenem Mund an. Dann änderte sich ihr ganzes Benehmen. Die Furcht, die in ihren Augen gelauert hatte, verschwand, und der harte, abweisende Gesichtsausdruck ging in Verachtung über. Sie warf den Kopf zurück, und aus ihren geöffneten, vollen Lippen ertönte ein grelles Lachen. »Sie wollen mir ein Angebot machen!« rief sie. »Mein Gott! Weil Sie gehört haben, daß ich für die Männer hier nicht zu haben bin, weil ich weiter herumkomme, darum glauben Sie, Sie könnten jetzt billig an mich rankommen? Weil Ihr elegantes Miststück Sie sitzengelassen hat …«
Daß sie ihn auf diese Weise mißverstand, brachte Geoff in Wut. Er beugte sich vor und fuhr sie an: »Halten Sie den Mund, Sie stinkende Schlampe! Ich sollte Sie wollen? Ich würde Sie nicht mit einer Kneifzange anfassen! Hören Sie zu, Frau, und lassen Sie mich ausreden. Meine Mutter sucht ein junges Mädchen zur Mithilfe im Haushalt und für kleine Arbeiten. Es soll bei ihr wohnen. Es wird gut angelernt und versorgt. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, daß sie Ihrer jüngeren Stieftochter den Job anbietet. Außerdem möchte ich Ihnen sagen, daß ich noch heute die Behörden in Durham aufsuchen werde, wenn Sie Einsprüche erheben. Und noch etwas: Sie werden keinen Penny von Lizzies Lohn erhalten; das Geld kommt auf die Bank. Und wenn Sie ihr irgendwelche Ungelegenheiten bereiten, so wird mein Vater wissen, was er zu tun hat. Also, wählen Sie!«
Ihre Antwort stieß sie zwischen zitternden, farblosen Lippen hervor: »Eines Tages wird Ihnen das alles heimgezahlt; ich bete darum, daß ich es noch erlebe. So wahr ich hier stehe, ich werde es noch erleben!«
»Ich bezweifle, daß sie jemals beten!« Geoff ging zur Tür, öffnete sie und rief: »Lizzie!«
Das Mädchen kam langsam ins Zimmer und stellte sich an den Kamin. Seine Augen waren weit geöffnet, das ovale Gesicht wirkte angespannt, und der blaue Fleck schien jetzt noch stärker hervorzutreten.
Geoff blickte erst Lizzie, dann ihre Stiefmutter an. Da diese schwieg, befahl er dem Mädchen: »Pack deine Sachen zusammen.«
»Was?« Sie starrte ihn und dann ihre Stiefmutter an. Offensichtlich wartete sie auf eine Erklärung. Da die Frau nicht antwortete, wandte Lizzie sich fragend an Geoff: »Ich soll meine Sachen packen?«
Geoff deutete auf Minnie und erklärte: »Wir haben uns geeinigt, daß du mit mir kommst und für meine Mutter arbeitest. Sie hat schon lange eine Hilfe gesucht. Es wird nicht schwer für dich sein; du mußt ihr nur bei der Hausarbeit und bei anderen Kleinigkeiten helfen.« Lizzies Mund öffnete sich langsam und schloß sich wieder. Dann, ohne auch nur ein Wort zu sagen, rannte sie ins angrenzende Zimmer, aus dem nun ein aufgeregtes Stimmengewirr zu hören war.
Während Geoff auf ihre Rückkehr wartete ‒ was nicht mehr als zwei Minuten dauerte ‒, starrte Minnie ihn mit unverhohlener Feindseligkeit an.
Als Lizzie wieder ins Zimmer kam, trug sie Mantel und Hut. In den Armen barg sie eine Pappschachtel, die ihren ganzen Besitz enthielt. Sie ging geradewegs auf Geoffrey zu und stellte sich neben ihn. Ihre offensichtliche Freude über die gelungene Flucht war mehr, als ihre Stiefmutter ertragen konnte. Sie beugte sich über den Tisch und schrie das Mädchen an: »Das wird dir noch leid tun, darauf kannst du wetten! Was soll ich jetzt mit Joe anfangen? Wer soll auf ihn aufpassen? Irgendwer muß für die Kinder arbeiten! Dein Dad wollte es nicht, der nichtsnutzige Faulpelz. Und du und deine Schwester, ihr seid genauso wie er. Ihr wart zu nichts zu gebrauchen und werdet es auch nie sein! Und ich kann mich abschuften, um euch großzuziehen. Meine Jugend habe ich mit euch Bande verschwendet. Und Joe ist dein Halbbruder! Denkst du nicht an ihn? Du und dein Dad seid für ihn genauso verantwortlich wie ich. Aber das läßt sich leicht ändern; ich brauche ihn nur in ein Heim zu geben.«
Geoff, der fühlte, wie das Mädchen neben ihm zitterte, legte eine Hand auf ihre Schulter und sagte beruhigend: »Hab keine Angst. Sie soll es nur versuchen. Wir werden uns um alles kümmern.«
Er drehte Lizzie herum und schob sie zur Tür. Als sie draußen waren, nahm er ihr die Schachtel ab und klemmte sie unter den Arm. Seine Hand lag auf Lizzies Schulter, während sie sich still von der Kate entfernten.
Sie hatten etwa eine halbe Meile zurückgelegt, als Lizzie das Schweigen brach. »Sie würde das doch nicht tun, oder? Joe ins Heim geben?«
»Nein, nein, mach dir keine Sorgen. Joe kommt nicht in ein Heim. Das lasse ich nicht zu.«
»Aber … aber Sie werden nicht da sein. Sie sind doch Soldat und nur auf Urlaub hier.«
»Richtig, ich bin nur auf Urlaub; aber mein Vater hat einigen Einfluß in der Gegend.«
Nach einer Weile sprach Lizzie wieder: »Letzte Nacht wußte ich nicht, daß Sie das waren, wegen dem schwarzen Mantel und der Kappe. Ich habe Sie aber schon ein paarmal in Ihrer Uniform gesehen. Sie sahen sehr gut aus.«
Normalerweise hätte er darauf geantwortet: ›Du solltest mich ohne Uniform sehen, dann sehe ich noch besser aus.‹ Aber dies war nicht die Zeit und der Ort für solches Geplauder, und Lizzie war auch zu jung dafür. Also sagte er: »Es wird dir gefallen bei meiner Mutter. Sie ist eine prima Frau. Sie wird dir viele Dinge beibringen ‒ gute Dinge.«
»Sie haben ein Klavier, nicht wahr?«
»Ja, das stimmt.«
»Ich habe es manchmal gehört, wenn ich am Tor vorüberging; nicht sehr laut, aber ich hörte die Musik.«
»Nun, du wirst es jetzt den ganzen Tag lang hören, manchmal bis spät in die Nacht. Meine Mutter spielt großartig, und sie liebt ihr Klavier.«
»Es muß herrlich sein, ein Klavier zu besitzen.«
Er schaute auf Lizzie herab. Sie blickte nach vorne, und ihr Gesichtsausdruck war so ehrfürchtig wie der Klang ihrer Stimme. Ihr braunes Haar war durch den Druck ihres Strohhütchens, das sie über die Ohren herabgezogen hatte, in Unordnung geraten. Ihr Gesicht war einfach, und sie war zu klein für ihre vierzehn Jahre. Vermutlich würde seine Mutter sie nicht nur beschäftigen, sondern sie auch ordentlich aufpäppeln.
Zu Geoffs Überraschung blieb sie plötzlich stehen und schaute ihm direkt ins Gesicht. Mit fordernder Stimme fragte sie: »Wer hat Sie dazu bewegt, mir diesen Job zu geben? Ich meine, hat Ihre Mutter schon vorher jemanden einstellen wollen? Na ja«, sie schüttelte den Kopf und fuhr fort: »Ich will nur wissen, warum Sie das tun.«
Sie beobachtete, wie seine Augen sich schlossen, seine Lippen sich zusammenpreßten und seine Schultern sich hoben und senkten. Dann öffnete er die Augen wieder und blinzelte sie an. »Lizzie«, meinte er, »ich weiß, was du meinst, obwohl ich nicht weiß, welche deiner Fragen ich zuerst beantworten soll. Laß es mich so ausdrücken: Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul; denn denk daran ‒ auch wenn er keine Zähne hat, so hat er doch vier Beine und bringt sogar noch vier Hufeisen mit.«
»Was?« Sie schaute ihn verständnislos an.
»Ach, komm jetzt!« Er ging voraus, und sie folgte ihm, und paßte ihre Schritte den seinen an.
Sie kamen gerade um eine Straßenbiegung, als auf einem Feldweg eine junge Frau zu Pferd auftauchte.
Geoff stutzte einen Moment, was seinen Schritt veränderte und Lizzie bewog, zu ihm aufzublicken. Als sie sich auf gleicher Höhe mit der Reiterin befanden, hielt er an, tippte an seine Kappe und grüßte: »Guten Morgen, Miß Brown.«
Die junge Dame antwortete knapp. »Guten Morgen.«
Geoff blickte zuerst auf Lizzie, bevor er wieder die Reiterin ansah. »Betreten bei Verfolgung verboten«, sagte er.
»Nein«, erwiderte die Dame kurz auf diese rätselhafte Feststellung.
Er tippte wieder kurz an seine Mütze und sagte, indem er sich zum Gehen wandte: »O doch, das stimmt. Guten Morgen, Miß Brown.«
Lizzie mußte sich jetzt beeilen, um mit ihm Schritt zu halten. Sie war verwirrt. Miß Brown war auf einem richtigen Weg geritten, nicht auf einem Feld oder Privatgrundstück, aber Geoffrey hatte gesagt: »Betreten bei Verfolgung verboten.« Mußte das nicht heißen ›bei Bestrafung‹? Außerdem war das Miß Bradford-Brown von The Hall gewesen, und er hatte so mit ihr geredet! Sie verstand ihn nicht, sie verstand nichts, was er tat; auch nicht, warum er ihr diesen Job besorgt hatte. Trotzdem freute sie sich darauf, bei seiner Mutter zu arbeiten, denn es war ein schönes Haus. Außerdem waren die Fultons ziemlich betucht ‒ mußten sie ja sein, wenn sie sich ein Klavier leisten konnten.
Aber merkwürdig war es schon, daß er zu Miß Bradford-Brown gesagt hatte, Betreten sei bei Verfolgung verboten, wo es doch ›bei Bestrafung‹ hieß. Er war schon ein kauziger Kerl.