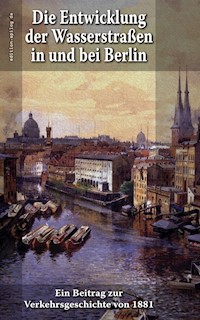
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: edition.epilog.de
- Sprache: Deutsch
Auf den Wasserstraßen sind 1879 über 3.000.000 Tonnen Güter nach Berlin eingeführt worden, mehr als auf sämtlichen Eisenbahnen. Betrachtet man den mehr als bescheidenen Zustand der öffentlichen Wasserläufe mit der meist unzureichenden Fahrtiefe und der an denselben vorhandenen Löschplätze, so muss man sich wundern, wie der Wasserverkehr zu solcher Bedeutung gelangen konnte. Die Artikelserie aus dem 'Zentralblatt der Bauverwaltung' von 1881 erläutert die Entwicklung der Berliner Kanäle und Häfen, sowie den Ausbau der Spree bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. - In neuer Rechtschreibung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 47
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Zeitreisen
– Beiträge zur Kultur- und Technikgeschichte –
Die Entwicklung der Wasserstraßen in und bei Berlin
Herausgegeben von Ronald Hoppeedition.epilog.de
Für diese Ausgabe wurden die Originaltexte in die aktuelle Rechtschreibung umgesetzt und behutsam redigiert. Längenangaben und andere Maße wurden gegebenenfalls in das metrische System umgerechnet.
Die Entwicklung der Wasserstraßen in und bei Berlin und die Entwürfe für deren Verbesserung
Von Professor E. Dietrich in Berlin
Zentralblatt der Bauverwaltung • 8.10.1881
1. Größe des Verkehrs auf den Berliner Wasserstraßen
Die Wasserstraßen bilden den ungleich lebhafteren Zufuhrweg für die in Berlin ankommenden Güter. Nach der Statistik des Jahres 1879 sind auf sämtlichen Eisenbahnen in Berlin rund 2 500 000 Tonnen, auf dem Wasser dagegen über 3 000 000 Tonnen eingeführt worden. Beachtet man, dass die Berliner Bahnhöfe, deren räumliche Ausdehnung vorzugsweise durch den Güterverkehr bedingt ist, nach überschläglicher Ermittlung ein Gebiet von annähernd 400 Hektar, das ist etwa die anderthalbfache Ausdehnung des Tiergartens, und großenteils Flächen sehr wertvollen Terrains bedecken, und betrachtet man dem gegenüber den mehr als bescheidenen Zustand der öffentlichen Wasserläufe und der an denselben vorhandenen Löschplätze, welche, natürliche und künstliche Wasserläufe, Häfen und Löschplätze zusammengerechnet, innerhalb der Weichbildgrenze Berlins bei meist unzureichender Fahrtiefe nicht der Hälfte jener Bahnhofsflächen gleichkommen, so muss man sich wundern, wie der Wasserverkehr, trotz der Zwangsjacke, welche ihm bis jetzt angelegt war, zu solcher Bedeutung gelangen konnte; alle Bestrebungen aber, die Zufuhrwege und den Zustand der Wasserstraßen in Berlin zu verbessern, müssen sicherlich als berechtigt erscheinen.
Dass der Ausdruck ›Zwangsjacke‹ nicht zu scharf gewählt ist, sei durch Hinweis auf den einen interessanten Umstand bewiesen, dass auf dem Landwehrkanal, der wichtigsten künstlichen Wasserstraße bei Berlin, vormittags nur nach der einen, nachmittags nur nach der anderen Richtung gefahren werden darf.
Der Verfasser beabsichtigt nun im Nachfolgenden eine gedrängte Übersicht desjenigen zu geben, was bisher für die Verbesserung der Berliner Wasserläufe geschehen ist, indem er eine Beurteilung der zurzeit für diesen Zweck schwebenden Entwürfe beifügt.
2. Geschichtliche Entwicklung bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts
Der natürliche Flusslauf der Spree zieht sich mit in mehrfachen Windungen, annähernd in der Richtung von Ost nach West, durch Berlin hindurch; er zeigt mitten in der Stadt eine natürliche Stromspaltung, die Insel Alt-Cölln bildend, auf welcher einer der ältesten Stadtteile Berlins liegt. Schon im Mittelalter wurden die beiden Flussarme, und zwar zum Zwecke von Mühlanlagen, den Dammmühlen und Werderschen Mühlen, aufgestaut; erst um das Jahr 1450 scheint man eine schiffbare Verbindung des Ober- und Unterwassers durch Anlegung einer hölzernen Schiffsschleuse, der heutigen Stadtschleuse an der Bau-Akademie, und durch Austiefung des einen, seitdem ›Schleusenkanal‹ genannten Flussarmes hergestellt zu haben.
Jene Schleuse wurde wohl im Laufe der Jahrhunderte von Zeit zu Zeit, wenn ihr Holzwerk zu arg verfault war, umgebaut; im Übrigen aber war damit für volle vier Jahrhunderte genug geschehen, denn das Jahr 1850 zeigt keine anderen Schifffahrtswege in Berlin als die damals schon vorhandenen. Im Gegenteil trat bei Gelegenheit der Befestigung Berlins, am Ende des 17. Jahrhunderts, eine arge Verschlechterung der Wasserstraßen dadurch ein, dass der unterhalb der Schleuse liegende Wasserlauf, welcher ursprünglich von der Schlossbrücke bis zur Ebertsbrücke dieselbe Richtung wie heute hatte, um die Festung nicht an zwei Punkten zu durchbrechen, derartig verlegt wurde, dass die Schiffe, von der Stelle der heutigen Schlossbrücke aus, quer durch das jetzt vom Lustgarten und Museum eingenommene Terrain hindurch zur Friedrichsbrücke, und dann, im rechten Winkel wendend, auf dem Hauptarm der Spree weiter fahren mussten. Später hat man diesen Zickzackweg glücklicherweise wieder beseitigt und für die Schiffe den alten Flusslauf, als den heutigen ›Kupfergraben‹, ausgebaut.
Die Befestigung Berlins forderte gleichzeitig die Anlegung eines nassen Grabens, für welchen sich, so weit er auf dem rechten Spreeufer liegt, der Name ›Königsgraben‹, auf dem linken Spreeufer dagegen der Name ›Grüner Graben‹ oder ›Festungsgraben‹ erhalten hat. Diese an Ober- und Unterspree offen anschließenden Graben wurden natürlich gleichfalls mit Stauwerken versehen, welche man später nach Fall der Festungswerke ebenfalls für kleinere Mühlenanlagen verwertet hat, die ›Zwirnmühle‹ am Königsgraben und die ›Walkmühle‹ am Grünen Graben. Diese alten Festungsgräben sind dann auch, so weit ausführbar, schiffbar gemacht, der Grüne Graben nur auf der kurzen Strecke von der Oberspree bis zur Walkmühle, der Königsgraben dagegen von Ober- und Unterspree bis an das Stauwerk der Zwirnmühle heran.
Von einem anderen nassen Graben, welcher, zur Umschließung der Dorotheenstadt angelegt, sich auf dem Terrain der heutigen Behrenstraße, vor dem Brandenburger Tor (Tor an der Tiergartenbrücke genannt) vorbei durch die Sommerstraße zur Spree hinzog, ist keine Spur geblieben.
Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts sind neben den natürlichen Armen der Spree, wie bereits erwähnt, keine neuen eigentlichen Wasserstraßen bei Berlin geschaffen worden. Im Jahre 1840 hatte sich aber die Einwohnerzahl, welche im Jahre 1740 etwa 100 000, im Jahre 1800 etwa 180 000 betragen hatte, bereits auf 325 000 Seelen gehoben; die Jahre 1840 – 1850 brachten weitere 100 000 Menschen hinzu, Handel und Fabrikation hoben sich in außerordentlicher Weise; was war natürlicher, als dass die Erleichterung des Schiffsverkehrs nach und bei Berlin, für welchen höchstens einige Baggerungs- und Regulierungsarbeiten im Fluss selbst in der noch heute üblichen ziemlich mangelhaften Art und Ausdehnung ausgeführt worden waren, zur zwingenden Notwendigkeit wurde.
Selbst die gerade zu jener Zeit auftretenden Eisenbahnen vermochten keine Abhilfe zu schaffen; auf dem Wasserweg kommen nämlich in erster Linie die Baumaterialien (nach der Statistik des Jahres 1879 62,5 % vom ganzen Wassertransport), dann die Brennmaterialien (19,5 %) und die Nahrungsmittel für Menschen und Pferde (10,5 %) nach Berlin; nur 7,5 % entfallen auf Rohprodukte und Erzeugnisse anderer Art. Für diese Stoffe aber haben, ungeachtet der mangelhaften Wasserverbindungen, die Eisenbahnen nicht in wirksame Konkurrenz treten können.





























