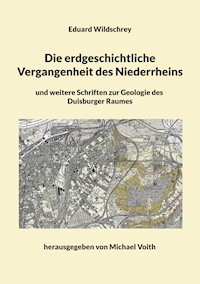
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Eduard Wildschrey war in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen in Duisburg und in der weiteren Umgebung ein in der Bevölkerung bekannter und geachteter Heimatforscher. Er ist heute in der breiteren Öffentlichkeit in Vergessenheit geraten. Die hier vorliegende Neuauflage seiner Publikationen mit Bezug zur Geologie erinnert an diesen Heimatforscher. Seine Veröffentlichungen dokumentieren den Stand der damaligen geologischen Forschung. Seine Schriften erläutern anschaulich die landschaftsgestaltenden Prozesse, die unsere niederrheinische Heimat geformt haben und noch heute wirksam sind. Für die Weimarer Zeit unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg bildet sein Wirken ein eindrucksvolles Beispiel, wie wissenschaftliche Themen, hier die Geologie, allen Bevölkerungsteilen zugänglich gemacht werden sollten. In einem Nachwort ordnet der Herausgeber die Texte Wildschreys in den historischen und fachlichen Kontext ein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
1. Sedanwiese und Versunkenes Kloster
2. Die Steppenzeit bei Duisburg
3. Ein Ur-Stromtal der Ruhr im Duisburg-Großenbaumer Walde
4. Beiträge zur Geologie Mülheims
5. Zur Geologie des Niederrheins
6. Der Kassenberg bei Broich
7. Geologie in der Unterwelt
8. Der Duisburger Steinbruch, eine Stromschnelle der Ur-Ruhr
9. Das Kreidemeer am Kassenberg bei Broich
10. Die erdgeschichtliche Vergangenheit des Niederrheins
11. Geologische Irrtümer am Niederrhein
12. Die Entstehung des Kaiserberges
13. Die Geologie von Sterkrade - Hamborn
14. Zur Geologie Duisburgs
15. Aus Duisburger Vorzeit
16. D.-Ruhrort – ein alter Rheinlauf festgestellt
17. Die Heimaterde und ihr Antlitz – Eine heimische Entdeckungsfahrt
18. Der Unkelstein
19. Das Urmeer am Duisserschen Berg
20. Aus der Vorgeschichte Neudorfs
21. Der alte Duisburger Rheinlauf wieder aufgefunden
22. Geologie und Tiefbau
23. Vom Tropenhimmel über Duisburg
24. „Was uns ein Stein erzählt“
25. Wenn die Steine reden
26. Die Geologie in der Volkshochschule
Nachwort: Historische und fachliche Einordnung
Die Textauswahl
Wer war Eduard Wildschrey?
Kurzes Intermezzo: Zeitschrift „Industriekultur“
Einschub: Wildschreys diskutierte Beiträge zur Duisburger Stadtgeschichte
Zum Stand der damaligen Geologie
Geologie und Geomorphologie
„Die Geologie ist keine Geheimwissenschaft“
Mit Humor durch die Erdgeschichte
Unmittelbare Anschauung – oder der Wert der Exkursionen
Geologie, Siedlungsgeschichte und Siedlungsgeographie
Wildschreys Anspruch in seinen geologischen Veröffentlichungen
Kartenanhang
Orts- und Geländeverzeichnis
Vorwort
Die in Wildschreys Veröffentlichungen beschriebenen Geländebegehungen und Exkursionen vermitteln trotz ihrer sprachlichen Zeitgebundenheit auch noch dem heutigen Leser ein anschauliches Bild von der Duisburger und niederrheinischen Landschaft und ihrer geologischen Entstehung.
Die hier zusammengestellten Texte von Eduard Wildschrey sind überwiegend Zeitungsbeiträgen bzw. kleineren Veröffentlichungen der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts entnommen. Auf dem damaligen Stand der Geologie basierend richteten sie sich vornehmlich an interessierte Laien. Sprachliche, methodische und didaktische Mittel waren auf einen breiteren Leserkreis gerichtet.
Die in den Schriften zum Ausdruck kommende Begeisterung Wildschreys für die landschaftsgestaltenden Phänomene unserer niederrheinischen Heimat kann auch bei den heutigen Lesern ihr Interesse für geologische und geomorphologische Prozesse wecken - vielleicht auch über die vorliegende Textsammlung hinaus auf jüngere Darstellungen.
Den fortdauernden Wandel der Landschaft beschrieb Wildschrey gerne mit dem „Panta rhei“ („alles fließt“) der griechischen Philosophen. Seine Texte vermitteln zudem einen Einblick in den damaligen Stand der geologischen Wissenschaft.
Die niederrheinische Landschaft und ihre geologischen Erscheinungen aufmerksam zu betrachten und sich an ihnen zu erfreuen, dazu forderte Wildschrey seine Leser immer wieder auf: „Unsere Heimat kann sich den interessantesten Gegenden Deutschlands an die Seite stellen. Wir sollten sie nur mit offeneren Augen betrachten. Wir sollten uns mehr der Natur hingeben.“a
a Die hier abgedruckten Texte sind in ihrem Aufbau und Gliederung den Originalvorlagen entsprechend wiedergegeben. Lediglich die Rechtschreibung ist grundsätzlich den heutigen Regelungen angepasst worden. Soweit die Originaltexte Abbildungen enthielten, sind diese hier ebenfalls aufgenommen. Die Veröffentlichungen sind in chronologischer Reihenfolge ihres Erscheinens aufgeführt.
1. Sedanwiese und Versunkenes Kloster
Aus: Rhein-Ruhr-Zeitung vom 11.08.1919.
Die Wanderungen im Rahmen des vom Duisburger Ortsausschuss für Jugendpflege veranstalteten Wanderführerkursus haben, wie bereits mehrfach erwähnt wurde, u.a. die Ausbreitung und Pflege der Heimatkunde zum Ziel. In welcher Art dabei vorgegangen wird, lassen die nachstehenden Ausführungen erkennen, die dem einschlägigen Stoffgebiet entnommen sind:
Nicht immer hat es auf der Erdoberfläche so ausgesehen wie heute. Es gab einmal eine Zeit, da dehnte sich das Mittelmeer über Deutschland bis nach England hinaus. Allerdings ist dies schon viele, viele Millionen von Jahren her. Und umgekehrt: dort, wo sich heute das Meer erstreckt, wie im Atlantischen Ozean, da bestanden früher große Kontinente. Heute erheben sich im Süden Europas die Alpen; vor – geologisch gesprochen – gar nicht so langer Zeit – da blaute dort der Ozean. Auch hier – im Herzen von Europa, wo heute kein Mensch etwas Derartiges suchen würde, gab es früher einmal ein riesiges Gebirge – weit größer, wie die Alpen – vielleicht so groß wie der Himalaya.
Hier am Niederrhein befinden wir uns ungefähr an der Nordgrenze dieses vorsintflutlichen Alpengebirges – dort etwa, wo es in sanften Wellen in die Ebene überleitete. Wo ist es geblieben? – In Schutt und Asche ist es zerfallen. Ein beständiges Werden und Vergehen ist die Erdgeschichte. Hier gibt es tatsächlich nichts Beständigeres als den Wechsel. Alles gerät in Fluss. Gewaltige Gebirge türmen sich auf – riesengroß, wie für die Ewigkeit geschaffen. Aber ein noch stärkerer Riese kam und berührte sie mit seinem Zauberstabe. Und sie sanken dahin in den Staub. Und wer war dieser Riese? – Der Wassertropfen. –
Das rinnende Wasser ist der geschworene Feind aller Erhebungen. Man muss nur sehen, welche Mengen Schutt und Gerölle die Wildbäche der Alpen tagtäglich in die Flüsse, die Flüsse hinaus ins Meer schleppen – um einen Begriff zu bekommen, welche geologische Großmacht das Wasser darstellt.
Aber um das zu erkennen brauchen wir nicht einmal eine Schweizer Reise zu unternehmen. Schon hier in Duisburg kann man einen Blick in die Werkstätte der Natur – Dezernat für Geologie, Unter-Abteilung Tiefbauamt, tun. Gehen wir durch die Koloniestraße hin, aus zum Steinbruch – da hinter der Unterführung der Rheinischen Bahn rechts von der Steinbruchstraße, sehen wir in einem Abstand von einigen hundert Metern den Bahndamm, der von der Wedau nach Hochfeld leitet. Vor dem Kriege hat man an seinem Hang Sand aufgeschüttet, man wollte ihn offenbar verbreitern. Die Arbeit ist aber, wie so vieles, liegen geblieben. Umso energischer hat sich das Wasser seiner angenommen. Mächtige Gräben und Rinnen hat es hineingesägt, sie sind schon bis zum alten Damm vorgedrungen; der ganze Schutt liegt unten am Fuße des Dammes. Man möchte fast versucht sein auszurechnen, wie lange es noch dauern wird, bis dass das Wasser den ganzen Damm niedergelegt hat. Oder vielmehr haben würde, wenn die Eisenbahnverwaltung sich seiner nicht annähme.
Ähnliche Beobachtungen kann man da unten in der Ruhrau (obere Au), nordöstlich vom Schnabenhuck machen, zwischen der Köln-Mindener und der Bergisch-Märkischen Strecke. Man muss vom Schnabenhuck aus bei der Großhoffschen Ziegelei die Unterführung des Bergisch-Märkischen Bahndamms passieren. Wenn man dann den Weg weiter nach rechts verfolgt, so sieht man nach vielleicht hundert Metern, unmittelbar vor den neuen unvollendeten Betonbauten, rechts vom Wege direkt am Bahndamm, eine kleine Schütte von grauem Ton. Sie mag vielleicht ein Meter hoch sein. Als ich vor 1 ½ Jahren hier in Urlaub war, hatte der Regen in die Abhänge kleine Furchen hineingenagt. An manchen Stellen hatten diese schon die Oberfläche der Schütte erreicht und sich eine kurze Strecke, etwa 2 Meter weit, hineingefressen. Jetzt sind die Rinnen schon vielleicht 5 Meter lang und haben sich vielfältig verzweigt. Lange wird diese Darbietung wohl nicht mehr zu sehen sein. Ein Trampelweg führt darüber hinweg, und vom Bahndamm und vom Wege her wird Asche angeschüttet.
Es ist ein Schulbeispiel im Kleinen dafür, wie ein einzelnes Flusstal entsteht – ja noch mehr: wie ein großes verzweigtes Flusssystem sich bilden kann. Man muss nur nicht denken, die Flüsse seien von Urbeginn aller Dinge an gewesen. Die heutigen Flüsse lassen sich nur bis in die Erdperiode hin verfolgen, die der Jetztzeit unmittelbar vorhergeht. Und das ist im Vergleich zu der ganzen Zeit, die in der Erdgeschichte bekannt ist, nicht überwältigend viel. Heute noch entstehen neue Flusstäler. Wer in schöner Sommerzeit mit einem Köln-Düsseldorfer Dampfer den Rhein hinauf fährt, sieht im Gebirge zu beiden Seiten des Stromes Nebentalbildungen in sämtlichen Entwicklungsstadien: vom Talküken an bis zum ausgewachsenen gebrauchsfertigen Tale. Da sieht man zunächst kleine, flache Mulden. Noch reichen sie nicht einmal das ganze Gehänge hinauf und führen nur bei Regen Wasser. Weiter erblickt man Bachrisse mit ziemlich steilem Gefälle – endlich auch vollendete Flusstäler mit breiter Sohle, ausgeglichenem Gefälle und vielen Kilometern Länge, wie etwa die Täler der Ahr, Lahn und Mosel. Ein schönes Beispiel für ein sich entwickelndes Tal, das vielleicht noch einmal zu den schönsten Hoffnungen berechtigen könnte, haben wir hier auf dem Kaiserberge an der Sedanwiese.
An ihrer tiefsten Stelle entspringt im Walde nördlich vom Wege ein Quell; sein Wasser sucht sich plätschernd seinen Weg durch den tiefen, kühlen Einschnitt im Walde. Ein Kloster ist hier nicht versunken. – Die Duissernschen Nonnen, die hier einmal vor undenklichen Zeiten für ein paar Jahre lang angesiedelt waren, haben ihr Kloster vielmehr freiwillig geräumt. Wohl aber sinkt das Gehänge des Baches andauernd nach und nimmt dabei ganze Bäume mit in die Tiefe. Ein jeder kann sich davon überzeugen. Und daran ist der Bach schuld. –
Jedes jugendliche Tal setzt sich in seinem Berggebiet aus zwei Abschnitten zusammen: aus dem Sammelbecken und dem Abzugskanal. Der Sammeltrichter hat gewöhnlich die Form eines Amphitheaters, das ist in diesem Falle eben die Sedanwiese. Hier läuft beim Regen das Wasser von allen Seiten zusammen. Die getrennten Rinnsale sind aber einzeln sehr schwach und können infolgedessen nicht viel in die Tiefe arbeiten. Daher ist die Mulde ziemlich flach. Anders aber in dem Abzugskanal. Da ist die ganze Wassermenge eines großen Sammelgebietes auf einen kleinen, schmalen Raum vereinigt. Da fühlt es seine Kraft und da befasst es sich infolgedessen in intensivster Weise damit, die Böschungen anzuknabbern. Man hat seinen Lauf sanft verbauen wollen, um die Wirkung etwas zu mildern. Genutzt hat es aber nicht viel. Man sieht große Partien, die abgerutscht sind. Und was da als Gerölle im Bachbett liegt und auf die Wiese hinausgeschleppt wird, das zeigt so recht die Kraft des fließenden Wassers. Die ganze Talform: Sammeltrichter mit seinem Abzugskanal, der birnförmige Grundriss des ganzen Gebietes ist recht typisch. Im Gebirge findet man solche Bildungen überall. Die Freunde des Siebengebirges werden sich ihrer aus dem östlichen Teil des Gebirges erinnern. Da unter dem Margarethen- und Sophienhof im Quellgebiet des Mittelbaches und ebenso unter dem Löwenburger Hof im Quellgebiet des Rhöndorfer Baches, befinden sich ähnliche Amphitheater. Hier in Duisburg haben wir kein so großes Gebirge. Infolgedessen können wir auch so großartige Talformen nicht erwarten. Die Sedanwiese ist aber doch das schönste Beispiel weit und breit. Warum in die Ferne schweifen...
2. Die Steppenzeit bei Duisburg
Aus: Rhein-Ruhr-Zeitung vom 17.10.1920 u. 24.10.1920.
I. Wir haben hier in Duisburg auf der Heide und im Wald ... an der Monninger Delle und im Eselsbruch und an vielen anderen Stellen an Berg und Tal viel Sand umherliegen. Von jeher hat mir dieser Sand viel Kopfzerbrechen gemacht. Wie kommt er hierher?
Am Mittelrhein, wo ich früher viel in eiszeitlichen Fluss-Ablagerungen gearbeitet habe, sah ich natürlich auch viel Sand. Er war aber immer im Wasser abgesetzt und trug auch deutlich Spuren dieses Ursprunges an sich: Schichtung, entweder waagerecht oder Kreuzschichtung, wie es sich für Wasserabsatz, der etwas auf Reputation hält, eignet und gebührt. Dazu hin und wieder Geröllablagerungen schichtweise dazwischen gepackt, und schließlich auch ein verhältnismäßig grobes Korn. Die Körnchen gehen ohne deutliche Grenze in kleine Steinchen und so in die gröberen Gerölle über. Das sind die Merkmale, die den wässerigen Absatz auszeichnen. Nimmt man gerade die Kreuzschichtung und zahlreiche Geröllablagerungen heraus, so hat man speziell Flussablagerungen gekennzeichnet, im Gegensatz zu den Meeresablagerungen (z.B. Gerresheimer Sande). Sehr schön lassen sich die Merkmale des Flussabsatzes in der Sandgrube an der Oranienstraße studieren ..., da, wo die Fundamente des Duisserschen Klosters aufgedeckt sind, von denen ich kürzlich hier berichtete.
Bei unserem Wald- und Heideland dagegen nichts von alledem. Ein gleichmäßig feines Korn, keine Spur von Geröllablagerungen (Wo sie vorhanden sind, sind sie stets von dem Gehänge nachträglich herabgerutscht). Keine Spur von Schichtung, sondern gleichmäßige, massige Struktur der ganzen Ablagerungen. Wie kommt dieses Gebilde nur hierher?
Mit ihm ging es mir, wie mit allen wissenschaftlichen Problemen. Erst ganz allmählich reifte in mir die Überzeugung, dass hier ein Problem vorläge. Die Erleuchtung kam dann aber blitzartig. Durch ein paar glückliche Funde.
Schon vor Jahren führte mich einer meiner ersten Besuche, die ich zusammen mit Prof. Athenstädt unternahm, in die große Sandgrube in dem Speldorfer Siepen. Es ist dies ein kleines Tälchen, dicht an der Duisburger Grenze, in dem Sattel zwischen Wolfsberg und Wolfsburg, da wo die Erfrischungsbude steht, wenige hundert Meter südlich von der Monning, und es endet an der Saarner und Duisburg-Mülheimer Straße. Die Sandgrube, von der ich sprach, liegt am Nordgehänge, nahe bei der Prinzenhöhe. Hier steht der Sand ungefähr 8 Meter mächtig an. Ein weicher, feiner Sand ... ganz anders als der Flusssand und trotz dieser Mächtigkeit keine eigentliche Schichtung. Aber er zeigt doch so eine Art schichtiger Zusammenpackung. Diese aber läuft nicht waagerecht, wie bei Wasserabsatz, sondern konstant dem Gehänge parallel. Das brachte mich auf die richtige Spur.
Das Gehänge war mit genau derselben Neigung schon vor dem Absatz des Sandes vorhanden. Der Sand hat das Gehänge also gewissermaßen austapeziert. Wer kann das gemacht haben? Wasser nicht. Denn abgesehen von vielen anderen Gründen, könnte diese Schichtung nicht dem Gehänge parallel laufen, sondern müsste waagerecht verlaufen.
Es kann nur der Wind gewesen sein. Ein Sturm, der große Staub- und Sandmassen emporwirbelt ... wir können es heute noch in den Steppen erleben. Woher ist dieser Wind aber gekommen?
Um diese Frage zu lösen, habe ich das Tal genauer untersucht. Auf der Nordseite steht eine mächtige Ablagerung von ungefähr 8 Meter Sand an. Am Südgehänge – dicht unter dem Wald – liegt auch eine alte Sandgrube. Da steht er aber nur wenige Meter mächtig. Daher ist der Betrieb dort auch längst wieder eingestellt. Der Wind hatte seine Hauptlast schon im Norden abgegeben und konnte für das Südgehänge nichts mehr übrig haben. Es muss der Nordwind gewesen sein. Er kam aus der Gegend der Monning – Wald gab es damals überhaupt noch nicht, Pflanzenwuchs spärlich – und fegte über den Bergrücken, der von der Prinzenhöhe ausgeht, hinweg. Dahinter liegt der Windschatten. Dort kam die Luft zur Ruhe und ließ den Sand fallen, den sie mitgebracht hatte. In Russland haben wir es ja bei den großen Schneestürmen beobachten können, dass der Schnee sich immer hinter einer Hecke, hinter einem Hause usw. absetzte. Als der Wind dann das Tal durchquert hatte und an dem Südgehänge ankam, hatte er kaum mehr Material bei sich. Daher dort die spärliche Sandbedeckung. Für den Sand des Siepens war damit die Frage entschieden.
In diesem Frühjahr setzte ich die Untersuchung an der Kiefernstraße am Kaiserberg fort. Ich wollte dort die alte Tongrube von Scheerer – zuletzt Kox – einsehen. Ich fand denselben Sand an den Gehängen. Auch mit derselben schaligen, schichtenähnlichen Absonderung. Und auch diesmal wieder dem Gehänge parallel – in Bezug auf die Himmelsrichtung also ganz anders geneigt, als im Siepen. Dort nach Südosten – hier nach Westen. Dieser Sand musste also auch Flugsand sein. Auch vom Wind abgesetzt. Dann musste aber auch der ganze Sand, der am Westgehänge des Duisserschen (Kaiser-)Berges in so großer Mächtigkeit ansteht, Flugsand sein. Und da war es mir mit einem mal klar: all der Sand, der zwischen beiden Stellen überall im Duisburger Wald, in Berg und Tal – z.B. im Hanielschen Forst, in der Monninger Delle, im Eselsbruch, an der Wolfsburg usw. – auftritt, und der genau dieselbe Beschaffenheit hat alles das musste Flugsand sein. Vom Winde dahingeschleppt. Damit war die Frage im Wesentlichen entschieden.
Nun hatte ich auch die Erklärung dafür, warum dieser Sand als verhältnismäßig dünner Schleier so gleichmäßig über Berg und Tal dahinzieht. Warum er keine Richtung in sich hat, sondern stets der Richtung folgt, die vom Gehänge vorgeschrieben ist. Warum er sich besonders in den Tälern anhäuft. Und vor allen Dingen, warum er keine Schichten zeigt, die sich durch die materielle Beschaffenheit ihrer Teilchen unterscheiden, so wie man das vom richtigen Flusssand verlangen muss.
Bis dahin hatte ich um die Pfingstzeit schon im Verein für Heimatkunde berichtet. Kurz darauf gelang es mir aber, für diese Flugsand-Theorie noch ein besonderes Paradestück aufzufinden. Nämlich Dünen. Dünen hier in Duisburg?
Ach ja, und sie sind nicht einmal so sehr selten. Sogar in unserer allernächsten Nähe. Das Auge muss sich nur erst an sie gewöhnt haben. Ich fand sie zuerst südlich an der Wedau – schon jenseits von der Duisburger Grenze – in dem Gebiet der Kolonie Bissingheim. Da fand ich – gerade an der Grenze beginnend – eine Reihe von Geländewellen in der Sandheide. Bis an die 100 Meter lang, 20 Meter breit, wenige Meter hoch. Manchmal in ganzen Reihen, mit der Breitseite hintereinander gelagert. Alle bestehen aus Sand, den ich schon beschrieben habe. Wenn das Frühere Flugsand war – dann musste dieser hier auch Flugsand sein. Und dann mussten diese Geländewellen hier Dünen sein. Richtige Dünen. Wie können diese sich aber hier in Duisburg bilden?
Unter den heutigen Verhältnissen natürlich nicht. Sobald alles bewachsen ist, kann der Wind keinen Sand mehr ausblasen. Aber z.B. auf den Truppenübungsplätzen – Friedrichsfeld. Wohin - da, wo kein Hälmchen wächst, da sieht man heute noch, wie der Wind mit dem Sand verfährt. Da kann man sich ein Bild machen. Heftige Stürme können die Dünen natürlich nicht hervorgebracht haben. Die sind vielmehr erforderlich, um den Sand auf die Berge hinauf und über die Höhen zu treiben. Dünen können nur durch gleichmäßig wehende, verhältnismäßig schwache Winde zusammengetragen werden. Diese müssen gerade so stark sein, um die Körnchen ins Rollen zu bringen, müssen sie sogar eine schiefe Ebene hinaufrollen können – dürfen sie aber nicht ganz in die Luft heben.
Wann und unter welchen Umständen kann das aber hier in Duisburg geschehen sein? Die geologische Neuzeit wird in Tertiär und Quartär eingeteilt. Das Tertiär hat mehrere Millionen Jahre gedauert – ihr Ende mag um 1-2 Millionen Jahre zurückliegen. Es ist die Zeit, in der bei uns z.B. der Ton des Kaiserberges abgelagert wurde. Es folgt dann das Quartär, das – in den Alpen wenigstens – in vier Eiszeiten zerfällt. Jede Eiszeit hat eine besondere Flussablagerung hervorgerufen. Der ältesten Eiszeit entspricht der älteste Rhein, dessen Überreste man auf dem Kaiserberg, am Heiligen Brunnen und weiter nördlich und südlich davon auf allen Waldhöhen findet. Nach Osten bis Kettwig – dort verläuft das älteste Rheinufer. Der vierten Eiszeit entsprechen dagegen die Sande und Kiese, die die Talebene bis zum Waldesrand bilden, und auf der alle Städte liegen – soweit sie hochwasserfrei sind. Auch Duisburg. Dieselben Ablagerungen sind es auch z.B., die in den Sand- und Kiesgruben der Wedau ausgebaggert werden.
Die Dünen am Bissingheim liegen auf den Rheinablagerungen dieser jüngsten Eiszeit. Sie sind also jünger als diese. Sie mögen rund 20000 Jahre alt sein. – während der älteste Rhein oben auf den Bergen schon eine Million Jahre zählt. Nach der Eiszeit hat sich die hochnordische Tundra nach Norden zurückgezogen und einer Steppenzeit Platz gemacht. In dieser war der Pflanzenwuchs erst spärlich. Der Boden war also noch kaum befestigt. Da hatte der Wind freies Spiel. Da konnte er den feinen Sand aus den Rheinabsätzen ausblasen und als Staubwolken anderswohin transportieren.
Allerdings muss ich hier einen Punkt erwähnen, den ich noch nicht habe aufklären können. Im Rheintal liegt der Flugsand auf den Absätzen der jüngsten Eiszeit – der sogenannten „Niederterrasse“. Im Ruhrtal, schon hinter dem Kaiserberg, ist aber die Niederterrasse der Ruhr frei von Sand, wenigstens von nennenswerten Sandablagerungen. Die mächtigen Ablagerungen beginnen da erst – schon unmittelbar hinter dem Kaiserberg – auf den Ablagerungen der vorletzten Eiszeit, der sogenannten „Mittelterrasse“. Daraus müsste man aber schließen, dass der Sand schon nach der dritten Eiszeit abgesetzt worden ist. Diesen Zwiespalt habe ich bislang noch nicht aufklären können.
II. Unter welchen Umständen sind nun die Dünen gebildet worden? Ich muss vorausschicken, dass sich die Dünen stets quer zur herrschenden Windrichtung einstellen. Die meisten von den Dünen des Bissingheims – nicht alle – streichen nach Nordwest. Die herrschende Windrichtung muss damals also aus Südwesten gewesen sein. Genauso wie sie es heute noch ist. Auch das spricht für ein verhältnismäßig junges Alter der Dünen. Nun haben wir auch eine Erklärung dafür, weswegen sich dieser Flugsand stets an der Ostseite der Talebene vor und in den Wäldern findet. In der ganzen Rheintalebene – auch linksrheinisch – blies der Südwestwind aus den noch unerwachsenen Flussablagerungen den Sand heraus und jagte ihn nach Osten. Zuerst mussten sich die gröberen Körner niedersetzen. So ist das ja auch bei der Aufbereitung durch Wasser. Daher kommt es, dass das Korn des Flugsandes umso größer wird, je weiter die Ablagerungen nach Westen liegen. Auch auf den Ehinger Bergen bei Mündelheim habe ich ihn gefunden. Das war der gröbste Flugsand, den ich bis jetzt angetroffen habe. Korngröße – soweit ich es in Erinnerung habe, 1 Millimeter oder darüber. Zugleich ist dies aber auch die westlichste Stelle, wo ich ihn bis jetzt entdecken konnte. In unserem engeren Stadtgebiet beginnt die Ablagerung einige 100 Meter vor dem Wald. Der Wald selbst existierte damals noch nicht. Wohl aber der Höhenzug, auf dem er steht. Dieser zieht sich vom Kaiserberg über Heiligen Brunnen, Elsenberg, Hölzenberg usw. nach Süden und ragt ungefähr 50 Meter über die Talebene empor. An diesem Höhenzug musste eine Stockung des Windes eintreten. Und sobald seine Bewegung aufhört, verliert er seine Tragkraft – er lässt fallen, was er mitgeschleppt hat. So sehen wir gerade vor dem Höhenzug den Sand besonders stark angehäuft, er mildert den Winkel zwischen Talebene und Berghang. Eigentlich müsste die Talebene, die ja aus dem Wasser abgesetzt ist, bis an den Fuß des Berges waagerecht verlaufen. Wer geschickt im Beobachten ist, sieht es aber schon draußen auf dem Felde – sonst auf der Karte 1:25.0000 – dass die Ebene nach dem Berge zu allmählich ansteigt. Das macht eben der Flugsand. Er beginnt etwa in der Gegend der Grabenstraße oder vor der Schweizerstraße. Am besten kann man das Ansteigen der Ebene gegenüber Wirtschaft Schwerdt nach dem Berge zu beobachten. Auf dem freien Platz, wo zuweilen der Kirmestrubel ist. Da ist die Neigung der Ebene recht auffällig. Da sieht man aber auch schon an den Wegeböschungen, , dass es nur der weiche, staubige Flugsand ist, der diese Neigung hervorruft. Ungefähr 100 Meter nördlich von dieser Stelle liegt unmittelbar am Fuße des Berges vor Waldesrande eine Sandgrube. Aus ihr wurde das Material für die rheinische Bahn ausgehoben. Da liegt der Sand 8-10 Meter hoch. Geht man aber von da aus den Berg hinauf, dann wird die Sanddecke immer dünner – ich habe das durch Nachgraben festgestellt. Und oben am Grat – kurz unterhalb des Weges von der Sedanwiese zum Schnabenhuck – hört er überhaupt auf. Da tritt auf den Wegen und an den Böschungen der nackte rotbraun verwitterte Ton des Kaiserberges zutage.
So zieht sich der Sand als Schleier von wechselnder Stärke über Berg und Tal. Meist füllt er die Tiefen an, weil diese im Windschatten liegen. Dieser Sandschleier, er ist es, der die geologische Untersuchung unserer Gegend so erschwert, weil er alles verhüllt.
Wer den Unterschied zwischen Flugsand und Flusssand studieren will, findet Aufschluss in der Neudorfer Heide. Da liegt der Flugsand als dünne Decke – 1 bis 1 ½ Meter – über den Sanden der Niederterrasse des Rheins. Flugsand der Decke ist ein sog. „weicher“ Sand, d.h. feinkörnig mit etwas Lehmstaub. Korngröße unter 1 Mllm. Darunter liegt dann der weit gröbere Flusssand, der „scharfe“ Sand der Verbraucher – sauber ausgewaschen, geschichtet und mit Geröllablagerungen. Für Bauzwecke ist er weit eher geeignet.
Überall soweit dieser Flugsand verbreitet ist, finden sich Stellen, in denen er zu Haufen zusammengeweht ist. Sandverwehungen, genauso wie Schneeverwehungen. An dieser unruhigen, welligen Oberfläche kann das Auge, wenn es erst einmal auf diese Erscheinungen eingestellt ist, den Sandboden schon von weitem erkennen. Auch wenn er durch Pflanzenwuchs verdeckt ist. Auf freiem Felde – auf einer großen tischebenen Fläche, wo der Windstrom durch nichts behindert ist, ordnen sich diese Verwehungen zu den bereits erwähnten Dünenzügen an. Am schönsten sind sie da zu sehen, wo ich sie auch zuerst auffand: südlich von der Wedau am Bissingheim. Da liegen sie in großer Zahl – leider sind sie durch die Anlage der Kolonie zum Teil schon zerstört. Dann weiter nach Nordosten auf Forsthaus Curtius zu. Wenn man von hier kommt, findet man schon auf dem Wege, der von dem Forsthaus nach Süden zur Grenze führt, 3 solcher Wellen. Die eine ist von dem Wege nach Westen der Länge nach durchschnitten. Wer scharfen Blick hat, findet Reste von solchen Wellen auch auf der alten Neudorfer Heide außerhalb der Grabenstraße. Hier sind sie aber meist durch den Pflug eingeebnet. Zwei ausgezeichnete Beispiele von Dünen – es sind wohl die am bequemsten zugänglichen – kann man ohne jede Mühe an der Mülheimer Straße finden. Im Walde, hinter der Villa Klucken, indes noch vor der Bahn. Sie kreuzen die Landstraße unter 45 Grad und verlaufen Nordost. Diese merkwürdige Richtung – sie kommt übrigens auch am Bissingheim vor – erklärt sich an dieser Stelle dadurch, dass zwischen den Bergen die Windrichtung unregelmäßiger wird. Überhaupt gelten alle diese Regeln nur sehr im Allgemeinen. – Die erste Düne verläuft hauptsächlich links von der Straße, setzt aber auch noch ein Stückchen nach rechts herüber. Die andere wird durch die Straße ungefähr mitten durchgeschnitten. Links von der Landstraße hat sich der alte Schafsweg, der nun fast schon verwachsen ist, der Länge nach in sie eingeschnitten. Weiter finden sich sehr starke Sandanhäufungen und ausgesprochene Dünen nördlich davon in der Hanielschen Dickung. Dünen liegen auch an der Umgehungsbahn – ungefähr da, wo der Weg von der Sedanwiese zur Monning die Bahn kreuzt. Sie werden von der Bahn angeschnitten. Der Sand liegt da unglaublich mächtig.
Rechts von der Mülheimer Straße finden sich mächtige Sanddecken im Eselsbruch und am Stern; da deutet auch eine unruhige Bodenbewegung auf Verwehungen hin. Ferner von da an zur Wolfsburg. Die Sanddecke wird dann wieder sehr stark weiter östlich jenseits der Grenze auf Speldorfer Gebiet. Z.B. an dem ganzen Hang, der sich nach dem Plötterweg hin senkt. Überhaupt steht fast ganz Speldorf bis nach Broich kurz vor der Ruhr auf Sand. Der Wind hat da – besonders an dem Hang hinter der Grenze – offenbar allen Sand niedergesetzt, den er über die Hochfläche des Pferdekopfes – zwischen Heiligen Brunnen und Wolfsburg - hinweggefegt hat. Diese Hochfläche trägt nämlich nur eine ganz dünne Decke und ist stellenweise ganz davon frei, sodass sogar der bloße Kies zutage tritt. Wie z.B. am unteren Burgweg. Eine Stelle weiß ich aber doch, wo er auf dieser Hochfläche eine Düne zusammengebracht hat. Sie liegt allerdings schon jenseits der Grenze. Wenn man nämlich von der Wolfsburg den Grenzweg nach zur Bahn geht – da, wo der Weg anfängt, sich zu senken, - da merkt man wieder den Sand. Wenn man hier von der Terrassenkante den Weg halblinks verfolgt, findet man nach 50 bis 100 Schritt eine Sandgrube. Sie steht in dieser Düne. Sie ist meines Wissens die einzige, die bei Duisburger Gebiet oben auf der Hochfläche liegt. Auf Speldorfer Gebiet findet man sie in solcher Höhe häufiger, z.B. südwestlich vom Friedhof. Dann in der Nähe von Haus Hammerstein usw.
Das Verbreitungsgebiet des Flugsandes beginnt im Westen im Großen und Ganzen etwas westlich von der Ostgrenze der Rheintalebene. Also ungefähr am Wald. Der Sand ist eigentlich nur für Wald- und Heidekultur zu gebrauchen. Für Ackerflächen eignet er sich weniger. Von der Waldgrenze aus zieht er sich die Berge hinauf, diese sind ja alle bewaldet. Er verlangt hauptsächlich Nadelwald; daher die Menge Nadelhölzer in unserer Nähe. Die östliche Verbreitungsgrenze liegt etwas vor der Ruhr, die ja hier von Süden nach Norden fließt. Ich erinnere nur an die Sandmassen bei Haus Rott. Kurz vor Kettwig an dem Weg, der nah Haus Linnep nach Bahnhof Hösel führt, wird er von einem anderen Windprodukt abgelöst. Das ist der Löss. Oder besser gesagt, sein Verwitterungsprodukt, der Lösslehm. Auch dieser überzieht als dünner Schleier Berg und Tal. Östlich von der Ruhr bildet er die ausschließliche Bedeckung. Bis dahin dringt der Flugsand nicht mehr vor. (Nebenbei bemerkt, fällt merkwürdigerweise die Sandgrenze bis auf wenige Kilometer zusammen mit dem Ostufer des mitteloligozänen Tonmeeres, dieses verläuft ungefähr in Richtung der Straße Saarn-Ratingen. Und dem Ostufer des Rheins der ersten Eiszeit. Diese verläuft ungefähr längs der Ruhr. Bei Kettwig ist das Ufer ziemlich genau festzustellen.)
Nach Süden habe ich den Sand bislang verfolgt bis in die Gegend von Ratingen. In Wahn bei Köln findet er sich auch noch. In Bonn nicht mehr. Da wird offenbar die Rheintalebene durch die Gebirge zu sehr eingeengt. Nach Norden scheint er eine Grenze nicht zu haben. Das Sandfeld von Friedrichsfeld ist allgemein bekannt. Auch nördlich von der Lippe findet er sich. Er zieht sich von da mit Unterbrechungen durch die ganze norddeutsche Tiefebene (Lüneburger Heide), die Mark (des Heiligen römischen Reiches Streusandbüchse) über Polen nach Russland hinein. Überall tritt er auf, wo eiszeitliche Ablagerungen in großen Flächen zur Verfügung stehen.
Durch diesen Flugsand erklären sich bei uns mancherlei landschaftliche, kulturwirtschaftliche und vorgeschichtliche Eigentümlichkeiten. Die Feldmark der mittelalterlichen Stadt verlief bis Schweizer- und Grabenstraße. Dort war sie durch die „Lantert“, d.h. Landwehr begrenzt. Weswegen verlief die Grenze gerade längs dieses Zuges? Und weswegen wurde der Boden außerhalb der Lantert nicht in Kultur genommen? Nun, einfach deswegen, weil außerhalb der unfruchtbare Flugsand lag, und weil dieser an dem genannten Straßenzug begann. Außerhalb lag die Heide. Sowohl die Duisserschen als auch die spätere Neudorfer Heide.
Weiterhin ist ja wohl allgemein bekannt, dass sich von Großenbaum über die Wedau, den neuen Kirchhof, Neudorf und Kaiserberg bis zur Monning ein vorgermanisches Gräberfeld erstreckte. Die Hünengräber finden sich heute noch an der Wedau, am Friedhof und an der Monning. Sie stehen überall in diesem Flugsand. Da haben wir wohl den Grund, oder vielmehr einen Grund, weswegen sie hier so zahlreich liegen. Der Flugsand ist wie schon die landläufige Bezeichnung sagt, weich und lässt sich selbst mit den Händen graben. Flusssand dagegen ist hart, kann stellenweise sogar sehr hart werden. Der Mann der Vorzeit hatte noch nicht die Spaten von heute. Für ihn musste ein weicher Boden sehr ins Gewicht fallen. Daher wird es wohl kommen, dass das Gräberfeld ungefähr mit dem Verbreitungsgebiet des Flugsandes zusammenfällt. Westlich davon – in dem Lehm, Flusssand und Kies der Niederterrasse – sind mir keine bekannt geworden.
Allerdings kommt noch hinzu, dass gerade in der genannten Richtung ein uralter Handelsweg verläuft, auf den schon Prof. Averdunk aufmerksam machte. Beide Gründe werden wohl zusammengewirkt haben. b
b Anm. Hrsg.: Wildschrey hatte im Jahr 1934 anlässlich der Baumaßnahmen des Duisburger Tierparks nochmals die Dünen- und Flugsandablagerungen nun speziell im Gebiet des neu entstehenden Zoos erläutert und auf die aus seiner Sicht siedlungsgeschichtliche Bedeutung der Sand- und Heideregionen hingewiesen. DGA am 21. und 24.02.1934. „Die Flugsanddünen – Naturstudien am neuen Duisburger Tierpark“ (Text hier nicht abgedruckt).
3. Ein Ur-Stromtal der Ruhr im Duisburg-Großenbaumer Walde
Aus: Duisburger General-Anzeiger vom 12.11.1920 (Vortrag beim Verein für Heimatkunde und Verkehrsinteressen Duisburg).
Der Verein für Heimatkunde und Verkehrsinteressen Duisburg hatte in der letzten Sitzung in der Tonhalle auch die Ortsgruppe des Sauerländischen Gebirgsvereins zu Gaste. Der Redner des Abends, Dr. Wildschrey, hielt einen Vortrag über: ein Ur-Stromtal der Ruhr im Duisburg-Großenbaumer Walde. Der Redner führte zunächst in die allgemeinen geologischen Geschehnisse ein, sprach von der Wirkung der Flüsse auf die Erdoberfläche und zeigte, wie man umgekehrt aus diesen Wirkungen alte verschollene Flussläufe wieder erkennen könne. Dann ging er zu seinem speziellen Thema über. In der städtischen Kiesgrube südlich der Kammerstraße im Walde, am Wege „Über Berg und Tal“, hatte er eine Flussablagerung erkannt, die sich nicht auf den Rhein zurückführen ließ. Ihr Material wies vielmehr auf die Ruhr hin. Aus ihrer Höhenlage schloss er auf die vorletzte Eiszeit, die einzige Eiszeit, bei der das skandinavische Inlandeis bis hierher und bis ins Rheinland vorgedrungen war. Redner hat dann den Flusslauf weiter nach Norden verfolgt, bis vor den Kaiserberg. Hier wandte sich der Fluss nach Osten. Die ganze Fläche zwischen Kaiserberg, Monning und Wolfsburg stellte weiter nichts als den Talboden dieses Flusses dar. Kaiserberg und Wolfsberg sind die beiden ihn begrenzenden Uferberge. Dann konnte Redner den Ruhrlauf weiter nach Osten verfolgen, immer längs der Duisburg-Mülheimer Straßenbahn. In Mülheim gewann der Lauf den Anschluss an das ursprüngliche Ruhrtal. Dieser hatte sich zu der damaligen Zeit in Mülheim deltaförmig verbreitet. Das rechte Ufer ging nach Norden nach Oberhausen zu. Aus diesem Delta erhob sich der Kaiserberg als Inselberg und teilte das Flusstal. Der linke Arm nahm den beschriebenen Weg, bog am Lotharplatz scharf links, ging den Waldrand entlang und wird vor der rheinischen Bahn ein Stück unsichtbar. Einige Kilometer dahinter taucht er wieder auf und fließt längs der Bahn Wedau – Ratingen bis Lintorf. Da verschwindet es unter die Flugsandbedeckung. Es wird weiter nach Westen sich gewandt haben, seine Reste sind aber durch die spätere Rheinablagerung zerstört. Wodurch ist dieser ganz seltene Verlauf zustande gekommen? Das Inlandeis war damals von Nordosten her in das Rheintal eingedrungen, und hatte es etwa bis zur Linie Großenbaum – Krefeld abgesperrt. Der Rhein wurde nach Westen abgedrängt und musste durch das Nierstal zur Maas abfließen. Die Ruhr war gezwungen, um diesen südlichen Ausläufer des Eises herumzufließen, wurde also nach Süden abgedrängt. Von Lintorf aus wird sie wohl am Südrande des Eises entlang nach Westen weiter geflossen sein, und vielleicht hinter Krefeld den Anschluss an das damalige Rheintal gewonnen haben. Der Redner wusste den Vortrag besonders dadurch interessant zu gestalten, dass er nicht die fertigen Resultate vorführte, sondern sie aus den beobachteten Tatsachen entwickelte und so den Hörer an diesen Entdeckungen gewissermaßen mit teilnehmen ließ. [...]c
c Anm. Hrsg.: In einem Zeitungsbeitrag vom 03.02.1934 griff Wildschrey die Thematik des „Urstromtals“ im Duisburger Wald nochmals auf. Wegen der Bau- und Rodungsarbeiten anlässlich des Duisburger Tierparks (Zoo) lag das Gelände damals zeitweise offen, sodass Wildschrey die Landschaftsgenese besser nachvollziehen konnte. Er fand dabei seine Entdeckung des „Monninger Durchbruchstals“ der Ruhr bestätigt (DGA vom 03.02 1934: „Eiszeit-Katarakt rauschte am Kaiserberg – Das entschleierte Geheimnis des Monninger Durchbruchstals und der Oberhausener Bucht“; Text hier nicht abgedruckt).
4. Beiträge zur Geologie Mülheims
Aus: Niederrheinisches Museum – Zwanglose Blätter für Heimatgeschichte und Heimatkunde vom 01.07.1921.
Alles, was ist oder geschieht, muss eine Ursache seines Seins oder Geschehens haben. Theoretisch gibt der Laie das ja wohl gerne zu. Mit der praktischen Anwendung hapert es aber gewöhnlich. Besonders, wenn es sich um die Gestaltung der Erdoberfläche handelt. Wie denn – diese Berge, diese Täler da – sie sollen erst entstanden sein? Sind die nicht immer da gewesen? Da hört man denn zuweilen: „Solange ich mich zu entsinnen weiß, ist das immer so gewesen. Schon zu meines Vaters sel. Zeiten. Ja sogar als mein Großvater noch lebte.“ Es berührte die meisten fremdartig, dass alle Dinge auf unserer Erdoberfläche im Laufe der Zeiten – allerdings sehr langer Zeiten – erst geworden sind, und das alles Gewordene seine Ursache hat.
Ich will das an einigen Beispielen aus der Geologie der jüngst verflossenen Erdperioden zeigen, die man in Mülheims Umgebung beobachten kann.
Bis Mülheim fließt die Ruhr in einer verhältnismäßig engen Flussrinne. Sie kann natürlich kilometerbreit sein. Aber immer ist sie doch ein deutlicher Kanal, der von verhältnismäßig steil geböschten Talhängen eingefasst ist.
Bei Mülheim selbst ändert sich mit einem mal der Charakter des Tales. Da tritt die Ruhr in eine deltaförmige Bucht ein, die sich schnell verbreitet. Das linke Ufer geht nach Westen über Broich, Speldorf und Monning, im Großen und Ganzen der Duisburger Straße parallel. Das rechte Ufer aber schlägt die Richtung nach Norden auf Oberhausen zu ein.
Wie kommt das? Die Ursache wird klar, wenn wir das Grundgestein betrachten. Bei Broich, bei Saarn, bei Mintard, ist das Gestein der Talhänge der feste Ruhrsandstein der Kohleformation. Unterhalb aber beginnt der tertiäre Ton. Die Grenze des alten Meeresbeckens – es war ein Zipfel der Nordsee – das diesen Ton (in der Oligocänzeit) absetzte, läuft von Ratingen aus so ziemlich der Landstraße nach Mülheim entlang. Das ist auch so ungefähr die Grenze der Niederrheinischen Bucht. In der Gegend von Mülheim tritt die Ruhr also in dieses Tongebiet ein. Er findet sich in Broich schon am Kassenberg, ferner in Speldorf (Krug- und Pfannenbäckereien), dann im Duisburger Wald und auf dem Kaiserberg. Die Ruhr musste sich ihr Tal in den Untergrund eintiefen. In das feste Felsgestein ging das nicht so einfach. Da beschränkte sie sich infolgedessen auf das Allernotwendigste – auf den verhältnismäßig engen Kanal, von dem ich oben sprach. So entstand die schmale Rinne bis Mülheim. Unterhalb aber geriet der Fluss in die Niederrheinische Bucht, in den weichen Ton. Mit dem konnte er schon eher anfangen, was er wollte. Der bot ihm keinen Widerstand, und da konnte er sich nach Herzenslust einem „ausschweifenden Lebenswandel“ ergehen. Es mag vielleicht auch sein, dass hier Bruchspalten mitgespielt haben. Jedenfalls Gründe genug, um das Talgebiet hier zu verbreitern!
Die Verhältnisse sind gerade an dieser Stelle des Ruhrgebietes etwas verwickelt. Die verschiedenen Zeiten und später auch verschiedene Flussgebiete haben hier über- und durcheinander ihre Spuren hinterlassen. Das ganze Gebiet hebt sich im Laufe der Zeit. Die Flüsse aber suchen sich der Höhe des Meeresspiegels anzupassen und sägen sich ein. Auf diese Weise ist bei uns das Gebirge entstanden, und so kommt es auch, dass die älteren Flussbette immer oben auf den Bergen zu finden sind. Die ganze Hochfläche von Saarn über Mintard bis Kettwig vor der Brücke hat eine gleichmäßige Höhe von 100-110 Metern über dem Meeresspiegel. Bei Kettwig vor der Brücke wird sie durch das Vogelsangbachtal abgeschnitten. Östlich davon steigen die Höhen plötzlich auf 140-150 Metern an. Wie kommt das?
Auf den Höhen von Auberg an bis jenseits von Schloss Landsberg findet man überall Kies, denselben Kies, den man auf den Kuppen von gleicher Höhenlage nach Westen bis zur Linie Lintorf-Kaiserberg findet. Es ist Rheinkies. Die Hochfläche muss also ein altes Rheinbett sein! Der Geologe bezeichnet sie als Hauptterrasse. Östlich vom Vogelsangbachtal dagegen, da, wo die Höhen so plötzlich ansteigen, findet man auf den Kuppen Quarzkiesel von einer älteren Formation. Es handelt sich um das Pliozän, d.h. um das jüngste Tertiär. Zu der Zeit, als der Rhein in der Gegend floss, muss dieses Gebiet also trocken und ungefähr schon 30-50 Meter höher als das damalige Rheintal gelegen haben. Durch das Vogelsangbachtal etwa ging der Uferrand. Dieses Tal existierte damals noch nicht! An seiner Stelle muss man sich vielmehr einen sanft ansteigenden Uferhang denken. Dieser Uferhang wird von da aus etwa in dem heutigen Ruhrtal weiter nach Norden gegangen sein.
Von Mintard aus nach Osten, besonders auf der rechten Ruhrseite, ist der ganze Fels mit ockergelben Lehm schleierartig überzogen. Er geht über Berg und Tal. Es ist offenbar verlehmter Löss, die Überreste eines staubartigen Absatzproduktes aus derjenigen Steppenzeit, die der dritten Eiszeit folgte. Westlich von Mintard - schon in Saarn, Broich, Speldorf usw. – findet man dagegen Berg und Tal in derselben Weise mit einem weichen, schüttigen Sand überdeckt – offenbar Flugsand. In der Speldorfer Waldund Gartenstadt bei Haus Hammerstein z.B., ist er auf dem uralten erwähnten Rheinboden (Hauptterrasse) zu ganzen Dünen zusammengeweht. Nach Westen zu lässt er sich weiter verfolgen auf die Talebene des heutigen Rheins hinab bis vor Uerdingen, d.h. bis auf die sog. Niederterrasse, die der 4. Eiszeit entspricht. In der Nähe von Bahnhof Wedau (Bissingheim) bilden sie auf dieser Niederterrasse z.B. ausgesprochene Wanderdünen, die da in Reihen hintereinander liegen. Unter diesen Umständen kann sich der Flugsand, da diese Niederterrasse der 4. Eiszeit entspricht, erst in der Steppenzeit, die der 4. Eiszeit folgte, abgesetzt haben.
Geht alles mit rechten Dingen zu, so müsste der Sand da, wo er mit dem Lösslehm zusammentritt, über diesem liegen. Denn bekanntlich liegt die jüngere Bildung immer über der älteren. Tatsächlich kann man eine solche Beobachtung auch in der Nähe von Mintard machen. Da öffnet sich ein kleines Seitental nach der Ruhr hin. Sand und Lehm bedecken hier gemeinsam den Felsen. Und in der Tat – es ist so, wie wir vermuteten: Der Sand liegt über dem Lehm. Eine hübsche Probe aufs Exempel!
Die Hauptterrasse entspricht der ersten alpinen (Günz-) Vereisung, die Niederterrasse der vierten alpinen (Würm-) Vereisung. Die Terrasse der zweiten alpinen Vereisung ist unterhalb Bonn nicht mehr nachzuweisen.
Wohl aber die der 3., der Risseiszeit. Bei uns wird sie auch Hauptvereisung genannt. Es ist nämlich diejenige Eiszeit, in der das skandinavische Inlandeis bis zur Ruhr und noch weiter südlich, bis nach Großenbaum und Crefeld vordrang. Die ihr entsprechende „Mittelterrasse“ kennen unsere Leser bereits aus den vorjährigen Untersuchungen von Dr. Wildschrey. Es ist das „Urstromtal“ der Ruhr, das er über Monning, Kaiserberg, Lotharstraße und Wedau bis Lintorf verfolgt hat.
Damit ist in groben Zügen die Geologie des Mülheimer Gebiets links der Ruhr gegeben. Wenigstens soweit sie durch die geologische Neuzeit bedingt ist! - E.W.
5. Zur Geologie des Niederrheins
Aus: Niederrheinisches Museum – Zwanglose Blätter für Heimatgeschichte und Heimatkunde vom 12.08.1921.
Die Decke der Niederrheinischen Bucht besteht fast ganz aus Ablagerungen tertiärer und diluvialer Zeiten. Darunter befinden sich paläopoische Schichten neben Kreide, Zechstein und Bundsandstein. Die südlich vorgelagerten Braunkohlenlager gehören dem Tertiär an. Tektonische Vorgänge, in den oben genannten Zeiten, ließen die Bucht als Einsturzbecken entstehen, deren Randhöhen Eifel, Hohes Venn und Bergisches Land sind. In der Diluvialzeit wechselte der Rhein oft sein Bett und bildete wohl zeitweise ein mächtiges Delta. Schottermassen, mit Steinblöcken der Eiszeit, lagerte er ab unter ständigen Bodenbewegungen; denn nur so erklärt sich die eigenartige Lagerung dieser Schichten. Die Erosion des Wassers ließ das Bild oft anders gestalten und die Auswaschungen überboten nicht selten die neuen Ablagerungen so stark, dass die jüngere Bodenschicht stets unter diejenigen älterer Zeiten geriet. Daher die Rheinterrassen, die den verschiedenen Perioden entsprechen. Haupt-, Mittel- und Niederterrasse hat man sie genannt, die höchste derselben ist zugleich die älteste, da diese Bildung der Terrassen nur die Folge der Talvertiefung sein kann. Der Hauptterrasse gehören die Hinsbecker, Gladbacher und Süchtelner Höhen an. In der Mittelterrasse liegen Kempen und Aldekerk, das Rheintal füllt die Niederterrasse aus. Gesteine der erstgenannten Terrasse sind Kies, wenig abgerundet und große Blöcke; die Mittelterrasse weist Sandstein, Tonschiefer, Quarz, Basalt, Trachyt, Porphyr, Melaphyr, Quarzit auf; Sand und Lehm, feinkörnig, gehören in ihren Hauptmassen der Niederterrasse an. Während Lössschichten der Hauptterrasse ihre Fruchtbarkeit geben, fehlen diese auf der dritten gänzlich; ein Zeichen dafür, dass die Lössbildung am Ende der Entstehung der Mittelterrasse erfolgt sein muss. Für das Vorhandengewesensein der Eiszeit sprechen Geschiebemengen am Hülser Berge und namentlich bei den Clever Höhen. Wahrscheinlich hat das Eis nicht die ganze Bucht außer der Haupteiszeit bedeckt, da südlich der genannten Höhen nur schwache Eiszeitspuren zu finden sind.
Der Rhein, der an der geologischen Gestaltung der Bucht immer stark beteiligt war und es auch jetzt noch ist, hat fast die ganze Bucht zeitweilig zu seinem Strombette genutzt. Die Tümpel, Teiche, „Meere“ und alten Flussläufe sind zumeist Hinterlassenschaften seines wechselvollen Lebens. Durchfließt doch die Niers heute ein ehemaliges Rheinstrombett, die Issel ausgenommen. Sumpf, Bruch, Wald und Feld wechseln reichlich ab. Stille Weiher, üppige Saatfelder, saftige Wiesen mit strotzendem Vieh, blühende Heiden, düstere Wälder, ragende Wildmühlen, stille Städtchen und friedliche Dörfer, alte Edelsitze, stolze Bauerngüter, sie geben dem Niederrhein sein ureigendstes Gepräge.
Dazu der eigenartig graublaue Himmel mit dichten und schweren Wolkenballen, der ruhig dahinfließende breite Strom mit seinen flachen, baumbestandenen Ufern, Barke und Segelschiff auf seinen Fluten, und im Hintergrunde ein altes, an Geschichten reiches Städtchen, das gibt unserer Heimat Schönheit und Reiz!
6. Der Kassenberg bei Broich
Aus: Niederrheinisches Museum – Zwanglose Blätter für Heimatgeschichte und Heimatkunde vom 12.08.1921.
Ich will hier nicht die Geologie des Kassenbergs selbst auseinandersetzen. Das käme im Wesentlichen darauf hinaus, dass ich Bärtlings Führer abschreiben müsste, der gerade vom Kassenberg eine gute Beschreibung gibt. Nach der Methode nämlich, wie man die Geologie früher auffasste.
Ich will vielmehr das behandeln, was man vom Kassenberg aus in der Umgebung beobachten kann. Der Berg bietet, wie wohl die wenigsten wissen, eine sehr gute Übersicht über die ganze Landschaft. Eine Übersicht, wie wohl nirgends in der ganzen Runde. Von ihm aus kann man das ganze Gebirge von Kettwig bis Oberhausen und Mülheim überschauen. Nirgendwo vermag man vor allem die Hauptterrasse des Rheins so klar übersehen wie gerade hier. Bei der Fernsicht verschwinden alle einzelnen Täler und Schluchten, die sie zerschlitzen, und die sie stellenweise so unübersichtlich machen, wenn man sie begeht. Aus der Ferne gesehen, verschmelzen alle Teile zu einem einheitlichen Ganzen. Und so kann von hier aus der Laie mit einem einzigen Blick einen Gesamteindruck erzielen, der sonst nur durch mühselige wochenlange Einzelarbeit zu gewinnen ist.
Wir suchen die Spitze des Kassenbergs zu erreichen. Er liegt zwischen der Holzstraße und der Prinzess-Luisenstraße. Die Felder sind schon abgeerntet; es ist daher leicht hinaufzukommen. Auf dem Gipfel sind einige Löcher ausgehoben. Dort standen einige Flugabwehrgeschütze. Diese Stelle suchen wir auf.
Aus dem Messtischblatt ersehen wir, dass wir bei 83 Meter Meereshöhe stehen. Das ist also gerade die vorschriftsmäßige Höhe für die Hauptterrasse bei Duisburg. In solcher Höhe ist immer Rheinkies zu vermuten. Und in der Tat: wenn nicht schon die vielen Steine auf den Feldern, besonders auf dem westlichen Teil des Gipfels aufgefallen sind, den lehrt es der Aushub aus den Gruben. Hier liegt, in typischem gelben Rheinsand eingebettet, ausgesprochenes Rheingeröll: weiße Quarzkiesel, Bundsandstein usw. Die Flakbatterie hatte sich 4-8 Meter tief in diesen Schotter eingewühlt.
Nun werfen wir einen Rückblick auf das Panorama.
Im Westen sieht man in der Entfernung von einigen Kilometern das Duisburg-Speldorfer Waldgebirge. Rechts – im Nordwesten – endet es mit der bewaldeten Nase des Schnabenhucks. Die Spitze liegt gerade in der Gesichtslinie der Lutherkirche, d.h. über ihrem Turm. Von da aus erstreckt sich nach links der Kaiserberg. Kenntlich an dem Wasserturm, der sich in seiner ziemlich waagerechten Horizontlinie erhebt. Noch weiter links wölbt sich der Wolfsberg gegenüber der Monning über dieser Linie etwas empor. Er bildet scheinbar die Fortsetzung des Kaiserbergs, ist aber, wenn man genauer zusieht, doch durch eine blaue Luftschicht von ihm getrennt. Dieser Schlitz ist der Einschnitt des Urstromtales der Ruhr.





























