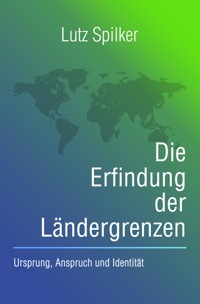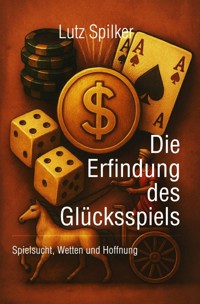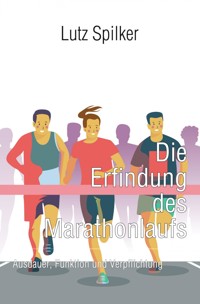
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Warum läuft der Mensch – und wozu? Diese scheinbar einfache Frage führt zurück in die Antike, zu jenem Lauf, der aus einem Botenlauf eine Legende machte. Damals, um 490 v. Chr., stand nicht Ruhm auf dem Spiel, sondern Verantwortung. Der Läufer von Marathon handelte nicht aus Ehrgeiz, sondern aus Pflicht – und doch wurde aus seiner Anstrengung der Inbegriff menschlicher Ausdauer. Das Buch zeichnet den Weg vom antiken Auftrag bis zur modernen Obsession nach: vom Überbringen einer Nachricht bis zum globalen Wettkampfspektakel. Es beschreibt, wie sich aus einem einmaligen Akt der Notwendigkeit ein Ritual des Ehrgeizes formte – kultiviert, vermessen und medial vervielfältigt. Dabei geht es nicht um Rekorde, sondern um Motive: um das Verhältnis von Körper und Wille, von Funktion und Selbstüberwindung, von Sinn und Symbol. ›Die Erfindung des Marathonlaufs‹ ist kein Sportbuch. Es ist eine Betrachtung über Maß, Ziel und Erschöpfung – über den Moment, in dem der Mensch über sich hinausläuft, um sich selbst zu begegnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Erfindung des
Marathonlaufs
•
Ausdauer, Funktion und Verpflichtung
Eine Betrachtung
von
Lutz Spilker
DIE ERFINDUNG DES MARATHONLAUFS
AUSDAUER, FUNKTION UND VERPFLICHTUNG
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.dnb.de abrufbar.
Texte: © Copyright by Lutz Spilker
Teile des Buchtextes wurden unter Zuhilfenahme von KI-Tools erstellt.
Umschlaggestaltung: © Copyright by Lutz Spilker
Das Cover und die internen Illustrationen wurden mithilfe von generativer KI erstellt.
Verlag:
Lutz Spilker
Römerstraße 54
56130 Bad Ems
Herstellung: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Die im Buch verwendeten Grafiken entsprechen den
Nutzungsbestimmungen der Creative-Commons-Lizenzen (CC).
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der
Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Inhalt
Inhalt
Das Prinzip der Erfindung
Vorwort
Der Lauf von Marathon
Ursprung einer Erzählung zwischen Geschichte und Mythos
Der Bote und die Botschaft
Vom Überbringen der Nachricht zum Sinnbild der Hingabe
Krieg, Körper und Pflichtgefühl
Wie der Lauf aus der Notwendigkeit geboren wurde
Laufen in der Polis
Der Athlet als Verkörperung gesellschaftlicher Tugend
Olympia und die Idee des Maßes
Körperliche Leistung als Spiegel geistiger Ordnung
Vom Mythos zur Moderne
Wie das 19. Jahrhundert den antiken Geist neu belebte
Athen 1896
Die Erfindung des modernen Marathonlaufs
Das Maß der Distanz
Von Athen bis London 1908: Die Definition der Strecke
Zwischen Ruhm und Opfer
Der frühe Wettkampfgedanke und seine Heldenbilder
Disziplin des Körpers
Training, Ernährung und das neue Wissen um Leistung
Frauen und Grenzen
Der langsame Zugang zur vermeintlich männlichen Disziplin
Marathon und Moderne
Fortschritt, Beschleunigung und das Streben nach Rekorden
Der Mensch im Takt der Maschinen
Rekorde als Religion
Wissenschaft als neuer Trainer
Das neue Heldenbild
Zwischen Technik und Transzendenz
Die Geschwindigkeit als Schicksal
Der Massenlauf
Demokratisierung eines ehemals heroischen Wettkampfs
Von der Heldentat zur Teilnahme
Die Stadt als Bühne
Die Demokratisierung der Leistung
Symbolik des Massenlaufs
Körperliche Gleichheit als Idee
Der Markt und die Masse
Eine neue Art Held
Die Rückkehr zur Einfachheit
Die Stadt als Strecke
Urbanität und Spektakel der Selbstüberwindung
Die Bühne der Urbanität
Der Zuschauer als Mitläufer
Selbstüberwindung als öffentliche Geste
Der Klang der Straße
Spektakel und Stille
Der Abdruck im Gedächtnis
Psychologie der Ausdauer
Vom physischen Schmerz zur mentalen Beharrlichkeit
Das innere Gespräch
Schmerz als Katalysator
Die Dynamik der Motivation
Flow und Erschöpfung
Die Lehre der langen Distanz
Der Läufer und sein Schatten
Selbstvermessung, Technik und Kontrollillusion
Die Faszination der Technik
Kontrolle als Illusion
Rhythmus und Selbstwahrnehmung
Technisierung der Selbstbeherrschung
Der Schatten als Partner
Marathon als Ritual
Kollektive Bewegung zwischen Religion und Routine
Grenze und Erschöpfung
Wo der Körper endet und der Wille beginnt
Der Lauf als Gleichnis
Vom Sport zum Symbol des Daseins
Im Ziel der Bewegung
Der Mensch im ewigen Kreislauf von Streben und Stillstand
Anmerkung zum Namen
1. Klassische Quellen und die Schreibweise ›Pheidippides‹
2. Moderne Adaptionen und die Schreibweise ›Philippides‹
3. Heutige Namenskonvention
Über den Autor
In dieser Reihe sind bisher erschienen
Lust verkürzt den Weg.
William Shakespeare
William Shakespeare (getauft am 26. April 1564 in Stratford-upon-Avon; gestorben am 23. April/jul. / 3. Mai 1616/greg. ebenda) war ein englischer Dichter, Theaterunternehmer und Schauspieler, dessen Dramen zu den bedeutendsten Werken der Weltliteratur gehören. Das überlieferte Gesamtwerk umfasst um 38 Bühnenstücke, sechs Versdichtungen sowie 154 Sonette.
Das Prinzip der Erfindung
Vor etwa 20.000 Jahren begann der Mensch, sesshaft zu werden. Mit diesem tiefgreifenden Wandel veränderte sich nicht nur seine Lebensweise – es veränderte sich auch seine Zeit. Was zuvor durch Jagd, Sammeln und ständiges Umherziehen bestimmt war, wich nun einer Alltagsstruktur, die mehr Raum ließ: Raum für Muße, für Wiederholung, für Überschuss.
Die Versorgung durch Ackerbau und Viehzucht minderte das Risiko, sich zur Nahrungsbeschaffung in Gefahr begeben zu müssen. Der Mensch musste sich nicht länger täglich beweisen – er konnte verweilen. Doch genau in diesem neuen Verweilen keimte etwas heran, das bis dahin kaum bekannt war: die Langeweile. Und mit ihr entstand der Drang, sie zu vertreiben – mit Ideen, mit Tätigkeiten, mit neuen Formen des Denkens und Tuns.
Was folgte, war eine unablässige Kette von Erfindungen. Nicht alle dienten dem Überleben. Viele jedoch dienten dem Zeitvertreib, der Ordnung, der Deutung oder dem Trost. So schuf der Mensch nach und nach eine Welt, die in ihrer Gesamtheit weit über das Notwendige hinauswuchs.
Diese Sachbuchreihe mit dem Titelzusatz ›Die Erfindung ...‹ widmet sich jenen kulturellen, sozialen und psychologischen Konstrukten, die aus genau diesem Spannungsverhältnis entstanden sind – zwischen Notwendigkeit und Möglichkeit, zwischen Dasein und Deutung, zwischen Langeweile und Sinn.
Eine Erfindung ist etwas Erdachtes.
Eine Erfindung ist keine Entdeckung.
Jemand denkt sich etwas aus und stellt es zunächst erzählend vor. Das Erfundene lässt sich nicht anfassen, es existiert also nicht real – es ist ein Hirngespinst. Man kann es aufschreiben, wodurch es jedoch nicht real wird, sondern lediglich den Anschein von Realität erweckt.
Der Homo sapiens überlebte seine eigene Evolution allein durch zwei grundlegende Bedürfnisse: Nahrung und Paarung. Alle anderen, mittlerweile existierenden Bedürfnisse, Umstände und Institutionen sind Erfindungen – also etwas Erdachtes.
Auf dieser Prämisse basiert die Lesereihe ›Die Erfindung …‹ und sollte in diesem Sinne verstanden werden.
Vorwort
Es gibt wenige Begriffe, die zugleich Bewegung, Geschichte und Mythos in sich tragen. Der Marathonlauf gehört zu ihnen. Seine bloße Erwähnung ruft Vorstellungen von Erschöpfung und Triumph hervor, von Disziplin und Überwindung, von einem Lauf, der mehr als nur sportlich ist. Doch wer sich dem Ursprung dieser Idee nähert, stößt nicht auf moderne Wettkämpfe, Medaillen oder Rekorde, sondern auf einen Bericht aus dem antiken Griechenland – auf die Gestalt eines Boten, der die Nachricht vom Sieg überbringt und daran zugrunde geht. In dieser Szene verdichtet sich das menschliche Verhältnis zur Grenze: zwischen Pflicht und Opfer, Distanz und Bedeutung.
Das vorliegende Buch folgt dieser Spur. Es fragt, warum gerade das Laufen – die einfachste aller Fortbewegungsarten – zur Metapher einer zivilisatorischen Leistung wurde. Warum aus einem Botenlauf ein Kult, aus einer Anstrengung ein Ideal, aus einem Weg ein Ritual entstand. Die ›Erfindung des Marathonlaufs‹ ist dabei weniger ein sporthistorisches Ereignis als ein kultureller Prozess, in dem der Mensch sich selbst als Maß seiner Ausdauer entwarf.
Wer die Geschichte dieses Laufs betrachtet, begegnet nicht nur Athleten, sondern Ideen: vom Körper als Werkzeug der Pflicht bis zur modernen Sehnsucht nach Selbstüberwindung. Der Marathonlauf steht in diesem Sinn nicht für Geschwindigkeit, sondern für Dauer – für das Durchhalten in einer Welt, die selten stehenbleibt. Vielleicht ist das sein eigentliches Geheimnis: dass er das Innehalten im Laufen lehrt. Und dass in jeder Ziellinie die Frage mitschwingt, wer hier wem davonläuft – der Mensch der Zeit, oder die Zeit dem Menschen.
URSPRUNG
UND
MYTHOS
Der Lauf von Marathon
Ursprung einer Erzählung zwischen Geschichte und Mythos
Es gibt Geschichten, die nicht erfunden werden müssen, weil sie sich selbst erfinden. Der Lauf von Marathon gehört zu ihnen. Ein Mann läuft, so erzählt man, von der Schlachtstätte bei Marathon bis nach Athen, um den Sieg über die Perser zu verkünden – und bricht tot zusammen. In diesem einfachen, beinahe schmalen Geschehen liegt etwas, das weit über die Tat hinausweist. Es ist ein Bild, das sich eingeprägt hat: der Mensch, der rennt, weil eine Botschaft größer ist als seine Kraft. Doch was wissen wir wirklich? Und was glauben wir nur, weil es erzählt wurde?
Der Ursprung dieser Geschichte liegt im Dunkel jener Zeit, in der Geschichte noch mit der Stimme begann. Die Quellen sind spärlich, die Deutungen zahlreich. Herodot, der älteste Chronist der Perserkriege, erwähnt keinen tödlichen Lauf nach Athen. Er berichtet lediglich, dass ein Bote namens Pheidippides von Athen nach Sparta eilte, um Hilfe zu erbitten – eine Strecke von fast 240 Kilometern, die er angeblich in zwei Tagen zurücklegte. Von einem Lauf von Marathon nach Athen schreibt er nichts. Erst Jahrhunderte später taucht die Episode auf, in der der Bote nach dem Sieg zusammenbricht. Es war der Rhetor Lukian, der um das zweite Jahrhundert nach Christus diese Geschichte in Worte fasste. Die spätere Welt übernahm sie, als wäre sie schon immer da gewesen.
Der Tod des Läufers war damit nicht bloß eine Anekdote, sondern ein Sinnbild geworden. Die Botschaft, die er trug – »Freut euch, wir haben gesiegt!« – ist zur Botschaft des menschlichen Ehrgeizes geworden. Seitdem steht der Lauf von Marathon für das äußerste Maß an Hingabe: der Mensch, der sich selbst übersteigt, um etwas zu vollbringen, das größer ist als er.
Die historische Grundlage des Ereignisses ist zugleich unspektakulär und monumental. Im Jahr 490 v. Chr. landeten die persischen Truppen in der Bucht von Marathon, etwa vierzig Kilometer nordöstlich von Athen. Die Athener, zahlenmäßig deutlich unterlegen, stellten sich dem übermächtigen Gegner entgegen – nicht nur aus Pflicht, sondern aus dem Bewusstsein heraus, dass sie hier über ihre Freiheit entschieden. Der Sieg, der folgte, war ein unerwarteter Triumph. Doch in der Euphorie des Erfolgs stand auch die Frage: Wer wird Athen benachrichtigen, dass das Unmögliche gelungen ist?
Die Vorstellung, dass einer diesen Auftrag auf sich nahm, ist wahrscheinlich, selbst wenn die überlieferten Details schwanken. Schon der Gedanke an diesen Boten besitzt eine eigentümliche Faszination. Denn er verkörpert etwas, das über den militärischen Kontext hinausgeht: die Verbindung von Bewegung, Information und Opfer. In gewisser Weise ist er der erste moderne Mensch – einer, der läuft, um etwas mitzuteilen, und der dafür seinen Körper als Träger der Botschaft einsetzt.
Doch wie viel davon ist Geschichte, und wie viel Legende? Es ist ein reizvoller Zwischenraum, in dem sich beide begegnen. Der Mythos füllt das, was die Geschichte offenlässt. Vielleicht starb der Läufer gar nicht. Vielleicht war er nie allein unterwegs. Vielleicht hat er nie »Freut euch, wir haben gesiegt!« gerufen, sondern nur still den Boden berührt, als er ankam. Aber das ändert nichts an der Kraft des Bildes. Der Mythos lebt, weil er eine Form von Wahrheit enthält, die nicht gemessen, sondern empfunden wird.
Man könnte sagen: Der Lauf von Marathon ist weniger ein historisches Ereignis als ein moralisches Gleichnis. Er erzählt, wie weit der Mensch zu gehen bereit ist, wenn er an etwas glaubt. Das erklärt, warum sich diese Erzählung über zweieinhalbtausend Jahre gehalten hat. Sie spricht von der Grenze des Körpers und von der Bedeutung des Ziels. Sie verbindet Tod und Triumph zu einer Einheit, die zugleich tragisch und erhebend wirkt.
In der antiken Welt war der Bote eine Figur des Übergangs. Er stand zwischen Herr und Volk, zwischen Wissen und Unwissen, Leben und Tod. Seine Aufgabe war nicht das Handeln, sondern das Übermitteln. Vielleicht ist es genau dieser Zwischenstatus, der ihn für spätere Generationen so faszinierend machte. Denn er steht sinnbildlich für den Menschen selbst: immer unterwegs, nie ganz angekommen, immer auf der Schwelle zwischen Sinn und Erschöpfung.
Als die Geschichte im 19. Jahrhundert wiederentdeckt wurde, war die Welt längst eine andere. Doch gerade ihre Fremdheit verlieh ihr neue Anziehungskraft. Die antike Leistung erschien als Maßstab, als Gegenbild zur modernen Bequemlichkeit. Der Lauf von Marathon wurde zum Symbol einer verlorenen Reinheit – eines Tuns ohne Berechnung, ohne Publikum, ohne Preisgeld. In dieser idealisierten Vorstellung schwang ein stiller Vorwurf mit: dass der moderne Mensch zwar schneller reisen, aber weniger bedeutsam handeln konnte.
So verwandelte sich eine unsichere Überlieferung in ein kollektives Leitbild. Jeder, der heute einen Marathon läuft, wiederholt unbewusst die alte Geste: den Kampf gegen die eigene Grenze, den Triumph über die Erschöpfung, den Versuch, einer Botschaft Gestalt zu geben, die nicht mehr ausgesprochen wird. Der Satz »Freut euch, wir haben gesiegt!« hat sich längst verflüchtigt, aber sein Echo hallt in jedem Zielstrich nach.
Was den Mythos zusätzlich nährt, ist die Nähe zwischen äußerer und innerer Bewegung. Der Lauf von Marathon war eine physische Tat – aber sie enthält eine psychologische Dimension, die über die Antike hinausweist. Der Läufer, der sich bis an den Rand seiner Kräfte verausgabt, ist ein Bild für das menschliche Streben selbst. Es gibt kein genaueres Sinnbild für den Versuch, die Distanz zwischen Notwendigkeit und Ideal zu überwinden.
Manche Historiker weisen darauf hin, dass der Tod des Läufers eine spätere, fast theatralische Hinzufügung sei. Sie mag erfunden sein – und doch trifft sie etwas Wesentliches. Denn in der Vorstellung, dass der Bote sein Leben opfert, um die Botschaft zu überbringen, liegt eine tiefe Wahrheit über das Verhältnis von Ziel und Preis. Ein Triumph, der ohne Opfer errungen wird, bleibt unvollständig. Der Mythos vom toten Boten erinnert daran, dass jedes Ziel eine Grenze markiert – und jede Grenze zugleich der Beginn einer neuen Bewegung ist.
Es ist bemerkenswert, dass dieser Mythos ausgerechnet in Griechenland entstand, jenem Land, das wie kein anderes das Maß und die Harmonie pries. Der Lauf von Marathon sprengt das Maß. Er ist kein Spiel, keine Übung, kein Wettkampf. Er ist ein Akt des Übermaßes, geboren aus Not und Hingabe. Vielleicht war es genau dieses Überschreiten, das den Griechen selbst als würdig erschien, erinnert zu werden.
In der Moderne wird der Lauf gern als Ursprung des Sports interpretiert. Doch im Kern ist er etwas anderes: Er ist der Anfang des Bewusstseins, dass der Körper ein Medium sein kann – ein Werkzeug der Mitteilung, ein Ausdruck des Geistes. Der Läufer von Marathon hat nichts gewonnen, nichts besessen, nichts hinterlassen. Aber er hat etwas gezeigt: dass Bewegung selbst eine Form des Sprechens ist.
Vielleicht liegt darin der eigentliche Grund, warum die Geschichte überlebt hat. Sie erzählt nicht von Geschwindigkeit, sondern von Sinn. Nicht vom Ziel, sondern vom Weg dorthin. Sie beschreibt den Menschen in seiner schlichtesten, verletzlichsten Gestalt – laufend, atmend, ringend. Der Mythos vom Boten, der stirbt, nachdem er das Wichtigste gesagt hat, ist ein Gleichnis über das Dasein selbst: dass Bedeutung oft nur einen Atemzug lang währt, aber doch genügt, um eine ganze Zivilisation zu prägen.
Und so bleibt der Lauf von Marathon ein Übergang – zwischen Wirklichkeit und Vorstellung, zwischen Sieg und Erschöpfung, zwischen Nachricht und Schweigen. Er ist keine Episode der Geschichte, sondern eine Verdichtung des Menschlichen. Vielleicht deshalb laufen wir noch heute. Nicht, weil wir gewinnen wollen, sondern weil wir spüren, dass in jeder Anstrengung ein Echo dieses alten Laufes mitschwingt. Ein Mensch, der läuft, trägt immer mehr als sich selbst.
Der Bote und die Botschaft
Vom Überbringen der Nachricht zum Sinnbild der Hingabe