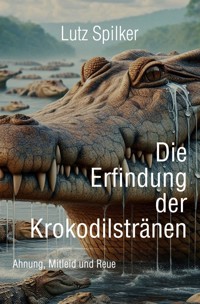
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Tränen gelten als Zeichen der Aufrichtigkeit. Doch was, wenn sie bloß Fassade sind – sichtbar, aber nicht wahrhaftig? Die sogenannte Krokodilsträne ist eine Redewendung mit langer Geschichte und subtiler Wirkung. Sie unterstellt eine gezielte Täuschung – ein Mitgefühl, das keines ist. Doch woher stammt dieses Bild? Warum gerade das Krokodil? Und was verrät die Wahl dieses Tieres über unser Verständnis von Emotion, Schuld und Darstellung? Dieses Buch geht der symbolischen Tiefenstruktur eines scheinbar beiläufigen Ausdrucks nach. Es zeigt, wie sich biologische Beobachtungen mit kulturellen Zuschreibungen vermischen, wie Sprache aus Irritation Bedeutung gewinnt – und wie der Mensch beginnt, sich selbst zu inszenieren, lange bevor er es bewusst reflektiert. Die K-Träne, wie sie hier genannt wird, ist mehr als eine sprachliche Kuriosität. Sie eröffnet einen Blick auf den sozialen Gebrauch von Emotionen, auf die feinen Übergänge zwischen Echtheit und Simulation, zwischen Affekt und Absicht. Ihre Geschichte führt durch mittelalterliche Tierdarstellungen, rhetorische Figuren, kindliche Strategien und gesellschaftliche Rollenspiele – bis hinein in die Gegenwart, in der Emotion öffentlich verhandelt und gezielt eingesetzt wird. Ein Essay über Tränen, die nicht fließen – und über ein Tier, das nie darum bat, Symbol für Verstellung zu werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Erfindung
der Krokodilstränen
•
Ahnung, Mitleid und Reue
Eine Betrachtung
von
Lutz Spilker
DIE ERFINDUNG DER KROKODILSTRÄNEN
AHNUNG, MITLEID UND REUE
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.dnb.de abrufbar.
Texte: © Copyright by Lutz Spilker
Umschlaggestaltung: © Copyright by Lutz Spilker
Verlag:
Lutz Spilker
Römerstraße 54
56130 Bad Ems
Herstellung: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Die im Buch verwendeten Grafiken entsprechen den
Nutzungsbestimmungen der Creative-Commons-Lizenzen (CC).
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der
Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Inhalt
Inhalt
Das Prinzip der Erfindung
Vorwort
Beobachtung am Wasserloch
Die Träne als Funktion, nicht als Botschaft
Die Szene als Deutungsfalle
Vom Reptil zur Redewendung
Der Moment der Projektion
Die stille Ironie der Biologie
Der Mythos entsteht
Nilreisen und Erzählräume
Zwischen Staunen und Moral
Vom Tierbild zur Menschenkritik
Mündliche Überlieferung und das Gedächtnis der Völker
Vom Tränenfilm zur Deutungslinse
Weinen im Bestiarium
Das Tierbuch als Spiegel der Tugend
Die Träne als moralisches Symptom
Schrift und Bild im Dienst der Moral
Die Wirkungsgeschichte der Krokodilsträne
Zwischen Fabel und Wirklichkeit
Das Reisebuch des Mandeville
Die Passage – zwischen Fabel und Weltbeschreibung
Glaubwürdigkeit als sekundäre Kategorie
Vom Tier zur Allegorie
Ein fremdes Tier in vertrauter Moral
Das Bild beginnt zu wandern
Die Träne als Spiegel
Tränen in der Theologie
Die Träne als Gnade
Die Verstellung des Gefühls
Der Teufel als Tränenproduzent
Die Träne als Prüfstein
Zwischen Himmel und Bühne
Vom Tier zur Metapher
Ein Bild verlässt seinen Ursprung
Die Verinnerlichung eines Fremdzeichens
Die soziale Kraft des Verdachts
Die Träne als Spiegelbild des Argwohns
Vom Tier zum Typus
Das Tier als Zeuge der Sprache
Sprache als Richter
Wenn Tränen Beweiskraft beanspruchen
Die Bühne des Bekennens
Die Träne als rhetorisches Argument
Das Krokodil als Einspruch
Die Skepsis bleibt
Die Träne als Strategie
Bühne der Gefühle
Tränen in höfischer Umgebung
Literatur als Vergrößerungsglas
Der Blick wird zur Instanz
Zwischen Bühne und Leben
Aufklärung ohne Gefühl
Die kontrollierte Seele
Misstrauen gegenüber Pathos
Zwischen Gefühl und Täuschung
Die Rhetorik der Zurückhaltung
Eine neue Nüchternheit
Das sentimentale Zeitalter
Die Träne als Offenbarung
Der Triumph der Empfindsamkeit
Das Krokodil verschwindet
Das Tränenmotiv in der Kunst
Zwischen Echtheit und Erwartung
Der moralische Zeigefinger
Vom Theater zur Bühne des Alltags
Justitia weint nicht
Das Kind weint klüger, als man denkt
Tränen und Geschlecht
Filmtränen – Inszeniertes Mitgefühl im Zeitalter der Kamera
Politik der Gefühle
Die weinende Nation
Populärkultur und Memes - Die K-Träne im digitalen Raum
Lügen mit Gefühl – Die K-Träne in Liebesbeziehungen
Psychologische Diagnosen – Tränen in der Persönlichkeitsstruktur
Künstliche Tränen – Schauspieltechnik und emotionale Reproduktion
Vom Affekt zur Absicht – Tränen im Wandel der Zeit
Misstrauensgesellschaft – Warum Gefühle vermehrt bezweifelt werden
Tiere als Projektionsflächen – Was wir anderen Lebewesen andichten
Der Zweifel als Reflex – Warum wir nicht alles glauben wollen
Empathie oder Kontrolle – Was Tränen im Gegenüber auslösen
Tränen und Wahrheit – Der schwierige Begriff des Echten
Das Krokodil schweigt – Rückblick auf ein symbolisches Missverständnis
Postskriptum der Träne – Über das Recht auf Gefühl und das Misstrauen dagegen
Über den Autor
In dieser Reihe sind bisher erschienen
»Natürlich ist das Elend der Menschen im Kosovo entsetzlich, für jeden Betrachter. Aber wenn ich die Krokodilstränen sehe, die Leute wie Bill Clinton, Tony Blair, Chirac, Joschka Fischer, Schröder, Scharping, General Clark und alle anderen NATO-Imperialisten vergießen, die sich heute für die neue ›Mutter
Teresas‹ der Welt ausgeben, dann wird mir übel. Glaubt mir, nichts ist schlimmer als die Tränen des Krokodils, das sein Opfer herunterwürgt.«
Unter dem Motto ›Stoppt die Bombardierungen! - Nein zum Krieg gegen Jugoslawien!‹ fand am 24. April 1999 eine Demonstration zum Nato- und US-Hauptquartier statt, an der sich ca. 600 Kriegsgegner beteiligten. Aufgerufen hatten das Heidelberger Bündnis ›Stoppt die NATO - Nein zum Krieg!‹, das Friedensplenum Mannheim und das Friedensbündnis Karlsruhe. Neben
weiteren Rednern sprach auch Dave Blalock, Mitglied der ›Vietnam Veterans against the War‹ vor dem Hauptquartier.
Dave Blalock
Dave Blalock, 1968-71 in der US-Army, 1969-70 in der Luftwaffe (First Aviation Brigade) in Vietnam, Mitglied der ›Vietnam Veterans against The War‹, Mitglied von A.I. und der ›Stop The War Brigade‹.
Credits: https://contraste.netz.coop/AlteHomepage/Archiv/jugoslaw2.htm
Das Prinzip der Erfindung
Vor etwa 20.000 Jahren begann der Mensch, sesshaft zu werden. Mit diesem tiefgreifenden Wandel veränderte sich nicht nur seine Lebensweise – es veränderte sich auch seine Zeit. Was zuvor durch Jagd, Sammeln und ständiges Umherziehen bestimmt war, wich nun einer Alltagsstruktur, die mehr Raum ließ: Raum für Muße, für Wiederholung, für Überschuss.
Die Versorgung durch Ackerbau und Viehzucht minderte das Risiko, sich zur Nahrungsbeschaffung in Gefahr begeben zu müssen. Der Mensch musste sich nicht länger täglich beweisen – er konnte verweilen. Doch genau in diesem neuen Verweilen keimte etwas heran, das bis dahin kaum bekannt war: die Langeweile. Und mit ihr entstand der Drang, sie zu vertreiben – mit Ideen, mit Tätigkeiten, mit neuen Formen des Denkens und Tuns.
Was folgte, war eine unablässige Kette von Erfindungen. Nicht alle dienten dem Überleben. Viele jedoch dienten dem Zeitvertreib, der Ordnung, der Deutung oder dem Trost. So schuf der Mensch nach und nach eine Welt, die in ihrer Gesamtheit weit über das Notwendige hinauswuchs.
Diese Sachbuchreihe mit dem Titelzusatz ›Die Erfindung ...‹ widmet sich jenen kulturellen, sozialen und psychologischen Konstrukten, die aus genau diesem Spannungsverhältnis entstanden sind – zwischen Notwendigkeit und Möglichkeit, zwischen Dasein und Deutung, zwischen Langeweile und Sinn.
Eine Erfindung ist etwas Erdachtes.
Eine Erfindung ist keine Entdeckung.
Jemand denkt sich etwas aus und stellt es zunächst erzählend vor. Das Erfundene lässt sich nicht anfassen, es existiert also nicht real – es ist ein Hirngespinst. Man kann es aufschreiben, wodurch es jedoch nicht real wird, sondern lediglich den Anschein von Realität erweckt.
Der Homo sapiens überlebte seine eigene Evolution allein durch zwei grundlegende Bedürfnisse: Nahrung und Paarung. Alle anderen, mittlerweile existierenden Bedürfnisse, Umstände und Institutionen sind Erfindungen – also etwas Erdachtes.
Auf dieser Prämisse basiert die Lesereihe ›Die Erfindung …‹ und sollte in diesem Sinne verstanden werden.
Vorwort
Es gibt Redewendungen, die sich durch bloße Wiederholung in den Alltag einschleichen, ohne dass ihr Bedeutungsraum je kritisch ausgelotet würde. Man nimmt sie zur Kenntnis, verwendet sie beiläufig, deutet sie intuitiv – und belässt sie doch im Schatten sprachlicher Gewohnheit. Die ›Krokodilsträne‹ ist eine solche Wendung: ein Ausdruck für geheucheltes Mitgefühl, ein Verdachtsmoment gegen die Echtheit gezeigter Emotion, ein stiller Vorbehalt gegenüber jeder Träne, die zur Unzeit kommt. Dass sich hinter dieser alltäglichen Formulierung ein komplexer kultureller Mechanismus verbirgt, wird selten bedacht. Dieses Buch möchte genau hier ansetzen.
Die Vorstellung, ein Tier – noch dazu ein Raubtier – könne Tränen vergießen, während es frisst, irritiert. Mehr noch: Sie provoziert Widerspruch. Denn sie führt zwei Ebenen zusammen, die einander instinktiv ausschließen – Grausamkeit und Gefühl. Doch gerade in dieser Widersinnigkeit liegt der Ursprung einer sprachlichen Erfindung, deren Wirkung bis heute anhält. Die Krokodilsträne, so die These, ist weniger eine biologische Beobachtung als vielmehr eine kulturelle Konstruktion: ein Sinnbild, entstanden aus Misstrauen, Faszination und moralischem Bedürfnis nach Entlarvung.
Dieses Buch rekonstruiert die Entstehung dieser Figur, nicht um das Tier als solches zu vermessen, sondern um den Blick auf den Menschen zu richten, der es als Projektionsfläche gewählt hat. Denn die Wahl des Krokodils ist nicht zufällig. Es steht für Kälte, Berechnung, Unnachgiebigkeit – und verleiht der Träne, die ihm angedichtet wurde, ihre paradoxale Schlagkraft. Wer Tränen mit Sanftmut verbindet, wird im Angesicht eines Krokodils stutzen. Und genau dieses Stutzen macht die Redewendung wirksam. Die Träne des Krokodils ist ein Alarmsignal. Nicht, weil sie wirklich fließt, sondern weil ihr Fließen unglaubwürdig erscheint – und damit der gezeigten Emotion ihre Echtheit entzieht.
In diesem Spannungsfeld bewegt sich die vorliegende Untersuchung. Sie fragt nicht nur danach, ob Krokodile tatsächlich Tränen vergießen, sondern vielmehr: Warum erzählt sich der Mensch eine Geschichte, in der genau dieses Tier zu weinen beginnt? Und was sagt diese Geschichte über das Verhältnis des Menschen zur Wahrheit, zur Täuschung und zur Emotionalität aus?
Die Krokodilsträne ist ein Kulturphänomen. Sie hat ihren Platz in Märchen, Gerichtssälen, zwischenmenschlichen Dramen und öffentlichen Auftritten. Sie erscheint dort, wo Emotionen strategisch eingesetzt werden, um Wirkung zu erzeugen – sei es aus Not, Kalkül oder Gewohnheit. Die K-Träne, wie sie im internen Sprachgebrauch dieses Buches genannt wird, markiert die Grenzlinie zwischen innerem Gefühl und äußerem Ausdruck – und benennt jenen Moment, in dem Authentizität und Absicht ununterscheidbar werden.
Wer Tränen zeigt, signalisiert Verletzlichkeit. Wer sie instrumentalisiert, tarnt eine Absicht hinter einem Gefühl. In dieser Konstellation liegt der soziologische Kern des Phänomens. Denn der Ausdruck der Emotion ist nie nur ein innerer Vorgang – er ist immer auch ein Zeichen an die Umwelt. Und Zeichen können falsch sein.
Dieses Buch stellt keine Diagnose, es formuliert eine Beobachtung. Es fragt, woher die K-Träne kommt, welche kulturellen Bedingungen sie hervorgebracht haben und warum sie sich über Jahrhunderte hinweg behaupten konnte. Es verfolgt Spuren in historischem Material, in sprachlichen Wendungen, in alltäglichen Gesten. Und es öffnet einen Denkraum, in dem das scheinbar Kleine – die Träne – zu einem Symptom größeren menschlichen Verhaltens wird.
Wer dieses Buch liest, wird weniger über Krokodile erfahren als über sich selbst. Denn die eigentliche Bühne der K-Träne ist nicht der Urwald, sondern das soziale Miteinander. Sie tritt dort auf, wo Schuld vermieden, Nähe inszeniert oder Nachsicht erwirkt werden soll. Ihre Analyse ist daher kein zoologisches, sondern ein soziokulturelles Unterfangen.
Dass sie Tränen vergießt, ist unwahrscheinlich.
Dass wir ihr das zutrauen, ist bezeichnend.
Beobachtung am Wasserloch
Die Tränensekretion bei Reptilien
Am Rande einer flachen Uferstelle, irgendwo in den Feuchtgebieten Zentralafrikas oder in den Flussdeltas Südostasiens, ruht regungslos ein Krokodil im Schlamm. Nur die Augen, halb geschlossen, verraten, dass es nicht schläft, sondern wartet. Die Haut glänzt feucht, das Maul leicht geöffnet. Die Szene ist unauffällig – wäre da nicht der schmale, glänzende Film, der sich unterhalb der Augen abzeichnet. Eine Flüssigkeit rinnt langsam über die runzlige Schuppenhaut. Wer lange genug hinschaut, stellt fest: Es sieht aus, als würde das Tier weinen.
Und genau hier beginnt das Missverständnis – oder besser: die Verwechslung von biologischer Erscheinung und menschlicher Zuschreibung. Dieses Kapitel widmet sich einem simplen, beinahe beiläufigen Vorgang, der dennoch zum Grundstein einer vieldeutigen Redewendung wurde. Denn was da am Wasserloch geschieht, ist nicht mehr – aber eben auch nicht weniger – als ein körperlicher Prozess, der durch den menschlichen Blick in eine Bedeutung verwandelt wurde, die über ihn selbst hinausweist.
Die Träne als Funktion, nicht als Botschaft
Zunächst ist festzuhalten, dass Krokodile sehr wohl über Tränendrüsen verfügen. Diese sind anatomisch ähnlich organisiert wie bei vielen anderen Landwirbeltieren. Sie haben ihren Platz oberhalb des Auges und dienen – wenngleich funktional unspektakulär – der Befeuchtung der Hornhaut. Bei längeren Aufenthalten an Land ist diese Benetzung notwendig, um das empfindliche Auge vor Austrocknung zu schützen. Auch das Ausspülen von Schmutzpartikeln spielt eine Rolle. Dies ist kein Zeichen innerer Regung, sondern schlichte biologische Notwendigkeit.
In der Fachliteratur ist dieser Sekretionsvorgang gut beschrieben, wenn auch selten im Fokus zoologischer Betrachtung. Bei der Beobachtung von Krokodilen an Land lässt sich gelegentlich ein verstärktes Absondern dieser Tränenflüssigkeit feststellen. Vor allem dann, wenn die Tiere ihre Beute an Land reißen oder fressen. Was dabei von außen wie emotionale Regung erscheint – etwa das sichtbare Ablaufen einer Flüssigkeit vom Auge über die Schnauze – ist physiologisch erklärbar: Der Kauvorgang, der bei Krokodilen erhebliche Muskelaktivität im Schädel auslöst, übt Druck auf verschiedene Gewebestrukturen aus, darunter auch jene, die in direkter Nähe der Tränendrüsen liegen.
Manche Forscher vermuten, dass es sich dabei um einen passiven Effekt handelt – gewissermaßen ein Nebenprodukt der Fressbewegung. Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass diese Sekretion mit inneren Zuständen vergleichbar ist, wie sie bei Menschen mit Tränenausdruck einhergehen – etwa Trauer, Rührung oder Schmerz. Die Träne des Krokodils ist eine Flüssigkeit, keine Mitteilung.
Die Szene als Deutungsfalle
Der Mensch sieht, was er zu sehen gelernt hat. Und so wird aus einem harmlosen Feuchtigkeitsfilm rasch ein vermeintliches Zeichen. Die Kombination von Träne und Beißakt wirkt irritierend. Sie widerspricht dem, was man erwartet. Wie kann ein Tier, das gerade einen anderen Körper zerreißt, zugleich Tränen vergießen? Diese Gleichzeitigkeit stiftet Sinn – oder besser: fordert zur Sinnstiftung heraus. Was sich da am Wasserloch abspielt, ist nicht nur ein zoologisches Geschehen, sondern ein psychologisches.
In der Beobachtung mischt sich Unverständnis mit Faszination. Wer ein Tier beim Fressen sieht und dabei eine Träne erkennt, wird unweigerlich nach Erklärungen suchen. Und wenn sich keine biologische anbieten lässt, tritt die kulturelle Fantasie auf den Plan. Die Vorstellung, ein Raubtier weine über sein Opfer, ist so widersinnig, dass sie – paradoxerweise – glaubhaft wirkt. Gerade weil sie so schwer vorstellbar ist, erhält sie eine Art dichterische Kraft. Das Bild prägt sich ein. Es wird weitererzählt. Und irgendwann gilt es als bekannt.
Vom Reptil zur Redewendung
Die Krokodilsträne, wie sie in der Sprache überliefert ist, lebt nicht von der zoologischen Genauigkeit, sondern vom Kontrast zwischen Erscheinung und Erwartung. Das Weinen eines Krokodils erscheint grotesk – gerade deshalb wird es zum Symbol. Und zwar nicht für Mitgefühl, sondern für seine Täuschung. Denn was könnte unglaubwürdiger sein als das Gefühl eines Wesens, das selbst keine Mimik kennt?
Diese Diskrepanz ist entscheidend. Krokodile haben ein starres Gesicht. Sie verfügen über keine Muskulatur, die emotionale Regung sichtbar machen würde. Kein Stirnrunzeln, kein Zucken, kein Zusammenziehen der Mundwinkel. Wenn ein Krokodil eine Flüssigkeit absondert, dann geschieht dies reglos – fast gleichgültig. Und eben das verleiht der Träne ihre Wirkung. Sie fließt – aber niemand weiß, warum. Die Mimik schweigt.
Hier offenbart sich ein weiterer Aspekt der Fehlinterpretation: Der Mensch neigt dazu, Bewegung mit Bedeutung gleichzusetzen. Eine Träne gilt nicht nur als Flüssigkeit, sondern als Bekenntnis. Sie wird gelesen wie ein Satz, gedeutet wie ein Geständnis. Beim Menschen selbst mag das bis zu einem gewissen Grad zutreffen – zumindest im kulturellen Verständnis. Beim Tier jedoch bleibt die Träne ein Mechanismus, nichts weiter.
Der Moment der Projektion
Was also geschieht in jenem Augenblick, wenn jemand ein Krokodil weinen sieht? Es ist nicht das Tier, das sich verändert – es ist der Blick des Betrachters. Die Träne wird nicht beobachtet, sondern erzeugt – im Auge desjenigen, der sie deutet. Aus einem Sekret wird ein Symbol. Aus einem Vorgang wird ein Verhalten. Und aus einer funktionalen Sekretion wird ein Ausdruck innerer Regung.
Diese Projektion ist nicht zufällig. Sie entspringt einer anthropozentrischen Weltsicht, in der Tiere Gefühle haben – oder eben nicht. Und je nachdem, wie sehr ein Tier dem Menschen ähnelt, werden ihm bestimmte Fähigkeiten zugeschrieben. Das Krokodil liegt in dieser Hinsicht denkbar ungünstig: Es ist kalt, unbeweglich, berechnend. Wenn es dennoch Tränen zeigt, erzeugt dies ein Spannungsverhältnis – eines, das die menschliche Fantasie nicht ungenutzt lässt.
Die stille Ironie der Biologie
Dass die Redewendung der Krokodilsträne überlebt hat, verdankt sich genau dieser Spannung. Sie verweist auf einen Widerspruch, der als Metapher funktioniert. Doch am Anfang stand ein einfacher, harmloser Vorgang: die Befeuchtung des Auges. Die Biologie des Reptils kennt keine Ironie. Aber der Mensch ist in der Lage, sie hineinzulesen. Und so wurde aus dem unbewegten Tier ein Symbol für gespielte Emotion – ausgerechnet deshalb, weil es selbst keine zeigt.
Wer also am Wasserloch steht und lange genug beobachtet, wird vielleicht eine Träne sehen. Sie ist echt – in dem Sinne, dass sie fließt. Aber sie ist nicht echt im Sinne einer Absicht oder Regung. Die Träne des Krokodils beweist nichts – weder Reue noch Kälte. Sie ist einfach da.
Damit ist sie der ideale Spiegel: Sie sagt nichts, aber sie lässt sich alles sagen. Und das macht sie – biologisch belanglos, kulturell jedoch folgenschwer – zur Geburtshelferin einer Redewendung, die bis heute gebraucht wird, wenn Zweifel im Raum steht.
Nicht das Krokodil täuscht – wir täuschen uns über das Krokodil.
Das ist die eigentliche Pointe. Und zugleich der Auftakt zu allem, was folgt.
Der Mythos entsteht
Frühe Fehldeutungen im Altertum
Irgendwann im Übergang von Beobachtung zu Erzählung, von Reisebericht zu Weltdeutung, wurde ein Tier zur Figur. Das Krokodil, ein scheues Wesen an den Ufern des Nils, erschien dem europäischen Blick der Antike als etwas Fremdes, beinahe Rätselhaftes. Es war weder Haus- noch Jagdtier, sondern ein unnahbares Reptil, das mit stoischer Regungslosigkeit im Schlamm lag, dann urplötzlich zuschnappte – lautlos, effizient, tödlich. Vielleicht gerade weil sein Verhalten so wenig zu fassen war, begannen Menschen früh damit, es mit Bedeutung aufzuladen. Und irgendwo in diesem Bedeutungsnetz tauchten zum ersten Mal die Tränen auf.
Die Vorstellung, ein Tier könne während des Fressens weinen, ist keine Erfindung der Neuzeit. Ihre Ursprünge lassen sich bis in die Antike zurückverfolgen, auch wenn sie dort noch nicht als geflügeltes Wort, sondern eher als irritierende Beobachtung erscheint – eine, die erzählt, weitergetragen, umgedeutet wurde. Nicht die Träne selbst war das Thema, sondern der Eindruck, den sie hinterließ. Und aus diesem Eindruck entstand eine Idee, die sich bis heute erhalten hat.
Nilreisen und Erzählräume
Die ersten Berichte über das Krokodil stammen aus der Feder von Reisenden, Händlern, Philosophen. Herodot, der als einer der frühesten ›Ethnographen‹ gelten kann, schildert im fünften Jahrhundert v.Chr. die Eigenheiten der ägyptischen Fauna. Auch das Krokodil kommt darin vor – als Wesen, das verehrt und zugleich gefürchtet wird. Zwar erwähnt Herodot keine Tränen, doch seine Beschreibung des Tieres legt den Grundstein für eine Wahrnehmung, die das Krokodil als Grenzfigur begreift: halb Tier, halb Götterwesen, gefährlich und doch faszinierend.
Andere Autoren, darunter Plinius der Ältere, vermerken in ihren enzyklopädischen Werken Hinweise auf merkwürdige Verhaltensweisen der Krokodile. Bei Plinius liest man, dass das Tier nach dem Verschlingen seiner Beute zu schnaufen beginne, dass Flüssigkeiten aus seinem Maul und seinen Augen träten – eine Beobachtung, die in der damaligen Weltsicht kaum als rein physiologischer Vorgang gedeutet wurde. Die Träne war keine Feuchtigkeitsabsonderung, sondern ein Ausdruck, ein Zeichen – wenngleich noch ohne festgelegte Bedeutung.
Das Missverständnis beginnt also nicht mit einer Lüge, sondern mit einem Deutungsversuch. Wenn Reisende durch Ägypten zogen, das Tier in der Nähe des Wassers beim Fressen beobachteten und dabei eine feuchte Zone um die Augen bemerkten, dann war das für sie kein mechanischer Vorgang, sondern ein symbolischer. Der Mensch der Antike war kein Biologe – er war ein Deuter von Zeichen. Und das Auge, das weint, musste etwas mitteilen.
Zwischen Staunen und Moral
In vielen antiken Kulturen galt das Auge als Sitz der Wahrheit. Wer die Augen schloss, verbarg etwas; wer sie öffnete, offenbarte sich. Tränen wiederum wurden bereits in frühen Kulturen als sichtbarer Ausdruck des Innersten verstanden – nicht nur als Reaktion auf Schmerz oder Trauer, sondern auch als Zeichen göttlicher Berührung, als Reinigung, als Entladung seelischer Spannung. Wenn ein Tier wie das Krokodil Tränen zeigte, dann musste es – aus damaliger Sicht – ein Gefühl geben, das diesen Ausdruck hervorrief.
Die Träne wurde nicht als unwillkürliche Flüssigkeit begriffen, sondern als Aussage. Und Aussagen forderten Deutung. Es ist gut möglich, dass aus dieser Deutungsbereitschaft heraus der Mythos von den weinenden Krokodilen entstand – zunächst nicht mit der Absicht zu täuschen, sondern aus dem Wunsch, dem Tier eine moralische Dimension zu verleihen.





























