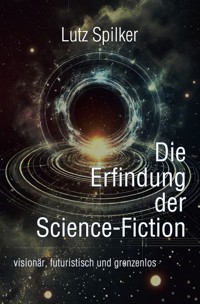
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was treibt den Menschen dazu, sich Welten auszudenken, die es (noch) nicht gibt? Warum flieht er gedanklich in ferne Galaxien, technische Utopien oder dystopische Kontrollsysteme? Und was sagt das über seine Gegenwart aus? Dieses Buch geht der Science-Fiction auf den Grund – nicht als literarischer Modetrend, sondern als kulturelle Notwendigkeit. Von Mary Shelleys Frankenstein bis zu heutigen Virtual-Reality-Welten zeigt sich: Science-Fiction ist weit mehr als Raumschiffe und Künstliche Intelligenz. Sie ist eine Reaktion auf gesellschaftliche Umbrüche, technologische Überforderung und den tiefen Wunsch, der Enge des Realen zu entkommen. Mit scharfem Blick und analytischer Tiefe verfolgt dieses Buch die Entstehung des Genres aus Unzufriedenheit, Sehnsucht und Fluchtimpuls. Es entschlüsselt Science-Fiction als Symptom einer Zeit, die an sich selbst zweifelt – und ihre Antworten in einer imaginären Zukunft sucht. Ob Utopie oder Dystopie, Hoffnung oder Warnung: Immer ist die Science-Fiction ein Spiegel – ein Spiegel, der nicht zeigt, was kommen wird, sondern was bereits fehlt. Ein fesselndes Sachbuch über die kulturellen, psychologischen und philosophischen Wurzeln eines Genres, das weit mehr enthüllt, als es voraussagt. Wer verstehen will, warum wir die Zukunft erfinden müssen, um das Heute zu begreifen, wird dieses Buch nicht mehr aus der Hand legen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die Erfindung der
Science-Fiction
•
Visionär, futuristisch und grenzenlos
Eine Betrachtung
von
Lutz Spilker
DIE ERFINDUNG DER SCIENCE-FICTION
VISIONÄR, FUTURISTISCH UND GRENZENLOS
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.dnb.de abrufbar.
Texte: © Copyright by Lutz Spilker
Umschlaggestaltung: © Copyright by Lutz Spilker
Verlag:
Lutz Spilker
Römerstraße 54
56130 Bad Ems
Herstellung: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Die im Buch verwendeten Grafiken entsprechen den
Nutzungsbestimmungen der Creative-Commons-Lizenzen (CC).
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der
Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Inhalt
Inhalt
Das Prinzip der Erfindung
Vorwort
Der Mythos als Urform der Weltdeutung
Platon und das Modell Atlantis
Visionen vor dem Teleskop
Träume vom Mond – Kepler, Godwin und frühe Himmelsreisen
Mechanisierung des Denkens – Der Rationalismus und die neue Weltlogik
Satire als Kosmos – Von Swift bis Voltaire
Die Geburt der Maschine – Die industrielle Revolution als Schock und Hoffnung
Frankenstein und die Erschaffung des Künstlichen
Elektrizität und Magnetismus als neue Zauberkräfte
Zeit als Dimension – Die Entdeckung der vierten Achse
Evolution und das Unheimliche der Zukunft
Jules Verne und die Verklärung des technisch Machbaren
H. G. Wells und die Geburt der dystopischen Imagination
Der Weltenbau in der Pulp-Ära
Zwischen Faschismus und Futurismus
Der Zweite Weltkrieg und die atomare Vorstellungskraft
Cybernetik und der Beginn des kybernetischen Zeitalters
Kalte-Kriegs-Science-Fiction und das Bild des Anderen
Mondlandung und die Wirklichkeit der Science-Fiction
Utopie und Gegenutopie im Zeichen der Ideologien
Ökologie und die Endlichkeit des Planeten
Die Ära der Computer: Information als Weltprinzip
Posthumanismus und die Idee des überflüssigen Menschen
Virtualität und die Auflösung des Realitätsbegriffs
Künstliche Intelligenz als autonomer Erzähler
Science-Fiction im Kino: Bilder des Unvorstellbaren
Spielwelten und interaktive Zukunftssimulation
Technikreligionen und säkularisierte Heilsversprechen
Science-Fiction als kulturelles Gedächtnis
Der Rückbau des Menschen: Von der Vision zur Entfremdung
Über den Autor
In dieser Reihe sind bisher erschienen
Was man heute als Science-Fiction beginnt,
wird man morgen vielleicht als Reportage
zu Ende schreiben müssen.
Norman Mailer
Norman Kingsley Mailer (* 31. Januar 1923 in Long Branch, New Jersey; † 10. November 2007 in New York City) war ein US-amerikanischer Schriftsteller und Regisseur sowie zweimal mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist. Zu seinen bedeutendsten
Werken gehören der Kriegsroman ›Die Nackten und die Toten‹ und der im alten
Ägypten spielende Roman ›Frühe Nächte‹.
Das Prinzip der Erfindung
Vor etwa 20.000 Jahren begann der Mensch, sesshaft zu werden. Mit diesem tiefgreifenden Wandel veränderte sich nicht nur seine Lebensweise – es veränderte sich auch seine Zeit. Was zuvor durch Jagd, Sammeln und ständiges Umherziehen bestimmt war, wich nun einer Alltagsstruktur, die mehr Raum ließ: Raum für Muße, für Wiederholung, für Überschuss.
Die Versorgung durch Ackerbau und Viehzucht minderte das Risiko, sich zur Nahrungsbeschaffung in Gefahr begeben zu müssen. Der Mensch musste sich nicht länger täglich beweisen – er konnte verweilen. Doch genau in diesem neuen Verweilen keimte etwas heran, das bis dahin kaum bekannt war: die Langeweile. Und mit ihr entstand der Drang, sie zu vertreiben – mit Ideen, mit Tätigkeiten, mit neuen Formen des Denkens und Tuns.
Was folgte, war eine unablässige Kette von Erfindungen. Nicht alle dienten dem Überleben. Viele jedoch dienten dem Zeitvertreib, der Ordnung, der Deutung oder dem Trost. So schuf der Mensch nach und nach eine Welt, die in ihrer Gesamtheit weit über das Notwendige hinauswuchs.
Diese Sachbuchreihe mit dem Titelzusatz ›Die Erfindung ...‹ widmet sich jenen kulturellen, sozialen und psychologischen Konstrukten, die aus genau diesem Spannungsverhältnis entstanden sind – zwischen Notwendigkeit und Möglichkeit, zwischen Dasein und Deutung, zwischen Langeweile und Sinn.
Eine Erfindung ist etwas Erdachtes.
Eine Erfindung ist keine Entdeckung.
Jemand denkt sich etwas aus und stellt es zunächst erzählend vor. Das Erfundene lässt sich nicht anfassen, es existiert also nicht real – es ist ein Hirngespinst. Man kann es aufschreiben, wodurch es jedoch nicht real wird, sondern lediglich den Anschein von Realität erweckt.
Der Homo sapiens überlebte seine eigene Evolution allein durch zwei grundlegende Bedürfnisse: Nahrung und Paarung. Alle anderen, mittlerweile existierenden Bedürfnisse, Umstände und Institutionen sind Erfindungen – also etwas Erdachtes.
Auf dieser Prämisse basiert die Lesereihe ›Die Erfindung …‹ und sollte in diesem Sinne verstanden werden.
Vorwort
Wenn ein Mensch beginnt, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, dann tut er das selten aus Überschwang, sondern meist aus einem Gefühl der Unvollkommenheit, der Unruhe, manchmal der Enttäuschung über das Gegenwärtige. In diesem Spannungsfeld zwischen Unzufriedenheit und Sehnsucht entstand ein literarisches Genre, das sich mit nichts Geringerem befasst als dem, was noch nicht ist – die Science-Fiction.
Doch was genau meinen wir, wenn wir von ›Science-Fiction‹ sprechen? Handelt es sich dabei um technische Utopien? Um Weltraumabenteuer? Um spekulative Gesellschaftsformen? Oder ist Science-Fiction vielleicht mehr als nur Literatur – eine Art Denkbewegung, ein kulturelles Korrektiv, ein Spiegel des kollektiven Bewusstseins?
Dieses Buch unternimmt den Versuch, die Science-Fiction nicht als Genre, sondern als Symptom zu begreifen – als eine Reaktion auf das, was fehlt. Es beschreibt die Science-Fiction nicht als literarische Spielart unter vielen, sondern als einen emotionalen Fluchtversuch, als imaginären Korridor hinaus aus einem Weltgefühl, das sich selbst nicht mehr genügt.
Die vorliegende Untersuchung fragt nicht primär danach, wann und wo bestimmte Werke erschienen sind. Stattdessen wird der Blick darauf gerichtet, warum sich Menschen überhaupt dazu gezwungen sahen, sich Welten auszudenken, in denen technische, gesellschaftliche oder biologische Zustände radikal anders geordnet sind als im Hier und Jetzt. Denn die Frage nach der Zukunft ist stets auch die Frage nach der Gegenwart – nach ihrer Zumutbarkeit, nach ihrer Deutlichkeit, nach ihren Grenzen.
So beginnt die Geschichte der Science-Fiction nicht mit einem Knall, sondern mit einem Defizit. Mary Shelleys Frankenstein (1818) gilt weithin als das erste literarische Werk, das der Science-Fiction zugerechnet wird – und doch ist es kein Lobgesang auf den Fortschritt, sondern eine düstere Warnung vor den Konsequenzen technischer Hybris. Ein Werk, das weniger die Möglichkeiten feiert als die Gefahren aufzeigt – und damit bereits den Ton vorgibt für viele Werke, die folgen sollten.
Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Feld der Science-Fiction immer weiter ausgedehnt. Es entstanden Subgenres, Spezialisten, technologische Prophetien, literarische Maschinenräume – doch der Kern blieb gleich: Science-Fiction ist die Möglichkeit, dem Jetzt auszuweichen, indem man ein Danach entwirft. Oft ist dieses Danach düster, manchmal überhöht, fast immer überladen – aber nie zufällig. Es speist sich aus Angst, Hoffnung, Kritik und Eskapismus gleichermaßen.
Was dieses Buch also zeigen will, ist nicht nur der chronologische Verlauf eines literarischen Phänomens, sondern dessen innere Notwendigkeit. Die Science-Fiction ist keine Laune – sie ist ein kultureller Reflex. Sie entsteht dort, wo Menschen sich nicht mehr von Religion, Philosophie oder Politik getragen fühlen. Sie beginnt dort, wo das technische Denken die Welt zu dominieren beginnt – und dabei seine Menschlichkeit zu verlieren droht.
Sie ist, mit anderen Worten, eine ästhetisch verschlüsselte Zustandsbeschreibung der jeweiligen Epoche. Man könnte auch sagen: Die Science-Fiction denkt für uns die Extreme zu Ende, die wir im Alltag nicht zu benennen wagen.
Zugleich darf man sich nicht täuschen: Science-Fiction ist nicht bloß Warnung, sie ist auch Versuch. Versuch, sich vorzustellen, wie es sein könnte – und nicht nur, wie es ist. Sie ist ein Suchscheinwerfer im Nebel der Möglichkeiten, oft ohne Ziel, aber immer mit Richtung.
Platon beschrieb mit Atlantis eine idealisierte Gesellschaft – nicht, weil er an sie glaubte, sondern um über den Zustand seiner eigenen Zeit nachzudenken. Hätte er die technischen Mittel späterer Jahrhunderte gekannt, hätte er seine Utopie vielleicht mit Elektrizität, Raumhäfen oder künstlicher Intelligenz ausgestattet – nicht, um sie zu verherrlichen, sondern um ihre politische Funktion zu unterstreichen.
So bewegt sich auch die Science-Fiction stets an der Grenze: zwischen Technik und Ethik, zwischen Fortschritt und Verantwortung, zwischen Vision und Warnung. Sie schreibt keine Zukunft – sie entwirft sie. Und dieser Entwurf ist immer ein Spiegel: Was wir für möglich halten, sagt mehr über uns aus als über das, was möglich ist.
Dieses Buch begibt sich auf die Spuren dieser Entwürfe – von den frühesten Träumen des Menschseins bis hin zu den hyperdigitalen Visionen der Gegenwart. Es wird nicht bloß die Entwicklung nachzeichnen, sondern die Beweggründe herausarbeiten, die diesem Genre eingeschrieben sind. Es wird zeigen, warum Science-Fiction nicht bloß Zukunft beschreibt, sondern unsere Gegenwart durch die Maske des Kommenden befragt.
Denn am Ende geht es um nichts Geringeres als die Frage:
Warum brauchen wir die Zukunft – um über das Heute sprechen zu können?
Dieses Buch ist eine Einladung zum Nachdenken – nicht über das, was kommen mag, sondern über das, was uns dazu bringt, überhaupt darüber nachzudenken.
Der Mythos als Urform der Weltdeutung
Frühe Menschheitsvorstellungen zwischen Götterfahrt, Schöpfung und Kosmologie
Bevor der Mensch begann, von anderen Planeten zu träumen, von Maschinen zu fabulieren oder sich in Gedankenflüge jenseits der Lichtgeschwindigkeit zu versetzen, suchte er Antworten auf weit elementarere Fragen: Woher komme ich? Was ist der Ursprung der Welt? Warum gibt es Tag und Nacht, Leben und Tod, Ordnung und Chaos? In diesen frühen Weltdeutungen – tief verwurzelt in den Mythen alter Kulturen – zeigt sich das erste Aufbegehren des Menschen gegen das Nichtwissen, gegen die Leere des Unverständlichen. Bevor es Wissenschaft gab, existierte die Welt der Götter, Halbwesen, Schöpfergestalten und Himmelsarchitekturen.
Diese mythischen Deutungsmuster dienten nicht allein der Erklärung naturhafter Vorgänge. Sie waren zugleich Spiegel seelischer Zustände, Ausdruck innerer Bewegungen und kollektiver Ängste. Wenn etwa ein Volk glaubte, die Sonne werde täglich von einem feurigen Streitwagen über den Himmel gezogen, dann war das mehr als ein Erklärungsversuch – es war ein poetischer Ausdruck von Ordnung, Rhythmus und Wiederkehr. Das Erklärbare wurde umrankt von Gestalten, deren Wirken das Vertraute ins Bedeutungsvolle überführte. Aus Licht wurde Gabe, aus Donner wurde Strafe, aus Geburt wurde Geheimnis.
Der Mythos war nicht Lüge, sondern Deutung – und in seiner Struktur liegt der erste Keim jenes Denkens, das später die Science-Fiction hervorbringen sollte. Denn auch dort geht es letztlich um eine Form der Weltordnung, um das Versöhnen von Unbekanntem mit dem Bekannten, um das Greifbarmachen des scheinbar Unfassbaren.
Der Blick in den Himmel – Kosmos als Spiegel
Eines der ältesten Zeugnisse menschlicher Deutungslust liegt in der Betrachtung des Himmels. Lange bevor Teleskope das All sichteten oder mathematische Formeln die Planetenbahnen beschrieben, blickten die Menschen mit Erstaunen, Furcht und Bewunderung nach oben. Was sie dort sahen, war nicht bloß ein Sternenfeld, sondern eine geordnete Welt über ihrer eigenen, bevölkert von Wesen, die über ihr Schicksal wachten.
In Mesopotamien etwa galten die Sterne als Schriftzeichen der Götter. Ihre Bahnen, ihre Rückläufigkeit, ihre Erscheinung zu bestimmten Zeiten des Jahres – all das war durchdrungen von Bedeutung. Der Kosmos war kein leerer Raum, sondern ein Mitteilungsgefüge. Auch in Ägypten, Indien, China und später in der antiken Welt war der Himmel das Buch, in dem zu lesen war, wie das Leben auf Erden zu verlaufen hatte. Diese Vorstellung verlieh dem All eine Form von Innerlichkeit. Die Sterne wurden zu Akteuren, nicht zu Objekten.
Manche Völker glaubten, der Himmel sei eine große Kuppel, die von Göttern getragen werde. Andere sahen darin ein Reich, durch das Seelen reisen konnten. Wieder andere erzählten von himmlischen Wesen, die auf die Erde hinabstiegen, um Menschen zu prüfen, zu lehren oder zu strafen. All diese Erklärungsmuster zeigen: Der Blick in den Himmel war immer auch ein Blick in das eigene Innere.
Schöpfung durch Sprache und Gewalt





























