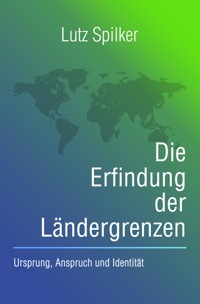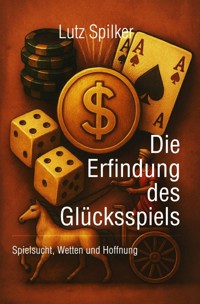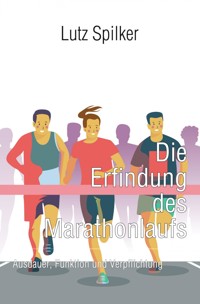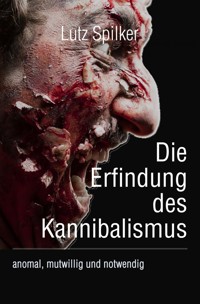
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Kannibalismus – ein Wort, das erschreckt, abstößt, fasziniert. Doch was, wenn sich hinter der bloßen Vorstellung vom Menschenfresser weit mehr verbirgt als bloßer Ekel? Dieses Buch geht der kulturellen, symbolischen und historischen Bedeutung des Kannibalismus nach – ohne Tabus, ohne Sensationslust, aber mit scharfem Blick. Vom rituellen Menschenopfer in frühen Hochkulturen über spirituelle Verschmelzungspraktiken bis zur Eucharistie in der christlichen Liturgie – der Verzehr des Menschen durch den Menschen ist kein dunkler Unfall der Geschichte, sondern Teil ihres innersten Gefüges. Selbst in der modernen Medizin (Organtransplantation), in der Sprache (»Ich hab dich zum Fressen gern«) oder in der Astronomie (»galaktischer Kannibalismus‹) lebt die Idee fort: Etwas wird sich einverleibt, um es zu transformieren. Dieses Buch versteht Kannibalismus als kulturelle Metapher, als Spiegel der Macht, als anthropologisches Grundmotiv – und zugleich als Phänomen, das einer moralischen ›Polkippung‹ unterlag. Was einst heilig oder heilsam galt, ist heute geächtet. Doch gerade dieser Wandel offenbart, wie relativ Moral tatsächlich ist. • Eine Expedition jenseits gewohnter Kategorien – irritierend, aufschlussreich, klärend. • Für Leserinnen und Leser, die Fragen stellen, wo andere sich abwenden. • Und für jene, die wissen: Verstehen beginnt dort, wo das Urteil endet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die Erfindung
des Kannibalismus
•
anomal, mutwillig und notwendig
Eine Betrachtung
von
Lutz Spilker
DIE ERFINDUNG DES KANNIBALISMUS
ANOMAL, MUTWILLIG UND NOTWENDIG
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.dnb.de abrufbar.
Texte: © Copyright by Lutz Spilker
Umschlaggestaltung: © Copyright by Lutz Spilker
Verlag:
Lutz Spilker
Römerstraße 54
56130 Bad Ems
Herstellung: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Die im Buch verwendeten Grafiken entsprechen den
Nutzungsbestimmungen der Creative-Commons-Lizenzen (CC).
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der
Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Inhalt
Inhalt
Das Prinzip der Erfindung
Vorwort
Der Blick unter die Oberfläche
Eine Kippung der Pole
Vereinnahmung als Grundprinzip
Keine Anklage. Keine Verteidigung. Eine Expedition.
Jenseits der Nahrung
Die frühesten Spuren tierischen Kannibalismus
Zwischen Instinkt und Notwendigkeit
Kannibalismus als ökologisches Regulativ
Von der Funktion zur Bedeutung
Evolutionäre Schatten
Zwischenbild einer langen Geschichte
Im Mutterleib beginnt das Fressen
Pränatale Selektion im Tierreich
Das Raubtier im Embryo
Evolution ohne Ethik
Anatomie eines Selektionsmechanismus
Grausamkeit ohne Grauen
Eine Frage des Standpunktes
Das Schweigen des Embryos
Eine Linie zur Menschheit?
Der dunkle Ursprung
Stille Anatomien des Überlebens
Der Fötus als Vollstrecker
Von der Selektion zur Strategie
Zwischen natürlicher Ordnung und stillem Horror
Der letzte Biss vor dem ersten Blick
Der Mensch als Abweichung?
Eine stille Wiederkehr
Die Jagd auf das Eigene
Selbstregulation durch Kannibalismus bei Spinnen und Fischen
Spinnen und das ritualisierte Ende
Wenn Fische zu Scharfrichtern werden
Jenseits der Grausamkeit
Die Jagd auf das Eigene
Biologie als Drama ohne Zeugen
Zeremonien der Gewalt
Erste Menschenopfer in sesshaften Kulturen
Der Tod als Bindeglied zwischen Himmel und Erde
Blutige Altäre – von Teotihuacán bis Anatolien
Die Opferung als Ordnungsakt
Kein Tabu, sondern Werkzeug
Die Angst vor dem Ende und der Wunsch nach Kontrolle
Der Kanon des Grauens – oder der Ordnung?
Inszenierte Hingabe
Die Institutionalisierung von Menschenopfern in frühen Hochkulturen
Vom rituellen Akt zum institutionellen System
Blut als kosmische Pflicht
Das Schweigen der Begleiter
Opfer als Zeichen politischer Macht
Die Rolle der Priester
Der Beginn des Zweifels
Vom Altar zum Altarbild
Die symbolische Transformation des Menschenopfers in Christentum, Judentum und Islam
Das Opfer Isaaks – die paradigmatische Verschiebung
Von der Opferstätte zur Gebetsstätte
Der Mensch wird zum Opfer – und zum Gott
Hingabe ohne Blut
Von der Blutschuld zur Deutungshoheit
Der Feind als Mahl
Trophäenkannibalismus in Stammesgesellschaften
Zwischen Hunger und Hoffnung
Kannibalismus in Hungersnöten der Antike
Wenn die Vorratskammern leer sind
Kein Verbrechen – sondern Zusammenbruch
Der Körper als letzte Ressource
Zwischen Scham und Gedächtnis
Hoffnung in der Verzweiflung
Heiliges Fleisch
Eucharistie und liturgischer Kannibalismus im frühen Christentum
Das Fleisch des Heilands
Liturgischer Kannibalismus?
Vom Brot zum Leib
Die Heiligung des Verzehrs
Gott ist tot – aber gegessen wird er noch
Exkurs I: Die Römer und der Verdacht der Menschenfresser
Exkurs II: Transsubstantiation und Mittelalter – das Mysterium wird dogmafest
Exkurs III: Göttliches Mahl – Parallelen in anderen Kulturen
1. Die Eucharistie als ›legitimierter Kannibalismus‹
2. Von der Trophäe zum Sakrament – eine semantische Wandlung
3. Das Sakrale als Rest einer Gewaltkultur
4. Gedächtnismahl vs. Erinnerungsakt
5. Der letzte Rest des Kannibalen im zivilisierten Menschen
Der Leib als Heilmittel
Medizinalkannibalismus im europäischen Frühneuzeitdenken
Der Körper als Apotheke
Zwischen Galgen und Altar
Heilig oder heilend?
Der schwindende Glaube – ein leiser Abschied
Eine stille Rückblende
Missionare und Menschenfresser
Koloniale Verzerrungen und Erfindungen des Fremden
Zwischen Fiktion und Furcht
Die Kolonialisierung der Vorstellung
Der Edle Wilde – eine ambivalente Figur
Das Echo in der Moderne
Der Mensch als Konstrukteur des Monströsen
Zivilisierter Ekel
Die kulturelle Kodierung des Abscheus
Vom natürlichen Widerwillen zur moralischen Waffe
Die zivilisatorische Inszenierung
Das Schweigen als Ekelstrategie
Das Ambivalente im Abscheu
Der letzte Reflex
Körperpolitik
Kannibalismus im Spiegel totalitärer Systeme
Das Verschwinden des Individuums
Der Mensch als Rohstoff
Der symbolische Kannibalismus
Die innere Logik der Entgrenzung
Der Nachhall in der Gegenwart
Der Fall ›Donner Party‹
Überleben auf Kosten des Verstorbenen
Schnee, Hunger, Stille
Der Hunger als Dämmerzustand
Zwischen Scham und Schweigen
Die Ethik im Eis
Vom Menschsein im Ausnahmezustand
Armin Meiwes
Kannibalismus im Internetzeitalter
Der virtuelle Tisch
Die Suche nach dem Freiwilligen
Der digitale Resonanzraum
Die Verschiebung der Grenzen
Kannibalismus ohne Hunger
Die bleibende Frage
Das Internet hat keinen Kannibalismus erfunden.
Rituelle Reinheit
Kannibalistische Praktiken in Papua-Neuguinea und ihre Funktion
Fleisch und Geist
Ein Tod, der nicht trennt
Die Krankheit als Spiegel
Reinigung durch Vereinnahmung
Fremdheit und Spiegel
Kannibalismus als spirituelle Aneignung
Der Glaube an Übertragung von Kraft, Mut, Geist
Der Mund als Schwelle
Die Verwandlung des Fremden in das Eigene
Der Körper als Träger von Tugenden
Zwischen Jenseitsglauben und Diesseitsmacht
Der Mut der Jäger
Die Grenze des Heutigen
Exkurs: Kannibalismus im Kontext schamanischer Ekstase
Der Schamane als Grenzgänger
Ekstase und Entgrenzung
Der Kannibalismus als Metapher für Auflösung
Kannibalismus als spirituelle Osmose
Sexualisierte Fressfantasien
Der Kannibalismus als perverse Grenzüberschreitung
Verbotene Lust
Der Kannibalismus in der Psychiatrie und Kriminologie
Exkurs: Trieb, Trauma und Transgression
Sakrileg im Sakrament
Der Widerspruch kirchlicher Rhetorik
Zwischen Ketzerei und Dogma
Die Rhetorik des Leibes bei Tertullian und Augustinus
Ein Ritus auf Messers Schneide
Vereinnahmung als Prinzip
Vom Kannibalismus zur Organtransplantation
Der Leib als Gabe
Süße Versuchung, bittere Absicht
Hänsel, Gretel und die kannibalistische Hexe
Der Geschmack der Wörter
Literarische Menschenfresser von Homer bis zur Postmoderne
Der kultivierte Schlund
Hannibal Lecter und die Popkultur des Grauens
Galaktischer Hunger
Kannibalismus im Kosmos
Kuru – Der Tanz der Sterbenden
Der Kannibale als Mahnmal
Die Erfindung des Ekelhaften
Wie kulturelle Tabus entstehen
Sprachliche Kannibalisierung
Redewendungen, Sprichwörter, Metaphern
›Ich könnte dich auffressen.‹
Moralische Polkippungen
Was einst galt und heute gilt
Posthumaner Kannibalismus
Fiktionen, Dystopien, philosophische Experimente
Einverleibung und Erinnerung
Kannibalismus als anthropologische Konstante
Über den Autor
In dieser Reihe sind bisher erschienen
Ist es ein Fortschritt,
wenn ein Kannibale Messer und Gabel benutzt?
Stanislaw Jerzy Lec
Stanisław Jerzy Lec (staˈɲiswaf ˈjɛʐɨ lɛts) (* 6. März 1909 als Baron Stanisław Jerzy de Tusch-Letz in Lemberg, Königreich Galizien und Lodomerien/Österreich-Ungarn; † 7. Mai 1966 in Warschau) war ein polnischer Lyriker und Aphoristiker.
Das Prinzip der Erfindung
Vor etwa 20.000 Jahren begann der Mensch, sesshaft zu werden. Mit diesem tiefgreifenden Wandel veränderte sich nicht nur seine Lebensweise – es veränderte sich auch seine Zeit. Was zuvor durch Jagd, Sammeln und ständiges Umherziehen bestimmt war, wich nun einer Alltagsstruktur, die mehr Raum ließ: Raum für Muße, für Wiederholung, für Überschuss.
Die Versorgung durch Ackerbau und Viehzucht minderte das Risiko, sich zur Nahrungsbeschaffung in Gefahr begeben zu müssen. Der Mensch musste sich nicht länger täglich beweisen – er konnte verweilen. Doch genau in diesem neuen Verweilen keimte etwas heran, das bis dahin kaum bekannt war: die Langeweile. Und mit ihr entstand der Drang, sie zu vertreiben – mit Ideen, mit Tätigkeiten, mit neuen Formen des Denkens und Tuns.
Was folgte, war eine unablässige Kette von Erfindungen. Nicht alle dienten dem Überleben. Viele jedoch dienten dem Zeitvertreib, der Ordnung, der Deutung oder dem Trost. So schuf der Mensch nach und nach eine Welt, die in ihrer Gesamtheit weit über das Notwendige hinauswuchs.
Diese Sachbuchreihe mit dem Titelzusatz ›Die Erfindung ...‹ widmet sich jenen kulturellen, sozialen und psychologischen Konstrukten, die aus genau diesem Spannungsverhältnis entstanden sind – zwischen Notwendigkeit und Möglichkeit, zwischen Dasein und Deutung, zwischen Langeweile und Sinn.
Eine Erfindung ist etwas Erdachtes.
Eine Erfindung ist keine Entdeckung.
Jemand denkt sich etwas aus und stellt es zunächst erzählend vor. Das Erfundene lässt sich nicht anfassen, es existiert also nicht real – es ist ein Hirngespinst. Man kann es aufschreiben, wodurch es jedoch nicht real wird, sondern lediglich den Anschein von Realität erweckt.
Der Homo sapiens überlebte seine eigene Evolution allein durch zwei grundlegende Bedürfnisse: Nahrung und Paarung. Alle anderen, mittlerweile existierenden Bedürfnisse, Umstände und Institutionen sind Erfindungen – also etwas Erdachtes.
Auf dieser Prämisse basiert die Lesereihe ›Die Erfindung …‹ und sollte in diesem Sinne verstanden werden.
Vorwort
Es gibt Themen, die das Denken reflexartig abwehrt. Der Kannibalismus gehört zu ihnen. Er stößt ab, lange bevor er verstanden ist. Das bloße Wort erzeugt Unbehagen, Ekel, Entrüstung – Reaktionen, die sich selten mit der Sache, meist aber mit dem eigenen moralischen Koordinatensystem beschäftigen. Dieses Buch unternimmt den Versuch, jene automatische Sperre auszuschalten – nicht um sie zu übertreten, sondern um sie zu betrachten.
Denn: Der Kannibalismus ist keine Randnotiz menschlicher Geschichte, sondern ein fester Bestandteil ihres kulturellen Repertoires. Er erscheint in Ritualen, Mythen, Rechtsakten, Religionen, Kriegen, Hungersnöten, Kunstwerken und sprachlichen Wendungen – in der Wirklichkeit ebenso wie in der Vorstellungskraft. Es wäre ein Irrtum, ihn ausschließlich in die Sphäre des Anormalen zu verbannen.
Vielmehr offenbart er sich als ein anthropologisches Spiegelbild: radikal, verstörend, aber aufschlussreich.
Der Blick unter die Oberfläche
Dieses Buch will weder schockieren noch moralisieren. Es will beobachten. Nicht von außen, sondern von innen. Nicht durch die Brille unserer heutigen Werte, sondern mit dem weiten Blick einer Zeitreise. Der Kannibalismus wird hier nicht als strafrechtlicher Tatbestand oder grausames Verbrechen untersucht, sondern als menschliche Praxis mit unterschiedlichsten Motiven und Bedeutungen. Dazu gehört der Überlebensinstinkt ebenso wie die rituelle Machtausübung, das spirituelle Verschmelzungsbedürfnis ebenso wie die symbolische Kommunikation über Grenzen hinweg.
Entscheidend ist:
Der Kannibalismus wird nicht als das Andere der Kultur beschrieben, sondern als ein Moment ihrer selbst.
Eine Kippung der Pole
Die zentrale Denkfigur dieses Buches ist die der moralischen Polkippung: Was einst legitim, ja notwendig erschien – etwa das Menschenopfer, die Leichenverwertung zu Heilzwecken oder der Verzehr im Namen der Götter –, gilt heute als unvorstellbar. Umgekehrt gab es Zeiten, in denen der Verzicht auf solche Handlungen als unverständlich oder sogar gefährlich galt. Moral, so zeigt sich, ist keine Konstante – sondern eine bewegliche Grenzlinie zwischen Akzeptanz und Ablehnung.
Der Kannibalismus bildet in diesem Spiel ein besonders markantes Beispiel. Ihm haftet eine übersteigerte Verwerflichkeit an, während gleichzeitig – in kulturell domestizierter Form – viele seiner Strukturen weiterleben:
• in der Eucharistie (»Dies ist mein Leib«),
• in der Transplantationsmedizin,
• in Sprichwörtern und Redewendungen (»Ich hab dich zum Fressen gern«),
und sogar in kosmologischen Modellen, wenn Galaxien kleinere Galaxien verschlucken und die Astronomie dafür den Begriff des »galaktischen Kannibalismus‹ verwendet.
Vereinnahmung als Grundprinzip
Das Buch verfolgt den roten Faden der Vereinnahmung: jenes anthropologische Grundmuster, sich das Fremde einzuverleiben – körperlich, symbolisch, spirituell. Ob der Feind verspeist wird, um seine Kraft zu erben, ob die Asche eines Verstorbenen im Wohnzimmer aufbewahrt wird, ob ein Organ transplantiert wird oder ein Gott zur Hostie gerät – immer geht es um Nähe, Macht, Kontrolle oder Transformation.
Diese Betrachtungsweise macht es möglich, den Kannibalismus zu entmoralisieren, ohne ihn zu verharmlosen. Es wird nicht darum gehen, Schuld zu verteilen oder Rechtfertigungen zu liefern. Stattdessen wird gezeigt, wie diese Praxis in den unterschiedlichsten Kontexten – historisch, sozial, religiös, psychologisch – funktionierte. Und warum sie immer wiederkehrt, selbst in einer Gegenwart, die sich als aufgeklärt betrachtet.
Keine Anklage. Keine Verteidigung. Eine Expedition.
Der Leser dieses Buches wird nicht mit Anleitungen, Appellen oder Urteilen konfrontiert. Es gibt hier keine Verteidigung des Kannibalismus – ebenso wenig wie seine pauschale Verdammung. Stattdessen lädt dieses Werk zu einer geistigen Expedition ein. Es folgt Spuren durch Jahrtausende, Kulturen, Disziplinen und Vorstellungen – bis sich ein Panorama zeigt, das weit über das hinausreicht, was der Begriff üblicherweise auslöst.
Die Bereitschaft, sich auf dieses Panorama einzulassen, ist die einzige Voraussetzung.
Der moralische Kompass darf, wenn man will, an der Garderobe abgegeben werden – nicht aus Beliebigkeit, sondern zur Erweiterung des Blickfeldes.
Denn das Ziel ist nicht die Provokation.
Das Ziel ist Verstehen.
• Für alle, die dem Denken mehr zutrauen als dem Reflex.
• Für alle, die ein Thema nicht meiden, weil es unbequem ist.
• Und für alle, die wissen: Der Mensch beginnt dort, wo er sich selbst zu erkennen wagt.
Jenseits der Nahrung
Die frühesten Spuren tierischen Kannibalismus
Bevor der Mensch seine ersten Feuerstätten errichtete, bevor Sprache, Werkzeug oder Mythos ihn von der Tierwelt zu unterscheiden begannen, existierte bereits ein Phänomen, das später als Kannibalismus in menschliche Kultur, Religion und Geschichte eingehen sollte – jedoch nicht als Erfindung, sondern als Verhaltensmuster: Tiere fraßen Tiere – ihrer eigenen Art. Nicht aus Grausamkeit, nicht aus Gier, sondern als Teil eines biologischen Ablaufes, der sich tiefer in das Dasein eingeschrieben hat, als es auf den ersten Blick erscheint.
Wer den Ursprung des Kannibalismus verstehen will, kommt um die tierische Welt nicht herum. Sie ist das geduldige, lautlose Archiv aller Handlungsmöglichkeiten, die dem Leben dienen – auch, wenn sie uns heute abstoßend erscheinen mögen. Tierischer Kannibalismus ist keine Anomalie, sondern ein stabiler Bestandteil ökologischer Systeme. Man findet ihn bei Fischen, Amphibien, Insekten, Reptilien, Spinnen – und sogar bei Säugetieren.
Zwischen Instinkt und Notwendigkeit
In der tierischen Welt ist das Fressen der eigenen Art nicht zwangsläufig ein Zeichen für Störung oder Notlage. Vielmehr offenbart es ein vielschichtiges Verhaltensmuster, das evolutionär erprobt ist. Biologen sprechen hier von ›intraspezifischem Konsum‹, doch was sich nüchtern anhört, ist bei genauerer Betrachtung ein Balanceakt zwischen Arterhaltung und individueller Fitness.
Ein klassisches Beispiel liefern Haie. Bei einigen Arten findet die erste Selektion nicht nach, sondern vor der Geburt statt. In der Gebärmutter der Mutter entwickeln sich mehrere Embryonen gleichzeitig – doch nur der kräftigste überlebt. Er frisst seine Geschwister auf, noch bevor sie das Licht der Welt erblicken. Was zunächst wie ein grausamer Akt erscheinen mag, ist biologisch gesehen eine Optimierung: Das stärkste Individuum kommt zur Welt – mit dem Magen voller Konkurrenz. Ein evolutionäres Vorrecht, geboren aus Instinkt, nicht aus bewusster Wahl.
Auch Amphibien zeigen dieses Verhalten. Kaulquappen mancher Froscharten wandeln sich unter Stressbedingungen in Raubtiere und beginnen, ihre Artgenossen zu fressen. Es handelt sich um eine flexible Anpassung an Umweltbedingungen, keine moralische Entgleisung. Kannibalismus ist hier Überlebensstrategie – die Antwort auf Dichte, Nahrungsknappheit, Raumprobleme.
Bei Spinnen schließlich tritt das Bild zutage, das besonders gerne zitiert wird: die ›Schwarze Witwe‹, die das Männchen nach der Paarung verspeist. Was lange als Ausnahme galt, ist bei vielen Spinnenarten gängige Praxis – allerdings nicht zwingend. Manchmal entkommt das Männchen, manchmal wird es toleriert. Das Verzehren des Partners ist also kein Automatismus, sondern ein Verhalten, das unter bestimmten Bedingungen ausgelöst wird – etwa durch Hunger, Stress oder hormonelle Ungleichgewichte. Doch gleichgültig, wie es motiviert ist: Es bleibt innerhalb der Logik tierischen Überlebens.
Kannibalismus als ökologisches Regulativ
Ein weiterer Gesichtspunkt, der den tierischen Kannibalismus in einem anderen Licht erscheinen lässt, ist seine regulierende Funktion innerhalb des Ökosystems. So gibt es Insektenarten, bei denen die Mütter einen Teil ihres Nachwuchses fressen, um den Rest zu ernähren. Es ist ein Opfer aus Notwendigkeit, kein Sadismus. Auch bei Säugetieren wie Ratten oder Kaninchen lässt sich beobachten, dass Mütter ihre kranken oder schwachen Jungen töten und verzehren – vermutlich, um Infektionen zu vermeiden oder Ressourcen zu schonen. Der Kannibalismus wird damit zu einer Maßnahme der Qualitätssicherung.
In Kolonien von Meerschweinchen, Hamstern oder sogar Affen kann es vorkommen, dass Jungtiere gefressen werden, die nicht zum eigenen Wurf gehören. Das dient nicht nur der Reduktion von Konkurrenz, sondern auch dem Schutz des eigenen Erbguts. So erscheint Kannibalismus als Mittel der Evolution – kein Ziel, aber ein Werkzeug.
Besonders eindrucksvoll ist das Verhalten bei Molchen: Wenn die Gewässer klein sind und das Futter knapp, entwickeln manche Individuen größere Mäuler und beginnen, andere Kaulquappen zu fressen. Diese Morphologie ist reversibel – wenn das Futterangebot sich verbessert, wird die räuberische Gestalt abgelegt. Das bedeutet: Kannibalismus ist nicht fest verankert, sondern situativ abrufbar. Er ist Option, kein Zwang.
Von der Funktion zur Bedeutung
Im Tierreich existiert keine Ethik. Es gibt keine Vorstellung von Schuld, keine Reflexion des Tuns. Was geschieht, ist dem Überleben geschuldet – nicht einer symbolischen Ordnung. Und doch liegt genau hier der entscheidende Unterschied zum menschlichen Kannibalismus: Tiere fressen ihre Artgenossen, weil es funktioniert – nicht, weil es etwas bedeutet.