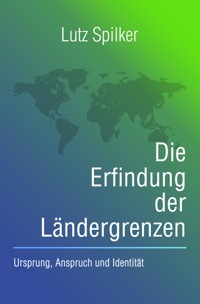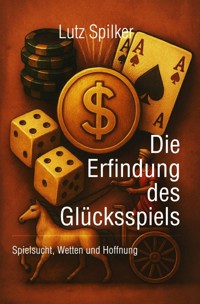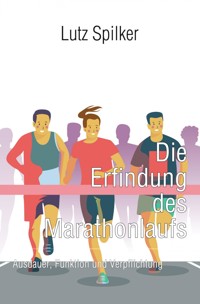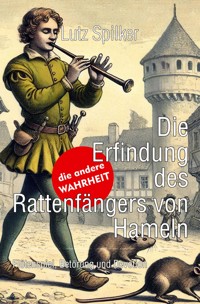
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hameln, 13. Jahrhundert. Eine Stadt, eine Legende, ein Mysterium: Der sagenumwobene Rattenfänger soll einst die Stadt von einer Plage befreit und, um seinen Lohn betrogen, aus Rache 130 Kinder ins Unbekannte geführt haben. Doch was, wenn sich die Dinge ganz anders zugetragen haben? Dieses Buch entwirrt die Geschichte, die seit Jahrhunderten überliefert, verklärt und mystifiziert wurde. Mit scharfem Blick auf historische Quellen, psychologische Deutungen und soziale Mechanismen geht der Autor der wahren Bedeutung der Legende nach – und zeigt, dass der berühmte Rattenfänger womöglich gar nichts mit Ratten zu tun hatte. War er in Wahrheit ein mittelalterlicher Schleuser, der Jugendliche und junge Erwachsene aus Hameln in ferne, unerforschte Gebiete abführte? Wurde ein schändliches Kapitel der Stadtgeschichte absichtlich in ein harmloses Märchen verwandelt? Und warum schweigen die ältesten Quellen über die angebliche Rattenplage? Eine spannende Spurensuche zwischen Mythos und Wirklichkeit, die nicht nur das Bild der bekannten Sage in Frage stellt, sondern auch zeigt, wie kollektive Erinnerung funktioniert – und wie sie verfälscht werden kann. Ein Sachbuch, das mit Präzision und Tiefgang ein uraltes Rätsel neu erzählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Erfindung
des Rattenfängers
von Hameln
•
Flötenspiel, Betörung und Devotion
Eine Betrachtung
von
Lutz Spilker
DIE ERFINDUNG DES RATTENFÄNGERS VON HAMELN
FLÖTENSPIEL, BETÖRUNG UND DEVOTION
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.dnb.de abrufbar.
Texte: © Copyright by Lutz Spilker
Umschlaggestaltung: © Copyright by Lutz Spilker
Verlag:
Lutz Spilker
Römerstraße 54
56130 Bad Ems
Herstellung: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Die im Buch verwendeten Grafiken entsprechen den
Nutzungsbestimmungen der Creative-Commons-Lizenzen (CC).
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der
Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Inhalt
Inhalt
Das Prinzip der Erfindung
Vorwort
Die erste Spur
Das älteste Zeugnis des Kinderverlustes in Hameln
Hameln im 13. Jahrhundert
Eine Stadt zwischen Aufbruch und Abgeschiedenheit
Europa im Wandel
Der soziale und wirtschaftliche Rahmen des Spätmittelalters
Chronisten und ihre Botschaften
Wie Geschichte im Mittelalter geschrieben wurde
Das Schweigen der Ratten
Warum frühe Quellen keine Nager kennen
Die Pest und andere Plagen
Seuchen als spätere Erklärungsmuster
Musik und Magie
Das Motiv des Flötenspiels im Volksglauben
Vertrag und Wortbruch
Die moralische Achse der Sage
Kinder im Mittelalter
Wer zählte überhaupt als ›Kind‹?
Die mittelalterliche Ostsiedlung
Expansion und Bevölkerungsverschiebung
Schlepper und Schleuser
Die Schattenseite der mittelalterlichen Wanderungsbewegungen
Die Kinderkreuzzüge
Historische Parallelen des Massenaufbruchs
Überbevölkerung und soziale Spannungen
Gründe für Abwanderung
Das Geschäft mit der Hoffnung
Anwerber und Lockvögel im Mittelalter
Das Trauma von Hameln
Der Verlust als kollektives Gedächtnis
Legendenbildung
Wie aus Geschichte Geschichten werden
Das Glasfenster der Marktkirche
Ein Bild erzählt Geschichte
Die Verschlüsselung der Schuld
Codierungen in mittelalterlichen Erzählungen
Die Erfindung der Ratten
Wie das Tier in die Sage gelangte
Die Macht der Bilder
Illustrierte Fassungen und ihre Wirkung
Reformation und Märchensammlung
Die Wiederentdeckung des Rattenfängers
Die Gebrüder Grimm und die Märchenhaftigkeit der Sage
Grimmsche Fassung, literarische Transformation
Hameln als Tourismusziel
Wie ein Mythos zur Marke wurde
Die Entdeckung der Sage im 19. Jahrhundert
Der Mythos wird zur Attraktion
Zwischen Geschichte und Inszenierung
Der Rattenfänger in Wirtschaft und Kultur
Die Schattenseiten der Kommerzialisierung
Zwischen Authentizität und Eventkultur
Ein Mythos auf festem Fundament
Die Verführung der Klänge
Musik als Manipulation bis heute
Die Magie des Klangs im Mittelalter
Musik als Mittel der Manipulation
Musik als Werkzeug der Massenlenkung
Musik, Identität und Kontrolle
Die zeitlose Macht der Musik
Verlorene Kinder, verlorene Geschichten
Parallelen in anderen Kulturen
Kindesentführungen als kollektive Urangst
Der ›Pied Piper‹ und seine weltweiten Verwandten
Die dunkle Seite des Übergangs
Der Kinderraub durch Herodes
Historische Realität trifft Legende
Feen, Kobolde und Anderswelten
Von Urban Legends zu Medienphänomenen
Ein kollektives Echo
Spuren im Osten
Gab es Spuren der verschwundenen Hamelner?
Der Rattenfänger in der Populärkultur
Von Film bis Comic
Legenden und Identität
Warum Städte ihre Mythen brauchen
Psychologie der Sage
Schuld, Angst und kollektive Verdrängung
Die Unerträglichkeit des Verlustes
Projektion und Schuldumkehr
Angst als formende Kraft
Die Macht der Verdrängung
Der Rattenfänger als archetypische Figur
Kollektives Gedächtnis und identitätsstiftende Wirkung
Die Legende als psychologisches Gefäß
Was bleibt?
Die Legende im Spiegel von Wahrheit und Fiktion
Über den Autor
In dieser Reihe sind bisher erschienen
Der Rattenfänger
Ich bin der wohlbekannte Sänger,
Der vielgereiste Rattenfänger,
Den diese altberühmte Stadt
Gewiß besonders nötig hat.
Und wären's Ratten noch so viele,
Und wären Wiesel mit im Spiele;
Von allen säubr' ich diesen Ort
Sie müssen miteinander fort.
Dann ist der gutgelaunte Sänger
Mitunter auch ein Kinderfänger,
Der selbst die wildesten bezwingt,
Wenn er die goldnen Märchen singt.
Und wären Knaben noch so trutzig,
Und wären Mädchen noch so stutzig,
In meine Saiten greif ich ein,
Sie müssen alle hinterdrein.
Dann ist der vielgewandte Sänger
Gelegentlich ein Mädchenfänger;
In keinem Städtchen langt er an,
Wo er's nicht mancher angetan.
Und wären Mädchen noch so blöde,
Und wären Weiber noch so spröde:
Doch allen wird so liebebang
Bei Zaubersaiten und Gesang.
Johann Wolfgang von Goethe
Johann Wolfgang Goethe, ab 1782 von Goethe (* 28. August 1749 in
Frankfurt am Main; † 22. März 1832 in Weimar), war ein deutscher Dichter, Politiker und Naturforscher.
Er gilt als einer der bedeutendsten Schöpfer deutschsprachiger Dichtung.
Das Prinzip der Erfindung
Vor etwa 20.000 Jahren begann der Mensch, sesshaft zu werden. Mit diesem tiefgreifenden Wandel veränderte sich nicht nur seine Lebensweise – es veränderte sich auch seine Zeit. Was zuvor durch Jagd, Sammeln und ständiges Umherziehen bestimmt war, wich nun einer Alltagsstruktur, die mehr Raum ließ: Raum für Muße, für Wiederholung, für Überschuss.
Die Versorgung durch Ackerbau und Viehzucht minderte das Risiko, sich zur Nahrungsbeschaffung in Gefahr begeben zu müssen. Der Mensch musste sich nicht länger täglich beweisen – er konnte verweilen. Doch genau in diesem neuen Verweilen keimte etwas heran, das bis dahin kaum bekannt war: die Langeweile. Und mit ihr entstand der Drang, sie zu vertreiben – mit Ideen, mit Tätigkeiten, mit neuen Formen des Denkens und Tuns.
Was folgte, war eine unablässige Kette von Erfindungen. Nicht alle dienten dem Überleben. Viele jedoch dienten dem Zeitvertreib, der Ordnung, der Deutung oder dem Trost. So schuf der Mensch nach und nach eine Welt, die in ihrer Gesamtheit weit über das Notwendige hinauswuchs.
Diese Sachbuchreihe mit dem Titelzusatz ›Die Erfindung ...‹ widmet sich jenen kulturellen, sozialen und psychologischen Konstrukten, die aus genau diesem Spannungsverhältnis entstanden sind – zwischen Notwendigkeit und Möglichkeit, zwischen Dasein und Deutung, zwischen Langeweile und Sinn.
Eine Erfindung ist etwas Erdachtes.
Eine Erfindung ist keine Entdeckung.
Jemand denkt sich etwas aus und stellt es zunächst erzählend vor. Das Erfundene lässt sich nicht anfassen, es existiert also nicht real – es ist ein Hirngespinst. Man kann es aufschreiben, wodurch es jedoch nicht real wird, sondern lediglich den Anschein von Realität erweckt.
Der Homo sapiens überlebte seine eigene Evolution allein durch zwei grundlegende Bedürfnisse: Nahrung und Paarung. Alle anderen, mittlerweile existierenden Bedürfnisse, Umstände und Institutionen sind Erfindungen – also etwas Erdachtes.
Auf dieser Prämisse basiert die Lesereihe ›Die Erfindung …‹ und sollte in diesem Sinne verstanden werden.
Vorwort
Die Geschichte vom Rattenfänger von Hameln gehört zu den bekanntesten und zugleich rätselhaftesten Erzählungen des europäischen Kulturraumes. Seit Jahrhunderten wird sie überliefert, weitererzählt, ausgeschmückt und in immer neuen Varianten dargeboten – mal als schauriges Märchen, mal als moralische Parabel, mal als düstere Warnung vor den Konsequenzen von Wortbruch und Undank. Doch was, wenn sich die Dinge, auf denen diese Sage beruht, in Wirklichkeit gänzlich anders zugetragen haben? Was, wenn die Geschichte des Rattenfängers von Hameln nicht nur ein Mythos, sondern ein bewusst konstruiertes Narrativ ist, das dazu diente, eine unbequeme Wahrheit zu verschleiern?
Dieses Buch trägt nicht zufällig den Titel ›Die Erfindung des Rattenfängers von Hameln‹. Es geht davon aus, dass die heute so populäre Version der Erzählung – ein geheimnisvoller Mann, der mittels Flötenspiel eine Rattenplage beendet und später, von der Stadt betrogen, aus Rache die Kinder Hamelns entführt – nicht die ursprüngliche oder gar die wahre Geschichte ist. Vielmehr legt dieses Buch dar, dass es sich bei dieser Legende aller Wahrscheinlichkeit nach um die verschlüsselte Verarbeitung eines realen, sozial oder politisch brisanten Ereignisses handelt, das im mittelalterlichen Hameln stattfand und das man später in codierter Form überlieferte, um Scham, Schuld und soziale Blamage zu vermeiden.
Zentral ist dabei die Erkenntnis, dass Legenden und Mythen nicht in einem Vakuum entstehen. Sie sind Produkte ihrer Zeit, ihrer sozialen, politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen. Geschichten wie die des Rattenfängers dienen dazu, kollektive Erfahrungen zu bewältigen, moralische Ordnungen zu stabilisieren oder Missstände zu verschleiern. Die ursprüngliche Begebenheit, auf der die Sage fußt, könnte – so die hier vertretene Hypothese – in der gezielten Abwanderung oder Verschleppung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Hameln bestanden haben, möglicherweise im Kontext der mittelalterlichen Ostsiedlung oder wirtschaftlicher Krisen. Das vermeintliche ›Flötenspiel‹ wäre in dieser Lesart lediglich ein Symbol für Verführung, Manipulation oder gar Zwang.
Diese Rekonstruktion basiert auf der einfachen, aber oft übersehenen Tatsache, dass die frühesten Überlieferungen des Geschehens – darunter das berühmte Kirchenfenster der Marktkirche von Hameln um 1300 – keinerlei Erwähnung von Ratten enthalten. Die Nagetiere, die in späteren Versionen den Ausgangspunkt des Dramas bilden, sind eine nachträgliche Zutat, die erst in den Jahrhunderten nach dem mutmaßlichen Ereignis Eingang in die Erzählung fand. Die eigentliche Konstante aller frühen Quellen ist das plötzliche Verschwinden einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen – ein schockierendes Ereignis, das tiefe Spuren im kollektiven Gedächtnis der Stadt hinterließ.
Dieses Buch möchte dem Leser jedoch keine vermeintlich absolute Wahrheit anbieten. Es versteht sich vielmehr als Einladung zur kritischen Reflexion über die Entstehung, Funktion und Wirkung von Geschichten. Der Leser wird zwei Versionen kennenlernen: Die eine ist die überlieferte Sage in geraffter Form – so, wie sie über Jahrhunderte tradiert wurde. Die andere ist eine rekonstruierte und historisch kontextualisierte Version, die aufzeigt, wie es sich möglicherweise zugetragen haben könnte. Beide Erzählungen besitzen ihre eigene Wahrheit, doch nur eine von ihnen hält einer kritischen historischen Prüfung stand.
Dabei ist zu beachten, dass der Begriff ›Kinder‹, der in den Quellen verwendet wird, nach mittelalterlichem Verständnis nicht nur kleine Kinder, sondern auch Jugendliche und junge Erwachsene umfasst. Im 13. Jahrhundert war das Leben von Menschen viel kürzer, Reife wurde früh erwartet, und Arbeits- oder Ehefähigkeit begann oft bereits im Alter von zwölf bis vierzehn Jahren. Wer also in den Überlieferungen als Kind bezeichnet wird, könnte durchaus ein halbwüchsiger oder junger Erwachsener gewesen sein – ein Aspekt, der für das Verständnis des tatsächlichen Geschehens von zentraler Bedeutung ist.
Der Leser wird gebeten, sich auf die Möglichkeit einzulassen, dass der berühmte ›Rattenfänger‹ nichts weiter war als eine Erfindung – eine symbolische Figur, die dazu diente, einen kollektiven Schandfleck in eine erzählbare und erträgliche Form zu überführen. Der wahre Kern der Geschichte könnte ungleich profaner, düsterer und menschlicher gewesen sein: ein Akt von Ausgrenzung, wirtschaftlicher Notwendigkeit oder gezielter Umsiedlung, verborgen hinter der Fassade eines märchenhaften Dramas.
Diese doppelte Erzählweise – die Legende und ihre mögliche historische Realität – soll nicht entzaubern, sondern aufzeigen, wie mächtig und wirkmächtig Geschichten sind. Denn selbst wenn der Rattenfänger niemals existierte, so existiert doch seine Erzählung – und sie prägt unser kulturelles Gedächtnis bis heute.
Dieses Buch lädt dazu ein, hinter die Kulissen zu blicken.
Die erste Spur
Das älteste Zeugnis des Kinderverlustes in Hameln
Ursprung der Überlieferung, früheste Quellen, erste Erwähnungen
Es ist die Leere, die verstört. Eine Leere, die sich nicht nur in den Zeilen der wenigen überlieferten Quellen zeigt, sondern auch im Verständnis der Menschen, die bis heute versuchen, ein rätselhaftes Ereignis zu ergründen: das Verschwinden der Kinder von Hameln.
Wer die Legende vom Rattenfänger kennt, denkt unweigerlich an eine bunte Gestalt mit Flöte, an eine Stadt, die von Ratten heimgesucht wurde, an eine versprochene Belohnung, die nicht gezahlt wurde – und an einen grausamen Racheakt, der die Stadt bis in unsere Tage heimsucht. Doch wer sich die Mühe macht, die Spuren der Überlieferung bis zu ihrem Ursprung zurückzuverfolgen, stößt auf eine gänzlich andere Geschichte. Eine Geschichte ohne Ratten. Ohne Musik. Ohne Flöte.
Die älteste bekannte Quelle stammt aus der Stadt selbst: ein farbiges Glasfenster in der Marktkirche von Hameln, datiert um das Jahr 1300. Dieses Fenster ist heute nicht mehr erhalten, doch Beschreibungen und Zeichnungen, die Jahrhunderte später angefertigt wurden, geben uns zumindest einen ungefähren Eindruck von seinem Inhalt. Zu sehen war – so berichten es die Chronisten – eine Gruppe von Kindern, die von einer auffällig gekleideten Person aus der Stadt hinausgeführt wird. Keine Rede von Nagetieren, keine Spur von musikalischer Verführung. Nur der Verlust.
Dieses Glasfenster ist mehr als ein Kunstwerk. Es ist die erste bildhafte Narbe einer Stadt, die etwas Unaussprechliches erlebt haben muss. Die Tatsache, dass dieses Ereignis auf einem derart prominenten und dauerhaften Medium festgehalten wurde, spricht dafür, dass es die Menschen tief erschüttert hat. Kirchenfenster waren im Mittelalter nicht bloß Schmuck – sie waren Botschaft, Mahnung, Erinnerung.
Die schriftlichen Spuren, die wir aus jener Zeit haben, sind spärlich und von karger Klarheit. Im sogenannten ›Lüneburger Manuskript‹, das aus der Mitte des 15. Jahrhunderts stammt, wird berichtet: »Im Jahre 1284 am Tage Johannis und Pauli führte ein Pfeifer, gekleidet in bunte Farben, 130 Kinder geboren in Hameln fort und sie waren verloren bei Koppen.« Hier taucht erstmals die Zahl der Kinder auf. Auch der Hinweis auf einen Pfeifer erscheint, doch von Ratten ist noch immer nicht die Rede. Ebenso fehlen jegliche Erklärungen oder Hintergründe.
Die Erwähnung des Ortsnamens ›Koppen‹ – oft interpretiert als der Koppenberg nahe Hameln – führt in eine Sackgasse. Dort wurde nie etwas gefunden, keine Gräber, keine Spuren eines Unglücks. Die Kinder verschwanden – und nichts blieb zurück. So blieb es Aufgabe der folgenden Jahrhunderte, dieses Nichts mit Sinn, Symbolen und Geschichten zu füllen.
Auch die berühmte ›Chronica Ecclesiae Hamelensis‹, die Hamelner Kirchenchronik aus dem 14. Jahrhundert, greift das Verschwinden auf. Doch die Worte bleiben nüchtern, beinahe unbeteiligt: »Im Jahre des Herrn 1284 am Tag Johannis und Pauli sind 130 Kinder von Hameln verschwunden.« Kein Motiv, kein Schuldiger, keine Deutung. Das Schweigen der Quelle ist lauter als jede Erzählung.
In der Forschung wird immer wieder auf eine auffällige Besonderheit hingewiesen: Die Stadt Hameln führte noch bis weit ins 17. Jahrhundert ihre Zeitrechnung ›post distractionem puerorum‹ – nach dem Verschwinden der Kinder. Diese Eigenart der Zeitrechnung unterstreicht, dass das Ereignis als tiefer Einschnitt im kollektiven Gedächtnis verankert war. Es muss weit mehr als ein bloßer Unfall gewesen sein. Eine Trauer oder ein Verlust von solcher Tragweite, dass man die Zeit selbst danach zu ordnen begann.
Je mehr man sich den ältesten Quellen nähert, desto deutlicher wird: Die Sage, wie wir sie heute kennen, ist eine Schöpfung späterer Jahrhunderte. Die Grundgeschichte jedoch – der Kern – handelt ausschließlich von einem plötzlichen, unerklärten Verlust einer großen Anzahl junger Menschen. Was ihnen widerfuhr, bleibt verborgen.
Auffallend ist auch, dass in keiner der frühen Quellen von Schuld oder von Bestrafung die Rede ist. Es gibt kein moralisches Urteil, keinen klaren Hinweis auf eine göttliche Strafe, keine Mahnung zur Umkehr. Das macht die Urfassung so eigentümlich kühl und nüchtern – und zugleich so verstörend. Man mag es sich nicht eingestehen, aber diese karge Art der Überlieferung lässt Platz für alle nur denkbaren Möglichkeiten: Entführung, freiwillige Auswanderung, Ritual, Unglück oder Verrat.
Warum aber berichtet keine Chronik von Eltern, die ihre Kinder suchen? Warum wird kein Aufstand, keine Anklage erwähnt? Ist es denkbar, dass die Stadt selbst in das Geschehen verstrickt war? Oder war das Verschwinden in den damaligen sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen gar kein Skandal, sondern ein unausgesprochen akzeptiertes Geschehen?
Die mittelalterliche Welt war durchzogen von Ungewissheiten und Verlusten. Krankheiten, Hunger, Krieg – der Tod war allgegenwärtig. Und doch war das plötzliche Verschwinden so außergewöhnlich, dass es Eingang in die Erinnerung fand. Die Frage bleibt: Warum? Und warum in dieser Form?
Es waren spätere Jahrhunderte, die begannen, dieses mysteriöse Ereignis mit Ausschmückungen zu versehen. Erst im 16. Jahrhundert tauchen die Ratten auf – zunächst in niederländischen und englischen Fassungen. Erst dann wird aus einem namenlosen Pfeifer der farbenfrohe Rattenfänger, der mit Musik Tiere und Kinder gleichermaßen lenkt. Die ursprüngliche Leere wird mit Geschichten gefüllt.
Bis heute wissen wir nicht, was im Jahr 1284 wirklich geschah. Die ältesten Zeugnisse berichten nichts weiter als den Verlust. Kein Motiv, kein Täter. Nur ein Datum, eine Zahl und ein fortwährendes Schweigen.
Vielleicht liegt genau darin der Grund, warum diese Geschichte bis heute erzählt wird: weil sie keine Antworten gibt. Weil sie offen bleibt. Weil sie, trotz aller Überlieferung, ein Rätsel bleibt. Und Rätsel, die nicht gelöst werden können, sind die widerständigsten Geschichten von allen.
Hameln im 13. Jahrhundert
Eine Stadt zwischen Aufbruch und Abgeschiedenheit
Geografie, Größe, politischer und wirtschaftlicher Kontext der Stadt
Wer heute durch die schmalen Gassen der Altstadt von Hameln flaniert, begegnet vor allem einer Stadt, die aus ihrer Legende Kapital schlägt. Touristenströme, Fachwerkromantik, bunte Glasfenster – all das erzählt mehr von der Sehnsucht nach Geschichte als von dem, was Hameln im 13. Jahrhundert wirklich war. Um die rätselhafte Geschichte des sogenannten Rattenfängers zu verstehen, muss man diese heutige Folklore abstreifen und einen nüchternen Blick auf die Stadt werfen, so wie sie sich damals, im ausgehenden Hochmittelalter, tatsächlich darstellte.
Hameln war im 13. Jahrhundert eine Kleinstadt. Ihre Bedeutung war überschaubar, ihr Einfluss gering. Eingebettet in das sanft gewellte Weserbergland, lag die Stadt am Ufer der Weser – jener Fluss, der sowohl Verbindung zur Welt als auch natürliche Grenze war. Die Weser schuf Möglichkeiten für Handel, für Transport und für gelegentlichen Austausch, aber Hameln war kein Knotenpunkt, kein Zentrum von überregionaler Bedeutung. Es fehlte der Zugang zum Meer, es fehlte die Nähe zu großen Handelsrouten wie jenen der Hanse oder der überregionalen Märkte.
Die Bevölkerung um 1280 dürfte wenige tausend Menschen umfasst haben, wahrscheinlich nicht mehr als zwei- bis dreitausend Seelen. Die Siedlung wuchs zwar, wie viele andere Orte dieser Zeit, langsam über ihren ältesten Kern hinaus, doch der Begriff ›Stadt‹* muss mit Vorsicht verwendet werden. Hameln war eher eine Ansammlung von Handwerkern, Fischern, einfachen Kaufleuten und einigen wenigen wohlhabenden Familien, die die städtische Entwicklung vorantrieben. Die politische Macht lag nicht bei einer großen Zahl von Bürgern, sondern in den Händen weniger.