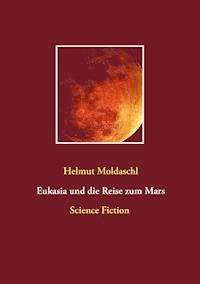Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Es gibt unendlich viele unbeweisbare Wahrheiten und daher ist die Wahrheit für uns unbegreiflich. Kurt Gödel Wien zu Beginn des 20. Jahrhunderts Auf der Suche nach der fundamentalen Wahrheit treffen sich berühmte Philosophen, Wissenschaftler, Künstler und Politiker zu regelmäßigen Gesprächen. Doch kreist ihr Ringen in tautologischen Zirkeln und eskaliert letztlich in tödlicher Gewalt. Der Roman führt den Leser durch ein schillerndes Geflecht von Realität und Illusion.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 659
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Es gibt unendlich viele unbeweisbare Wahrheiten, und daher ist die Wahrheit für uns unbegreiflich.“
(Kurt Gödel)
Inhalt
Prolog
Das Zentrum der Wahrheit
Widersprüchliche Wahrheiten
Heilsame Wahrheit
Lokale Wahrheiten
Bestandteile der Wahrheit
Die Wahrheit der Kunst
Verdeckte Wahrheiten
Politische Wahrheiten
Spielerische Wahrheit
Ausgediente Wahrheiten
Die Deutung der Wahrheit
Spielraum der Wahrheit
Die unerbittliche Wahrheit
Die Bedeutung der Wahrheit
Die Verfolgung der Wahrheit
Fehlende Wahrheiten
Wahrheit und Harmonie
Das Ende einer Wahrheitssuche
Unbegreifliche Wahrheiten
Finale Wahrheiten
Epilog
Prolog
„Ein bemerkenswerter Tag heute!“
16. Juni 1904 (Bloomsday), vom Vormittag bis zum frühen Nachmittag • Wien, 3. Bezirk, Gasthaus des Königs
Moritz Schlick, Robert Musil und Alexander Zemlinsky
Erdberg ist der älteste Bezirk Wiens. Sein Name stammt von einem befestigten Ringwall aus dem Frühmittelalter, seine erste urkundliche Erwähnung aus dem 12. Jahrhundert. Ein Bereich des Bezirks liegt etwas höher und besticht durch monumentale Bauten mit großzügigen Parkanlagen und herrschaftlichen Palais. Der dörflich anmutende Teil hingegen liegt etwas tiefer. Der Bezirk ist Geburtsort zweier Nobelpreisträger und Wohnsitz von Künstlern, Literaten und Komponisten.
Im Gasthaus des Königs trafen sich in diesem Bezirk am späteren Vormittag des 16. Juni 1904 mehr oder weniger zufällig zwei gebildete Herren: der Schriftsteller Robert Musil und der Philosoph Moritz Schlick. Beide hatten zwar schon über weitreichende gesellschaftliche Kontakte voneinander erfahren, und sie schätzten sich ob ihres Ansehens, das sie mittlerweile in der Öffentlichkeit genossen, waren einander aber noch nie begegnet.
Es war Zufall, dass die Begegnung gerade vor diesem Haus stattfand, wohl auch Zufall, dass sich gerade heute in Dublin, der irischen Hauptstadt, die Protagonisten eines monumentalen Romans trafen. Der Anzeigenakquisiteur Leopold Bloom, dessen Frau Molly und der junge Lehrer und Schriftsteller Stephen Dedalus, um an diesem einen Tag alles zu erleben, was aus ihrer Sicht wert war erlebt zu werden, nämlich Zitronenseife in Sweny’s Shop zu kaufen und ein Gorgonzolabrot bei Davy Byrne zu essen.
Odysseus war der historische Pionier dieses außerordentlichen Werks gewesen. Er musste aufregende Ergebnisse ähnlicher Art gehabt haben, andernfalls es dem genialen irischen Alkoholiker niemals in den Sinn gekommen wäre, auf tausend Seiten seines Romans alle Details dieses einen Tages in so bemerkenswerter Subtilität darzustellen, dass man Dublin gut und gerne hätte auferstehen lassen können, würde es denn einmal ein Krieg von der Landkarte hinwegfegen.
Die Absicht des Schriftstellers war zwar anerkennenswert, ein perfektes Abbild der Stadt mit seinen Einwohnern zu erschaffen, doch schon das Geburtsdatum seiner späteren Ehefrau, Nora Barnacle alias Molly Bloom, würde aus keiner der zahllosen Angaben des Romans eindeutig rekonstruierbar sein, und nicht etwa deswegen, weil ein Dokument verloren gegangen oder sein Inhalt vergessen worden wäre, ganz im Gegenteil. Es sollten, was sonst selten genug der Fall war, sogar beide Dokumente, das standesamtliche und das kirchliche, zu diesem wichtigen Ereignis vorliegen. Jedoch würden sich die Geburtsdaten darin um einen Tag unterscheiden. Und mindestens daraus sollte Joyce geschlossen haben, dass bei jeder erdenklichen Sorgfalt und diffizilster logischer Betrachtung stets und überall in der Welt mindestens eine Schwachstelle der besonderen Art bestehen bliebe. Mollys unklarer Umstand mochte bei oberflächlicher Betrachtung zwar für Frau Barnacle irrelevant erscheinen, da die beiden ja niemals leiblich zusammentrafen, doch immerhin war zumindest Frau Barnacle an einem bestimmten Tag zur Welt gekommen, und darum hatte sie auch das Recht auf einen wohldefinierten Geburtstag. Und andererseits gehörte dieses Geburtsdatum wiederum, weil man es eben nicht kannte, entschieden zur Klasse unbeweisbarer Wahrheiten.
Kritische Fragestellungen dieser und ähnlicher Art würden die Wiener Logik und Philosophie des zwanzigsten Jahrhunderts ausreichend beschäftigen, und sie würden ebenso langsam wie unerbittlich zu einem fundamentalen Diskussions- und Forschungsgegenstand heranwachsen. Ja, sie würden sogar zu Zerreißproben logischer Behauptungen werden, mathematische Sätze annihilieren und physikalische Theorien aushöhlen. Dieser Sachverhalt würde am heutigen Tage noch nicht ausgesprochen werden, und deshalb würde er gemäß späterer philosophischer Erkenntnisse noch gar nicht vorhanden sein, doch würde er fundamentaler Bestandteil der späteren Arbeiten Wiener Philosophen werden.
Im Moment konnte keiner der beiden Herren erahnen – trotz ihrer Jugend waren sie bereits exzellente Denker –, dass ihre Schicksale schon lange vor dem Tag ihres ersten physischen Zusammentreffens über eine sonderbare Wesenheit verknüpft waren. Diese war weder naturwissenschaftlicher noch philosophischer Natur, und so begannen sie zunächst eines der für Wien typisch schwerelosen Gespräche über Gott und jene kleine Welt, die sie hier umgab. In dieser Stadt der politischen und gesellschaftlich-künstlerischen Dialektik war man gewohnt, bei jeder passenden Gelegenheit mit angemessener Ausführlichkeit über alles zu sprechen, und damit konnte man jedem Thema, unabhängig von dessen Relevanz, etwas abgewinnen und seine Bedeutung ins Unermessliche steigern.
Der in Heeresdingen bewanderte Schriftsteller beleuchtete also eine nicht allgemein bekannte, aber durchaus erwähnenswerte geschichtliche Beziehung zwischen dem englischen Königreich und diesem unscheinbaren Platz hier, welchen die vormittägliche Sonne in ein liebliches Licht getaucht hatte. Er tat dies, um seiner freudig erregten Stimmung und dem Gasthaus angemessenen Ausdruck zu verleihen, und er begann mit einer begeisterten Schilderung der Odyssee eines englischen Königs, welche vor langer Zeit gerade in diesem Gasthaus ihr Ende gefunden hatte:
„Man sieht es dieser Gegend nicht an, aber es ist hoch interessant, und man muss sich es zunächst vergegenwärtigen“, begann er seinen Sermon. Der Philosoph übergab seine Mappe langsam von seiner linken in seine rechte Hand und schob dabei seinen linken Fuß kaum einen Fußbreit vor.
„Richard I Plantagenet“, sagte der Literat, „war bis zu seiner Krönung Graf von Maine, Herzog der Normandie, Graf von Anjou und Herzog von Aquitanien. Von 1189 bis zu seinem Tod 1199 war er König von England. So ich mich richtig erinnere.“
Er machte eine kurze Pause. Währenddessen führte der Philosoph seine linke Hand langsam zur Schläfe, welche er mit den Spitzen zweier Finger berührte. Mit dieser minimalen Geste versuchte er eine kleine Zäsur im Vortrag des Schriftstellers zu erwirken. Aber jener war zu sehr von der eigenen Schilderung gefangen, um bemerken zu können, dass sie beide inzwischen den kleinen Garten betreten hatten und inmitten der gedeckten Tische standen.
„Ziel des von ihm geführten dritten Kreuzzuges war die Rückeroberung Jerusalems gegen die Truppen von Sultan Saladin. Da Richards Schwester – das sollte man wissen – seit dem Tod ihres Mannes, König Wilhelm II, in Messina gefangen gehalten wurde, stürmte Richard“, der Literat machte einen gewaltigen Ausfallschritt, „auf dem Weg ins Heilige Land zunächst einmal die italienische Stadt, sorgte für die Freilassung der Witwe und erhielt dort ob seines Wagemuts den Beinamen ‚Löwenherz’.“
Der Ober ging an den beiden vorbei, murmelte eine Begrüßungsformel und dann einen schüchternen Hinweis auf den freien Tisch links von ihnen, was vom Philosophen mit einer geschult lässigen Handbewegung neutralisiert wurde.
Schon bald nach dem Beginn des Kreuzzugs zeichneten sich allerdings im Heimatland Gewitterwolken ab, denn Richards Bruder Johann Ohneland verwaltete inzwischen, eher schlecht als recht – das muss man zugeben – das Mutterland. Und Philipp II von Frankreich, mit Richard zerstritten, nutzte dessen Abwesenheit zur Schwächung von England. Er schloss mit Johann einen Vertrag, um einen Teil der englischen Besitzungen in Frankreich kassieren zu können. Großzügig übertrug er Johann die Verwaltungshoheit über die ihm noch verbleibenden Gebiete. Der dem abwesenden König nicht unbedingt gewogene englische Adel zwang Richards Justiziar Wilhelm von Longchamp zur Aufgabe seines Amtes.“
„Eine solche Reise muss unvorstellbar strapaziös gewesen sein, und außerdem wusste Richard ja nicht, was fernab geschehen war.“ Der Philosoph versuchte mit eher trivialen Phrasen den Redeschwall des Literaten aufzuhalten.
Dieser hingegen erahnte die Taktik seines Zuhörers und führte deshalb gleich weiter aus: „Ende Oktober 1192 brach der erfolglose Kreuzritter sein morgenländisches Vorhaben ab und schloss mit dem Sultan einen Waffenstillstand. Philipp allerdings hatte inzwischen die französischen Häfen sperren lassen, um dem angeschlagenen Heimkehrer die Rückreise zu erschweren.“
Der Schriftsteller interpretierte die Stirnfalten des Philosophen als die Folge gesteigerten Interesses an seinem Vortrag und hob deshalb die Tonhöhe seiner Stimme zu solcher Dramatik, dass einige Gäste in ihren Diskursen innehielten und sich umsahen:
„Richard nahm also den Weg durch die Adria. Auf der Rückreise zu seinem welfischen Schwager Heinrich dem Löwen wurde er zum ersten Mal im Kärntnerischen Friesach erkannt. Der Babenberger Herzog Leopold V, der Tugendhafte, gab den Befehl zur Gefangennahme, der Engländer schaffte es trotz der Verfolgung weiter bis nach Bruck an der Mur, dort enttarnte man ihn am 6. Dezember aufgrund seines auffallend höfischen Gehabes ungeachtet seiner Verkleidung als Pilger. Nun stellte sich für ihn die Frage nach der weiteren Route. Er wählte den Semmering statt der verschneiten Voralpen und erreichte am 21. Dezember genau diese Stelle hier.“
Der Philosoph war hingerissen von den Emotionen des Literaten und dem genius loci, denn immerhin standen sie an jener Stelle, wo vor siebenhundert Jahren ein englischer König angekommen war. Der Redner holte zum Finale aus:
„Das Ganze nahm jetzt seinen Verlauf. Ein Begleiter des Königs kaufte Lebensmittel ein, zahlte mit morgenländischem Geld, man folgte ihm und fasste Löwenherz in diesem kleinen Gasthaus. Er wurde in die Burg Dürnstein an der Donau verbracht und nach einem Jahr, genau am 4. Februar 1194 war es, gegen ein Lösegeld von mehr als zwanzig Tonnen Silber freigelassen.“
Der Literat schien erschöpft.
„Damit errichteten die Babenberger in Wien neue Stadtmauern“, sagte der Philosoph völlig ruhig. „Sie ließen den Graben von der Stephanskirche bis zur Freyung zuschütten, die Stadt Friedberg in der Steiermark befestigen und eine neue Stadt bauen: die Wiener Neustadt. Ein guter Ausgang also.“
„Wunderbar. Wunderbar.“ Einige Leute waren applaudierend aufgesprungen und gingen gestikulierend im Garten umher. Von der Theatralik des Literaten gefangen, war der trotz seiner Jugend soigniert wirkende Philosoph, obwohl er die Geschichte bereits kannte, den Ausführungen mit freundlichem Wohlwollen gefolgt. Es war unwichtig geworden, ob nun ein König oder irgendwer anders und hier oder irgendwo geboren, festgenommen oder getötet worden war. Die fulminante Darstellung der historischen Umstände allein hatte den Zuhörer und wohl auch alle anderen in diesem kleinen Garten in eine unwirkliche Wirklichkeit versetzt, was durch die geheimnisvoll historische Authentizität des Platzes unterstützt wurde – so das Vorkommnis überhaupt so und hier stattgefunden hatte – und durch die leidenschaftliche Hingabe des Schauspielers, vielleicht sogar durch seine geheimnisvolle Kraft. Fast war es unwichtig geworden zu wissen, wer denn nun der eine und wer der andere Herr war, wer Philosoph, wer Literat, zumal man der wichtigen gesellschaftlichen Regel, einer Rede in jedem Fall aufmerksam zu folgen, gleichgültig wer was übermittelte, entsprochen hatte.
Diese Regel nämlich stand vor allen anderen. Beispielsweise wer auf wen worüber einredete und von welchem Stand Redner und Zuhörer waren. Man hatte keine Fragen zur Klärung zu stellen, sondern hörte einfach nur zu. Dieser ersten Regel zu folgen, die wohl vom Theater stammte, das alle Zuschauer ihrer alltäglichen Realität nur dann zu entrücken vermochte, wenn sie sich der Darstellung hingaben, war wohl die wichtigste Voraussetzung für die Entwicklung der Philosophie in dieser Weltstadt des Theaters. Wien war nicht nur eine Stadt mit unzählig vielen Bühnen, sondern war selbst eine – ein Theater für die Musik, die Philosophie, die Kunst, die Wissenschaften, die Politik; und wie in jedem Theater waren auch hier die Schauspieler und das Publikum, das sich von Vorträgen jedweder Art fesseln ließ. Und wie in einem herkömmlichen Theater gab es auch in diesem zwei Bühnenbereiche. Im vorderen, auf der Bühne, wurde das Schöne gepflegt, das Irrationale, der Imaginärteil der gesellschaftlichen Sphäre. Im hinteren Bereich hingegen, auf dem Schnürboden, wurden das Technische und das Pekuniäre präpariert, gelegentlich auch das Wissenschaftliche. Sofern es der Technik von Nutzen war. Dieser Bereich war nur den Eingeweihten dieser Sparten zugänglich und zwischen den beiden Bereichen wirkte das was man in anderen Ländern als Politik bezeichnete.
Die Distinguierten der Wiener Gesellschaft interessierten sich für diesen Bereich nur am Rande, wenn seine Maschinerie, die das Spiel auf der Bühne am Leben erhielt, einmal kurzzeitig versagte. Sie zeigten sich, sie sahen sich, sie zahlten und sie erhielten. Man hatte kein Recht undankbar zu sein, nur weil sie an Elementen mit geringem Interpretationsspielraum wenig interessiert waren, denn immerhin überließen sie den aus ihrer Sicht langweiligen Teil den Kennern und Spezialisten dieses Gebietes, sie überließen ihnen das wissenschaftliche und politische Heft, und damit überließen sie ihnen alle Möglichkeiten zur Gestaltung der Welt. Dieser sogenannte intellektuelle Teil der Wiener Zivilisation widmete sich der Unterhaltung, den schönen Künsten, den Genüssen des Lebens. Und der Philosophie. Überall in der Welt hätte sich bei einer solchen Arbeitsteilung eine Kluft aufgetan zwischen den beiden Bereichen. Nicht aber in Wien.
Wie beim klassischen Theater verband in dieser Stadt der Widersprüche eine unsichtbare Regie die Akteure beider Teile, ohne ihre Ausrichtung zu verändern, sodass alle mit gleichem Recht behaupten konnten, mitgewirkt zu haben am harmonischen Ganzen. Zuzuhören war die Gabe, die die Bürger dieser Stadt in hohem Maße auszeichnete. Leben und leben lassen war ihre Maxime, der sich alle zu ihrem eigenen Vergnügen unterzuordnen hatten und dies gerne taten.
In diesem kleinen Schanigarten jedenfalls waren alle Anwesenden über eine kurze Zeitspanne hindurch in jene transzendente Sphäre versetzt worden, die ein Theater ausmachte, und sie wurden erst mit den freundlich verbindlichen Worten des Obers in ihre alltägliche Wirklichkeit entlassen.
Nach dem Fallen des imaginären Vorhangs nahmen die beiden Herren Platz, und nachdem sie die Speisekarte studiert und sich mit dem ersten Viertel zugeprostet hatten, diskutierten sie mit jener verhaltenen Stimme gesitteter Zuhörer in der Zwischenaktpause das Erlebte, und sie taten das, als ob der englische König gleich wieder präsent wäre, sie diskutierten die Legitimität der Gefangennahme Richards und ihre weitreichenden Konsequenzen und was wohl die weitere Entwicklung Wiens gewesen wäre, hätte dieser Handstreich nicht stattgefunden.
„Ein schöner Tag heute.“
„Ja, wunderschön.“
Zwei schlanke Sätze ließen die Anspannung wohltuend verflachen, und das Gespräch erhielt sogleich jenen eleganten Schwung, welcher trotz oder vielleicht gerade wegen der zunächst selbst auferlegten Zurückhaltung erstaunliche Gemeinsamkeiten offenlegte. Nun konnte man die beiden Herren genauer betrachten.
Der Schriftsteller, Robert Musil, war ein Kärntner, 23 Jahre alt, mäßig groß von Statur, mit bübischem Blick, und aus seiner gewandten Diktion konnte man nicht unbedingt entnehmen, dass er wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Technischen Hochschule gewesen war.
Der Philosoph, Moritz Schlick, ein fescher Berliner im englischen Zweireiher, wenige Jahre jünger als der Literat, mit flammenden schwarzen Augen, war ein aristokratischer Feingeist
Er würde einmal den berühmtesten internationalen philosophischen Zirkel führen. Zu dessen Gründungsmitgliedern würde das leibhaftige Dissertationsthema des Kärntners zählen: Ernst Mach, ein weltbekannter Naturwissenschaftler und Philosoph aus Brünn.
Musil hatte in Brünn zunächst Ingenieurwissenschaften studiert, später Psychologie und Philosophie in Berlin.
1908 würde er seine Dissertation „Beurteilung der Lehren Machs“ abliefern, nach seiner Promotion ein Angebot zu einer Habilitation erhalten, dieses aber wegen seiner überbordenden literarischen Neigung zu seinem späteren Nachteil ablehnen. Nämlich würde er die nächsten dreißig Jahre hindurch an einem zunächst erfolglosen Roman schreiben. Nicht nur in seinem Umfang und seiner langwierigen Entstehungsgeschichte würde der Roman dem des Iren gleichen, sondern auch in den Bezugspunkten zur Gesellschaft. Einige Jahrzehnte nach seiner Entstehung und erst nach dem Tod des Verfassers würde das Werk eine eindrucksvolle Bewertung erfahren und in die Literaturgeschichte eingehen. Allerdings würde kaum ein Kritiker beide Romanteile jemals vollständig gelesen und erst recht nicht verstanden haben.
Schlick war zweifelsfrei literarisch interessiert, wenn auch nicht an jener Art von Belletristik, der man den Roman des Kärntners zu dessen Lebzeiten zuordnen würde. Als Philosoph schien er in seinen tiefgehenden Forschungsaktivitäten andere Orientierungspunkte zu haben als die Lebensart der vornehmen Gesellschaft des Habsburgerreiches. Diese oberflächlich betrachtete wissenschaftliche Distanz hinderte den Philosophen aber keinesfalls, sich der Persönlichkeit des Schriftstellers freundschaftlich zu nähern, mit dem sicheren Gefühl, dass hier gerade eine bedeutsame Begegnung stattgefunden hatte.
Fast zwanzig weitere Jahre würde Schlick forschen und lehren, um 1922 an der hiesigen Universität zunächst den Lehrstuhl für Naturphilosophie von Ernst Mach zu übernehmen und nach zwei weiteren Jahren mit einem interdisziplinären Diskussionszirkel – dem „Wiener Kreis“ – in die Philosophiegeschichte einzugehen.
Noch konnte er allerdings nicht wissen, dass in zwei Jahren in Brünn ein außergewöhnlicher Logiker mit Namen Kurt Gödel geboren würde, den man später als den größten nach Aristoteles bezeichnen sollte. Im Zirkel und damit auch im Leben des Philosophen würde er eine wesentliche Rolle spielen, denn der Philosoph würde sich 1911 an der Universität Rostock mit einer Schrift zum Wesen der Wahrheit habilitieren, ohne zu ahnen, welche Erkenntnisse der Brünner zwei Jahrzehnte später aus der Prädikatenlogik zutage fördern und damit die Grundfesten der Mathematik erschüttern würde.
Schlick war ganz offensichtlich von der verhaltenen Lieblichkeit des Platzes begeistert, der im beruhigenden Schatten der Kastanienbäume lag.
„Schlick, was macht die Philosophie?“, fragte Musil. „Ich habe über Sie und Planck gehört und sogar gelesen. Sind Sie jetzt schon mehr der Philosophie oder noch eher der Physik zugewandt? Ist ja außerordentlich interessant.“
„Ich habe meine Dissertation abgegeben und werde demnächst promovieren“, sagte Schlick. „Mit Planck hatte ich großes Glück. Er ist der Grand Seigneur der Physik, und man kann viel von ihm lernen. Aber trotzdem, jetzt bin ich froh, wieder hier in der Stadt zu sein und etwas Abstand von diesem nüchternen Thema zu gewinnen. Irgendwann hat man genug davon.“
Obgleich keiner der beiden Herren Wienerischer Abstammung, waren sie seit einigen Jahren in diese Gesellschaft integriert, und sie bewegten sich in ihrem Dunstkreis ebenso gewandt wie die Wiener selbst.
„Ich nehm‘ ein Beuschl mit Semmelknödel und einen Weißen Spritzer“, sagte Musil.
„Mir einen Tafelspitz und noch ein Achterl Veltliner“, sagte Schlick.
Während sie auf ihr Essen warteten, erschien am Eingang zum Garten ein bekanntes Gesicht.
„Zemlinsky“, sagte Schlick, „Sie hier, das ist eine Überraschung! Darf ich Ihnen Herrn Musil vorstellen.“
Musil stand auf und verneigte sich leicht. „Herr Zemlinsky, ich habe einige Ihrer Kompositionen gehört und war beeindruckt. Zwar bin ich kein Experte, aber nach meinem Gefühl sind es außerordentliche Werke.“
„Danke, danke für die Ehre, Herr Musil“, sagte Zemlinsky. „Schlick, schön Sie zu treffen. Wunderbares Plätzchen ist das hier. Da haben sie den Richard geschnappt, wissen Sie das! Weil wir gerade reden, also ich war ja gestern im Musikverein, da hat das Buschquartett im Brahms-Saal gespielt, ich muss Ihnen sagen.“
Zemlinsky wippte auf den Beinen wie ein Dirigent, der einem eingeschlafenen Pauker ein Zeichen geben muss.
„Ach, Sie waren gestern im Konzert“, antwortete Schlick. „Ich hatte es gelesen, aber schon seit längerer Zeit leider keine Gelegenheit mehr dazu. Entweder keine Karten – es ist ja ständig lang vorher alles ausverkauft – oder irgendwelche Termine.“
„Hervorragend wie immer gestern“, sagte Zemlinsky. „Wissen Sie, ich bin immer ganz gefangen von der Musik. Noble Gesellschaft dort übrigens. Kommerzialräte, guter Anzug, silbergraue Krawatte. Stecktuch. Sogar Lackschuhe manche. Die Frau sitzt immer rechts, Sie wissen ja, Etikette in Wien – bei manchen wichtiger als die Tonart. Die wirklichen Kenner sitzen immer ganz weit hinten. Studenten von der Akademie haben wenig Geld, verstehen aber ungemein viel von der Musik und hinten ist sowieso die bessere Akustik.“
Die drei Herren setzten sich. Zemlinskys Unruhe war zum Greifen. Er nahm die Speisekarte her und bestellte ohne sie anzuschauen ein Schnitzel.
„Der Schubert ist immer ein Erlebnis für mich“, sagte er. „Gestatten Sie, ich muss Ihnen meine Eindrücke erzählen, bevor sie in unserer Diskussion verschwimmen: Also dieses Quartett da von Schubert … der Bratscher in einem Streichquartett ist ja eigentlich ein armes Schwein, weil er nicht so viel zu sagen hat wie die anderen, außer beim Smetana natürlich, der hatte damals schon den Tinnitus – der hohe Ton, das Es. Beim Haydn gibt ja eh nur der Erste den Ton an, die anderen begleiten. Bisserl Harmonie dazu, gestern war zum Glück kein Haydn. Schubert Opus posthum. Beim Schubert da gibt der Bratscher den ganzen Rhythmus. Hier ist er die Seele. Unglaublich, was der Schubert hier geschaffen hat. Wissen Sie, der zweite Satz wird unterschätzt, die anderen Sätze haben zwar mehr Tempo und Dynamik, aber dieser zweite Satz sieht so harmlos aus. In der Harmlosigkeit des Satzes liegt sein Mysterium. Wie in der Mathematik, manche Sequenzen sehen harmlos aus, sind es aber nicht.“
„Wie in der Logik, nicht wahr, Kollege Musil!“, bemerkte Schlick.
„Und in der Philosophie ist das ziemlich ähnlich“, konterte Musil. „Sehen Sie doch einmal den Kant an. Der war nie weiter als ein paar Gehstunden von Königsberg entfernt. Dennoch hat er die ganze Welt durchschaut und die Erkenntnisse klar ausgedrückt.“
„Aber Sie kennen schon die Meinung von Gauß über Kant. Er hat ja gesagt, dass das, was der behauptet entweder trivial oder falsch ist“, sagte Schlick mit einem Lächeln auf den Lippen.
„Das kann ich mir nicht vorstellen, bei Kant, weshalb?“, fragte Musil. „Aber wenn es stimmt!“, meinte Zemlinsky.
„Der Gauß war eine ganz andere Dimension“, sagte Musil, „als die von gewöhnlichen Philosophen. Im Gegensatz zur Philosophie ist das Mathematische immer greifbar. Dort ist alles beweisbar.“
„Aber ist in unserem Leben alles greifbar und beweisbar?“, sagte Zemlinsky. „Ich denke nicht, dass wir alles beweisen können. Es gibt Stimmungen, die weit über das Rationale hinausgehen. –
Darf ich noch einmal kurz zurück zum Quartett von Schubert! Wissen Sie, viele erkennen die Uhr darinnen nicht. Der Bratscher ist diese Uhr, er ist die rhythmische Seele, da-daa—da-daa—da-daa—da-daa. Nur wenn der Rhythmus genau gehalten wird, lebt der zweite Satz. Diese Uhr, ich krieg‘ die Gänsehaut. Sie können nach ein paar Noten schon erkennen, ob die Spieler das alles richtig verstanden haben. Die Alma hat es jedenfalls verstanden.“
Der dünne Zemlinsky zitterte plötzlich wie Espenlaub. Schlick wandte sich zu Musil und senkte die Augen. Alma. Irgendwann musste dieser Name fallen. Beide kannten die Dame und beide wussten, was sie für die Gesellschaft und in der Gesellschaft bedeutete. Trotz ihrer Jugend hatte sie einen bemerkenswerten Einfluss auf die gesamte Künstlerschaft. Die beiden Herren wussten natürlich manches über die Beziehungen von Zemlinsky zu dieser Dame der Gesellschaft.
„Man muss die Biographie vom Schubert kennen, sonst kann man ihn nicht spielen.“ Zemlinsky hatte sich wieder gefangen.
„Der Schubert“, versuchte Schlick abzulenken, „war im Gegensatz zu Mozart arm, bettelarm. Mozart war nicht wirklich arm. Da wird immer betont, dass Mozart arm war, das ist blanker Unsinn, natürlich hat er Geld gebraucht, alle haben sie Geld gebraucht, der Beethoven auch. Der hat den Zmeskall von Domanovecs angepumpt und der hat dann natürlich immer was gespendet.“
„Der Zmeskall war Beamter in der ungarischen Hofkanzlei“, sagte Musil. „Der Beethoven hat ihn ein falsches Schwein genannt. Sie können sich denken. Das hat dem Zmeskall aber offenbar gar nichts gemacht. Er hat trotzdem oder vielleicht gerade deswegen bezahlt. Und wenn man sich andererseits vorstellt, dass sich der Schubert die Notenlinien selbst hat malen müssen, weil er kein Geld für die Blätter gehabt hat und wie viel Zeit er da verbraucht hat mit diesem Mist, wo er irgendetwas Gscheites hätte schreiben können, dann ist das ein wirklicher Jammer.“
„In Mozarts Nachlass“, sagte Schlick, „war ein Drittel die Kleidung, dafür hat er eine Menge Geld ausgegeben, Konstanze hat das verkauft. Das Requiem hat sie auch fertig machen lassen, vom Süßmayr. Eine echte Geschäftsfrau.“ Schlick lachte.
„Mozart war verschuldet, aber nicht arm. Arm sein ist das Gegenteil von verarmt sein“, sagte Zemlinsky und zupfte an seinem Ärmel, aus dem ein grauer Faden heraushing, „Er war immens eitel, weil er so klein war, das kann ein Problem sein. Es macht einen Unterschied, ob man klein ist oder groß. Bettelbriefe hat man gesagt. Lächerlich. Die waren doch alle froh, wenn er sie um Geld gebeten hat. Durch seine Schulden sind sie weltberühmt geworden. Wie einfach man doch berühmt werden kann.“
Der Faden war noch immer da, und Zemlinsky zupfte wieder.
„Sie können sich vielleicht nicht vorstellen, wie das ist, mit Alma zusammen zu sein“, sagte er. „Ich weiß, wie sie ist, sie ist eine besondere Frau. Musikalischer als so mancher Dirigent. Sie ist eben die Tochter eines Landschaftsmalers, und ein Maler ist eben auch ein Künstler, das muss kein Musiker sein. Das Künstlerische liegt ihr im Blut, ihre Sprache, ihre Bewegungen, die Art, wie sie den Kopf dreht, sie hat einfach die Ader von ihrem Vater. Der Schindler war eine Persönlichkeit in der Wiener Kunstszene. Anerkannt war er sicher. Vielleicht nicht gerade extrovertiert, wie es der Klimt jetzt schon ist. Der Schindler hat sich immerhin mit seinen Bildern ein ganzes Schloss kaufen können und seine Tochter ist nun die Gönnerin in künstlerischen Salons. Wenn man in einem Schloss aufgewachsen ist, dann tut man sich leicht in der Gesellschaft.“
„Kann man denn mit Bildern oder Romanen sein Leben finanzieren?“, fragte Musil. Zemlinsky griff in die Innentasche seiner Jacke und holte ein Taschentuch heraus, mit dem er seinen Mund abwischte. Er tat dies etwas länger und langsamer, als man es sonst tut: „1887 haben sie Schindler zum Ehrenmitglied der Wiener Akademie der bildenden Künste gemacht. Der Kronprinz Rudolf hat da angeblich eine gewisse Rolle gespielt. Sie hat mir das mehrfach ganz stolz erzählt. Damit ist ihr Vater einer der bedeutendsten Künstler der Monarchie und eben ziemlich reich geworden.“
„Wie ich gehört habe, war die Mutter von Alma mit Carl Moll befreundet, ist das wahr?“, fragte Musil.
„Befreundet“, sagte Zemlinsky, „Sie sind gut. Sie hatte ein feuriges Verhältnis mit ihm, ganz Wien hat das gewusst. Moll war zuerst der Schüler ihres Mannes, der ist da ein und ausgegangen. Ein selten genialer Künstler war der Moll. Alma hat das sehr belastet, hat sie mir gesagt.“
„Moll hat an der Akademie der bildenden Künste bei Christian Griepenkerl studiert“, sagte Schlick. „Das war etwa 1880. 1897 war er sogar bei der Begründung der Wiener Secession dabei.“
Christian Griepenkerl stammt aus einer alten Oldenburger Familie. Ab Ende 1855 war er in der Schule Carl Rahls. Er arbeitete an den Fresken in der Treppenhalle des Hofwaffenmuseums und in den Palais Todesco und Sina. Ab 1874 Professor an der Akademie der bildenden Künste, gehörten Moll, Faistauer, Max Kurzweil, Carl Otto Czeschka, Richard Gerstl und Schiele zu seinen Schülern.
In dieser Zeit hat sich auch Hitler auf der Akademie beworben. 1907 zwar zum Probezeichnen zugelassen, hat Griepenkerl das Verdikt aber negativ bewertet, mit der Begründung, es wären zu wenige Köpfe in den Zeichnungen.
„Das Verhältnis zwischen Moll und Alma hat auch die nächsten Jahre heimlich fortbestanden“, sagte Zemlinsky.
„Weil Sie gerade erwähnt haben“, sagte Schlick, „dass Moll bei der Gründung der Secession dabei gewesen ist: Die Secessionisten hatten sich sehr für die moderne Kunst eingesetzt, verschiedene Ausstellungen zeitgenössischer Kunst nach Wien gebracht und großen Einfluss auf ihre Entwicklung gehabt. 1901 hatte Josef Hoffmann – angeblich plant er ja jetzt in Brüssel eine Art Palais für Adolphe Stoclet ...“
„... sitzt der nicht im Aufsichtsrat der Austro-Belgischen Eisenbahn-Gesellschaft ...“, warf Musil ein, „... und die wiederum betreibt hier in Österreich die Aspangbahn.“
„... hat also der Hoffmann“, setzte Schlick fort, „hat der Hoffmann für Moll und Koloman Moser, dieser hier einer der bedeutendsten Künstler und auch der ein Mitbegründer der Secession, auf der Hohen Warte im 19. Bezirk ein großes Doppelhaus gebaut. Der Rahmenplan für die Villenkolonien ist von wohlhabenden Bauherren finanziert worden. Dort wohnt der Moll jetzt in der Steinfeldgasse 8. Ich war schon einmal dort. Auf Betreiben Molls ist übrigens 1903 auch die Moderne Galerie im Belvedere entstanden. Er ist sehr umtriebig, nicht nur in der Familienbildung.“
„Wissen Sie, im Haus der Molls verkehren sehr viele Künstler. Schriftsteller, Maler, Architekten. Solche Kreise haben sich natürlich im Selbstbewusstsein der Alma niedergeschlagen“, sagte Zemlinsky. „Jetzt kann ihr schon keiner mehr das Wasser reichen, auch der Mahler nicht. Alma hat Viele kennengelernt, weil sie immer wieder beim Abendessen mit ihnen dabei war. Sogar der Direktor des Hofburgtheaters, der Max Burckhard, hat ihr vor einigen Jahren Theaterkarten zugeschickt. Dann war sie einmal bei ihm zu Hause, er hat mit ihr einzelne Aufführungen besprochen, und er hat sie auch gefördert, wie das ihr Vater getan hat. Ihr Interesse an der Literatur war es damals. Einmal das und einmal das halt. Der Klimt hat ihr die Malerei beibringen wollen, und was anderes vermutlich auch. Der hat ja jetzt schon einen Haufen unehelicher Kinder. ‚Sie gefällt mir, wie uns Malern eben ein schönes Kind gefällt’, hat er gesagt. Das hat der Schindlerin natürlich überhaupt nicht gepasst.“
„Kennen Sie sie gut, die Alma“, fragte Musil, wohl wissend, dass das Weibsbild, wie er sie einmal genannt hatte, nicht ganz Ohne war.
„Mein Gott, was heißt ganz gut“, sagte Zemlinsky, „ich habe ihr Klavierunterricht und Unterricht in der Komposition gegeben, sie wollte immer komponieren, immer nur komponieren. Das war eine schöne Zeit, ich bin da gerade Kapellmeister am Wiener Carltheater geworden und die Musikszene ist mir offengestanden. Alma hat einen ziemlichen Nachholbedarf gehabt, ihre Kompositionen waren ja durchaus originell, aber halt ziemlich fehlerhaft. Bei sowas krieg‘ ich immer Kopfschmerzen. Eigentlich war sie weniger am Komponieren interessiert als am Gesellschaften. Ich habe sie dann irgendwann vor die Wahl gestellt: Entweder machst du das Eine oder das Andere. Beides geht nicht. Sie hat eindeutig das Andere wollen.“
„Ist sie jetzt eigentlich liiert?“, fragte Musil.
„Nicht mit mir. Vermutlich ist es meine Größe, ich bin klein, ich hab’s versucht, sie hat nicht begriffen, dass sich auch ein Gnom verlieben kann und dass es nicht die Größe allein ist. Und dann noch meine Herkunft. Demütigungen. Quälereien am laufenden Band. Dann war das mit der Zuckerkandl. Mit dem Gustav Mahler ist sie jetzt zusammen, um Ihre Frage zu beantworten. Der Mahler ist auch keine Schönheit, aber wie das Schicksal so will. Im November vor drei Jahren waren wir am Abend bei der Zuckerkandl bei so einem Empfang in ihrem Club, und da war eben der Direktor dabei. Dirigent an der Hofoper. Da hat man verloren.“
Zemlinsky stand auf, brach einen kleinen Zweig ab, machte mit dem rechten Arm eine weite Bewegung und einen Diener:
„Das imponiert einer jungen Dame natürlich. Einerseits, und andererseits hat ihm ihre Selbstsicherheit imponiert. Denn sie hat ihm da frank und frei ins Gesicht erklärt, dass sie das Ballett von Josef Bayer, das er gerade zur Aufführung gebracht hat, für dümmlich hält. Und offenbar hat auch er es dann auch für dümmlich gehalten. Gustav hat sich wohl an diesem Abend in sie verliebt und ihr schon im November einen Heiratsantrag gemacht. Ihre Mutter hat zwar versucht, ihr den Mahler auszureden – zu alt wäre er, verarmt und krank –, zudem hat der Moll gesagt, wäre Mahler jüdischer Abstammung. Nun, jüdisch bin ich auch, aber beim Mahler war es etwas anderes. Obendrein war der zum Katholizismus konvertiert. Mir hat sie von der Geschichte erst einen Monat später erzählt, und dazu, dass sie sein Körpergeruch störe und seine Musik unverständlich sei.“
‚Er hält von meiner Kunst gar nichts – von seiner viel – und ich halte von seiner Kunst gar nichts und von meiner viel. So ist es! Nun spricht er [Mahler] fortwährend von dem Behüten seiner Kunst. Das kann ich nicht. Bei Zemlinsky wär‘s gegangen, denn dessen Kunst empfinde ich mit – das ist ein genialer Kerl’, schreibt Alma Schindler, die spätere Ehefrau des Komponisten Gustav Mahler, des Architekten Walter Gropius, des Dichters Franz Werfel und Gefährtin des Malers Oskar Kokoschka, in ihren Tagebuchseiten am 19. Dezember 1901.
Zemlinsky rückte seine Brille zurecht und zahlte. „Für mich ist Schubert nicht so genial wie Mozart. Wissen Sie.“ Schlick sagte dies, nahm einen Schluck und blickte über die Brille hinweg auf Musil, den er im Gegenlicht, das die Fensterscheiben von der anderen Straßenseite warfen, nur in Umrissen erkennen konnte.
Zemlinsky sprang auf, und das Stakkato seiner Antwort klang durch den ganzen Garten: „Ja klar, das ist klar, der Mozart war genial. Er hat alles im Kopf gehabt, war ein Musiker und intelligent. In anderer Weise war der Schubert genialer. Er war vielleicht nicht so intelligent wie Mozart, aber ein Musikant – das gibt einen Unterschied. Schubert hat das tschechische Blut gehabt wie diese ganzen Wiener da – der Strauss – der Lanner – die Schrammeln. – – –Schlick.“
Der Paukenschlag ließ das Blut des Adressaten erstarren. „Schlick. Das merken Sie doch überall in dieser Stadt. Auch der Dvorak, das hört man gleich. Aber Brahms war von der Waterkant und hat die wunderschönsten Sachen und Walzer geschrieben. Diese Freiheit im Rhythmus gibt es nur noch bei Brahms. Da kann man keinen Dreivierteltakt zählen wie beim Strauss. Das Wasser im Hafen schwingt im eigenen Rhythmus. Phantastisch. Phantastisch.“
Musil war hingerissen vom fulminanten Vortrag des kolossalen Zwerges. Mit der Gabel malte er Kreise in die Luft und gab dabei zischende Laute von sich. Unter dem Tisch bewegte er seine Beine auf und ab. Die Leute links von ihm meinten, es wäre ihm etwas widerfahren, helfende Hände streckten sich ihm entgegen.
„Nein, vielen Dank, sehr aufmerksam. Es geht mir sehr gut.“ Er wendete sich nach links und rechts und schwenkte den Kopf hin und her.
„Vielleicht wissen Sie“, sagte Zemlinsky, wohl durch die exaltierten Kopfbewegungen Musils angeregt, „dass Dampflokomotiven den Dvorak schier verzückt haben. Bei seinem Aufenthalt in Amerika ist er immer wieder zum Bahnhof gegangen und dann auf dem Perron gestanden, mit unsäglichem Heimweh nach seiner tschechischen Heimat.“
„Das Heimweh hat ihm sicherlich weh getan“, sagte Schlick, nachdem er sich wieder beruhigt hatte, „aber für die Musik war es sehr günstig, denn seine Kompositionen sind erst mit dem Aufenthalt in Amerika so gut geworden.“
„Das stimmt, Schlick, das stimmt“, sagte Zemlinsky. „In Amerika hatte er sich mit der Pentatonik befasst, mit den indianischen Harmonien aus den Appalachen. Es gibt da beispielsweise eine Indianische Kanzonetta. Allerdings sind nicht alle Interpretationen seiner Werke, die er dort geschrieben hat, richtig. So muss er also da gestanden sein – ähnlich wie der Schubert einsam in seiner dunklen Küche, der Dvorak auf diesem Bahnhof, und er muss die Dampflokomotiven angesehen haben, die einzige Verbindung zur weit entfernten Heimat. Und dann hat er dieses zwingende und voll kinetischem Überschwang sprudelnde Streichquartett in F-Dur geschrieben. Für mich eine einzige Eisenbahnfahrt. Das Durchdrehen der Räder, die Lok, wie sie anzieht, das Dampfabblasen beim Stillstehen, tsch tsch – tsch tsch – tsch tsch – tsch tsch. Das lockere Durchfahren ebener Strecken, daadarantan daadarantan daadarantan daadarantan – didlidl didlidl didlidl didlidl.“
Zemlinsky machte eine stoßende Bewegung mit dem Arm.
„Wenn ein Ensemble das erkannt hatte, dann hat es sich ganz leicht getan bei der Interpretation. Und wenn nicht, dann wurde das nichts mehr, da konnte man noch so viel erklären. Nach ein paar Takten schon merkte man, ob die das verstanden hatten. Das lernt man nirgendwo. Da nutzt die ganze Akademie nichts. Vor ein paar Wochen, am 1. Mai ist er gestorben. Ein Jammer ist das.“ Der Kleine war voll in seinem Element. Man konnte sich vorstellen, wie er Alma in solchen Momenten in seinen Bann zog. „Das kommt aber nicht nur bei Dvorak vor, oder Mendelssohn. Selbst der alte Bach hat – wenn Sie so wollen – Programmmusik geschrieben. Nur ist man da nicht gefasst darauf. Da gibt es zum Beispiel diese Sonate für Cello, wo er eine Maultrommel imitiert. Im ersten Satz gleich. Eine permanent arpeggierte Prim auf zwei verschiedenen Saiten. Das muss man erkennen. Die dürfen nicht rein sein. Müssen etwas dissonant gespielt werden. Nur dann hört man diese Maultrommel heraus. Wenn das einer so spielt, kriegt er von mir gleich eine Eins.“
Die beiden Herren hörten mit atemloser Spannung zu, denn es wurde direkt vor ihnen gespielt. Das war die Kunst der Musik. Direkt vor mir geschieht das jetzt, dachte Musil, und dasselbe dachte Schlick über seine Halluzination.
„In der Mathematik ist es ähnlich wie in der Kunst“, sagte Musil, er hatte Schlicks Gedanken erraten. „Mathematik ist Kunst. Es gibt Tage, da hat man das Gefühl, dass es jetzt gleich klappen muss. Schlick, das kennen Sie sicher auch. Man plagt sich ewig mit irgendeiner Formel herum, und plötzlich hat man die Lösung und weiß nicht einmal, wieso. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Musik-Genies irgendwo so richtig geplagt haben. Allen ist es wohl zugeflogen.“
„Nicht allen, leider. Dem Beethoven sicherlich nicht“, sagte Zemlinsky. „Was der herumgeschmiert hat in seinen Partituren, ist unglaublich. Auch Genies haben viel gearbeitet und damit erst die Voraussetzungen geschaffen für ihre Ideen. Aber letztendlich gibt’s der Herr. Und in der Musik gibt es zweifelsfrei Ausnahmen, denen nichts so richtig in den Schoß gefallen ist. Für mich zum Beispiel der Bruckner, der Musikant Gottes. Der Bruckner war überhaupt kein Musikant Gottes, hat sich alles schwer erarbeiten müssen, Symphonien hat er nachbessern lassen. Das wäre dem Mozart nie passiert, und der Beethoven hätte so etwas niemals zugelassen. Dem Bruckner ist wahrlich nichts in den Schoß gefallen, eigentlich auch dem Beethoven nicht, man kann sich nur wundern, dass man die Neunte überhaupt entziffert hat. Vielleicht ist eh nicht jede Note richtig.“
Er imitierte die Pauken aus dem Scherzo der Neunten und schlug dazu mit den Händen auf den Tisch. Die Gäste hatten sich mittlerweile nicht nur daran gewöhnt, sie signalisierten jetzt bereits sogar eine gewisse Erwartung.
„Weil wir gerade hier sitzen“, sagte Schlick. „Der Boltzmann ist da gleich um die Ecke geboren, und er unterrichtet auch Physik hier in der Nähe. Der spielt übrigens ganz hervorragend Klavier. Wie er klein war, hat er sogar beim Bruckner Klavierstunden gekriegt, das war gleich da hinten in dem Haus. Man allerdings gewusst, dass mit ihm etwas nicht stimmt, er war oft bei Beerdigungen.“
„Beim Bruckner merkt man den Oberösterreicher“, sagte Zemlinsky, „der Mozart hat das typisch Bayrische, der ist kein Österreicher, auch wenn es den Wienern nicht passt, na gut, die Mutter, das stimmt, der Großvater aber war Dachdecker, in Dillingen bei Ulm. Kein Musiker.“
„Wie Einstein der Geiger“, bemerkte Musil, „der ist auch kein Musiker, kein wirklicher jedenfalls, vielleicht ein geigender Physiker, aber Mozarts Vater war einer.“
„Ja schon, aber ich sag ja, der Großvater“, meinte Zemlinsky. „Der Großvater war ein Dachdecker, wie schon gesagt, in Dillingen glaub‘ ich. Und der Einstein übrigens hat eine falsche Haltung. Die Geige relativ tief, so hat der keinen gescheiten Ton herausgekriegt. Aber die Wissenschaftler merken das nicht.“
„Gleich daneben ist Lauingen“, sagte Schlick, „ich meine, da wo der alte Mozart her war. Interessante Gegend. Denn ganz in der Nähe ist dort der Albertus Magnus her, wissen Sie. Der steht sogar auf dem Marktplatz auf dem Sockel. Und nicht allzuweit davon übrigens sind auch die Einsteins her.“
„Den Mozart Dachdecker hört man heut noch raus aus manchen Kompositionen“, sagte Zemlinsky. „Die Struktur seiner Klaviersonaten beispielsweise erinnert an die eines Daches. Seine Mutter war musikalisch vorbelastet, aus Sankt Gilgen, aus einer Musikerfamilie am Wolfgangsee, eine ganz liebe Frau. Aber nicht besonders gescheit oder was man heute als gescheit bezeichnet. Sicherlich hat sie eine gesunde Portion Menschenverstand gehabt, aber der Vater hat das Regiment geführt. Der Sohn hat sie ganz lieb gehabt, soweit Mozart überhaupt hat jemanden lieben können. Und dann hat sie in Paris sterben müssen und ist dort auch begraben. Der Sohn hat sie zurücklassen müssen. Und vorher ist sie nie aus Sankt Gilgen herausgekommen. Wie der Kant aus Königsberg.“
Musil kostete vom Wein: „Ein treffender Vergleich. Wollen Sie sich nicht noch einmal zu uns setzen, Herr Zemlinsky?“
„Ich muss noch in die Johannesgasse ins Kons, dort spielt heute ein Schüler von mir vor“, sagte Zemlinsky, „aber ein Achterl nehm ich noch.
Übrigens, was ich noch sagen wollte, der Schubert hat die Kirchenglocken in dieses Quartett ‚hineingehört’, hätt ich fast gesagt, und hineinkomponiert. Man redet ja immer über den Beethoven, weil der nichts mehr gehört hat und trotzdem die schönsten Sachen geschrieben hat. Der Schubert hat kein Klavier gehabt und hat sich die Tastatur am Küchentisch aufgemalt. Nicht weil er damit geübt hat, das ist totaler Unsinn, wenn die Leute das sagen, sondern nur wissen wollte, ob man das noch mit den Fingern greifen kann. Und diese Uhr da in dem Quartett, die ist da so ein Wahnsinn. In dieser Tonart auch noch dazu. Der Schubertsche Todesrhythmus. Man muss sich vorstellen, dass er da in seiner finsteren dreckigen Küche gesessen ist, und da war die Uhr an der Wand.
Ticke – tacka – ticke – tacka – ticke – tacka – ticke – tacka
Und das Pendel hin – her – hin – her – hin – her – hin – her
Und dann der Stundenschlag. Das muss man den jungen Schülern sagen. Hört doch einmal, was los ist. Sucht nicht nach den Dynamikbezeichnungen, nicht nach den Accelerandi. Denkt einmal, wie der gewohnt hat, wie er gegessen hat, was die Geräusche von der Straße gewesen sein mussten, die Kanonen der Franzosen damals. Nicht das peng – peng – peng. Das hört jeder Ungläubige. Jeder Trottel. Nein. Das Rasseln der Kette, wenn nach dem Stundenschlag die Gewichte die Kette herunterziehen und dabei die Feder nachspannen – das ist nicht spektakulär – das ist vermeintlich keine Musik – dieses Rasseln hört man im Quartett in der Komposition, und dann gruselt‘s mich total.“
Zemlinsky war an den Rand des grünen Sprossenstuhls gerutscht, fast hätte man einen Absturz in den Kies des Lokals vermutet, sein geringes Gewicht wurde von einem einzigen Brett gehalten. Die Eisenfüße des Stuhls quietschten sich in den Untergrund. Die beiden Herren hielten ihre Weingläser bereits seit einiger Zeit in der Hand und waren nicht imstande zu trinken. Es war klar, was Alma fasziniert hatte an diesem oberflächlich betrachtet unscheinbaren Männchen. Es war diese rücksichtslose Hinwendung zu einem Thema, und vermutlich war sie die erste Zeit ihres Beisammenseins mit Zemlinsky der Meinung, dass sie dieses eine Thema für ihn war, und das war ihr Irrtum.
„Das d-moll-Quartett hat Schubert nicht mehr hören können“, sagte Zemlinsky. „Es ist erst nach seinem Tod gespielt worden. Aber das hat ihn nicht gestört, alles hat in seinem Kopf stattgefunden, so hat er auch die falschen Töne der Musikanten nicht gehört.
Diese Kirchenglocken hab‘ ich das erste Mal begriffen, als die Busch einmal geübt haben – da hab ich zugehört – da haben sie diese Passage ganz langsam gespielt ganz lang sam – man hat jeden Ton gehört – die vielen komplizierten Intervalle – die sonst nur so vorbeisegeln – als Zuhörer kann man das gar nicht begreifen – im Konzert schon gar nicht – auch nicht die Spieler – außer wenn das ganz langsam gespielt wird – und bei diesem Busch-Quartett hat man plötzlich die Intervalle der Glocken gehört.
Glocken lassen sich ja grundsätzlich nicht rein stimmen – da sind immer irgendwelche dissonanten Obertöne drinnen – komische Intervalle physikalisch begründet – und diese Dissonanzen hat der Schubert natürlich als Musiker erkannt und in seiner Komposition simuliert.“
Musil hielt sein Glas immer noch in derselben Weise. Aber er nickte wenigstens. Zemlinsky nahm jetzt einen Schluck.
„Da entdeckt man ganz plötzlich etwas, das zweihundert Jahre versteckt war und jeder glaubt er kennt das eh. Aber das ist der große Irrtum. Niemand kennt irgendetwas. Wie in der Wissenschaft. In der Philosophie. Möglicherweise sogar in der Mathematik. Ein Wahnsinn, wie Schubert das komponiert hat. Nichts wissen wir. Gar nichts.“
Musil war außer sich. Schlick hatte es sich ganz bequem gemacht, die Fliege abgenommen, eine Sonnenbrille aufgesetzt. Noch einen Wein nachbestellt. Eine Sachertorte.
„Und da ist er da gesessen bei dieser Funzel von Lampe und Hunger hat er gehabt, wirklichen Hunger, war bettelarm und dann waren da draußen auch noch die Franzosen vor der Türe, die er in diesen langsamen Satz hineingepackt hat, in diesen langsamen Satz mit dem Uhren tick-tack. Daa-dada-daa-dada-daa-dada-daa-dada
Die Kriegsfanfare zusammen mit der Uhr. Hintereinander. Der Satz muss natürlich ganz im Rhythmus gespielt werden, der Rhythmus darf nicht wackeln, es muss ein Andante sein ohne die geringste Rhythmusverschiebung – weil die Uhr ja auch keine Verschiebung hat – alles auch ganz gleichmäßig. Wie beim Radetzkymarsch. Die Soldaten treten sich sonst auf die Fersen.“
Nun verschwanden die ersten Sonnenstrahlen bereits hinter dem Kamin an der grauen Feuermauer.
„Und da ist er bei dieser Funzel gesessen und von unten hat er die Fanfaren der Franzosen gehört, wie die über das Straßenpflaster durch die enge Straße gezogen sind. Die waren ja 1809 hier herinnen – wir haben Napoleon zwar bei Aspern geschlagen – aber das hat auch nichts genützt – denn sie sind gleich wieder dagewesen und die Uhr und die Fanfaren das alles ist in diesem Satz drinnen.
Es gibt in Paris keine Avenue Aspern weil die Unsrigen ihn in der Lobau bei Essling geschlagen haben. Aber eine Wagram gibt es, weil wir dann nachher gleich wieder eine auf den Kopf gekriegt haben bei Wagram. Ich weiß nicht, was die Franzosen an diesem Napoleon gefunden haben. Nach meinem Gefühl war er ein Verbrecher. Der Beethoven war ja begeistert von ihm. Die Eroica hat er ihm gewidmet Und dann hat er gemerkt, was der für ein Gauner war, krönen hat er sich lassen. Keine Komposition mehr für ihn.“
„Man kann sich kaum vorstellen“, sagte Schlick, „mit welcher Angst die Leute hier in Wien gelebt haben, während die Franzosen gewütet haben.“
Es war in der Tat ein Wunder gewesen, dass nebenher so viel entstanden war. Schubert und Beethoven waren nur zwei Beispiele davon. Jeder hatte in seiner abgeschlossenen Welt gelebt. Literatur. Philosophie. Musik... Beethoven hatte sich von Napoleon distanziert.
„Und diese Beklemmung hat der geniale, hungernde, armseligselige Schubert in diesen einen Satz gepackt“, sagte Schlick.
„Welche Rolle spielt eigentlich die Musik in Ihren Betrachtungen, Schlick?“, fragte Zemlinsky. Der Philosoph sollte eine kleine Chance kriegen, ein Thema, in die nicht enden wollende Coda von unerschöpflichen Phantasien des Komponisten einzustimmen. Aber dessen Gedanken waren bereits woanders. Schlick sah auf die Uhr.
„Wie war Ihr Tafelspitz, Musil, das Schnitzel, Zemlinsky?“ „Hervorragend.“
„Gehen wir zur Universität? Zemlinsky, wir könnten ein Stück gemeinsam gehen.“
Die Herren Schlick, Musil und Zemlinsky würden einander selbst nach Jahren der Trennung immer wieder irgendwo und in irgendeiner Rolle begegnen. Der Literat würde sich für einige Jahre in einem feudalen Winkel dieses Bezirks niederlassen mit direktem Blick auf das pompöse Palais eines russischen Fürsten, der ehemals einer der großzügigsten Gönner Beethovens gewesen war, weshalb ihm dieser drei seiner berühmtesten Streichquartette gewidmet hatte. Und Musil würde hier, inspiriert durch den Blick auf diesen prachtvollen Bau, an seinem gewaltigen Roman arbeiten, der ihn über viele Jahre hinweg beschäftigen und doch erst nach seinem Tod als das vollständigste literarische Fragment in die Weltliteratur eingehen würde. Der Philosoph Schlick würde auf den Lehrstuhl für Philosophie der hiesigen Universität berufen werden und in dieser Funktion einen bedeutenden philosophischen Zirkel gründen, die besten Naturwissenschaftler und Mathematiker um sich scharen und vor allem die Bekanntschaft eines niederösterreichischen Gärtners und Volksschullehrers machen. Etwa zwanzig Jahre nach diesem Zusammentreffen würde der Gärtner – und zufällig wiederum hier und damit nicht weit entfernt vom Schreibtisch des Schriftstellers, sozusagen ums Eck herum, wie die Wiener sagen – von seiner überaus wohlhabenden Schwester mit dem Entwurf eines stattlichen Wohnpalais für den Bezirk beauftragt werden, gleich hinter dem Palais des russischen Fürsten. Ein Unikat formaler Radikalität würde der Bau werden, konzipiert von stadtbekannten und respektgebietenden Künstlern und Architekten, welche zum Freundeskreis dieser bedeutenden Industriellen- und Mäzenatenfamilie gehörten. Das Objekt würde trotz seiner äußerlich abschreckenden architektonischen Schonungslosigkeit ein Eiland, das auch die entrücktesten Philosophen aus dem gnadenlosen Realteil der Stadt aufnehmen und mit einer beispiellosen Aura umgeben konnte. Der Gärtner würde alsbald Mitglied des philosophischen Zirkels geworden sein, ein international bekannter Philosoph und zudem Professor in Cambridge. Jeder der Herren hier im kleinen Schanigarten würde in diesem Wien der ehemaligen Donaumonarchie seinen Weg gehen. Dieser Weg würde durch die kausalen Strukturen ihres Lebens und durch die Strukturen der Leben aller anderen vorgegeben sein. Alle, die versuchen würden, die Geheimnisse dieser Strukturen zu ergründen, würden irgendwann Schiffbruch erleiden. Brutal und ohne Rücksichtnahme auf irgendwelche Wünsche und Befindlichkeiten würde das Schicksal seine Rechnung begleichen.
Vierzehn Jahre nach seinem Ruf an die Universität Wien, am Montag, dem 22. Juni 1936, dem Ende des Sommersemesters, würde Moritz Schlick auf dem Weg in seine wöchentliche Vorlesung auf der Feststiege der Aula vor zahlreichen Anwesenden aus nächster Nähe durch vier Schüsse getötet. Einer der Schüsse würde Schlick ins Herz treffen und ihn damit sofort töten.
Das Zentrum der Wahrheit
„Der Ehrenhof ist nur ein Eingeständnis unseres Unwissens.“
16. Juni 1904, am Nachmittag • 3. Bezirk und 1. Bezirk, vom Gasthaus des Königs zur Universität
Moritz Schlick und Robert Musil
Schlick und Musil gehen nach ihrem Essen im Gasthaus des Königs durch den Stadtpark und die Innenstadt zur Universität. Dort sprechen sie über Planck, Mach, Freud und Boltzmann. Schlick wird im Rahmen seiner Dissertation Planck in Berlin besuchen und will vorher mit Freud sprechen, der eine gute Verbindung zu Ernst Mach hat.
Die beiden Herren gingen vom Gasthaus des Königs vorbei am Palais Rasumofsky durch den Stadtpark zum Ring, dann über die Stubenbastei und die Wollzeile zum Stephansplatz und von dort durch die Herrengasse zur Universität.
Auf der Ringstraße war wie immer reges Treiben. Leute mit Eisstanitzeln in der Hand kamen aus der Meierei im Park, und wie immer im Sommer saßen selbst rheumatische Personen mit Zeitungen und Pfeifen bis in die Nacht hinein im Freien auf schmalen, harten Eisenstühlen. Der Stadtpark stellte sich zu dieser wunderbaren Jahreszeit wie ein Repräsentant des Schmelztiegels der Kulturen im Gemenge des Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn dar. Der Sommer vereinte im noch funktionierenden Kaiserreich alle politischen Strömungen in trauter Einigkeit.
Die Existenz von Stimmung neben Begrifflichkeit, die Harmonie von Verstand und Gefühl, das Nebeneinander von Traum und Wirklichkeit, Avantgarde und Barock, Prunk und Niedergang. Endzeitliche Antagonismen demonstrierten auf dieser beispiellosen Bühne die permanente Verwandlung einer scheinbar trägen Gesellschaft.
Als die beiden in der Herrengasse am Palais Ferstel vorbeigingen, erwähnte Schlick in einem auffallend kurzen Satz einen Leo Bronstein, der die Absicht geäußert haben sollte, in der nächsten Zeit in das habsburgische Wien zu emigrieren, weil ihm der Boden in Russland zu heiß geworden wäre. Tatsächlich sollte das Central bald das Stammcafe Trotzkis und der politisch links orientierten Wiener Gesellschaft werden. Die Gesellschaft im Bühnenteil von Wien war daran nicht interessiert. Sie war stets mit sich selbst beschäftigt. Mit ihrer Schönheit, ihren Kleidern, ihrem Ansehen, ihrer Geltung. Akademischer Staub war nicht ihr Metier.
Lew Dawidowitsch Bronstein, eine der schillerndsten Personen unter den marxistischen Theoretikern; später Volkskommissar des Auswärtigen Amts für Kriegswesen, Ernährung, Transport und Verlagswesen; Gründer und Organisator der Roten Armee; risikobereiter Abweichler von der sowjetischen Parteilinie des Marxismus-Leninismus; war von 1902 bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges gelegentlich in Wien. Er erschien regelmäßig zu Diskussionen und zum Schachspiel hier im Café Central. Zur Beschaffung von Geld zeigte er sich zudem oft in der Redaktion der Arbeiterzeitung in der Mariahilfer Straße und sogar in der Wohnung von Victor Adler, dem Begründer der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei.
Mit dem Blick auf die Votivkirche gerichtet, waren es nur noch ein paar Minuten zur Universität. Der Weg in das Gebäude führte über die rechte Rampe und dann nochmals rechts durch den Haupteingang in die Aula.
Mit wenigen Schritten war man im Zentrum der Weisheit. Links hinauf die Juristenstiege in den gleichnamigen Flügel. Symmetrisch zu ihr, rechts hinauf, die Philosophenstiege, vielen Studenten die Hoffnung auf ein neues Leben. Gerade nach vorne, an den Treppen vorbei, ging es hinaus in den Arkadenhof.
Der Philosophie und damit der Philosophischen Fakultät zugeordnet waren in dieser Universität die Naturwissenschaften. Wer, gleichgültig in welcher naturwissenschaftlichen Disziplin, promoviert werden wollte, hatte am Ende seines Studiums noch ein umfangreiches Philosophicum abzulegen, worin er beweisen musste, dass ihm während seines Studiums die Philosophie ebenso viel bedeutet hatte wie Physik, Chemie oder Mathematik. Letztere nahm hierbei eine besondere Stellung ein, denn sie hatte in der Tiefe mehr mit Philosophie zu tun als jede andere Wissenschaft. Und sicherlich stand sie ihr näher als der Physik oder der Chemie, zumal weder Philosophie noch Mathematik Naturwissenschaften waren, was nicht allen Philosophen gerecht wurde. Für den Naturwissenschaftler und Schriftsteller Musil schien die Aula eine Quelle der Inspiration zu sein, für den Philosophen Schlick lediglich der Durchgang zu seinem momentanen Arbeitsplatz.
Die Struktur der beiden Aufgänge zu den Gebäudeflügeln trug wesentlich zu jener Aura bei, die das ganze Gebäude beherrschte. An beiden Treppen waren da die großen Fenster zum Arkadenhof und am ersten kleineren Treppenabsatz jeweils vier große Beleuchtungskörper.
Sie öffneten die große Türe und gingen in den Hof hinaus. Die Ähnlichkeit mit dem Palazzo Farnese war verblüffend – auch da gab es die Büsten und Tafeln, welche den Hof zu einem Ort der Erinnerung machten. Jeder Besucher würde an den Stelen von Persönlichkeiten vorbeigehen, deren ganzes Sinnen und Trachten der Wahrheit gegolten hatte. Die in Stein Verewigten mussten, im Gegensatz zu den unzähligen Unverewigten und Namenlosen, zeit ihres Lebens unvergleichlich erfolgreicher gewesen sein in ihrem Bemühen, jenes rätselhafte Etwas zu finden, das sich bisher vehement einer Identifizierung und erst recht einer Kategorisierung entzogen hatte.
Für Musil stellte sich die Frage, wer bei der Annäherung an die Lösung dieses Rätsels, welches die Menschheit als ‚Wahrheit’ bezeichnete, den Erfolg quantifizierte. Und er fragte sich, wer festzustellen hatte, was nützlich und was gut für die Menschheit war, und wer dann das Recht oder gar die Pflicht hatte, zu bestimmen über den Einzug in diese Stätte. So kam er stillschweigend zu dem Ergebnis, dass der Hof mit seinen toten Statuen ein Eingeständnis des menschlichen Nichtwissens war.
Mit dieser inneren Erkenntnis, die er seinem Begleiter nicht mitteilte, betrat Musil wiederum die Aula, wobei er die Stille in der hohen Halle als eine ganz andere, eine lebendige empfand, im Gegensatz zur beklemmend leblosen, die im Hof geherrscht hatte. Sie schritten über die Philosophenstiege nach oben. Die Anlage der Treppe war perfekt wie in allen Palais der Stadt. Die Proportionen der Stufen unterstützten – falls es die Situation erforderte – das bedächtige Emporschreiten vornehmer Damen und ihrer galanten Begleiter, wobei Zuschauer am Treppenrand sich sattsehen mochten am seidigen Schimmer vorbeischwebender Kleider, funkelnder Diademe und schlanker Fesseln. Den Damen an der Flanke entging wohl kein noch so geringer Makel an Kleid oder Trägerin, und nach Abschluss der Veranstaltung konnten sie neidvoll feststellen, schuldlos gewesen zu sein an ihrer eigenen demütigenden Passivität und nun das Recht zu haben, die inadäquate gesellschaftliche Position ihres Begleiters zu kritisieren.
Auf der rechten Seite jenes ersten, des kleineren Treppenabsatzes wandte sich Musil zu Schlick, dem ein beängstigender Seufzer entglitt:
„Weg mit der ganzen Philosophie!“
Die Anklage hatte eine solch überraschende Wucht, dass Musil sich des Fehlens einer dritten Person versichern musste. Der Satz passte nicht zur Noblesse des Philosophen, der zwei Stufen schräg oberhalb stand. Das war nicht Schlick! Wahrscheinlich hatte er nur eine Metapher ausgesprochen, ein Zitat aus irgendeinem seiner Bücher oder eine Assoziation an ein besonderes Begebnis. Oder war es eine psychische Störung. Die kurze und gnadenlose Formulierung ließ den Schriftsteller erschauern, es durchzuckte ihn eine Verkrampfung und machte ihm das Weitergehen unmöglich. Schlick indes kümmerte dies alles nicht, er lief in Eile die Treppe empor.
Musil drehte sich langsam wie unter Zwang nach rechts, als ob er ahnte, was drei Jahrzehnte später an dieser Stelle geschehen würde.
Ein ehemaliger Student Schlicks, Dr. Johann Nelböck, wird den Philosophen am 22. Juni 1936 inmitten der Universität Wien auf dem ersten unteren Absatz der Philosophenstiege mit vier Kugeln aus einer Browning Marke Klinger 6,35 kurz vor Beginn der Vorlesung und dem Betreten des überfüllten Hörsaals 41 töten.
Der Philosoph hatte inzwischen den zweiten und dann den dritten Teil der Treppe durchmessen. Er hörte am Schritt von Musil, dass ihm dieser wieder folgte, nahm sein Tempo geringfügig zurück und holte auf den letzten Stufen die Schlüssel zum Besprechungszimmer aus der Jackentasche. Musil war inzwischen an ihn herangekommen.
Schlick öffnete die innere Türe des zweiten Zimmers auf der linken Seite des Quergangs. Es war, wie alle Zimmer der Philosophen, doppelt gesichert, offenbar um keine Erkenntnisse vor ihrer definitiven Klärung nach außen an die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Jetzt öffnete er die zweite Tür und trat ein in den typischen Geruch von Fußbodenöl und antikem Mobiliar. Gegenüber waren drei Doppelfenster, mit Haken fixiert, damit die Laden bei Wind nicht klapperten. Durch die geschlossenen Jalousien fiel nur ein schmaler Lichtstrahl. Schlick schaltete die Tischlampe an und machte eine Notiz in seinem Kalender.
„Musil, bitte nehmen Sie Platz. Möchten Sie einen Cognac, es sollte noch einer da sein.“ Musil nahm das Angebot dankend an.
„Wir haben Zeit bis etwa acht, dann muss ich mich noch auf die Besprechung mit Planck vorbereiten, ich kann nicht alle Bücher nach Berlin mitnehmen, die ich dafür brauche, muss noch einige raussuchen. Ich bin zwar schon fast fertig damit, aber irgendwas ist immer wieder unklar. Das fällt einem erst dann auf, wenn man schon unterwegs ist.“
Er goss Musil und sich selbst ein. Schlick war kurz vor seinem Physik-Rigorosum und stand zeitlich unter Druck. Wegen einiger wichtiger Unterlagen war er extra von Berlin nach Wien gereist, und auch um ein paar Freunde zu Gesprächen zu treffen. „Ich muss Ende nächster Woche zu Planck, vorher noch nach Lausanne und Heidelberg. Planck hat vor vier Jahren die Strahlungsformel entdeckt, das war sensationell, Sie wissen es sicherlich. Es wird ungeheure Konsequenzen für die Physik haben, ich fühle das. Was machen Sie nächste Woche am Mittwoch? Da könnten wir darüber sprechen. Falls es Sie interessiert. Ich bin nächste Woche am Mittwoch noch einmal kurz bei Freud.“
Schlick hatte einen Termin beim Psychotherapeuten, aber keineswegs zur eigenen Behandlung, wie Musil einen Augenblick dachte. Unter anderem interessierten ihn die Traumdeutungen, wie Schlick sagte, an denen Freud gemeinsam mit Carl Gustav Jung arbeitete. Aus Schlicks Sicht war schon Plancks Erkenntnis ein Motiv, sich nachher wieder zu treffen, aber auch die Arbeiten von Freud natürlich. Zwei diametrale Themen, meinte er.
„Ich kann gerne vor dem Haus auf Sie warten, bis Sie fertig sind. Wenn Sie wollen.“
„Ich denke, wir werden um etwa 17 Uhr fertig sein. Ich möchte mit ihm etwas über die Traumdeutung besprechen, das ist ein interessantes Gebiet, obwohl ich bei manchen Dingen durchaus meine Zweifel habe. Sie können auch in die Praxis kommen und dort auf mich warten.
Da ist noch eine Sache mit Mach. Der ist ein hervorragender Naturphilosoph und hat ein gewaltiges Wissen. Philosophie hat ja aus meiner Sicht nur dann einen Sinn, wenn ein Hintergrund vorhanden ist. Ein naturwissenschaftlicher Hintergrund. Man muss die Aussagen der Naturwissenschaften kennen und sich vor allem mit der Logik befassen, sonst kann man nicht vernünftig philosophieren Bevor man damit beginnt, muss man eine Ahnung haben, wie die Welt funktioniert. Ich kann nicht sagen ‚wirklich funktioniert’, das wäre eine Anmaßung. Erst nachdem man sich intensiv mit den objektiven Elementen der Welt beschäftigt hat, sollte man philosophieren, alles andere wäre Unfug.
Nur Vermutungen anzustellen ist zu wenig, obwohl es nicht wenige Philosophen gibt, denen das genügt. Die reden dann um den heißen Brei herum, formulieren Tautologien, und irgendwann sind sie wieder am Anfang. Wir hatten da einen in Berlin, der machte auf einer langen Tafel einen langen Pfeil: links schrieb er ‚IST’ und rechts ‚SEIN’, und dann redete er eine Stunde darüber, und am Schluss fragten wir uns, was er uns sagen wollte. Niemand hatte etwas verstanden. Unter Wirklichkeit, also dieses IST, verstehe ich wie etwas wirkt und sonst nichts. Wenn es nicht wirkt, IST es nicht.
Nur wenn etwas eine Wirkung hat, wenn es etwas anderes verändert, dann IST es. Aber ein stationäres IST, etwas, das nur an sich ist, kann ich nicht begreifen. Und da kommt erstmal der Planck ins Spiel. Planck ist ein anderer Ansprechpartner als Mach, vielleicht nicht gerade ein typisch philosophischer, aber ein Analyst ersten Ranges. Seit seiner Entdeckung ist klar, dass Energie nur in Form diskreter Objekte daherkommt, da gibt es keinen Zweifel mehr, jedenfalls unter seinen Kollegen nicht. Paradoxerweise hatte er selbst massive Akzeptanzprobleme mit der Quantisierung der Masse und erst recht mit seiner Quantisierung der Energie.
Der Mach bläst eigentlich ins selbe Horn, er ist ein kritischer Geist, aber er wird nicht verhindern können, dass die neuen Erkenntnisse von Planck die Philosophie auf eine harte Probe stellen, und deshalb möchte ich meine guten Beziehungen zu Planck für eine Diskussion nutzen, solange ich noch an dieser Dissertation bei ihm arbeite. Wie gesagt, die Physik wird durch seine Erkenntnis einen ungeheuren Impuls bekommen.“
Schlick wollte Musil an dieser Stelle nicht gleich erzählen, dass er Freud bitten wollte, einen Kontakt zu Mach herzustellen, denn Machs Lehrstuhl würde über kurz oder lang frei werden, und Schlick war an diesem Lehrstuhl außerordentlich interessiert. Schon weil sich hier eine Verbindung der Philosophie mit den Naturwissenschaften würde herstellen lassen. Doch war es eben noch nicht so weit.
„Übrigens hat es einen Grund, weshalb viele Physiker in späten Jahren zu philosophieren beginnen. Musil, wir sind noch jung, und auch wenn wir klar denken können, brauchen wir viele Gesprächspartner und ebenso viele Meinungen. Und wir brauchen die Übersicht über das Ganze, und diese lässt sich nicht lehren und nicht lernen. Man muss sie erleben.“
Schlick wirkte trotz seiner Jugend reif, jetzt aber nervös und angespannt.
Musil erinnerte sich und konnte nicht umhin zu betonen, dass Mach komische Bemerkungen zur Atomistik gemacht hätte, wie er es bezeichnete, und dass er seiner Meinung nach insbesondere Boltzmann treffen wollte.