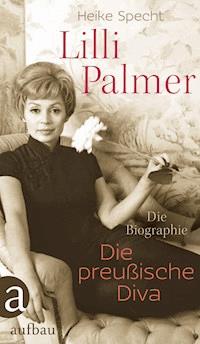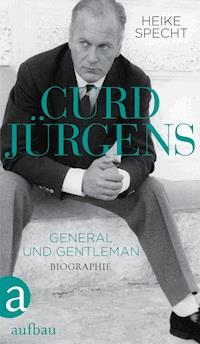11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ohne Frauen fehlt die Hälfte Simone Veil, Margaret Thatcher, Angela Merkel, Kamala Harris: Sie alle eroberten ihren Platz in einer Männerwelt und veränderten sie Stück für Stück. Das Buch führt uns zu diesen und vielen anderen Ersten ihrer Art. Es zeigt nicht nur, was fehlt, wenn Frauen nicht mit am Tisch sitzen, sondern auch wie sie in den letzten hundert Jahren gegen Widerstände an die Spitze gelangten und neue Themen setzten. Die Autorin hat viele Erste interviewt und akribisch recherchiert. Sie belegt, dass die Kämpfe noch nicht ausgefochten sind: Die Hälfte der Menschheit hat noch längst nicht die Hälfte der Macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Éloïse
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: ullstein bild – Hans G.Lehmann (Ulrike Meinhof); John Minihan/Freier Fotograf/Getty Images (Margaret Thatcher); ullstein bild – ullstein bild (Louise Schröder); Helene Bamberger/Opale/Bridgeman Images (Simone Veil); ullstein bild – Marlene Gawrisch/WELT (Aminata Touré); Pool/Getty Images (Angela Merkel)
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Motto
Einleitung
1 Die Systemrelevanten
Geistiges Vorwärtskommen
Schwestern, zur Sonne, zur Freiheit
Frauenwille siegt
Wider die Diktatur des Mannes
Frau Oberbürgermeister
Die Grandes Dames bauen auf
2 Justitia ist eine Frau
Selbert greift ein
Die Fragen des Lebens
Der weiße Rabe
Die Kronjuwelen des Patriarchats
»Ich widerspreche«
3 Parteisoldatinnen
Mit der Partei verheiratet
»… deshalb darf die Stimme der Frauen nicht fehlen«
Frau Bundestagspräsidentin
Käte klärt auf
Königin – Schreckschraube – Hexe
4 Wider die erstarrte Gesellschaft
Die Aktivistin
Eine Frau ist keine Insel
Die Emanzipation der Mütter
Wegscheide
»Weibersache«
Staatsfeindin
Die Eidgenossinnen verlieren die Geduld
Die Welt verändern
5 Die neuen Frauen
Eine Frau macht Ernst
Der lange Marsch der Emanzipation und die Rache der Genossen
»Und Damen!«
Innere Freiheit
Die Ökofeministin
»Mein eigener Maßstab«
Macht
6 Einsame Spitze
Fremdkörper
Politik in Zeiten der Pandemie
One’s own woman
Paragraf 218 und kein Ende
Mutgemeinschaft
Double Standard
»Ein weiblicher Söder«
7 Anführerinnen der freien Welt
Die Unterschätzten
Eiserne Lady
Macherin des Machbaren
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
Europa ist eine Frau
8 Mut statt Demut
Ungemütliche Frauen
Wenn Frauen führen
Die neuen Ersten
Dank
Abbildungsnachweis
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
»You can’t be what you can’t see.«
Marian Wright Edelman
Einleitung
»Mr. Vice President, I’m speaking«, die Kandidatin im dunkelblauen Blazer mit US-Flagge am Revers hebt mahnend die Hand, blickt nur einmal knapp und kühl in Richtung ihres Konkurrenten, der sie in dieser Vizepräsidentschaftsdebatte im Herbst 2020 in Utah erneut unterbrochen hat, und wiederholt dann noch einmal nachdrücklich: »I’m speaking!«
»Jetzt rede ich!« – Unzählige Frauen daheim vor den Bildschirmen konnten sich spätestens zu diesem Zeitpunkt problemlos mit Kamala Harris identifizieren. Nahezu jede von ihnen hatte das schon erlebt, im Büro, bei einem Meeting, bei einem Arzttermin, in geselliger Runde. Ein Mann unterbricht, belehrt, macht das von ihr Gesagte lächerlich oder redet es klein. Und nahezu jede steckte schon mal in dem Dilemma: Wie adäquat reagieren? Wie sich zur Wehr setzen, ohne entweder aggressiv und zornig zu wirken oder, genauso fatal, hilflos und überfordert? Mit einiger Genugtuung beobachteten Frauen weltweit an diesem Abend, wie souverän die Vizepräsidentschaftskandidatin der Demokraten dem amtierenden Vizepräsidenten von den Republikanern Paroli bot – mit Ruhe und Entschiedenheit ließ sie den quengelnden Mike Pence lächelnd auflaufen.
Harris gewann diese TV-Debatte, da waren sich Beobachter*innen hinterher ziemlich einig. Und sie gewann wenig später zusammen mit Joe Biden auch die Präsidentschaftswahlen. Aber während Joe Biden der 46. Mann in einer Liste von 45 weißen und einem Schwarzen Präsidenten war, zog Kamala Harris im Januar 2021 als eine Erste ins Weiße Haus: Sie ist nicht nur die erste Vizepräsidentin, sondern auch die erste mit jamaikanisch-indischen Wurzeln. Sieht man sich die Porträtgalerie ihrer ernst und wichtig dreinblickenden 48 Vorgänger an, so stellt man fest, dass es in 230 Jahren zwar fünf Johns, drei Thomasse und drei Charles’ gab, aber keine einzige Frau. Sicher, ein bisschen Variation lässt sich beim Anblick der honorigen Herren schon konstatieren, schließlich änderten sich Moden und Trends innerhalb der letzten Jahrhunderte, so waren manche der Amtsvorgänger glatt rasiert, andere wiederum trugen Backen-, wieder andere einen rauschenden Vollbart und selbstverständlich gab es auch die Moustache-Fraktion. Die frühen Herren waren angetan mit Musselinhemd mit steifem »Vatermörder« und Gehrock, spätere bevorzugten Jackett, dazu Hemd und Fliege, und die modernen Vizepräsidenten griffen zu dunklem Anzug und Krawatte.
[1] Kamala Harris bei der Vereidigung zur ersten Vizepräsidentin der USA am 20. Januar 2021 und ihr Ehemann Douglas Emhoff, der erste Second Gentleman des Landes.
Allen bisherigen Vizepräsidenten aber war gemeinsam gewesen, dass sie Männer waren. Weiße Männer. Allen, bis zu Kamala Harris. Plötzlich vollendete die Reihe der VP-Porträts das Bild einer Frau mit brauner Haut und schwarzen, schulterlangen Haaren, mit Hosenanzug und wahlweise High Heels oder bunten Chucks. Es kursierten Fotos von Harris als kleinem Mädchen mit dunklem Lockenkopf oder geflochtenen Zöpfen, Abbildungen mit ihr und ihrer aus Madras stammenden Mutter, die einen Sari trägt, und Fotos der erwachsenen Harris mit ihrer Patchworkfamilie.
Vielfach in ihrem Leben und in ihrer beruflichen Karriere, so Harris, sei sie in Räume gekommen, in denen sie niemand fand, der oder die aussah wie sie selbst. Mit dieser Feststellung spricht die Politikerin den springenden Punkt an, der uns in diesem Buch beschäftigen wird: Die Erste sein – das ist natürlich verbunden mit einem Erfolgserlebnis, mit Triumph, mit einem weiteren beachtlichen Loch in der gläsernen Decke, es ist aber vor allem auch ein Kraftakt. Während ihre Vorgänger im Weißen Haus aussahen, sprachen und sich verhielten wie Dutzende der Herren, die dieses Amt bereits innegehabt hatten, sticht Harris heraus. Die Erste sein heißt aufzufallen, nicht reinzupassen, keine Vorbilder zur Nachahmung zu haben. Es heißt auch, dass es keine ausgetretenen Pfade gibt, vielmehr gilt es, sich erst einen Weg freizuschlagen und Neuland zu erobern. Und schließlich heißt es, sich permanent rechtfertigen zu müssen. Ein Anzug tragender Mann in fortgeschrittenem Alter muss kaum jemandem auseinandersetzen, warum er diesen oder jenen Job möchte, dieses oder jenes Amt anstrebt. »Obrigkeit ist männlich. Das ist ein Satz, der sich eigentlich von selbst versteht«, schrieb der sächsische Historiker, Antisemit und Frauenfeind Heinrich von Treitschke Ende des 19. Jahrhunderts, und bis zum heutigen Tag machen Politikerinnen, Funktionärinnen, generell Frauen, die für diesen oder jenen Posten die Hand heben, die Erfahrung, dass ihr Engagement erklärungsbedürftig ist. Unser mentales kulturelles Modell einer mächtigen Person, so die Historikerin Mary Beard, sei weiterhin eindeutig männlich.[1] Frauen, die Machtanspruch erheben, sind noch immer suspekt. Wieder und wieder, so Hillary Clinton, sei sie 2016 gefragt worden, warum sie Präsidentin werden wolle: »Why? But, really – why?« Die klare Implikation von derlei Fragen war, dass irgendetwas nicht stimmen könne mit ihr, dass ihrer Kandidatur etwas anderes zugrunde liegen müsse, ein unerklärlicher, fast widernatürlicher Machthunger. Niemand, so Clinton, habe dagegen Bernie Sanders oder Ted Cruz einer Psychoanalyse unterzogen. Die Tatsache, dass diese Herren ins Rennen um das höchste Amt gingen, wurde als völlig normal betrachtet.[2]
Männliche Herrschaft, so der französische Soziologe Pierre Bourdieu, sei deswegen so dominant, weil sie der Rechtfertigung nicht bedürfe.[3] Es verlangt einer Frau also viel ab, Erste zu sein. Neben all dem Engagement, dem Durchhaltevermögen und der Arbeit, die ohnehin nötig sind, um eine außergewöhnliche Karriere zu machen, müssen es die Ersten zusätzlich aushalten, dass ihre schiere Gegenwart in diesem oder jenem Umfeld, ihre bloße Existenz auf diesem oder jenem Posten unentwegt infrage gestellt wird. Die Anforderungen also an Frauen, dorthin zu gelangen, wo Männer seit Jahrhunderten ganz selbstverständlich agieren – an die Schaltstellen der Macht –, waren und sind zum Teil noch heute enorm. Um es mit den Worten der US-amerikanischen Politikerin Faith Whittlesey zu sagen: »Ginger Rogers tat nichts anderes als Fred Astaire, aber sie tat es rückwärts und mit High Heels.«
Die Ersten ihrer Art widmet sich den ersten Frauen, die in den letzten gut hundert Jahren in Männerdomänen einbrachen, aufstiegen, Posten und Ämter einnahmen. Es geht um Frauen – vor allem um Politikerinnen, aber auch um Juristinnen, Journalistinnen, Bischöfinnen, Künstlerinnen und, ja, auch um eine Terroristin –, die ihren Platz am Tisch der Macht eroberten. Nach dem Ersten Weltkrieg erhielten Frauen in mehr und mehr Ländern der westlichen Welt das aktive und passive Wahlrecht. Seit sich rund fünftausend Jahre zuvor patriarchale Strukturen durchgesetzt hatten, konnte nun erstmals die weibliche Hälfte der Menschheit in der Masse politisch und gesellschaftlich Einfluss nehmen, zu dieser Zeit wurde für sie auch der Weg frei in die Verwaltung, an die Universitäten und in die Gerichtssäle.[4]
Sicher hat es in der überlieferten Geschichte immer wieder mächtige Frauen gegeben, von der ägyptischen Königin Hatschepsut über Elizabeth I. von England bis zur Habsburgerin Maria Theresia, doch diese Herrscherinnen waren eben genau das – HERRscherinnen. Sie blieben Ausnahmen, die die Regel bestätigten. Das patriarchale System sollte durch sie nicht angetastet werden, und so ließ sich die mächtige Hatschepsut mit dem pharaonischen Knebelbart abbilden und Elizabeth I. wurde als Kriegerkönigin in Rüstung und zu Pferde mystifiziert. »Politisch«, so die Maria-Theresia-Biografin Barbara Stollberg-Rilinger, »galt Maria Theresia als Mann«. Die Regentin hörte auf, eine Frau zu sein, sobald sie den Thron bestieg.[5] Auch wenn diese Herrscherinnen natürlich trotz der nach außen an den Tag gelegten männlichen Machtinszenierung auf dem Thron Frauen blieben – ein Fakt, der gerade bei Maria Theresia als Mutter von sechzehn Kindern, kaum übersehen werden konnte –, machten sie nicht dezidiert als Frauen und schon gar nicht für Frauen Politik.
Erst im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert wurden mit dem Streben nach Nationalstaat, Menschenrechten, Verfassung und Demokratie auch Stimmen laut, die eine staatsbürgerliche Gleichstellung der Frau forderten. In den USA, Großbritannien und auch in Deutschland wurden Frauenvereine gegründet, 1865 etwa der Allgemeine Deutsche Frauenverein unter der Führung von Louise Otto-Peters und Auguste Schmidt oder 1866 der unter der Schirmherrschaft von Kronprinzessin Victoria stehende Berliner Lette-Verein. In England kämpften Suffragetten zum Teil mit Guerilla-Methoden um das Recht auf politische Mitbestimmung. In Deutschland forderten mutige Frauenrechtlerinnen und Publizistinnen wie Hedwig Dohm, Helene Lange, Anita Augspurg oder Minna Cauer bessere Bildung für Mädchen, das Recht auf weibliche Erwerbstätigkeit und das Frauenwahlrecht. In diesen Jahren zeigte sich außerdem eindrucksvoll, dass die Arbeiterbewegung eben auch eine Arbeiterinnenbewegung war. Sozialistinnen wie Marie Juchacz und Kommunistinnen wie Clara Zetkin kämpften für gleiche Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und wirksamen Mutterschutz. Die soziale Frage und deren Lösung brannte vielen Frauen – bürgerlichen wie sozialistisch gesinnten – unter den Nägeln, soziale Berufe entstanden, und Reformerinnen wie Alice Salomon waren federführend an der Professionalisierung der Sozialarbeit beteiligt. Neben dem Kampf für fairere und sicherere Arbeitsbedingungen rückte der häusliche Bereich in den Fokus. Die Idee kam auf, dass auch Gesundheit, Hygiene und Erziehung politisch waren. Und es waren vor allem Reformerinnen, die diese Idee trugen. Der Aufbruch der Frauen war weltweit vermutlich der wichtigste Emanzipationsprozess in der Reformzeit um 1900, konstatiert die Historikerin Hedwig Richter.[6]
Warum aber wird die umwälzende Veränderung, die diese frühen Frauen in Gang gesetzt haben und die dann von all den Ersten, denen wir in diesem Buch begegnen, auf die eine oder andere Art fortgesetzt wurde, bis heute vielfach nicht als bahnbrechend wahrgenommen? Sicher, die Frauen veranstalteten keine dröhnenden Aufmärsche, sie schwangen keine Fahnen und schrien: »Es lebe die Revolution!«, äußerst selten legten sie die Arbeit nieder und streikten. Im Gegenteil, sie krempelten die Ärmel hoch und machten sich ans Werk. Sie griffen, von einzelnen militanten Suffragetten einmal abgesehen, nicht zu Pistolen und Gewehren, ihre Waffen waren der gespitzte Bleistift, die Schreibmaschine, das geschliffene Wort, ihre Rüstung waren Krankenschwesternschürzen, Richterinnenroben, die Aktentasche der Sozialarbeiterin, das Dossier der Parlamentarierin.
Vielleicht wird der Einfluss, den Frauen auf unsere Gesellschaften in den letzten hundert Jahren nahmen und nehmen, in der Geschichtsschreibung und politischen Berichterstattung so oft übersehen, weil ihr Kampf so gänzlich unmartialisch ausgefochten wurde und wird, weil so wenig Triumphgeheul im Spiel ist, so wenig brennende Barrikaden. Unser Fokus auf Revolutionen, die stets als etwas durch und durch Männliches wahrgenommen wurden, verstellen uns den Blick auf die große, aber langwierige und meist wenig glamouröse Reformarbeit der Frauen.[7] Hinzu kommt, dass die Themen und Anliegen der Frauen über Jahrzehnte kleingeredet und marginalisiert wurden. »Frauenpolitik«, das galt vielen als ein kleiner Garten ganz am Rande der großen, wichtigen Politik, den ein paar emsige Damen beackern durften. Tatsächlich aber, auch das wird in den folgenden Kapiteln deutlich, haben Frauen in den letzten hundert Jahren Weichen gestellt und Akzente gesetzt, die unseren Gesellschaften erst jenes Antlitz gaben, das wir heute kennen. Viele ihrer Ziele – Geschlechtergerechtigkeit, wertschätzende Erziehung, Bildungsgerechtigkeit, Ehe als Partnerschaft und Ehe für alle, Gesundheitsschutz, körperliche Selbstbestimmung – haben unser Leben stärker geprägt als so manche viel diskutierte außen- oder sicherheitspolitische Entscheidung.
Das, was jahrzehntelang als »Frauenpolitik« verniedlicht wurde, ist in Wahrheit wirkmächtige Gesellschaftspolitik. Und dennoch konnte noch in den 1970er-Jahren der französische Premierminister Jacques Chirac seiner Gesundheitsministerin Simone Veil entgegenhalten, Abtreibung sei »Weibersache«, und selbst in den späten 1990er-Jahren nannte der deutsche Kanzler Gerhard Schröder das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend schlicht »Familie und das ganze Gedöns«. Lange Jahre wurde die »Frauenpolitik« auch als Abstellgleis für Politikerinnen betrachtet und die eine oder andere potenzielle Konkurrentin auf diese Weise aus dem Weg geschafft. Nach dem Einzug in die Parlamente dauerte es viele Jahrzehnte, bis Politikerinnen erstmals sogenannte »klassische« Ressorts übernahmen beziehungsweise das, was Männer dafür hielten: das Justiz-, Finanz-, Verteidigungs- oder Innenressort etwa. 1992 wurde Sabine Leutheusser-Schnarrenberger die erste deutsche Justizministerin, 2007 übernahm Christine Lagarde als erste Frau das französische Finanzministerium, 2021 bekamen die USA mit Janet Yellen ihre erste weibliche Secretary of the Treasury, und im selben Jahr wurden Annalena Baerbock und Nancy Faeser Deutschlands erste Außen- bzw. Innenministerin.
Nur nach und nach also konnten Frauen damit beginnen, ihre Perspektiven in das einzuspeisen, was lange als »allgemeine« Politik verstanden worden war, was tatsächlich vielfach aber eben »Männerpolitik« war. Und tatsächlich gibt es bis heute noch immer Erste. Deswegen reicht dieses Buch auch ganz bewusst bis in die unmittelbare Gegenwart. All die Ersten aber, die in den letzten hundert Jahren in die Parlamente und Amtsstuben, Gerichtssäle und Redaktionen eingezogen sind und die Welt veränderten, auch das sei betont, stehen auf den Schultern von Gigantinnen: Von der Pariserin Olympe de Gouges, die während der Französischen Revolution die damals ungeheuerliche Meinung vertrat, Menschenrechte seien auch Frauenrechte; über die Engländerin Mary Wollstonecraft, die mit ihrem 1792 erschienenen Buch A Vindication of the Rights of Woman auf das Recht der Frauen auf Bildung pochte und damit ein erstes feministisches Manifest vorlegte; über Sojourner Truth, die als ehemalige Sklavin in den USA ihren Kampf gegen die Sklaverei mit dem Kampf um Frauenrechte verband; bis zu den bereits erwähnten deutschen Frauenrechtlerinnen und vielen mehr.
Sämtliche Ersten, die uns in diesem Buch begegnen, brachten Aspekte und Themen ein, die die herrschenden Männer zuvor jahrzehnte-, zuweilen jahrhundertelang einfach nicht auf dem Schirm gehabt hatten. Wenn heute zu Recht Frauenquoten und vielfach auch Parität gefordert wird, halten vor allem Männer häufig dagegen, dass in einer repräsentativen Demokratie Abgeordnete das ganze Volk vertreten sollen und das Parlament eben keine Ständevertretung sei. Das stimmt schon. Aber erstens stellen Frauen die Hälfte der Menschheit dar, sie sind keine Minorität, keine Kaste oder soziale Schicht, keine spezielle Sondergruppe mit Partikularinteressen. Und zweitens muss man mit Blick auf die Geschichte leider sagen, dass die Interessen und Rechte von Frauen oft erst dann ausreichend berücksichtigt wurden, als sie auch in den entsprechenden staatlichen Organen vertreten waren. Es war mit Louise Schroeder eben eine der ersten Parlamentarierinnen, die in der Weimarer Republik den Mutterschutz durchsetzte. Es war in der Geburtsstunde der Bundesrepublik Elisabeth Selbert und nicht einer der 61 Männer im Parlamentarischen Rat, die die Formulierung »Männer und Frauen sind gleichberechtigt« im Grundgesetz verankerte. Es war Erna Scheffler und keiner ihrer männlichen Kollegen am Bundesverfassungsgericht, die dem väterlichen Stichentscheid den Todesstoß verpasste und der patriarchalen Familie damit einen empfindlichen Schlag beibrachte. Es war mit Gesundheitsministerin Simone Veil eine Frau, die Abtreibung in Frankreich endlich aus der Illegalität rausholte. Und es war schließlich ein überfraktionelles Bündnis von Parlamentarierinnen im Bundestag, das dafür sorgte, dass Vergewaltigung in der Ehe zur Straftat wurde.
Wenn heute also Parität gefordert wird, so soll diese für mehr Pluralität, für mehr politische Teilhabe und eine gerechtere Verteilung der Macht sorgen. In der Politik, aber auch im Recht, im Journalismus, in der Literatur, im Film und in vielen anderen Bereichen unseres Lebens fehlt die Hälfte, wenn Frauen nicht mit am Tisch sitzen. Die italienische Schauspielerin Anna Magnani brachte es auf den Punkt: »Die Phantasie der Männer reicht bei weitem nicht aus, um die Realität Frau zu begreifen.« Dass der weibliche Blick aber noch immer als eine Abweichung von der Norm betrachtet wird, zeigt sich daran, dass es Etiketten wie »Frauenliteratur«[8], »Frauenfilm« oder eben »Frauenpolitik« gibt, wohingegen Bücher von Männern einfach Literatur sind, Filme von Männern häufig als großes Kino betrachtet werden und Politik von Männern schlicht Politik ist. Der weiße, heterosexuelle Mann, so noch immer vielfach die Auffassung, ist das Basismodell des Menschen.[9] Alle anderen, auch die Frauen, sind mehr oder weniger exotische Sondermodelle. Wenn Männer ihre Argumente vortragen, ihre Geschichten erzählen – egal, ob in der Politik, in einem Zeitungskommentar, in einem Roman oder Film –, gelten diese als universell. Und mit genau diesem Impetus und dieser Selbstverständlichkeit – dass eben ihre Perspektive die allgemein gültige ist – tragen die Herren seit Jahrhunderten ihre Betrachtungen und Thesen vor, während Themen, die das Leben und den Alltag von Frauen betreffen, vielfach banalisiert und marginalisiert werden.
An vermeintlichen Selbstverständlichkeiten zu rütteln, ist mühsam. Aber genau das taten und tun die Ersten ihrer Art durch ihre bloße Existenz. Und wenn wir auf die letzten hundert Jahre schauen, haben sie durchaus beachtliche Erfolge zu verbuchen. Herausragende Spitzenpolitikerinnen haben die Gesellschaften, in denen sie wirkten und wirken, dauerhaft geprägt – von Tel Aviv über London, Berlin, Brüssel und Washington bis Buenos Aires, Monrovia und Wellington. Manche dieser Frauen – Golda Meir mit Zigarette in der Hand etwa, Margaret Thatcher mit Perlenkette und Handtasche, Angela Merkel, die Raute formend, oder auch die trauernde Jacinda Ardern mit schwarzem Kopftuch nach dem Terrorangriff auf zwei Moscheen in Christchurch – sind zu wahren Ikonen geworden. Aber Vorsicht: Der Hinweis auf diese Ersten dient zuweilen als Ausrede, um nötige strukturelle Veränderungen auszubremsen. Wenn diese Frauen es geschafft haben, dann sei der Weg doch prinzipiell frei, so die Behauptung. Aber eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Die Präsenz von Frauen auf ehemals genuin männlichem Territorium ist in den letzten hundert Jahren sicht- und hörbarer geworden. Seit mit Margaret Thatcher 1979 die erste Frau Regierungschefin eines westlichen Industriestaates wurde, übernehmen regelmäßig Politikerinnen in aller Welt den Posten der Premierministerin, der Kanzlerin, der Präsidentin – auch wenn sie immer noch weit in der Minderheit sind. Der Frauenanteil unter den Abgeordneten stieg in den letzten Jahrzehnten seit Ende des Zweiten Weltkriegs kontinuierlich und kommt erst in jüngerer Zeit durch den Einzug rechter Parteien in die Parlamente ins Stocken. Auch die Zahl von Autorinnen, Regisseurinnen, Professorinnen, Chefredakteurinnen und Verfassungsrichterinnen wuchs in den letzten Jahrzehnten, ja selbst in immer mehr Unternehmensvorständen und Aufsichtsräten sitzt inzwischen die eine oder andere Frau. Aber mit dem Zugewinn an weiblichem Einfluss und weiblicher Macht verstärkt sich auch die Gegenreaktion. Je präsenter Frauen werden, desto krasser werden die misogynen Angriffe jener Männer, die mit dieser Moderne nicht umgehen können oder wollen. Gerade in den letzten Jahren ist vor allem auf Social-Media-Plattformen ein erschütterndes Ausmaß an Frauenfeindlichkeit zu verzeichnen. Frauen werden überdurchschnittlich häufig Opfer von Hasskommentaren und Beleidigungen bis hin zu konkreter Androhung von Gewalt.
Noch immer ist in der öffentlichen Debatte außerdem ein deutlicher Double Standard zu beobachten, oder wie Hildegard Knef einmal sagte: »Brüllt ein Mann, ist er dynamisch. Brüllt eine Frau, ist sie hysterisch.« Was bei Männern als engagiert, führungsstark und leidenschaftlich gilt, wird Frauen allzu oft als überehrgeizig, übereifrig und schrill ausgelegt. Frauen sind entweder zu emotional oder zu kaltherzig, sie sind die graue Maus oder die männermordende Schwarze Witwe, die sorgende Mutti oder berechnende Karrierefrau. Hillary Clinton, eine, die es wissen muss, sagte einmal in einem Interview: »You know as a woman we are many things.«[10]
Solcherlei Stereotypen zu entkommen, ist nicht leicht und viele der Ersten haben deswegen ihr Frausein sicherheitshalber kaum zum Thema gemacht. Das ändert sich in den letzten Jahren spürbar mit einer neuen Generation, die auf Demut pfeift. Aber auch diese Jungen haben noch mit einem Phänomen zu kämpfen, das die britische Journalistin Mary Ann Sieghart den Authority Gap nennt.[11] Sieghart zeigt eindrücklich, wie häufig und intensiv weibliche Expertise infrage gestellt wird, während wir noch immer dazu neigen, Männern in dunklen Anzügen Autorität und Wissen zuzuschreiben. Das hängt zum Teil mit Körpergröße und Stimmlage zusammen, aber eben vor allem mit tradierten Mustern und Stereotypen, die schwer aus den Köpfen zu bekommen sind und die den Ersten ihrer Art von Weimar bis heute zu schaffen machen.
»Wenn es die Lehman-Sisters statt den Lehman-Brothers gewesen wären, sähe die Welt heute anders aus«, sagte die ehemalige IWF-Chefin Christine Lagarde mit Blick auf die Finanzkrise von 2008. Das männlich dominierte Bankenwesen hatte die Finanzwelt an den Abgrund geführt und Lagarde hielt es für möglich, dass sich dies wiederholen könnte, falls man nicht endlich für mehr Diversität in diesem Sektor sorgte.[12] Das ist ein ganz entscheidender Punkt: Bei der Forderung nach mehr Teilhabe geht es nicht darum zu sagen, dass Frauen die besseren Politikerinnen, die besseren Bankerinnen, womöglich die besseren Menschen sind, es geht um Diversität. Frauen bringen aufgrund ihrer biografischen Erfahrungen andere Themen ein, sie setzen Schwerpunkte auf eigene Weise. Überdies zwang allein die Tatsache, dass sie über Jahrzehnte wenig oder keinen Zugang hatten zu den etablierten männlichen Machtnetzwerken, Frauen dazu, eigene Verhaltens- und Machtstrategien zu entwickeln. Homogene Gruppen neigen dazu, sich gegenseitig zu bestärken und zu verstärken, je vielfältiger dagegen Stimmen in einem Entscheidungsprozess sind, desto ausgewogener und facettenreicher ist das daraus resultierende Handeln. Was also machen Frauen anders? Welche inhaltlichen Schwerpunkte setzen sie? Wie sehr können sie die bestehenden Spielregeln überhaupt verändern, solange Parität nicht erreicht ist? Welches Verhältnis haben sie zur Macht? Und wie sieht weibliches Machtgebaren aus?
Unsere Reise zu den Ersten ihrer Art erstreckt sich auf über ein Jahrhundert, blickt vor allem auf Deutschland und Europa, bringt uns aber auch in verschiedene andere demokratische Länder, in denen politisches System und Gesellschaft vergleichbar sind: in die USA, nach Israel und Neuseeland. Diese Tour des Femmes führt mit Louise Schroeder und Marie-Elisabeth Lüders zu den allerersten weiblichen Abgeordneten im Weimarer Reichstag; zu Frauen wie Elisabeth Selbert, Erna Scheffler und Annemarie Renger, Juristinnen und Politikerinnen, die entscheidend mithalfen, die Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem modernen demokratischen Sozialstaat zu machen; sie nimmt uns mit zur französischen Gesundheitsministerin und ersten Präsidentin des Europaparlaments Simone Veil; zur ersten Schweizer Bundespräsidentin Ruth Dreifuss, deren Land erst 1971 das allgemeine Frauenstimmrecht einführte; aber auch zu einer der ersten und sicher bekanntesten Terroristinnen, Ulrike Meinhof, die die Gesellschaft mit Gewalt verändern wollte; zu den »neuen Frauen«, die in den 1980er-Jahren die Politik umkrempelten, Frauen wie Petra Kelly, Renate Schmidt und Claudia Roth; zu Ersten, die zunächst wenige auf dem Plan hatten und die doch zu Anführerinnen der freien Welt wurden: Margaret Thatcher und Angela Merkel; und zu den Ersten dieser Tage, die selbstbewusst sagen: »Jetzt spreche ich«, Frauen wie Kamala Harris, Ursula von der Leyen und Annalena Baerbock.
Aktuell kann man den Eindruck gewinnen, dass die Art, wie Frauen Politik machen, wieder zurückgedrängt wird von einer Renaissance der maskulinen Breitbeinigkeit. Diese geht nicht zuletzt vom neuen Mann im Weißen Haus aus, denn Kamala Harris, die erste Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, kandidierte im Herbst 2024 gegen Donald Trump, um die erste US-Präsidentin zu werden – und verlor. Droht uns nun ein veritabler Backlash? Die Worte von Harris’ Mutter – »Kamala, du kannst in vielen Dingen, die Erste sein, aber bleib nicht die Einzige«[13] – bekommen in jedem Fall eine neue Dringlichkeit.
In diesem Sinne: Auf zu den Ersten ihrer Art.
1 Die Systemrelevanten
Marie-Elisabeth Lüders – Louise Schroeder
Als es vorbei war, erkannten die beiden Frauen ihre Stadt kaum wieder. Wie abgebrochene Zähne ragten die Häuser aus dem traurigen Geröll, das die Straßen säumte. Als hätte Berlin durch die Luftangriffe der vorangegangenen Monate nicht schon genug gelitten, hatte die selbstmörderische Schlacht um die Hauptstadt in den letzten Wochen noch zusätzliche schreckliche Verheerungen angerichtet, unzählige Leben gekostet, das, was an Infrastruktur noch geblieben war, in Schutt und Asche gelegt. Im sogenannten »Volkssturm« hatte das Regime noch in den letzten Kriegsmonaten Greise und Kinder für den längst verlorenen Kampf aufgeboten und erbarmungslos geopfert.
Der Krieg hatte auf Berlins Antlitz seine grausamen Spuren hinterlassen und Gleiches konnte man wohl von den zwei Frauen sagen, die sich hier im Sommer 1946 wiedertrafen. Auch sie, die sich seit Jahrzehnten kannten und schätzten, hatten Mühe, jene Frau, mit der sie im Reichstag zusammengearbeitet hatten, in dem ergrauten, müden und ausgemergelten Gesicht ihres Gegenübers wiederzufinden. Abgemagert und gesundheitlich schwer angeschlagen von Jahren des Krieges, der Mangelernährung und der Verfolgung, begegneten sich Marie-Elisabeth Lüders und Louise Schroeder nun wieder. Sie konnten sich selbst kaum gerade halten und sollten doch in den folgenden Jahren ihrer Stadt und ihrem Land unschätzbare Aufbauhilfe leisten.
In der Weimarer Republik hatten Lüders und Schroeder einer sehr kleinen, aber durchaus wirkmächtigen Minderheit angehört. Sie waren zwei von wenigen Dutzend Frauen im Deutschen Reichstag gewesen. Der weibliche Anteil an den Abgeordneten hatte nie mehr als knapp 9 Prozent ausgemacht und war mit den Jahren eher geschrumpft als gewachsen. Je weiter das Parlament in den 1920er-Jahren nach rechts driftete, desto männlicher wurde es. Ein Phänomen, das wir übrigens auch dieser Tage wieder beobachten können. Mit dem Erstarken rechtspopulistischer Parteien in Europa sinkt der Frauenanteil in den Parlamenten. Bei der Reichstagswahl im März 1933 machten weibliche Abgeordnete nur noch 3,8 Prozent aus. Da war Marie-Elisabeth Lüders und Louise Schroeder längst klar, dass in diesem neuen Deutschland kein Platz mehr für sie war.
Als die beiden Politikerinnen sich etwa ein Jahr nach Kriegsende in ihrer Stadt wiedersahen, waren sie im Grunde in einem Alter, in dem man eher daran dachte, sich zur Ruhe zu setzen, als nochmals neu anzufangen. Ob Lüders und Schroeder einander von ihren Erlebnissen der letzten Jahre berichteten? Wir wissen es nicht. Vermutlich war dazu kaum Zeit. Der helle, flirrende Sommer stand in seltsamem Widerspruch zur deprimierenden Situation, in der sich die Berliner*innen befanden. Es herrschte eklatante Wohnungsnot, die Versorgungslage war katastrophal, Geflüchtete mussten untergebracht werden, Kinder waren verwaist, Männer und Frauen versehrt an Körper und Seele.
Marie-Elisabeth Lüders und Louise Schroeder hatten vor dem Krieg unterschiedlichen Parteien angehört und das sollte auch nach 1945 so bleiben. Die eine war echte Liberale, die andere durch und durch Sozialdemokratin, und doch wussten beide, dass sie in der verzweifelten Lage, in der sich die Stadt befand, gebraucht wurden. Sie waren überzeugte Demokratinnen, tief durchdrungen von der Notwendigkeit und Geltung der Menschenrechte, der Gleichberechtigung der Geschlechter, der Rechtsstaatlichkeit, kurz: all jenen Werten, die in den vorangegangenen Jahren mit Füßen getreten worden waren und an die es nun anzuknüpfen galt. Darüber hinaus waren sie beide erfahrene und ausgewiesene Sozialpolitikerinnen mit jeder Menge administrativem Know-how, das nun so bitter nötig war. »Ich müsste zwölf Jahre jünger sein«, konstatierte Louise Schroeder trocken und krempelte die Ärmel hoch. Während die junge Generation nach zwölf Jahren Diktatur stark vom Nationalsozialismus geprägt oder gänzlich desillusioniert war und mit Politik nichts mehr zu tun haben wollte, übernahmen nun Frauen und Männer fortgeschrittenen Alters noch einmal das Ruder. »Wer nach den Erfahrungen der sechs Kriegsjahre noch Kraft und Willen zum Leben hatte«, so erinnerte sich Marie-Elisabeth Lüders später an diese Zeit, »durfte auf keinen Fall den Anruf, mitzuarbeiten und mitzuhelfen, überhören, wenn die persönlich-menschlichen Bedenken auch noch so groß waren.«[1]
[2] Die Juristin und Parlamentarierin Marie-Elisabeth Lüders kämpfte in Kaiserreich, Weimarer Republik und Bundesrepublik für Geschlechtergerechtigkeit.
So wurden Marie-Elisabeth Lüders und Louise Schroeder im Alter von 67 beziehungsweise 58 Jahren noch mal zu dem, was sie knapp dreißig Jahre zuvor als junge Frauen bereits gewesen waren – zu Pionierinnen. Auch damals hatten sie die politische Arena betreten als ein grauenhafter, verlustreicher Krieg zu Ende gegangen war. Auch damals hatten sie die Chance ergriffen, ihre Werte und Überzeugungen in das gerade entstehende politische Gebilde einzubringen und es dauerhaft mitzuprägen. Ihre ersten politischen Schritte aber taten beide Frauen noch im Kaiserreich. In einer Ära, in der Frauen zwar weder wählen noch gewählt werden durften, die aber dennoch eine Zeit des Aufbruchs war. Wie nie zuvor wurden im ausgehenden 19. Jahrhundert Geschlechterrollen infrage gestellt, Vereine gegründet, Schriften publiziert, es wurde debattiert und gestritten. In diese Zeit, in der der unerhörte Gedanke, Männer und Frauen könnten gleichberechtigt sein, erstmals massenhaft und schichtenübergreifend durch die Köpfe blitzte – vor allem durch weibliche, versteht sich –, in diese Zeit also wurden Marie-Elisabeth Lüders und Louise Schroeder hineingeboren. Und das hatte Folgen.
Geistiges Vorwärtskommen
Wenn der Wirkliche Geheime Oberregierungsrat Carl Christian Lüders morgens am Frühstückstisch Platz nahm – sorgsam gescheiteltes Haar, gepflegter Vollbart, steifer Stehkragen, der strahlend weiß aus dem schwarzen Anzug herausragte –, kam er nicht selten zu spät. Seine Tochter, ein aufgeweckter, hochgeschossener Teenager, das, was man damals einen Backfisch nannte, hatte sich oft schon die Vossische Zeitung geschnappt und war vertieft in die Lektüre, während sie ihre Schrippen mit Marmelade bestrich. Die Mutter, Friederike Laura Sophie Lüders, hob missbilligend die Augenbraue. Was für Marotten das Kind hatte! Marotten, so nannte Marie-Elisabeths Mutter das frühe Interesse ihrer Tochter für Politik. Ganz und gar unpassend für ein junges Mädchen, fand sie.
Marie-Elisabeth, Lisbeth genannt, aber liebte es, sich in Reichstagsreden zu vertiefen, die damals seitenweise in den Zeitungen abgedruckt wurden. Das parlamentarische Hin und Her, das Argumentieren, Streiten und Aushandeln faszinierte sie. Es war, als wäre man ganz nah dran, quasi mit dabei. Die Reichstagsreden gaben dem jungen Mädchen einen ersten Eindruck davon, wie parlamentarische Prozesse abliefen. Noch durften Frauen nicht wählen, Lisbeth als Minderjährige sowieso nicht, noch gab es keine weiblichen Abgeordneten, keine Ministerinnen oder höheren Beamtinnen. Daran war gar nicht zu denken. Und doch gaben ihr die abgedruckten Reden einen Einblick in den Maschinenraum der Macht, in die Abläufe des Parlaments, in das Austarieren des politisch Möglichen. Ihr Vater fragte sie einmal, was ihr an der Zeitungslektüre so gefalle. »Man kann darin lesen«, so Lisbeth, »was der Kaiser täglich tut (Hofbericht!) und was die Leute möchten, warum sie es möchten, und was andere Leute dazu sagen.« Dagegen war wenig einzuwenden, fand wohl auch Carl Christian Lüders. »So fing es an. – Und es endete im Reichstag, im Berliner Abgeordnetenhaus und Senat und im Bundestag«, erinnert sich die Politikerin viele Jahre später.[15]
Marie-Elisabeth Lüders wurde 1878 in Berlin in eine preußische Beamtenfamilie hineingeboren. Ihr Vater arbeitete im Kulturministerium und neigte der Deutschen Volkspartei zu. Intellektuelle wie der Historiker Theodor Mommsen und die Physiker Wilhelm Conrad Röntgen und Max Planck kamen regelmäßig ins Haus. Der Bildungsdrang, die wissenschaftliche Neugier, die Lust am intellektuellen Austausch – all das umgab Lisbeth wie die Luft zum Atmen, all das sog sie begierig auf.
Lisbeth war das jüngste von sechs Kindern und wurde nach eigener Aussage »in Freiheit dressiert«. »In Freiheit ja – dressiert nur so weit, wie es unbedingt notwendig und in Familien mit vielen Kindern überhaupt möglich ist.« Wenn man die alten Porträts betrachtet, ist die Ähnlichkeit zwischen Lisbeth und ihrem Vater frappierend. Vermutlich hat sich Carl Christian Lüders nicht selten über seine Tochter gewundert, aber auch hin und wieder in ihr erkannt, jedenfalls hat er sie offenbar vielfach ihrer Wege gehen lassen und sie in ihrer Besonderheit akzeptiert. Das heranwachsende Mädchen hatte nicht nur für ihr Alter und die Zeit eher ungewöhnliche Lesegewohnheiten, auch ihre äußere Erscheinung fiel auf. Sie war groß gewachsen und hatte eine tiefe Stimme. Zwei Eigenschaften, die ihr später durchaus zugutekommen sollten. Ihr Konfirmationsspruch stammte aus dem Buch des Propheten Jesaja: »Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.« In diesen Worten fand Lüders lebenslang nicht nur Halt und Trost, sie spornten sie auch an. »Es stand als Forderung gegen jede unbequeme Kapitulation«, schreibt sie in ihren Memoiren, »es stand hilfsbereit neben dem bitteren Kampf mit dem Tode, der jahrelang unerbittlich alle meine Pläne durchkreuzte. Es war später Schutz gegen alle familiären und sozialen Widerstände, die uns Frauen das Leben so schwer machten.«[16]
Auf Widerstände stieß Marie-Elisabeth Lüders früh. Sie testete die Grenzen, lotete aus, wie weit sie gehen konnte und fand schmerzhaft heraus, wo für Mädchen Schluss war. Sie wollte keinesfalls das Schicksal so vieler Gleichaltriger teilen, junger Frauen aus gutem Hause, die darauf warteten, weggeheiratet zu werden, und sich die Zeit bis dahin mit Sticken und Klavierspielen vertrieben. Ihr Traum war es, Architektin zu werden. Daher bat sie um ein Gespräch mit dem Rektor der Technischen Hochschule, der ihr eröffnete, das sei nichts für Mädchen, die würden doch nicht verstehen, was hier gelernt werde, worauf Lüders ihm entgegnete: »Die Brüder sind auch nicht klüger als ich.« Der Rektor wird erstaunt gewesen sein angesichts eines derart provokativen Selbstbewusstseins und eines zweifellos entwaffnenden Arguments, seine Meinung aber änderte er nicht. Junge Frauen der gehobenen Gesellschaftsschicht hatten um die Jahrhundertwende nicht allzu viele Optionen. Die meisten Mädchen besuchten ein Pensionat oder eine Schule für höhere Töchter, erlernten aber keinen Beruf, sondern wurden mehr oder weniger nahtlos Ehefrau und Mutter. Das erschien Lisbeth allerdings wenig erstrebenswert. Ein solches Leben versprach ihr, wie sie es ausdrückte, kein geistiges Vorwärtskommen. Typische Frauenberufe der Zeit waren Lehrerin, Krankenschwester und Gesellschafterin. Nichts, was Lüders begeistert hätte. In der Nachbarschaft hatte sich die junge Frau unterdessen mit dem freisinnigen Abgeordneten Eugen Richter angefreundet, mit dem sie viel über gesellschaftliche Fragen diskutierte. Auch diese Bekanntschaft – Richter war zu diesem Zeitpunkt nicht nur vierzig Jahre älter als Lisbeth, sondern auch ein bekannter Publizist und Parlamentarier im Preußischen Abgeordnetenhaus und im Reichstag – zeugt von Lüders’ Entschlossenheit, ihren Interessen zu folgen, egal was Freunde und Freundinnen oder die Mutter sagten, und einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein. Als Richter einmal eher nebenbei bemerkte, dass es ja schade sei, dass sie kein Junge sei, weil sie sonst in die Politik gehen könne, hat sich in Marie-Elisabeth Lüders’ Kopf wohl einiges in Bewegung gesetzt.[17]
Den skeptischen Eltern zum Trotz begann sie, Gesangsunterricht zu nehmen, beschäftigte sich mit Fotografie und entschied sich schließlich, an die Frauenschule in Niederofleiden zu gehen. In dieser Pioniereinrichtung der Frauenbildung wurden Mädchen nach dem Oberschulabschluss in Land-, Haus- und Ernährungswissenschaft sowie Sozialwesen ausgebildet. Der Szenenwechsel vom großbürgerlichen Berliner Beamtenhaushalt in die hessische Provinz bescherte der jungen Lisbeth eine wichtige Erweiterung ihres Horizonts. Die Schülerinnen, Maiden genannt, trugen eine spezielle Tracht und lebten in recht einfachen Verhältnissen. Dass Lüders in Niederofleiden auch im Kindergarten Dienst tat und in direkten Kontakt mit der Not der dort lebenden Familien kam, sollte für sie lebenslang prägend sein. Nach ihrer Rückkehr nach Berlin stand sie aber erneut vor der quälenden Frage, wie es beruflich mit ihr weitergehen sollte. Der gesellschaftliche Druck, den Konventionen zu folgen und zu heiraten, wuchs mit jedem Lebensjahr. »Wie andere junge Menschen strebte ich von zu Hause fort, um dem ewigen Kreislauf des Lebens einer ›höheren Tochter‹ zu entgehen«, erinnerte sie sich später an diese Zeit.[18] Der Lehrerinnenberuf bot ihr zunächst den gangbarsten Ausweg. In einem Weimarer Mädchenpensionat lehrte sie Deutsch. Sosehr sie sich auch dagegen sträubte zu unterrichten, so wichtig sollte diese Etappe doch für sie werden, denn hier knüpfte sie Kontakte zu Kolleginnen, die dem Bund Deutscher Frauenvereine angehörten.
Erst wenige Jahre zuvor gegründet, bot diese Organisation den einzelnen Vereinen der bürgerlichen Frauenbewegung ein gemeinsames Dach. Lüders kam in intensive Berührung mit der sogenannten Frauenfrage und fing Feuer. Sie stellte fest, dass die Themen, die sie seit Langem umtrieben, die ungleiche Behandlung von Jungen und Mädchen, die unzähligen Wege, die ihr im Gegensatz zu ihren Brüdern verschlossen blieben, nicht nur sie bewegten, sondern auch viele andere Geschlechtsgenossinnen. Das muss ziemlich befreiend auf dieses groß gewachsene, selbstbewusste Mädchen aus gutem Hause gewirkt haben. Bisher hatte sie Frauenrechtlerinnen nur aus der Entfernung gekannt, vom Hörensagen. Sie waren ihr als »verschrobene alte Jungfern« geschildert worden. Nun konnte sie sich selbst ein Bild machen. »Keine war ›verschroben‹.«[19] Im Herbst 1901 fuhr sie mit den neuen Freundinnen zur Generalversammlung des Bundes Deutscher Frauenvereine nach Wiesbaden – der Vater hatte die Erlaubnis gegeben – und lernte zentrale Gestalten der deutschen Frauenbewegung wie Alice Salomon, Margarete Friedenthal und Anna Pappritz persönlich kennen.
Pappritz war eine entschiedene Abolitionistin, sie forderte die Abschaffung der staatlich reglementierten Prostitution. Überwiegend wurde damals noch die Meinung vertreten, Prostitution sei nötig, weil Männer nun einmal Geschlechtsverkehr brauchten, allerdings sei diese staatlich zu kontrollieren und zu überwachen. Das bedeutete im Klartext, dass die Prostituierten in den Fokus genommen wurden. Um Geschlechtskrankheiten einzudämmen, mussten allein sie sich regelmäßigen Zwangsuntersuchungen unterziehen, während die Rolle der Männer bei der Übertragung der Krankheiten, ganz im Einklang mit der damals herrschenden Doppelmoral, geflissentlich ignoriert wurde. Gleichzeitig öffnete diese Art der staatlichen Gängelung der Korruption Tür und Tor und lieferte die Frauen schutzlos einem männlichen Überwachungssystem aus. Pappritz und ihre Kampfgefährtinnen wollten dem ein Ende machen. Vor allem die Begegnung mit der entschlossenen Anna Pappritz, die auf dem brandenburgischen Rittergut Radach aufgewachsen war und neben ihrer politischen Arbeit auch Novellen und Romane veröffentlichte, machte großen Eindruck auf die junge Marie-Elisabeth Lüders und sollte überaus prägend für ihre eigene politische Arbeit werden. »Meinen damals noch gänzlich ungeübten Augen erschloss sich eine völlig neue – wie mir schien – grenzenlose Welt: die Welt, die ich unbestimmt seit Jahren gesucht hatte.«[20]
Eugen Richters Bemerkung, es sei schade, dass sie kein Junge sei, die Arbeit im Kindergarten von Niederofleiden sowie die soziale Not, deren Zeugin sie dort wurde, und schließlich die persönliche Begegnung mit den führenden Frauenrechtlerinnen und Sozialreformerinnen der Zeit bestärkten Marie-Elisabeth Lüders in ihrer Entscheidung, mehr zu wollen als einen Ehemann und eine Familie. Sie sah die vielen gesellschaftlichen Baustellen mit glasklarem Blick und war bereit, tätig zu werden. Nur – noch war es Frauen unmöglich, an Posten und Positionen zu gelangen, um Einfluss geltend zu machen. Die Schaltstellen der Macht – in Politik, Justiz, Verwaltung – waren mit Männern besetzt. Auch die Universitäten wanden sich seit Jahren, fanden immer wieder neue Ausreden, warum Frauen nicht geeignet seien für ein Hochschulstudium. Das preußische Kultusministerium etwa befragte die verschiedenen Fakultäten der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin, ob ein Frauenstudium denkbar wäre. Jede Fakultät lehnte ab und verwies auf die Nachbardisziplin, die doch für Studentinnen viel besser geeignet sei. Die männlich besetzten Gremien schmetterten regelmäßig Eingaben der Frauenvereine ab, das Frauenstudium – etwa in der Medizin – endlich zuzulassen. Zwar wurden Frauen hier und da als Gasthörerinnen geduldet und es wurden zum Teil auch Sondergenehmigungen erteilt, aber erst ab 1908 wurde es Frauen in Preußen generell gestattet, sich für ein Hochschulstudium einzuschreiben.
Während die Männerwelt also zunächst noch verschlossen blieb, sollte für Marie-Elisabeth Lüders’ politische Identitätsfindung die Zusammenarbeit mit Alice Salomon an deren 1908 gegründeter Sozialer Frauenschule prägend werden. Hier machte Lüders regelmäßig Hausbesuche bei Arbeiterfamilien und die soziale Frage stellte sich ihr immer dringlicher. In vielen Bereichen, das war ihr klar, brauchte es rasch Reformen, gerade für Frauen, Familien und Kinder. Auch der für sie persönlich anstehende nächste Schritt stand längst für sie fest: Sie wollte Nationalökonomie studieren. Die alte Faszination für Politik, die Frage, wie alles zusammenhing, trieben sie an. 1909 immatrikulierte sie sich, zusammen mit ihrer Freundin Agnes von Harnack, als eine der ersten Frauen an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin. »Mit besonderem Hochgenuss überreichten wir dem damaligen Dekan Professor Roethe unsere Immatrikulationshefte, nachdem er uns absichtlich lange hatte warten lassen«, erinnerte sie sich an diesen besonderen Moment. In vielen Seminaren und Kollegs war sie die einzige Frau, deren Eintreten ins Auditorium von vernehmbarem Scharren der Kommilitonen begleitet wurde. Marie-Elisabeth Lüders musste neben dem Studium aber auch noch das Abitur nachholen und die Begegnung mit dem Dünkel der Gymnasiallehrer war fast noch schlimmer als die scharrenden und höhnenden jungen Männer im Hörsaal. Sie solle doch lieber Strümpfe stopfen, statt zu studieren, hielt ihr einer der Lehrer entgegen. Lüders, zu diesem Zeitpunkt schon eng mit der Frauenbewegung verbandelt und bestens vernetzt, ließ sich von derlei Vorurteilen nicht aus der Ruhe bringen, machte nicht nur Abitur, sondern wurde auch in kürzester Zeit als erste Frau an der Berliner Universität zum Dr. rer. Pol. promoviert.
Nach ihrem Studienabschluss wurde sie die erste Wohnungspflegerin der Stadt Berlin und knüpfte damit an ihre sozialreformerische Arbeit für Alice Salomon an. Erschüttert war die junge Frau aus bildungsbürgerlichem Haus, als sie mit der nackten Realität der Arbeiterwohnungen konfrontiert wurde. Kinderreiche Familien in kleinen, schlecht gelüfteten, feuchten Mietskasernen. Der Berliner Maler Heinrich Zille hatte zweifellos recht, wenn er sagte, man könne jemanden mit einer Wohnung genauso umbringen wie mit einer Axt. Tatsächlich litten viele der Bewohner unter Lungenkrankheiten, Mangelernährung, Kinder bekamen zu wenig frische Luft, zu wenig Licht, hatten Wachstumsprobleme, die Säuglingssterblichkeit war hoch, die Mütter wurden, kaum hatten sie ein Kind zur Welt gebracht, wieder schwanger.
Gegen derlei Missstände, zu dieser Überzeugung gelangte Lüders, halfen nur politische Maßnahmen. Eine Tür, hier aktiv zu werden, öffnete sich endlich, als es im Jahr 1908 zur Neufassung des Vereins- und Versammlungsrechts kam, die für Frauen den Weg zu organisierter und öffentlicher Betätigung frei machte. Lüders erinnert sich daran, mit welchem Hohn die männlichen Parlamentarier dieser Gesetzesänderung begegneten. Die Vorstellung, Frauen könnten die neuen Möglichkeiten, Politik zu machen, tatsächlich nutzen, muss den Herren gänzlich abwegig erschienen sein. »Die Reden und Lachsalven, mit denen die ›Volksvertreter‹ – in völliger Unkenntnis der dynamischen Kräfte in der Frauenbewegung – die Verabschiedung dieses für uns entscheidenden Gesetzes begleiteten, haben mich mehr als alles andere auf den politischen Weg gedrängt«, schreibt Lüders in ihren Memoiren.[21]
Schwestern, zur Sonne, zur Freiheit
Die Neuregelung des Vereins- und Versammlungsrechts machte auch für Louise Schroeder eine Türe auf. Nur wenige Monate nachdem das Gesetz erlassen worden war, trat sie mit 23 Jahren in die SPD ein. 1887 in Altona geboren, war Louise Schroeder neun Jahre jünger als Marie-Elisabeth Lüders. Ihre Kindheit und Jugend standen in starkem Kontrast zu den Verhältnissen, in denen Lüders aufgewachsen war. Schroeders Vater war Bauarbeiter, ihre Mutter kam vom Lande und führte einen kleinen Gemüseladen. Während Lüders in einem bildungsbürgerlichen Beamtenhaushalt groß geworden war, mit Herrenzimmer, Sommerfrische und Dienstmädchen, wurde Louise Schroeder in ein durch und durch proletarisches Milieu hineingeboren. Der Vater war überzeugter Sozialdemokrat und nahm die kleine Louise regelmäßig mit zu Parteifesten und Maifeiern.
Es ist faszinierend, dass diese beiden Frauen, die unter so unterschiedlichen Bedingungen ins Leben starteten, und sich schließlich auch in verschiedenen Parteien engagierten, als Politikerinnen doch ähnliche Hürden zu überwinden hatten und sich außerdem in Bezug auf die Verbesserung der Situation von Frauen und Familien vielfach ähnlichen politischen Zielen verschreiben sollten. Beide zeichnete ein unbändiger Bildungshunger aus. Selbstverständlich verfügte Louise Schroeder nicht über die gleichen finanziellen Voraussetzungen – man konnte es sich nicht leisten, das Kind auf eine höhere Schule zu schicken, von einem Studium ganz zu schweigen –, aber sie nutzte die vielfältigen Möglichkeiten, die die Arbeiterbewegung bot. Orts- und Bibliotheksvereine, sozialdemokratische Zeitschriften und Zeitungen versorgten junge Arbeiter*innen mit reichlich geistiger Nahrung. Die Hochachtung für Bildung dürfte in vielen Elternhäusern proletarischer Kreise ebenso ausgeprägt gewesen sein wie in so manch höherem Beamtenhaushalt. Wachsendes Selbstbewusstsein und Zukunftsoptimismus inspirierten viele Männer und Frauen nach langen Schichten in der Fabrik, nach einem anstrengenden Arbeitstag als Verkäuferin oder Schneiderin noch einen Abendkurs zu besuchen, sich zur politischen Arbeit zu treffen, zu debattieren über die Themen, die sie alle beschäftigten: bessere Arbeitsrechte und -bedingungen, mehr Gesundheitsschutz, Hygiene, sexuelle Aufklärung und – die Beteiligung von Frauen am politischen Prozess.
Louise Schroeder besuchte nach ihrem Mittelschulabschluss in Hamburg die Gewerbeschule und arbeitete zunächst in einem der damals aufkommenden modernen »Frauenberufe« als Stenotypistin. In relativ kurzer Zeit gelang der ambitionierten jungen Frau der Aufstieg zur Chefsekretärin in einer Versicherungsgesellschaft, wo sie auch Fremdsprachen lernte. Das sollte ihr später sehr zugutekommen, als sie nach dem verlorenen Krieg als Bürgermeisterin mit den englisch- und französischsprachigen Besatzern Berlins zu verhandeln hatte – doch so weit sind wir längst nicht. Noch herrschten die Hohenzollern in Deutschland.
Die junge Louise Schroeder war unabhängig. Ein Zustand, nach dem sich eine wachsende Zahl von Frauen sehnte. Sie verdiente ihr eigenes Geld, über das sie selbst entscheiden konnte, denn sie war als Unverheiratete nicht vom Gutdünken des Ehemannes abhängig. Im Kaiserreich hatte der Ehemann das alleinige Bestimmungsrecht über Frau und Kinder. Er verwaltete das gemeinsame Vermögen, auch das Geld, das seine Frau in die Ehe brachte. Er entschied – übrigens bis weit übers Kaiserreich hinaus bis 1977 –, ob seine Frau einer Arbeit nachgehen durfte. Die Rollenverteilung war strikt geregelt: Der Ehemann galt als Alleinverdiener, die Ehefrau hatte sich um den Haushalt und die Kinder zu kümmern.
Ledig zu bleiben, wie Louise Schroeder, garantierte also eine gewisse Freiheit, aber nur wenige konnten es sich leisten. Gut bezahlte Jobs für Frauen waren rar gesät, ihre Gehälter waren in der Regel niedriger, weil man davon ausging, dass sie nicht für eine Familie sorgen mussten. Auch einige Töchter aus dem gehobenen Bürgertum blieben unverheiratet und strebten nach alternativen Lebensentwürfen, doch hier grätschte nicht selten der Vater oder ein anderer männlicher Verwandter dazwischen, argumentierte mit finanzieller Abhängigkeit oder Familienehre und sorgte dafür, dass die junge Frau an dem ihr zugedachten Platz blieb. Junge Büroangestellte aus proletarischem Milieu dagegen, noch dazu, wenn sie in einer Großstadt lebten, hatten da – wenn auch im bescheidenen Rahmen – nicht selten größere Chancen, eigenständige Wege zu gehen.
Ein Foto von Louise Schroeder aus dem Jahr ihres Parteieintritts 1910 zeigt eine aufrechte junge Frau, die geflochtenen Zöpfe am Hinterkopf hochgesteckt, mit großem Hut, hochgeschlossenem Kleid mit weißem Stehkragen und dunkler Stola. Das Bild ist beindruckend, beweist es doch, wie sehr auch Sozialdemokratinnen sich auf Fotografien wie Angehörige des Bürgertums in Szene setzten – Handschuhe, Hüte und Spitzenkragen inbegriffen. Es belegt aber auch das wachsende Selbstbewusstsein einer erwachenden Schicht moderner Frauen, die in gerade neu geschaffenen Berufen die Arbeitswelt entdeckten und veränderten.
[3] Empowerment: Arbeiterkind Louise Schroeder engagierte sich früh bei der SPD, zog 1919 als jüngste Abgeordnete in die Weimarer Nationalversammlung ein und wurde zu einer der profiliertesten Sozialpolitikerinnen.
Wir wissen nicht viel über Louise Schroeders Privatleben in diesen Jahren, aber wir kennen dennoch ihre große Leidenschaft. Wie Marie-Elisabeth Lüders waren auch Schroeder die Umstände, unter denen viele Arbeiterfamilien ihr Leben fristen mussten, nur zu vertraut. Immer stärker zog es sie im Laufe des Ersten Weltkriegs zur Sozialpolitik, auch weil in diesen Jahren die Not besonders drängend wurde. Schließlich übernahm sie das Pflegeamt in Altona und sammelte praktische Erfahrung. Dieser Job war ein Crashkurs in Sachen Verwaltungsarbeit und Teamführung. Mädchenjahre einer Bürgermeisterin sozusagen.
Louise Schroeder war fest im sozialdemokratischen Milieu verankert. Auch auf die Frage der Frauenemanzipation sah sie aus diesem Blickwinkel, hatte doch der sozialdemokratische Vordenker August Bebel bereits 1879 die politische und gesellschaftliche Gleichstellung der Frau gefordert. Sein Buch Die Frau und der Sozialismus war inzwischen ein Standardwerk. Schroeder erlebte die Probleme der Proletarierinnen an vorderster Front. In ihrer Altonaer Arbeit war sie mit der sozialen Not von Familien konfrontiert, mit Frauen, die nicht wussten, wie sie ihre Kinderschar durchbringen sollten, die Gewalt und Alkoholismus ihrer Männer ausgesetzt waren. Sie kannte das Elend lediger Mütter und unehelich geborener Kinder und die ewige Sorge vieler Frauen, ungewollt schwanger zu werden, und verfolgte daher einen sexualreformerischen Kurs, setzte sich für sexuelle Aufklärung und die Ausgabe von Verhütungsmitteln ein.[22]
Auch Marie-Elisabeth Lüders’ politische und soziale Arbeit erfuhr durch den Ersten Weltkrieg einen ordentlichen Schub. Im dritten Kriegsjahr, die anfängliche Begeisterung, die zumindest einen Teil der Bevölkerung – überwiegend den städtischen, bürgerlichen, männlichen Teil – im Sommer 1914 zunächst erfasst hatte, war längst einer brutalen Desillusionierung gewichen, war Marie-Elisabeth Lüders zur Leiterin der Frauenarbeitszentrale im Kriegsministerium ernannt worden. Die Hoffnung auf einen schnellen Sieg war im Schlamm des zermürbenden Stellungskrieges stecken geblieben. Während die Jugend Europas in Flandern und Frankreich, in Galizien und Wolhynien starb, junge Männer schwer versehrt an Körper und Seele in Lazaretten darbten, versetzten Meldungen von grauenhaften neuen Waffen, wie Gift- und Senfgas, die Menschen in Angst und Schrecken. Auch in der Heimat wuchsen die Not und der Wunsch, dass dieses erbarmungslose Schlachten endlich ein Ende haben würde.
Während die Kaiserin persönlich Lüders’ Arbeit unterstützte und förderte, bekam diese im Kriegsministerium erheblichen Gegenwind. Auguste Viktoria schoss eine Million zu, um die Arbeits- und Lebensbedingungen von Arbeiterinnen während des Krieges zu verbessern, was zahlreiche höhere Offiziere im Ministerium nachhaltig verärgerte, »deren Männerstolz sich vor allem durch die Millionenspende für die Arbeit einer ›Frau‹ verletzt fühlte«. Viele Industrielle wehrten sich überdies dagegen, ihre männlichen Arbeitskräfte durch weibliche zu ersetzen, geschweige denn die Arbeitsbedingungen für diese Frauen, die sie ja ohnehin nicht wollten, erträglicher zu machen. Einmal eröffnete ein Unternehmer Lüders, der Krieg sei sowieso bald gewonnen und dann kämen die Deutschen in den Besitz des französischen Erzbeckens im Val de Briey. »Mein Erschrecken über so viel gefährliche Blindheit war groß«, erinnert sich Lüders. »Alle Hinweise auf die militärischen Tatsachen nutzten nichts. Plötzlich sagte ich rücksichtslos: ›So sicher wie Sie das Erzbecken von Briey zu bekommen glauben, so gut kann ich Ihnen den Vollmond als Eierkuchen zum Nachtisch versprechen!‹ Der Kommerzienrat schwieg. Das Unheil nahm seinen Lauf.« Wenig später bekam Lüders von ihrem neuen Vorgesetzten im Ministerium, einem aufgrund eines angeblichen Herzleidens heimatversetzten Major, die Anweisung, ihm sämtliche »Frauenberufe« aufzulisten. »Ich konnte wahrheitsgemäß nichts anderes tun, als ihm zu schreiben, dass es nur einen spezifischen Frauenberuf gäbe, und zwar den der Amme; alle anderen Berufe könnten und würden auch von Männern ausgeübt. Diese Mitteilung nahm er übel.«[23]
Dass Lüders es mit zahlreichen ihrer männlichen Kollegen verbal durchaus aufnehmen konnte, ja, ihnen wohl zuweilen deutlich überlegen war, zeigt eine weitere Begebenheit. Kronprinzessin Cecilie, die der Frauenbewegung gegenüber durchaus aufgeschlossen war, wohnte in den Kriegsjahren einer Vortragsreihe über die Einbeziehung der Frauen in den Vaterländischen Hilfsdienst bei. An einem Abend sprach zunächst ein berühmter Nationalökonom, der kein Ende finden konnte, sodass für Marie-Elisabeth Lüders im Anschluss nur zwanzig Minuten blieben. »Es gelang ihr«, so die ebenfalls anwesende Frauenrechtlerin Dorothee von Velsen, »in dieser Zeit alles Wesentliche zu sagen.« Als die Kronprinzessin und Lüders einander nach der Veranstaltung vorgestellt wurden, bekundete Erstere ihre Hochachtung für diese rhetorische Leistung. »Ja, Kaiserliche Hoheit«, erwiderte Lüders ungerührt, »Geheimrat S. ist eben an das Klingelzeichen gewöhnt, und das war hier leider nicht vorgesehen.« Von Velsen war beeindruckt von der großen, unerschrockenen Frau. »Sie war als Tänzerin, Tennisspielerin und Schlittschuhläuferin begehrt. (…) Eine echtere Berlinerin wäre schwer vorstellbar. Denn was kennzeichnet die Bewohner dieser Stadt? Schnelle Reaktion, schlagfertiger Witz, nicht leicht zu erschütternde Sicherheit und ein Mut, der mit der Gefahr wächst.«[24]
Ganz so früh und so klar wie bei Louise Schroeder fiel bei Marie-Elisabeth Lüders die Entscheidung für eine politische Partei nicht. Ihr Vater war deutsch-national, sie selbst bewegte sich aber mehr und mehr in freisinnigen Kreisen rund um den Theologen und großen Liberalen Friedrich Naumann, außerdem war sie tief von der bürgerlichen Frauenbewegung geprägt, beeindruckt von Vorkämpferinnen wie Minna Cauer, Helene Lange sowie der gerade erwähnten Dorothee von Velsen. 1918 schließlich beteiligte sich Lüders an der Gründung der Deutschen Demokratischen Partei, DDP, und wurde direkt Vorstandsmitglied auf Reichsebene. Wie einige andere Aktivistinnen der bürgerlichen Frauenbewegung, wie etwa Anna Pappritz und deren Lebensgefährtin Margarete Friedenthal sowie Gertrud Bäumer, schien ihr die DDP die geeignetste politische Heimat zu sein – auch wenn ihrem Vater das Bauchgrimmen verursachte.
Frauenwille siegt
Als klar wurde, dass der Krieg verloren war und es überall im Reich zu Aufständen und Demonstrationen kam, stand für die frauenbewegten Politikerinnen fest, dass nun Nägel mit Köpfen gemacht werden mussten. Aktivistinnen der bürgerlichen wie auch der proletarischen Frauenbewegung der jüngeren Generation – Marie-Elisabeth Lüders war bei Kriegsende vierzig Jahre alt, Louise Schroeder gerade mal Anfang dreißig – waren sich der Vorkämpferinnen bewusst, die bereits im Kaiserreich für die Sache der Frau und das Frauenwahlrecht eingetreten waren. Nun war die Stunde gekommen, die lange gehegten Forderungen nach Gleichberechtigung und Wahlrecht auf den Tisch zu bringen und umzusetzen. Monarchen flohen aus ihren Palästen, Revolution lag in der Luft. Allerorten gründeten sich Ausschüsse, Gruppen und Räte, um Interessen zu formulieren, Machtverhältnisse zu ändern, die Zeichen auf Zukunft zu setzen. Noch war nicht klar, wie diese Zukunft aussehen würde, doch den Frauen war bewusst, dass sich hier ein Zeitfenster öffnete. Zur Gunst der Stunde und der erheblichen Vorarbeit, die vonseiten der Frauenbewegung Jahrzehnte lang geleistet worden war, kam das gewachsene Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein vieler Frauen. In den vorangegangenen vier Jahren hatten sie nicht nur vielfach in der Familie das Sagen übernommen, einfach weil die Ehemänner an der Front gewesen waren, sie hatten auch zahlreiche Tätigkeiten ausgeübt, die einstmals Männern vorbehalten waren, und damit die Arbeitswelt in einem Maße verändert, wie man es sich vor dem Krieg niemals vorstellen hätte können. Dieser kriegsbedingte, ganz praktische Emanzipationsprozess, den viele Frauen durchlaufen hatten, verlieh ihren Forderungen in der nun anstehenden Umbruchsphase die nötige Wucht.[25]
»Der erste Wahlgang der Frauen. Ziel eines Jahrhunderts – Beginn eines Jahrtausends. (…) Es ist schön, und wie selbstverständlich; dieser Aufmarsch der Familien am Wahlbureau. Vater und Mutter und Töchter. Die kleinen Kinder laufen mit. Sie wollen sehen, wie Mutter wählt. Und die Mutter sagt: Sie sollen ihr ganzes Leben an diesen Tag denken«,[26] so erinnert sich die DDP-Politikerin und Frauenrechtlerin Gertrud Bäumer an diesen revolutionären Moment, in dem Frauen in Deutschland im Januar 1919 erstmals ihre Stimme abgeben durften. Revolutionär war der Moment zweifellos, und doch fällt nicht nur bei Bäumer der Begriff »selbstverständlich«. »Die Frauen«, so Elly Heuss-Knapp, Vorsitzende der »Propagandagruppe« der Frauenverbände Deutschlands und spätere erste First Lady der Bundesrepublik, »hatten das Wahlrecht bekommen (…), nach der Kriegsarbeit der Frau kam es als Selbstverständlichkeit.«[27] Heuss-Knapp, die in den 1930er-Jahren auch als Werbetexterin arbeitete, hatte für die Frauen-Propagandagruppe Wahlslogans geschrieben, die tausendfach auf Plakate und Flugblätter gedruckt wurden: »Frauen, werbt und wählt. Jede Stimme zählt. Jede Stimme wiegt. Frauenwille siegt.« Eine Selbstverständlichkeit nannte denn auch Marie Juchacz das Frauenwahlrecht. Die ehemalige Schneiderin und einflussreiche Gewerkschafterin war 1919 eine von 41 Parlamentarierinnen unter 423 Abgeordneten des frisch gewählten Hauses und hielt am 19. Februar als erste Frau eine Rede im Reichstag: »Es ist das erste Mal, dass in Deutschland die Frau als Freie und Gleiche im Parlament zum Volke sprechen darf. Ich möchte hier feststellen, und glaube damit im Einverständnis vieler zu sprechen, dass wir deutschen Frauen dieser Regierung nicht etwa in dem althergebrachten Sinne Dank schuldig sind. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit: sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist.«[28]
In der Einleitung war bereits die Rede davon: Unsere Vorstellung von Revolution, die Bilder, die dieser Begriff evoziert, sind meist männlich aufgeladen. Revolution, das waren und sind in den Augen vieler aufgeputschte Gruppen von meist jüngeren Männern, wehende Flaggen, aufrüttelnde Sprechchöre, gelegentlich auch Gewaltexzesse. Die friedlich wählenden und in Ausschüssen debattierenden Frauen wurden dagegen nicht als revolutionär wahrgenommen. Obwohl die Erlangung des Wahlrechts für Frauen genau das war – revolutionär. Und selbstverständlich war es schon gar nicht gewesen. Es hatte hart errungen werden müssen. Tatsächlich hatten sich im Herbst 1918 Frauenrechtlerinnen aller Couleur zusammengetan, um in einem überfraktionellen Vorstoß sicherzustellen, dass ihre Forderungen in all dem männlichen Umsturzstreben nicht vergessen wurden. Die Liberale Gertrud Bäumer, die Vorsitzende des Frauenstimmrechtsbundes Anita Augspurg und die Sozialistin Marie Juchacz verbündeten sich und potenzierten damit die Kräfte.[29]
In diesen Umbruchsjahren nach dem Ersten Weltkrieg wurden Frauen in verschiedenen Ländern der Welt zu vollen Staatsbürgerinnen und erhielten das Wahlrecht: Die Polinnen wie die deutschen Frauen im Jahr 1918, die US-Amerikanerinnen 1920, die Engländerinnen, soweit sie über dreißig Jahre alt waren, 1918, zehn Jahre später wurde das Wahlrecht im Vereinigten Königreich auf alle Frauen über einundzwanzig ausgeweitet. Interessant ist, dass die beiden westlichen Nachbarn Deutschlands, Belgien und Frankreich, im Vergleich dazu spät dran waren und erst in den 1940er-Jahren das allgemeine uneingeschränkte Frauenwahlrecht einführten.
Kaum dreißig Jahre alt, wurde Louise Schroeder 1919 als jüngste Abgeordnete in die Weimarer Nationalversammlung gewählt. Die Sozialdemokratin hatte eine beachtliche Karriere hingelegt und schon reichlich sozialpolitische Erfahrungen gesammelt, sodass man sie auf die schleswig-holsteinische Wahlliste gesetzt hatte. Ihr engagierter Wahlkampf hatte sie bei beißender Winterkälte durch Norddeutschland bis hinauf nach Helgoland geführt und ihr schließlich den Sieg eingebracht. »Das war der Moment, wo mein Leben einen anderen Verlauf nahm, wo ich aus dem Privatleben – dem täglichen Brotverdienen, den Eltern helfen – ausschied und ins politische Leben eintrat.«[30]
Die ebenfalls versierte Sozialpolitikerin Marie-Elisabeth Lüders nahm erst ein paar Monate später ihren Sitz im Reichstag ein, sie rückte für den verstorbenen Friedrich Naumann nach. Es war ein großer Triumph für die Vierzigjährige, nach den vielen individuell erfochtenen kleinen Erfolgen, nun einen Sieg der Frauen insgesamt konstatieren zu können. Das Frauenwahlrecht, aktiv und passiv, das war ihr klar, war ein entscheidender Schritt in Richtung Gleichberechtigung. »In jahrzehntelangem Ringen ist es gelungen«, so führte sie aus, »die Frau in die Reihe der Staatsbürger einzugliedern. Soziale Vorurteile, wirtschaftliche Hemmnisse, berufliche Hindernisse, gesetzliche Verbote mussten beseitigt werden, um die Frau in ihrer staatsbürgerlichen Wertung aus dem Kreise der Lehrlinge, Unmündigen, unter Kuratel Gestellten oder der bürgerlichen Ehrenrechte Beraubten zu befreien.« Dieser Kampf sei aufgenommen worden in der Erkenntnis und Überzeugung, dass »die Verschiedenartigkeit der geistigen und seelischen Kräfte von Mann und Frau der Gesamtheit – nicht nur der Frauen – ein Recht auf die Kräfte beider im Dienst des Ganzen gibt«. Dieser Punkt ist interessant. Für Lüders war die Mitarbeit der Frauen essenziell für das große Ganze. Nicht nur verbesserten Politikerinnen und Reformerinnen das Leben von Frauen entscheidend und brachten deren Interessen ein in den nationalen Diskurs, auch Männer profitierten von dieser Kooperation. Alle hätten ein »Recht auf die Kräfte der Frauen im Dienst der Gesamtheit«.[31] Kurz gesagt: Wenn die Frauen nicht mit am Tisch sitzen, fehlt deren Perspektive und Input und das schadet allen, nicht nur den Frauen selbst. Ein starkes Argument für die Partizipation und ein sehr selbstbewusstes.