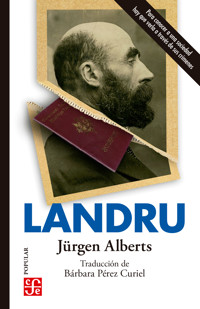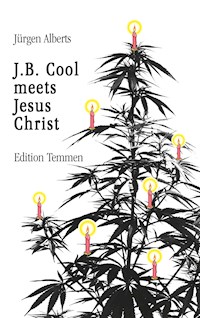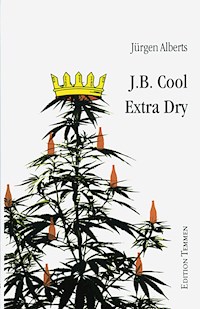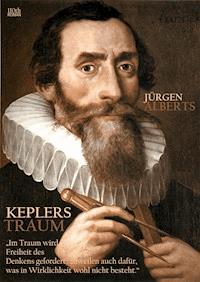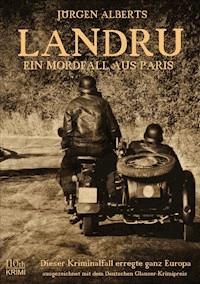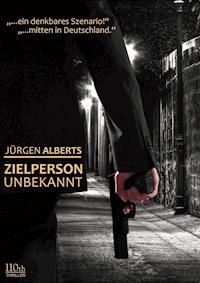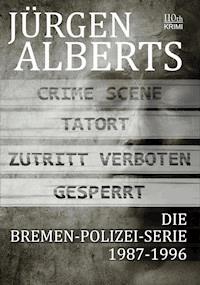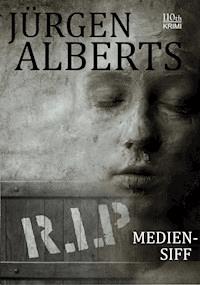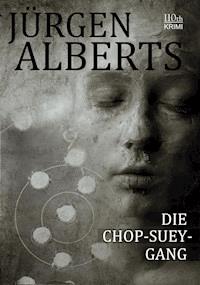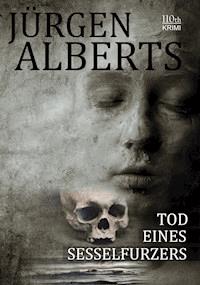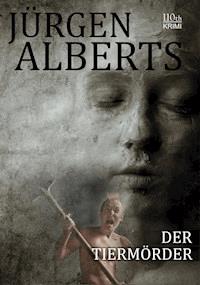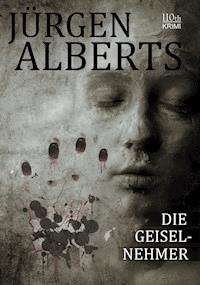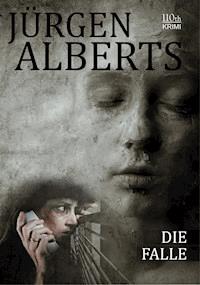
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Ein Pressesprecher versucht mit gefälschtem Material einen Journalisten zu Fall zu bringen. Der Plan scheint zu klappen, der missliebige Kritiker steckt in der Falle. Doch angeschlagene Gegner sind oft am gefährlichsten. Der Journalist schlägt zurück.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Falle
Kriminalroman
von
Jürgen Alberts
Impressum:
Cover: Karsten Sturm, Chichili Agency
Foto: fotolia.de
© 110th / Chichili Agency 2014
EPUB ISBN 978-3-95865-053-4
MOBI ISBN 978-3-95865-054-1
Urheberrechtshinweis:
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors oder der beteiligten Agentur „Chichili Agency“ reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Kurzinhalt
Ein Pressesprecher versucht mit gefälschtem Material einen Journalisten zu Fall zu bringen. Der Plan scheint zu klappen, der missliebige Kritiker steckt in der Falle. Doch angeschlagene Gegner sind oft am gefährlichsten. Der Journalist schlägt zurück.
1
Klaus Grünenberg schrieb an einem Bestseller, das wusste er. Hohe Auflagen, hohes Ansehen und dann der lang ersehnte Absprung. Endlich das schreiben können, was er wollte. Nur ging die Arbeit nicht so schnell voran, wie er hoffte.
Immerhin war er seit drei Jahren Lokalchef der >Weser-Nachrichten< und hatte genügend zu tun. So sehr ihn dieser Job auch langweilte. Bei seinem wöchentlichen Zug durch die Kneipen, den er traditionell mit seinem Vorgänger Bollmann veranstaltete, wurde sein Lamento immer länger. Er war Chef und hatte trotzdem nur wenig zu sagen. Es regierte der Verlagsleiter, und auch nach dem Tod des Verlegers änderte sich da wenig. Die Zügel hatte ein Management in die Hand genommen, das nur eins fürchtete: die gewerkschaftlich organisierte Technik. Wenn die zur Tat schritt, blieben die Seiten weiß. Die Kollegen von der schreibenden Zunft waren nicht gefährlich. Da genügten starke Worte.
Wie jeden Abend gegen zehn Uhr saß Grünenberg an seiner Schreibmaschine und tippte wie ein Verrückter. Obwohl er tagsüber an einem Computer schrieb, benutzte er zu Hause immer noch seine mechanische Schreibmaschine, deren Typenhebel sich häufig verhedderten. Dementsprechend sah sein Manuskript aus.
>Wie mache ich auf mich aufmerksam<, sollte der Bestseller heißen. In, letzten Jahren war der Buchmarkt überschwemmt worden mit Ratgebern, Lebenshelfern, Überlebensbüchern, mit Kompendien zur Vater-Mutter-Kindschaft, mit Tipps für Singles und Doubles, die alle mit der Frage kokettierten: Was ist der Sinn des Lebens? Und die jede Menge Antworten bereithielten.
Grünenberg wollte sich auf diesem Markt bewähren. Das Problem, das er mit seinem Bestseller anschnitt, war noch nicht gelöst.
Alle wollen Aufmerksamkeit.
Das Baby brüllt, warum kümmert sich denn keiner um mich - die erste Regel: laut sein, damit jemand zuhört. Der Schüler, der den Papierkorb in Brand steckt die zweite Regel: ruhig mal jemand erschrecken, sonst merkt es keiner.
Der Querulant, der bei jeder Diskussion auftritt, wichtige Fragen anschneidet, will dabei auf sich selbst verweisen.
Klaus Grünenberg drückte sich, um die Vokabel >Liebe<, aber er wusste, dass er sie verwenden musste, wenn das Buch wirklich ein Bestseller werden sollte. Die Kleidung, die Marotten, die Frisuren, aber auch die Gesten, die Witze, die Gags, es galt das gesamte Repertoire zu beschreiben, mit denen sich Mitmenschen aus der Menge hervorheben. Und gerade in Journalistenkreisen blühte die Kunst, auf sich aufmerksam zu machen:
Klaus Grünenberg hatte den Ton des Fernsehers leise gestellt, weil er einen Gedanken nicht festhalten konnte, seine Finger ruhten auf der Tastatur, die speckig und klebrig war. Im Fernsehen lief mal wieder eine von diesen Talkshows, die sowieso am besten zu ertragen waren, wenn man, den Ton abstellte.
Ich müsste auch was über die Exzentriker schreiben, diese Querdenker, von denen es eine unentdeckte Vielzahl gab?, dachte Grünenberg, während er abwesend auf das bläuliche Fernsehbild starrte. Aus Protest leistete er sich keinen Farbfernseher, er fand die Programme zu schlecht, um sie auch noch in Farbe ansehen zu müssen.
Immer wenn Klaus Grünenberg schrieb, hatte er die Gardinen zugezogen, so dass nicht mal das Licht der gegenüberliegenden Straßenlaterne hereinscheinen konnte. Nur die Schreibtischlampe brannte. Die Whiskyflasche stand offen. Er brauchte kein Glas. Die fertigen Seiten warf er in: einen halbierten Karton. Langsam Schrieb er sich in Hitze und zog sich immer weiter aus. So auch jetzt: Er saß nackt an der Maschine, der Schweiß lief.
Der Posten des Lokalchefs hatte ihn fett werden lassen. Fast fünfzehn Kilo zugenommen. Er war zwar nie ein sportlicher Redakteur gewesen, spielte auch nicht in der Redaktionsmannschaft Fußball, aber seine schlanke Linie hatte er über Jahre gehalten. Dann kam die Beförderung und damit die Essenseinladungen, die zugleich Einladungen zu unbeschränktem Trinken waren, und so rollte sich um seine Hüften ein beträchtlicher Rettungsring. Gelegentlich hörte er im langgestreckten Flur: »Der hat heut aber wieder miese Laune.«
Aufmerksamkeit erhaschen, erreichen, einfahren, mit Hochdruck, mit heißem Herzen. Grünenberg hatte sich Listen angelegt, wie er sein Thema umschreiben konnte, die Gelegenheit beim Schopf packen, das, Haus auf den Kopf stellen, sich ins Zeug legen, nach etwas jagen, er hatte Wörter herausgesucht, um seine Beschreibungen kräftig zu würzen: alert, biereifrig, hurtig, rührig, zackig und zielbewusst. Er überschrieb seine Kapitel mit Typenbezeichnungen: Die Ameise, der Geschaftlhuber, der Intrigant, der Renommist.
Im nächsten Jahr wurde Grünenberg vierzig, dann musste er raus sein aus dem Job, sich, verändern, musste frei sein von den Zwängen der täglichen Hierarchie und der pausenlosen Produktion. Das war ein Ziel, das er sich schon lange gesteckt hatte. Nun kam der Geburtstag näher, aber sein Ziel schien weiter entfernt. Auch deswegen tippte er so viele Seiten. Immer wenn die Whiskyflasche leer war, schaltete er die Schreibtischlampe und den Fernseher aus und stolperte ins. Bett. Vor ein paar Tagen hatte er die Seiten indem Karton gezählt: über 500 Blatt
Natürlich durfte niemand in der Redaktion von diesem Buch erfahren, sonst würde man ihn ständig damit aufziehen. Dabei hatte Grünenberg den Verdacht, dass er nicht der einzige bei den >Weser-Nachrichten< war, der heimlich an einem Bestseller schrieb.
Er wollte unbezahlten Urlaub nehmen, um das ganze Manuskript zusammenzustellen. Sechs Wochen rechnete er, aus diesem Papierberg ein Buch herauszubaggern. Sechs Wochen mussten reichen.
Erst hatte er keine Lust, den Hörer abzunehmen, aber das Telefon klingelte unentwegt.
»Grünenberg.« Er lallte ein wenig.
»Sind Sie es selbst, verehrter Meister der Feder«, fragte der Anrufer. Seine Stimme war etwas piepsig.
»Ja, doch. Mit wem hab ich das Vergnügen?«
»Das tut nichts zur Sache. Sind Sie interessiert an dem Knüller Ihres Lebens.«
»Nein.« Er stockte. Ihm kam diese Stimme bekannt vor, aber der Anrufer verstellte sich. »Um was geht's denn, du Informant?«
»Kein Telefon. Ich meld mich wieder.«
Dann hatte der Teilnehmer aufgelegt.
Grünenberg war zu betrunken gewesen, um das Tonband in Gang zu setzen, dann hätte er wenigstens die Stimme noch mal anhören können. Knüller Ihres Lebens, auch so ein Wichtigtuer!, dachte Grünenberg und schwankte zum Bett. Drei Minuten später träumte er von einem Blitzlichtgewitter, das ihm galt.
Michael Adler zwirbelte seinen Schnauzbart und faltete dann die Hände im Schoß. Sein Gegenüber war nicht zu bremsen. Der eitle Gerichtsgutachter Dr. Stenzler, weißes Haar, eleganter Anzug, schwarz-weiß lackierte Schuhe. Es sollte ein Gespräch sein, aber kaum hatte Adler eine Frage gestellt, schon antwortete sein Interviewpartner in einem Schwall von langen Sätzen. Und nachher würde ihm die Redaktion wieder den Vorwurf machen, er hätte nicht genügend nachgefragt.
Dr. Stenzler war nur in diese Talkshow gekommen, weil er ein persönlicher Freund des Fernsehdirektors war, der hatte ihn in den höchsten Tönen gepriesen. »Ein kompetenter Gutachter, der viele interessante Fälle kennt, der witzig ist und nur so sprüht.« Bis jetzt hatte es noch nicht einen Lacher gegeben. Der Gerichtsgutachter erzählte sowieso nur von einem Fall, von dem Adler noch nichts gehört hatte.
»Kann sich denn ein Gutachter nicht auch irren?« unterbrach ihn der Journalist. Aber Dr. Stenzler ließ sich nicht unterbrechen. Adler verwünschte das Gespräch. Seitdem er einer der drei Talkmaster war, weil ein vertrottelter Weinkenner endlich den Platz geräumt hatte, musste er sich behaupten, kämpfen, dass man ihm die Position nicht wieder streitig machte. Dazu gab es zu viele Neider in der Anstalt, die selbst gerne vor die Kamera gegangen wären, um ein paar witzige Fragen zu stellen. Schließlich wurde jeden Sonntag die Talkshow in den >Weser-Nachrichten< rezensiert. Wenn die Kritiken auch nicht immer positiv ausfielen, man stand in der Zeitung.
Dr. Stenzler hatte eine weiche Stimme. »Die Frage ist doch immer, wie viel verstehen denn Richter überhaupt von Detailfragen? Wie viel wollen sie wissen, um ihr Bild von einem Mörder abzurunden? Haben sie eine Ahnung von moderner Spurensicherung oder sind sie auf dem Stand ihrer Ausbildung stehengeblieben? Das sind doch die Fragen, die man erst einmal stellen muss.«
Adler spürte, wie die Kamera auf ihn gerichtet war. Jetzt musste er fragen, jetzt. Ein merkwürdiges Gefühl, er brauchte gar nicht auf das Rotlicht zu sehen. Auf dem Schirm war sein Bild, schweigend.
»Wollen Sie denn gar nicht wissen, warum ich so sicher bin, dass Fred Konz nicht der Mörder ist?«
»Doch, sagen Sie es. Ich habe mich gerade mit diesem Fall nicht beschäftigt.«
»Schade, sehr schade. Wir müssten in die Details gehen.
Der Konz-Fall, ist ein typisches Beispiel eines Justizirrtums. Ich hab einwandfrei bewiesen, dass der Mann nicht geschossen haben kann. Aber der Richter war fest davon überzeugt und hat ihn verurteilt.« ,,
Michael Adler wollte das Thema wechseln. »Was hat Sie denn überhaupt dazu gebracht, Gerichtsgutachter zu werden? So was singt einem der Vater doch nicht an der Wiege? Wie war Ihr Weg zu diesem Beruf?«
Er sah es Dr. Stenzler an, dass er auf diese Frage nicht antworten würde. Wenigstens ein paar Informationen zur Person rüberbringen, auch wenn die. Gäste sich auf sein Thema verbeißen, das nicht zum ersten Mal vorkam, der Talkmaster muss sie knacken. Das war die Stimme des Fernsehdirektors, die Michael Adler nicht aus dem Kopf bekam. Und es muss unterhaltend sein. Dann sollte er sich doch selbst mal auf seinen Unterhaltungswert testen lassen. Adler wusste, dass er sich am Anfang seiner Karriere als Talkmaster nicht dagegen wehren durfte, welche Gäste er bekam. Da wär er, schnell wieder von dem Sessel heruntergerutscht.
»Sehen. Sie, der Fred Konz ist ein ganz typischer Aufschneider, der, hat, als ihn die Polizei in seiner Wohnung aufsuchte, gesagt, ja klar hab ich den alten Sack umgelegt. Und die Waffe hab ich in den Wallgraben geworfen. Das war reine Angabe, verstehen Sie? Sein Pech, dass tatsächlich die Waffe im Wallgraben gefunden wurde. Aber der Mann ist nicht in der Lage, eine Wespe zu erledigen, die ihn gerade gestochen hat.«
Michael Adler platzte der Kragen. »Wir sollten mal von diesem Fall wegkommen, ich denke, nicht alle Zuschauer werden die Einzelheiten verfolgt haben. Beantworten Sie mir doch lieber meine Frage: wie Sie Gerichtsgutachter geworden sind.«
Ich werde das Gespräch gleich beenden, dachte Adler, dann kann ich in der Nachbesprechung wenigstens so einen Pluspunkt erringen. Es war seine dritte Talkshow, und er hasste diese Nachbesprechungen, die sich Konferenzen nannten. Dabei mussten er und die beiden anderen Kollegen sich mindestens eine Stunde anhören, was die Redakteure und der Fernsehdirektor auszusetzen hatten. Sie verteilten Noten, Beurteilungen, Verurteilungen, sie hatten sich Notizen gemacht, wussten natürlich alles besser und hätten, es auch besser gemacht. Wenn am Sonntag ein Verriss in den >Weser-Nachrichten< erschien, dann wurde diese Konferenz zum Schlachtfest.
»Ich habe den Franz. Döhler umgebracht « Dr. Stenzler war laut geworden. »Ich war es selbst!«
»Was?« Adler kam in seinem Sesselhoch.
»Wie ich sage.« Der Gutachter lächelte ein wenig. Aber er schwieg.
Michael Adler blickte zum Regie-Pult hinüber zu Stenzler, zum Publikum. Dann fragte er: »Sie haben ihn umgebracht?«
»Ja, erschossen und anschließend die Waffe den Korth Kaliber 38, in den Wallgraben geworfen. Ich hatte ihn mir am Nachmittag besorgt. Das ging ganz schnell.« •
»Und warum? « Adler fasste seinen Gesprächspartner an. Er merkte, wie sein Blut durch den Kopf raste.
»Dazu möchte ich nichts sagen.« Dr. Stenzler lächelte wieder.
»Aber, Herr Dr. Stenzler, das wird Sie ins Gefängnis bringen, wenn Sie sich selbst bezichtigen. Sie müssen doch einen Grund haben, hier zu gestehen?«
Dr. Stenzler wippte mit den schwarz-weiß-lackierten Schuhen, sah auf die Spitzen, blickte ein wenig wirr im Fernsehstudio umher, die Kameras nahmen ihn abwechselnd von vorne, von der Seite:
Michael Adler kam noch näher an den Gutachter heran.
»Es ist natürlich ihr gutes Recht, hier zu schweigen, aber wir sind in einer Talkshow, das ist gerade das Gegenteil. Einer lachte. Dann noch einer. Wie eine Erlösung, endlich würde das Gespräch unterhaltend.
Michael Adler sonnte sich im Vorgefühl dessen, was dieses Interview auslösen würde. Fünf Minuten reine Langeweile, und dann ein Mordgeständnis vor der Kamera. Das würde in der Sonntagsrezension Schlagzeilen machen.
Der Gerichtsgutachter stand auf, gab Adler die Hand, als sei jetzt die Zeit für die Verabschiedung gekommen, und ging. Die Kameras verfolgten seinen Abgang.
Michael Adler rief ihm hinterher: »Dr. Stenzler, das werden Sie beweisen müssen, dass Sie der Mörder sind.«
Kein Laut im Studio:
Auch der Pianist, dem der Aufnahmeleiter kräftig auf die Schulter schlug, begann nicht zu spielen. Er starrte dem Gutachter nach. Seitdem es diese Talkshow gab, saß er am Klavier und spielte seinen Jazz-Sound herunter.
Kaum war die schwere Studiotür zugeschlagen, setzte im Studio ein Tumult ein, lautstarke Gespräche, Zurufe: »Holt ihn zurück!«
Der Redakteur im Studio brüllte: »Musik, verdammt noch mal Musik.« Seine Stimme war gut zu hören.
Der Pianospieler tat seine Pflicht. Er improvisierte seine Version der Stahlnetz-Titelmusik.
Fritz Pinneberger riskierte ein Auge, als er den Gerichtsgutachter Dr. Stenzler in der Talkshow entdeckte. Ein alter Bekannter, wie der in die Talkshow kam, war ihm ein Rätsel. So ein Langweiler, der immer nur Fakten und Fakten wälzte, der immer recht hatte, der jeden mit Theorien über die unaufgeklärten Morde überschüttete. Auch wenn ihn keiner fragte.
Marianne Kohlhase sah sich grundsätzlich keine Talkshows an, sie saß im Wohnzimmer und grollte.
Es war Freitagabend, und Fritz hatte ihr versprochen, dass sie zu einem Rockkonzert nach Oldenburg fahren würden. Dann kam er erst gegen acht aus dem Dienst, wieder mal hatte die Mordkommission Überstunden abverlangt, war völlig kaputt und schüttete sich wortlos zwei Flaschen Bier in den Hals. Dann hatte er gesagt, er sei zu müde, um noch eine Stunde Auto zu fahren. Und überhaupt, das Rockkonzert komme zum falschen Zeitpunkt.
»Und wann ist der richtige Zeitpunkt?«, hatte Marianne ihn gefragt. Sie stritten sich eine Weile. Und dann verzog sich Pinneberger ins Schlafzimmer und stellte den Fernseher an.
In einem Trailer wurden die Gäste der Talkshow >Fünf nach halbzehn< angekündigt, darunter auch Dr. Stenzler.
Pinneberger wollte wach bleiben, schlief dann aber eine Stunde.
Marianne war zweimal im Schlafzimmer gewesen, hatte ihren Freund angesehen, mit dem war wirklich nichts mehr anzufangen, trotzdem war ihre Wut nicht verflogen. Es gab nur eins, er musste die Polizei verlassen, diese ständigen Überstunden, dieses häufige Verschieben von Urlaub. Wie oft hatten sie darüber gesprochen, wie oft hatte Fritz gesagt, er wolle sich ernsthaft nach etwas anderem umsehen. Aber er war Oberkommissar beim ersten Dezernat, keine Chance auf eine Beförderung, kurz vor der berühmten Grenze. Wer es bis Vierzig nicht zum Hauptkommissar geschafft hat, aus dem wird nie was. Der Spruch kursierte im Polizeipräsidium.
»Marianne, komm mal her«, rief Pinneberger plötzlich aus dem. Schlafzimmer, »schnell, mach schnell. Dr. Stenzler in Aktion«, rief er noch lauter.
»Wer ist das?«, fragte Marianne in der Tür.
»Quatsch jetzt, nicht! Er hat gerade behauptet, dass er der Mörder von Döhler ist.«
Sie hörten beide zu, sahen, wie Adler sich aufgeregt um eine Frage bemühte.
Der Abgang war grandios.
Die Piano-Musik von Gottfried.
»Der hat doch 'ne Meise, der Stenz, also wirklich, das ist mein Fall, das war eine saubere Sache, ganz simpel, erstes Ausbildungsjahr, der Konz hat seine Strafe gekriegt, fertig, ab in den Kahn und nun will es der Stenzler gewesen sein ...« Pinneberger unterbrach sich.
»Kannst du mir erklären, worum es geht?« Marianne kam einwenig näher.
Seitdem der große Farbfernseher direkt am Fußende des Bettes stand, gab es immer drei Personen im Schlafzimmer. Sie nahm die Fernbedienung und stellte den Ton ab.
»Der Stenzler hat das Gutachten für den Konz gemacht, aus seiner Sicht, als gutachtender Psychologe, hat er ihm einen Freibrief ausgestellt, der Konz sei zu keinem Mord fähig. Ich war nicht selbst im Gerichtssaal, aber er soll sich mächtig ins Zeug gelegt haben und was er alles für Gespräche mit dem Konz geführt haben will. Der Konz sei ein Justizopfer, weil nur ein paar Indizien, gegen ihn sprechen. Der dürfte auf keinen Fall verurteilt werden. Nun weiß doch jeder, dass der Stenz spinnt. Für ihn gibt es nur Gutachter, die Bescheid wissen, und Richter, die keine Ahnung haben, und so einen Quatschkopf ins Fernsehen zu holen. Aber das mit dem Mord ist stark, was?«
Marianne zog ihren Pullover aus.
»Willst du noch fernsehen jetzt?«
»Ne, ne, mach die Kiste ruhig aus. Ich wollte nur den Auftritt vom Stenzler mitkriegen. Und ausgeschlafen bin ich jetzt auch, soll'n wir noch losfahren?«
Marianne ließ keinen Zweifel, was sie jetzt wollte. »Du kannst ja eine Platte auflegen, wir haben sogar was von, der Gruppe da, die heute auftritt.«
Pinneberger brauchte keine Musik. Wie gut, dass er schon eine Runde vorgeschlafen hatte.
So fing das Wochenende befriedigend an.
2
»Tür zu, verdammt noch mal«, schrie Lindow, der auf dem Linoleumboden saß und versuchte, die beschriebenen Zettel festzuhalten. Einige Blätter wurden aufgewirbelt.
Der fast sechzigjährige Hauptkommissar, der vor Jahren ins Wirtschaftsdezernat strafversetzt worden war, schüttelte den Kopf. »Nirgendwo hat man seine Ruhe.«
Fritz Pinneberger stand schuldbewusst an der Tür.
»Kannst du mir mal sagen, was du hier auf dem Fußboden treibst, Wolfgang? Reicht der Schreibtisch für die Beweise nicht aus?«
»Das geht dich gar nichts an.« Lindow schimpfte mit seinem Skatbruder und legte die Blätter wieder an ihren Platz:
Pinneberger beugte sich nach unten.
Fußballtabellen.
Spielpaarungen.
Ergebnisse.
»Wir können es schaffen«, sagte Lindow, jetzt etwas leiser, »wir können es schaffen. «
»Was, bitte?«
Lindow blickte versonnen auf sein Gesamtwerk.
»Für dich als Antifußballschurke ist das natürlich nicht wichtig, aber für mich schon!«
»Was können wir schaffen?« Pinneberger betonte jedes Wort einzeln. Dieser Hauptkommissar, dessen Hobby Briefmarkensammeln war, an den Wänden hingen ausgewählte Stücke seiner Leidenschaft: Marken mit Polizeimotiven aus aller Welt, dieser Hauptkommissar war im vorgezogenen Ruhestand. Und zwar im Dienst. Seit seiner Auseinandersetzung mit dem Kriminaldirektor und der Polizeiführung war er abgeschoben, musste jeden Fall, den er zu bearbeiten gedachte, vorlegen, und wurde so erfolgreich an der Arbeit gehindert.
»Wir können Meister werden. Sieh mal hier, Fritz, ich hab die ganzen Begegnungen der nächsten zehn Spieltage für die fünf führenden Bundesligamannschaften aufgelistet, wir müssen nur vier von den Auswärtsspielen gewinnen, dann haben wir echt eine Chance.«
Pinneberger kam aus der Hocke hoch. »Lass das ja den Lang nicht sehen, du kriegst wieder ein Diszi reingewürgt.«
»Der Lang, der Lang«, Lindow lachte laut auf, »meinst du, ich hätte den Chef schon einmal in meinem Büro gesehen. Der lässt mich antanzen, grüßt mich nie auf dem Flur. Ich muss zu dem. Da kannst du ganz sicher sein.«
Am Anfang hatte es Lindow viel ausgemacht, abgeschoben zu sein. Fünfundzwanzig Jahre Mordkommission und dann Bagatellfälle im Wirtschaftsressort, das war ein Abstieg. Wenn auch die Umweltkriminalität wesentlich zunahm, wurde Lindow kaum tätig, obwohl er einige Male Papiere zu den neuen Straftatbeständen vorgelegt hatte. Kriminaldirektor Lang gab ihm zu verstehen: »Ich bin bei Ihnen nie sicher, Lindow, ob Sie nicht einen privaten Rachefeldzug gegen die Politiker führen wollen.«
»Hast du am Freitag die Talkshow gesehen?«
»Dieser Stenz, einfach großartig, was. Das war ein Auftritt.«
»Du kennst ihn doch länger als ich, Wolfgang, ist da was dran? Ich meine, der geht ein ziemliches Risiko ein, wenn er sich hinstellt und sagt, ich hab den Döhler umgenietet, oder?«
»Dein Fall?«, fragte Lindow, der bei ihren gemeinsamen Skatabenden größten Wert darauf legte, dass nie über berufliche Dinge gesprochen wurde.
»Ja, mein Fall. Ich muss was ...«
Wolfgang Lindow stand auf: »Dr. Stenzler hat gute Beziehungen, da musst du verdammt aufpassen.«
»Das weiß ich auch.«
Lindow stellte sich ans Fenster und sah in den grauen Februartag hinaus. Auf der gegenüberliegenden Seite war das Gerichtsgebäude mit seinen geschwärzten Steinen. Die Volkszählungsgegner hatten es mit neuen Parolen verziert: >Zählt lieber Eure Tage, die Ihr noch habt.<
»Ich würde ihn mir zur Brust nehmen, Fritz. Und zwar ganz ernsthaft. Du hast allen Grund dazu. Gibt denn der Fall so was her?«
»Indizienkiste, mein Gott. Der Konz hat gestanden, dann widerrufen, die Waffe war da, wo er sie hingeworfen hatte.«
»Schmauchspuren?«
»Da haben die Kollegen von der Spurensicherung gepennt, schöne Scheiße. Soll der Richter auch schwer drauf rumgehackt haben. Aber als der sein Geständnis von sich gab, wurde er gleich eingebuchtet. Klar. Konnte ja keiner wissen, dass er widerruft, oder?«
»Und sonst, was meinst du?«
»Der war es, ganz bestimmt. Der Widerruf war nur der schwache Versuch, eine geringere Strafe einzufangen.«
Lindow sah auf seinen leeren Schreibtisch. Da stand das Telefon, die Glasplatte ohne Papier, darunter die Telefonliste der Dienststellen. »Wie ich dich darum beneide, Fritz. Lass ihn vortanzen. Dr. Stenzler als Mordverdächtiger, ich wär gerne dabei. - Was macht dein neuer?«
Seitdem Davids tot war, hatte Pinneberger mehrfach den Assistenten gewechselt. So eine Zusammenarbeit wie mit dem schwulen Kollegen kam nie wieder zustande.
»Der Neue, ich kann dir sagen, das ist ein Früchtchen, der steht morgens um sieben schon in den Akten, füllt Papier die Menge und geht abends als letzter vom Schiff. Ein verdammter Streberling, aber nicht so viel kriminalistischen Spürsinn im Kopf. Gut fürs Archiv. Mal sehen, wie lange der sich bei mir hält.«,
»Könnte ich nicht dein Assistent werden?«, fragte Lindow und zog an seinem ledernen Schlips.
»Gute Idee, schlag ich gleich Lang vor.« Pinneberger lachte. »Und lass dich, nicht bei deiner wichtigen Arbeit stören.« Er zeigte auf die wohlgeordneten Blätter auf dem Boden:
Zwei Stunden später hatte Pinneberger in Erfahrung gebracht, dass der Gerichtsgutachter Dr. Stenzler sich nicht in der Hansestadt aufhielt. Seine Frau sagte ihm, dass er sich melde, sobald er wieder nach Hause komme.
Es war kein Demonstrant zu sehen, obwohl eine Menschenmenge erwartet worden war. Der Wendekanzler sprach in der Stadthalle, und nur geladene Gäste wurden eingelassen.
Ein Debakel der Polizeiführung. Überall standen die grauen Wagen der Zivis, in den Einsatzwagen die Mannschaften, der Leitstand war in einem Wohnmobil untergebracht.
Der Polizeipräsident tobte: »Wann kriegen wir endlich eine zuverlässige Einschätzung, der Lage. Alles unfähige Trottel, die mit der Stange im Nebel herumstochern und Gefahren an die Wand malen, die nicht vorhanden sind.«
Der Leiter des Verfassungsschutzes, Müller, nickte eifrig, obwohl von seiner Behörde diese Fehleinschätzung gekommen war.
»Seien wir froh, dass alles ruhig verläuft«, sagte er mit sonorer Stimme. »Sieht doch auch gut aus.«
»Sieht gut aus, Müller, dass ich nicht lache. Sieht schlecht aus, wie soll ich das den Einsatzleitern klarmachen. Hier sind einige Hundertschaften umsonst zusammengezogen worden.«
Der Polizeipräsident hatte schon vor einiger Zeit die Jacke abgelegt, die Ärmel aufgekrempelt, als, wollte er selbst an Rangeleien mit Demonstranten, teilnehmen.
Derweil zog der Wendekanzler zu den Klängen einer Berliner Bigband in die Stadthalle ein. In zehn Tagen war Bundestagswahl und dies sollte der krönende Höhepunkt werden. Der Beifall der, siebentausend Parteimitglieder, die auch aus dem Umland herangekarrt worden waren, nahm kein Ende. Der Kanzler hob beide Arme, als hab er gerade einen Gegner k.o. geschlagen.
Die Pressefotografen blitzen ganze Fotoserien von dem strahlenden Pfälzer.
»Wir könnten doch einen kleinen Zwischenfall inszenieren, ich meine ...« Müller stockte, um sich zu vergewissern, ob jemand seinen Überlegungen folgen würde.
»Wie meinen Sie das?«, fragte Polizeipräsident Mantz.
»Na ja, so irgendwas Kleines, ein paar Leute, die versuchen, in die Stadthalle zu kommen, ohne geladen zu sein, die dann Krawall schlagen, und wir nehmen die dann in Gewahrsam.« Müller schaute in die Runde.
Da jeder der anwesenden Herren rauchte, lag schon Nebel im Wohnmobil.
»Ich sehe keine Demonstranten, die Krawall schlagen«, gab der Einsatzleiter zurück.
»Ich auch nichts«, echote der Polizeipräsident. Müller zog seine Krawatte. Fester.
»Hier laufen genügend SEK-Leute rum, die das spielen könnten. Sehn doch sowieso aus wie Demonstranten, mit ihrem langen Haar und den Turnschuhen. Den malen wir ein Transparent ...«
Der Polizeipräsident räusperte sich. Er schien nicht abgeneigt. Der Einsatzleiter schüttelte den Kopf: »Ich hetz doch nicht meine Leute aufeinander.«
»Dass würde nicht auffallen müssen, meine ich«, sagte Müller. Der Leiter des Verfassungsschutzes hatte es in langjähriger Kleinarbeit geschafft, das Verhältnis zum Polizeipräsidenten zu entspannen. Die andauernde Konkurrenz zwischen seiner Dienststelle und dem zuständigen Dezernat bei der Kripo war davon zwar nicht berührt, immer noch arbeitete man nebeneinander, manchmal, sogar gegeneinander, aber auf der Führungsebene waren die Kontakte gut. Müller rechnete es sich als Beweis seines hervorragenden Verhältnisses zu Mantz an, dass er bei wichtigen Einsätzen in der Zentrale sitzen durfte.
»Aber das fällt auf, Müller«, wandte der Polizeipräsident ein, er nahm seine Pfeife, die schon mehrfach ausgegangen war, und klopfte den verbrannten Tabak heraus.
»Wir können nicht in sechs Monaten reparieren, was die Schuldenpartei in dreizehn Jahren kaputtgemacht hat«, tönte der Wendekanzler in der Stadthalle, »es wäre blanker Zynismus gewesen, hätten wir gewartet, bis alles noch schlechter geworden wäre.« Er sprach davon, dass jeder Lehrling einen Ausbildungsplatz bekommen sollte, dass der notleidenden Werftindustrie mit großzügigen Subventionen unter die Arme gegriffen werde. Alle müssten aber, auch Opfer bringen. »Was dem Opa zugemutet worden ist, der nach dem Krieg mit dem Pappkarton aus dem Osten kam, kann heute auch mal Studenten zugemutet werden.«
Beifall, Hochrufe. Die Stimmung war ausgezeichnet.
»Alles ruhig in der Halle?«, fragte der Einsatzleiter über Mikro aus dem Wohnmobil.
»Keine Vorkommnisse«, kam die Antwort aus dem quäkenden Lautsprecher.
»Da hatte ich noch drauf gehofft, dass wenigstens ein paar Störer in der Halle sind«, sagte Müller gedehnt, er faltete die Hände auf dem kleinen Plastiktisch, »ich glaube, wir, sollten uns was einfallen lassen.«
Mantz entflammte seine frisch gestopfte Pfeife.
»Was soll das sein, ein Pressetext für die Wahlkampfmappe?«
Grünenberg war versucht, den Artikel zu zerreißen. Die beiden jungen Kollegen standen vor seinem Schreibtisch und blickten in die Luft.
»Ich schick euch doch nicht zur Konferenz des Kanzlers, damit ihr eine Lobeshymne singt, sondern ein paar Fragen stellt. Hätt' ich euch die vorher aufschreiben müssen, oder was?«
Keine Antwort.
Zwar hatte der Wendekanzler ein Exklusivinterview mit der Zeitung abgelehnt, weil dazu im Wahlkampf keine Zeit sei, aber immerhin hatte er der örtlichen Presse eine halbe Stunde gegeben, damit sie direkt mit ihm sprechen konnte.
»Also, was war los?«
Grünenberg ärgerte sich, dass die beiden nicht dazu ständen, was sie verbockt hatten.
Er hätte natürlich auch selbst zu dieser Pressekonferenz gehen können, wenn dieser Brief nicht am Mittag auf seinem Schreibtisch gelegen hätte.
»Ich will was hören, oder seid ihr im Verein der Taubstummen in den Vorstand gewählt worden?«
Klaus Grünenberg wedelte mit dem Manuskript in der Luft, als wolle er Fliegen jagen.
»Er hat die ganze Zeit gesprochen.«
»Was hat er?«
»Der hat darüber gesprochen, was er alles für die Region tun will, was er in Sachen Lehrstellen unternehmen will ...«
»Wahlkampfgewäsch. Warum habt ihr ihn nicht festgenagelt? Es gibt doch Fakten ...«
Der jüngere der beiden Journalisten zuckte zusammen, aber er bekam den Mund nicht auf.
»Er kam zu spät zu dem Termin, hat eine Viertelstunde gesprochen und ist dann ab in die Stadthalle.«
»Es war ein Pressegespräch angekündigt«, warf Grünenberg ein. Das wird eine Generation von lammfrommen Fragenichtsen werden!, dachte er. Nicht, dass es nicht schon immer diese Journalisten gegeben hätte, die immer dann, wenn Machthaber auftraten, verstummten, das Haupt neigten und zu bloßen Zeilenempfängern wurden. Aber ihm wäre das nicht passiert, wenn er im Presseclub dabei gewesen wäre.